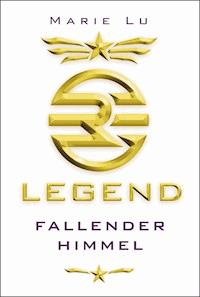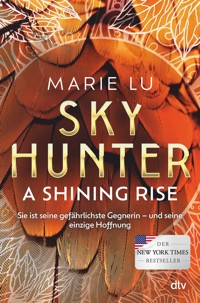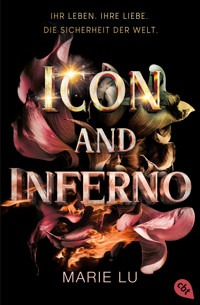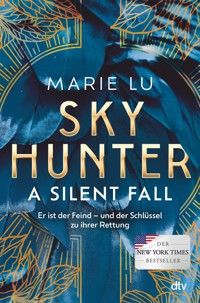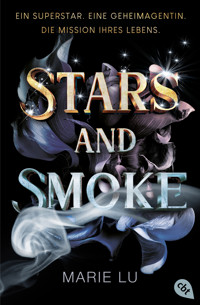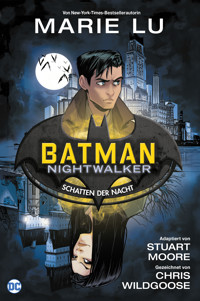Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Young Elites
- Sprache: Deutsch
Adelina hat nur ein Ziel vor Augen: Rache. An der Inquisition, den weißen Soldaten, die sie beinahe getötet hätten, und an der Gemeinschaft der Dolche, von der sie verraten und verstoßen wurde. Unter dem Namen Weiße Wölfin sucht sie gemeinsam mit ihrer Schwester nach weiteren Begabten, um ein eigenes Bündnis zu schließen. Mit dessen Hilfe wollen sie der grausamen Verfolgung durch die Inquisition für immer ein Ende bereiten. Aber Adelina ist alles andere als eine Heldin. Ihre finsteren Kräfte entgleiten mehr und mehr ihrer Kontrolle. Verzweifelt kämpft sie gegen diese innere Dunkelheit an – und droht den Kampf zu verlieren. Auch im zweiten Band der historischen Fantasy-Trilogie zaubert Spiegel-Bestsellerautorin Marie Lu wieder eine originelle Geschichte in einer märchenhaften Welt mit einer Antiheldin, die sich zwischen Macht und Liebe entscheiden muss. Actionreich, düster und romantisch! "Das Bündnis der Rosen" ist der zweite Band der Young Elites-Trilogie. Der Titel des ersten Bandes lautet "Die Gemeinschaft der Dolche". Mehr Infos und Extras zu Young Elites unter: www.young-elites.com
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Cassie – Schwestern für immer, egal, was kommt.
ADELINA AMOUTERU – Als ich noch …
ADELINA AMOUTERU
Als ich noch klein war, erzählte meine Mutter mir manchmal den ganzen Nachmittag lang alte Volksmärchen. Eines davon ist mir besonders im Gedächtnis geblieben.
Es war einmal ein habgieriger Prinz, der verliebte sich in eine boshafte Frau.
Der Prinz besaß weit mehr, als er brauchte, aber er bekam einfach nie genug. Als er eines Tages krank wurde, reiste er ins Königreich des Großen Ozeans, in dem die Grenze zur Unterwelt liegt, um mit Moritas, der Göttin des Todes, über ein längeres Leben zu verhandeln. Die jedoch lehnte sein Ersuchen ab, woraufhin der Prinz ihr heiliges Gold stahl und damit zurück an die Erdoberfläche floh.
Moritas sann auf Rache und schickte ihre Tochter Caldora, den Engel des Zorns, aus, ihn zurückzuholen. In einer warmen, stürmischen Nacht entstieg Caldora, in nichts als einen Mantel aus silberner Seide und Nebel gekleidet, den Meeresfluten, eine Erscheinung, so vollkommen, dass es schmerzte. Der Prinz lief zum Wasser, um sie willkommen zu heißen. Sie lächelte ihn an und strich ihm über die Wange.
»Was gibst du mir für meine Liebe?«, fragte sie ihn. »Bist du bereit, dich von deinem Königreich, deiner Armee und deinen Juwelen zu trennen?«
Der Prinz, geblendet von ihrer Schönheit, wollte sie beeindrucken und so nickte er. »Alles, was du begehrst«, antwortete er. »Ich bin der mächtigste Mann der Welt. Nicht einmal die Götter können es mit mir aufnehmen.«
Und so schenkte er ihr sein Königreich, seine Armee und seine Juwelen. Sie nahm seine Gaben mit einem Lächeln entgegen, nur um gleich darauf ihre wahre Gestalt zu enthüllen – flossenbewehrt, skelettartig, dämonisch. Sie legte sein Reich in Schutt und Asche, zerrte den Prinzen mit sich ins Meer und brachte ihn in die Unterwelt, wo er bereits geduldig von ihrer Mutter, Moritas, erwartet wurde. Der Prinz versuchte abermals, mit der Göttin zu verhandeln, doch es war zu spät. Zum Ausgleich für das Gold, das er ihr gestohlen hatte, verschlang Moritas seine Seele.
Diese Geschichte fällt mir nun wieder ein, als ich zusammen mit meiner Schwester an Deck eines Handelsschiffs stehe und zur Küste hinüberblicke, wo sich langsam der Stadtstaat Merroutas aus dem Morgendunst hebt.
Eines Tages, wenn nichts mehr von mir übrig ist als Staub und Asche – was für Geschichten werden sich die Menschen wohl über mich erzählen?
Es war einmal ein Mädchen, das hatte einen Vater, einen Prinzen und eine Gemeinschaft von Freunden. Doch dann wurde sie von ihnen betrogen und tötete sie alle.
STADTSTAAT MERROUTASDIE SEELANDE
ADELINA AMOUTERU – Ich glaube, er …
Sie waren wie ein Lichtblitz am sturmverhangenen Himmel, das schwindende Dunkel vor Anbruch des Tages. Es hat sie nie zuvor gegeben, noch werden sie jemals wiederkehren.
Unbekannter Verfasser über die Elite der Begabten
ADELINA AMOUTERU
»Ich glaube, er ist hier.«
Die Stimme meiner Schwester Violetta reißt mich aus meinen Gedanken. »Hm?«, murmele ich und hake mich bei ihr unter, während wir uns einen Weg durch das Getümmel auf den Straßen bahnen.
Violetta schürzt die Lippen zu dem mir so vertrauten besorgten Gesichtsausdruck. Sie muss bemerkt haben, dass ich mit meinen Gedanken ganz woanders war, und ich bin dankbar, dass sie nicht weiter darauf eingeht. »Ich habe gesagt, es könnte sein, dass er hier ist. Auf dem Marktplatz.«
Es ist früher Abend am längsten Tag des Jahres. Wir sind mitten in die Feierlichkeiten auf den Straßen von Merroutas geraten, dem wohlhabenden, lebhaften Stadtstaat zwischen Kenettra und dem Tamourischen Reich. Die Sonne ist beinahe am Horizont versunken und die drei Monde hängen tief und rund, wie reife goldene Früchte, über dem Wasser. In Merroutas wird das mittsommerliche Schöpfungsfest gefeiert, mit dem der Fastenmonat beginnt.
Violetta und ich schlendern zwischen den Menschentrauben umher, tauchen ein in das schimmernde Meer von Farben. Wir sind beide in Gewänder aus tamourischer Seide gekleidet, unser Haar ist in Tücher geschlungen und an unseren Fingern glänzen bronzene Ringe. Die Leute um uns tragen Ketten aus Jasminblüten um die Hälse, sie verstopfen die Straßen und bevölkern die Plätze, tanzen in langen Reihen um kuppelgekrönte Paläste und Badetempel herum. Wir passieren Kanäle, deren Pegel sich unter der Masse der schwer beladenen Boote heben, und Gebäude mit silbernen und goldenen Verzierungen, aus sich schier unendlich fortsetzenden Mustern aus Kreisen und Quadraten. Prunkvoll geschmückte Wandteppiche hängen in der dunstigen Luft von den Balustraden. Immer wieder begegnen uns kleinere Gruppen von Soldaten in wallenden Seidengewändern statt schwerer Rüstungen. In ihre Ärmel ist ein Emblem aus einem Mond und einer Krone eingestickt. Diese Soldaten gehören nicht zur Inquisition, dennoch ist ihnen sicher zu Ohren gekommen, dass Teren auf der anderen Seite des Meeres Befehl gegeben hat, uns gefangen zu nehmen. Wir machen einen weiten Bogen um sie.
Ich fühle mich inmitten all der Feiernden wie benebelt. Es ist so seltsam, von derart viel Freude umgeben zu sein. Was soll ich mit Freude anfangen? Meine Energie nährt sie nicht. Also schweige ich und lasse mich von Violetta durch die Menge führen, während ich weiter meinen finsteren Gedanken nachhänge.
Wie so oft, seit wir vor drei Wochen Kenettra verlassen haben, wurde ich von flüsternden Stimmen aus dem Schlaf gerissen, die Sekunden später verstummten. Dann wieder, wenn ich allein bin, höre ich gedämpftes Murmeln. Die Stimmen sind nicht immer da und manchmal verstehe ich sie nicht, selbst wenn sie mich direkt ansprechen. Doch ich spüre ihre Gegenwart ununterbrochen am Rande meines Bewusstseins lauern. Wie eine Klinge, ein Wechsel aus Lärm und Stille, eine schwarz brennende Lampe. Sich unerbittlich ausbreitendes Feuer. Und das sagen sie:
Adelina, warum gibst du dir die Schuld an Enzos Tod?
Ich hätte meine Illusionen besser zu beherrschen wissen sollen, antworte ich dem Flüstern lautlos. Dann hätte ich Enzo retten können. Ich hätte den Dolchen von Anfang an trauen sollen.
Nichts davon ist deine Schuld, widersprechen die Stimmen in meinem Kopf. Du hast ihn ja nicht einmal selbst getötet – es war nicht deine Waffe, die seinem Leben ein Ende bereitet hat. Warum also haben sie dich verstoßen? Du hättest nicht zu den Dolchen zurückkehren müssen, hättest ihnen nicht helfen müssen, Raffaele zu retten. Und trotzdem haben sie sich gegen dich gewendet. Warum glaubt niemand an deine guten Absichten, Adelina?
Warum solltest du dich schuldig fühlen, obwohl es gar nicht dein Fehler war?
Weil ich ihn geliebt habe. Und jetzt ist er fort.
Es ist besser so, erwidern die Stimmen. Wie oft hast du oben am Ende der Treppe gestanden und davon geträumt, eine Königin zu sein?
»Adelina«, sagt Violetta. Sie zupft an meinem Ärmel und das Flüstern verschwindet.
Ich schüttele den Kopf, um in die Wirklichkeit zurückzufinden. »Bist du sicher, dass er hier ist?«, frage ich.
»Wenn nicht er, dann zumindest ein anderer Begabter.«
Wir sind hier in Merroutas, um den Fängen der Inquisition zu entgehen. Dies ist der nächste Ort außerhalb kenettranischer Kontrolle, aber wir werden bald weiter nach Süden ziehen, in Richtung der Sonnenlande, so weit fort wie nur möglich.
Doch wir sind noch aus einem anderen Grund hierhergekommen.
Wenn man jemals auch nur von einem einzigen Begabten gehört hat, handelten die Geschichten höchstwahrscheinlich von einem Jungen namens Magiano. Raffaele, der schöne junge Kurtisan, der einmal mein Freund war, hat Magiano manchmal während einer unserer nachmittäglichen Trainingsstunden erwähnt. Seither habe ich seinen Namen aus dem Mund zahlloser Reisender vernommen.
Manche sagen, er sei in den finsteren Wäldern auf den Ember-Inseln, einer winzigen Inselkette weit östlich von Kenettra, von Wölfen aufgezogen worden. Andere wiederum behaupten, er hätte in den Wüsten von Domacca in den heißen Sonnenlanden das Licht der Welt erblickt, ein Bastard, aufgewachsen unter Nomaden. Er sei ein Wilder, heißt es, ein regelrechtes Raubtier, von Kopf bis Fuß in Blattwerk gehüllt und mit einem Verstand und Händen so flink wie ein Fuchs bei Mitternacht. Vor einigen Jahren sei er ganz unvermittelt aufgetaucht und seither Dutzende Male seiner Verhaftung durch die Inquisition entgangen – beschuldigt für alles Mögliche, von illegalem Glücksspiel bis hin zum Raub der Kronjuwelen der kenettranischen Königin. Den Geschichten zufolge kann er einen Menschen allein mit seinem Lautenspiel über den Rand einer Klippe in den Abgrund locken. Und wenn er lächelt, blitzen seine Zähne boshaft.
Obwohl jeder weiß, dass er zur Elite gehört, kann niemand sicher sagen, worin genau seine Gabe besteht. Uns ist nur bekannt, dass er kürzlich hier in Merroutas gesichtet wurde.
Wäre ich noch dasselbe Mädchen wie vor einem Jahr, als ich meine Kräfte noch nicht kannte, hätte ich womöglich nie den Mut aufgebracht, mich auf die Suche nach einem solch berüchtigten Begabten zu machen. Aber dann habe ich meinen Vater getötet. Mich der Gemeinschaft der Dolche angeschlossen. Und ich habe sie alle betrogen, genau wie sie mich. Oder vielleicht war es auch umgekehrt. Da bin ich mir nie so sicher.
Alles, was ich weiß, ist, dass die Dolche nun meine Feinde sind. Wenn man allein in einer Welt lebt, die einen hasst und fürchtet, sucht man eben nach anderen, die genau so sind wie man selbst. Nach neuen Freunden. Begabten Freunden. Freunden, die einem dabei helfen, eine eigene Gemeinschaft zu gründen.
Freunden wie Magiano.
»Salaam, meine hübschen Tamourinnen!«
Wir sind auf einen weiteren großen Platz ganz in der Nähe der Bucht gelangt. Am Rand reihen sich Essensstände mit dampfenden Töpfen und Kleinkünstler mit langnasigen Masken, die ihre Tricks zum Besten geben. Einer der Essensverkäufer lächelt uns an. Sein Haar steckt unter einem tamourischen Turban und sein Bart ist dunkel und sorgfältig gestutzt. Er verneigt sich vor uns. Ich hebe unwillkürlich die Hand an den Kopf. Mein silbernes Haar ist noch immer kurz, nachdem ich es mir abgeschnitten habe, aber heute Abend ist es ebenfalls unter einem Turban aus zwei langen goldseidenen Tüchern verborgen, und ein Reif mit Goldtropfen, die mir fast bis zu den Augenbrauen herabreichen, schmückt meine Stirn. Meine vernarbte Gesichtsseite habe ich mit einer Illusion verhüllt. Für den Mann wirken meine blassen Wimpern schwarz und meine Augen makellos.
Ich werfe einen Blick auf die Gerichte, die er zum Verkauf anbietet. Töpfe voller gefüllter Weinblätter, Lammspieße und warmes Fladenbrot. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen.
»Reizende Damen aus der Heimat«, ruft er uns zu. Vom Rest seiner Worte verstehe ich nichts bis auf »Bitte, kommt!« und »Frühstück«. Ich erwidere sein Lächeln und nicke. Noch nie bin ich in einer Stadt gewesen, in der es so viele Tamouren gibt. Es ist beinahe wie eine Rückkehr in unsere Heimat.
Du könntest Herrscherin über all das sein, erhebt sich das Flüstern in meinem Kopf und mein Herz klopft vor Verzückung.
Als wir den Stand des Mannes erreichen, kramt Violetta einige Bronzetaler hervor und reicht sie dem Mann. Ich halte mich im Hintergrund, beobachte, wie sie ihn zum Lachen bringt, wie er sich zu ihr herüberlehnt und ihr etwas zuflüstert, woraufhin sie errötet. Violetta schenkt ihm ein Lächeln, neben dem die Sonne verblasst. Beim Abschied hält sie zwei Fleischspieße in der Hand. Als sie sich umdreht, begutachtet der Verkäufer ihren Po, bevor er sich dem nächsten Kunden zuwendet. Er wechselt in eine andere Sprache: »Avei, avei! Vergesst die Glücksspiele und kostet meine frischen Brotfladen!«
Violetta hält einen Bronzetaler hoch. »Zum Sonderpreis. Weil wir ihm so sympathisch sind.«
»Nicht übel.« Ich hebe verschmitzt die Augenbraue und greife nach einem der Spieße. Noch sind unsere Börsen gut gefüllt, weil ich einigen Edelleuten mithilfe meiner Gabe Geld gestohlen habe. Das ist mein Beitrag. Violettas dagegen ist völlig anderer Natur. »Wenn du so weitermachst, bezahlen sie uns bald dafür, dass wir ihr Essen annehmen.«
»Ich arbeite daran.« Violetta reißt betont unschuldig die Augen auf, was kein bisschen unschuldig ist. Ihr Blick wandert über den Platz und verharrt auf einem riesigen Freudenfeuer vor einem Tempel. »Wir nähern uns ihm«, sagt sie und nimmt einen kleinen Bissen von ihrem Fleisch. »Seine Energie ist nicht sehr stark. Und sie scheint sich ständig zu verändern.«
Nachdem wir gegessen haben, folge ich Violetta und ihrer Gabe, die uns in einem komplizierten Zickzackmuster durch die Menschenmenge leitet. Seit unserer Flucht aus Estenzia habe ich sie jeden Abend an mir üben lassen, genau wie damals, als wir noch klein waren und sie mir das Haar geflochten hat. Sie zupft und zerrt. Dann verbinde ich ihr die Augen und bewege mich lautlos durch den Raum, um zu prüfen, ob sie meine Position erspüren kann. Violetta tastet nach den Strängen meiner Energie, studiert ihre Struktur. Ich merke, wie sie stetig besser darin wird.
Das macht mir Angst. Aber Violetta und ich haben einander ein Versprechen gegeben, nachdem die Dolche uns verstoßen haben: Wir werden unsere Kräfte niemals gegeneinander richten. Wenn Violetta den Schutz meiner Illusionen braucht, werde ich ihn ihr immer gewähren. Umgekehrt wird Violetta mir niemals wieder meine Kräfte nehmen.
Irgendjemandem muss ich schließlich vertrauen.
Fast eine Stunde schlendern wir umher, bis Violetta mitten auf dem Platz stehen bleibt. Sie runzelt die Stirn. Auch ich halte an und werfe ihr einen fragenden Blick zu. »Hast du ihn verloren?«
»Kann sein«, antwortet sie. Über der Musik kann ich sie kaum verstehen. Wir warten noch einen Moment, bevor sie sich nach links wendet und mir mit einem Nicken bedeutet, ihr zu folgen.
Kurz darauf bleibt sie abermals stehen. Sie dreht sich einmal um sich selbst und verschränkt dann mit einem Seufzer die Arme vor der Brust. »Er ist mir schon wieder entglitten«, sagt sie. »Vielleicht sollten wir einfach den Weg zurückgehen, den wir gekommen sind.«
Kaum dass die Worte ihren Mund verlassen haben, hält uns ein junger Straßenkünstler auf. Er ist gekleidet wie alle anderen – das Gesicht hinter einer langnasigen Maske verborgen und den Körper in bunte, nicht zueinander passende Tücher gehüllt. Erst bei genauerem Hinsehen fällt mir auf, dass die Tücher aus teurer Seide bestehen, fein gewebt und leuchtend eingefärbt. Er ergreift Violettas Hand, hebt sie vor seine Maske, wie um sie zu küssen, und legt sich die andere Hand aufs Herz. Dann führt er uns zu einer kleinen Gruppe von Leuten, die sich um seinen Stand versammelt haben.
Ich erkenne die Aufbauten auf den ersten Blick – ein kenettranisches Glücksspiel, bei dem zwölf verschiedenfarbige Steine vor dem Spieler ausgelegt werden, aus denen er drei auswählen muss. Anschließend werden die Steine unter Bechern verborgen und gemischt. Meistens spielt man zu mehreren, sodass man, wenn man als Einziger alle drei Steine findet, nicht nur sein eigenes Geld zurückgewinnt, sondern auch die Einsätze der anderen und die Börse des Spielleiters. Ein Blick auf den Beutel am Gürtel des Mannes verrät mir, dass er schon lange keine Runde mehr verloren hat.
Der Spielleiter verbeugt sich wortlos und bedeutet der Gruppe, drei Steine zu wählen. Ich sehe zu, wie zwei von ihnen sich eifrig Steine aussuchen. Neben uns steht ein Malfetto-Junge. Das Blutfieber hat ihn mit einem unansehnlichen schwarzen Ausschlag gezeichnet, der sich über seine Wange und sein Ohr zieht. Ich entdecke einen Anflug von Furcht unter dem nachdenklichen Ausdruck in seinen Augen.
Mmm. Meine Energie drängt in seine Richtung wie ein von Blutgeruch angelockter Wolf.
Violetta beugt sich zu mir herüber. »Spielen wir eine Runde«, schlägt sie vor und auch ihr Blick liegt auf dem Jungen. »Ich glaube, ich spüre etwas.«
Ich nicke dem Spielleiter zu und lasse zwei Goldtalente in seine ausgestreckte Hand fallen. Er dankt mir mit einer schwungvollen Verbeugung. »Für meine Schwester und mich«, sage ich und zeige auf drei Steine.
Er nickt schweigend zurück. Dann beginnt er, die Steine zu mischen.
Violetta und ich konzentrieren uns auf den Malfetto-Jungen, der aufmerksam die kreisenden Becher beobachtet. Während wir darauf warten, dass der Spielleiter innehält, werfen auch die anderen Leute dem Jungen Blicke zu und lachen. Einige stoßen leise Malfetto-Beleidigungen aus. Doch der Junge reagiert nicht darauf.
Nach einer Weile hört der Spielleiter auf, die Becher umherzuschieben. Er ordnet sie alle zwölf in einer Reihe an, verbirgt die Hände in seinem Gewand und fordert die Spieler mit einer Geste auf zu raten, wo sich ihre Steine befinden.
»Vier, sieben und acht«, ruft der Erste und lässt die Hand auf den Tisch niederkrachen.
»Zwei, fünf, neun«, hält ein anderer dagegen.
Noch zwei weitere geben ihre Tipps ab.
Dann wendet der Spielleiter sich uns zu. »Eins, zwei und drei«, sage ich. Die anderen lachen in sich hinein, aber ich beachte sie gar nicht.
Auch der Malfetto-Junge gibt einen Tipp ab: »Sechs, sieben und zwölf.«
Der Spielleiter hebt den ersten Becher hoch, dann den zweiten und den dritten. Ich habe verloren. Ich gebe mir Mühe, enttäuscht zu wirken, doch meine Aufmerksamkeit liegt weiter auf dem Jungen. Sechs, sieben und zwölf. Der Mann greift nach dem sechsten Becher und es stellt sich heraus, dass der Junge richtiggelegen hat.
Der Spielleiter deutet auf den Jungen. Dieser stößt einen triumphierenden Juchzer aus. Die anderen Spieler mustern ihn finster.
Als Nächstes dreht der Mann den siebten Becher um. Wieder hat der Junge richtig geraten. Seine Mitspieler wechseln nervöse Blicke. Wenn der Junge sich beim letzten Becher geirrt hat, verlieren wir alle unser Geld an den Spielleiter. Hat er dagegen auch ein drittes Mal den richtigen Tipp abgegeben, streicht er unser aller Geld ein.
Der Becher hebt sich. Der Junge hatte recht. Er hat gewonnen.
Der Spielleiter sieht abrupt auf. Der Junge stößt einen überraschten Freudenschrei aus, während die anderen ihn wütend anstarren. Hass lodert in ihnen auf, düstere Energiefunken, die zu dicken schwarzen Flecken verschmelzen.
»Was meinst du?«, wende ich mich an Violetta. »Spürst du etwas in seiner Energie?«
Violettas Blick ist noch immer fest auf den jubelnden Jungen gerichtet. »Wir folgen ihm.«
Widerstrebend händigt der Spielleiter seine Börse aus, zusammen mit dem Geld, das wir anderen gesetzt haben. Die übrigen Spieler beginnen, untereinander zu murmeln, während der Junge die Münzen einsammelt. Als er den Stand verlässt, heften sie sich an seine Fersen, ihre Mienen verkniffen, die Schultern angespannt.
Sie werden ihn überfallen. »Komm«, flüstere ich Violetta zu. Ohne ein Wort gehorcht sie mir.
Eine Weile scheint es, als sei der Junge zu glücklich über seinen Gewinn, um sich der Gefahr bewusst zu werden, in die er sich gebracht hat. Erst als er am Rande des Platzes angelangt ist, bemerkt er die anderen Spieler. Er geht weiter, seine Schritte werden schneller. Ich spüre, wie die Angst in seinem Inneren zu einem stetigen süßen Rinnsal anschwillt, und die Verlockung ist groß.
Der Junge flüchtet in eine enge Seitengasse, schummrig und verlassen. Violetta und ich drücken uns in die Schatten an einer Hauswand und ich hülle uns in eine leichte Illusion, damit wir unentdeckt bleiben. Skeptisch werfe ich einen Blick zu dem Jungen hinüber. Ein berüchtigter Begabter wie Magiano wäre doch sicher nicht so leichtsinnig.
Schließlich holt einer der anderen Spieler ihn ein. Bevor der Junge auch nur die Hände heben kann, bringt der andere ihn zu Fall.
Eine zweite Person tut so, als würde sie über den Jungen stolpern, tritt ihm dabei jedoch in den Magen. Der Junge schreit auf und seine Angst verwandelt sich in Panik – ich sehe die Fäden über ihm schimmern wie ein dunkles Netz.
Schon haben die übrigen Spieler ihn umzingelt. Einer packt ihn beim Kragen, reißt ihn hoch und schleudert ihn gegen die Mauer. Der Kopf des Jungen prallt hart auf den Stein und einen Moment lang ist nur das Weiße in seinen Augen zu erkennen. Er sackt zu Boden und krümmt sich zu einer Kugel zusammen.
»Warum bist du weggelaufen?«, höhnt einer der Angreifer. »Scheint dir doch eine Menge Spaß gemacht zu haben, uns alle um unser Geld zu betrügen.«
Die anderen fallen mit ein.
»Und wozu braucht ein Malfetto überhaupt so viel Geld?«
»Willst du damit vielleicht zu einem Dottore gehen und dich von deinen Zeichen befreien lassen?«
»Oder dir eine Hure nehmen, um endlich zu wissen, was du verpasst?«
Ich beobachte. Als ich noch neu bei den Dolchen war und mit ansehen musste, wie auf offener Straße Malfettos misshandelt wurden, habe ich mich danach in meine Kammer geflüchtet und geweint. Inzwischen habe ich so etwas oft genug erlebt, um die Fassung zu behalten und ohne Gewissensbisse von der Angst der Opfer zu zehren. Und so empfinde ich nichts als einen Anflug von Erregung, als die Angreifer den Jungen weiter quälen.
Der Junge kämpft sich auf die Füße, bevor die anderen erneut auf ihn einschlagen können – und rennt die Straße hinunter. Seine Verfolger stürzen hinterher.
»Der ist kein Begabter«, murmelt Violetta mir zu. Zutiefst verwirrt schüttelt sie den Kopf. »Tut mir leid. Ich muss jemand anderen gespürt haben.«
Ich weiß nicht, warum ich plötzlich das Gefühl habe, wir sollten der Gruppe folgen. Wenn der Junge nicht Magiano ist, gibt es keinen Grund, warum wir ihm helfen sollten. Vielleicht liegt es an meiner wachsenden Ungeduld oder der Verlockung der finsteren Kräfte. Oder daran, dass die Dolche Malfettos immer nur geholfen haben, wenn sie zur Elite gehörten. Oder vielleicht auch an der Erinnerung daran, wie ich an einen Eisenpfahl gekettet und mit Steinen beworfen wurde, während ich darauf wartete, vor den Augen der ganzen Stadt auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden.
Einen flüchtigen Moment lang stelle ich mir vor, dass ich, wenn ich eine Königin wäre, das Misshandeln von Malfettos zu einem Verbrechen erklären könnte. Ich könnte die Peiniger dieses Jungen mit einem einzigen Befehl zum Tode verurteilen.
Ich eile ihnen nach. »Komm«, dränge ich Violetta.
»Bitte nicht«, versucht sie, mich aufzuhalten, aber sie weiß, dass es zwecklos ist.
»Ich bin auch brav.« Ich lächele sie an.
Sie hebt eine Augenbraue. »Deine Vorstellung von brav unterscheidet sich ziemlich stark von der anderer Leute.«
Wir huschen durch die Dunkelheit, unsichtbar hinter meiner Illusion. Vor uns werden Rufe laut, als der Junge um eine Ecke biegt, um seine Verfolger abzuschütteln. Vergeblich. Beim Näherkommen höre ich seinen Schmerzensschrei, als sie ihn doch erwischen. Als wir sie wieder einholen, haben die Spieler den Jungen abermals eingekreist. Einer von ihnen befördert ihn mit einem Schlag ins Gesicht zu Boden.
Bevor ich genauer darüber nachdenken kann, handle ich. Mit einer einzigen Bewegung greife ich nach den Energiefäden, die uns verbergen, und schiebe sie zur Seite. Dann marschiere ich geradewegs in den Kreis. Violetta bleibt stehen und beobachtet mich schweigend.
Es dauert einen Moment, bis die Angreifer mich bemerken – erst als ich mich direkt vor den zitternden Malfetto-Jungen stelle, nehmen sie Notiz von mir. Sie zögern.
»Was soll das?«, raunzt der Anführer irritiert. Sein Blick wandert über die Illusion, die noch immer meine entstellte Gesichtshälfte verbirgt. Alles, was er sieht, ist ein makellos schönes Mädchen. Sein Grinsen kehrt zurück. »Ist das etwa deine Hure, du dreckiges Malfetto?«, provoziert er den Jungen. »So viel Glück hast du doch gar nicht verdient!«
Eine Frau neben ihm mustert mich argwöhnisch. »Sie war auch bei dem Spiel dabei«, sagt sie an die anderen gewandt. »Wahrscheinlich hat sie dem Jungen geholfen zu gewinnen.«
»Ah, natürlich«, erwidert der Anführer. Dann wendet er sich mir zu. »Na, hast du vielleicht auch noch ein bisschen Gold bei dir? Deinen Anteil?«
Ein paar der anderen Angreifer scheinen sich ihrer Sache nicht mehr so sicher zu sein. Einer von ihnen bemerkt das Lächeln in meinem Gesicht und wirft mir einen nervösen Blick zu, bevor er zu Violetta schaut, die einige Schritte entfernt steht und wartet. »Wir sollten einfach gehen«, schlägt er vor und hält eine Geldbörse hoch. »Unser Geld haben wir doch schon zurück.«
Der Anführer schnalzt mit der Zunge. »Wir sollten es uns nicht zur Gewohnheit machen, Betrüger ungeschoren davonkommen zu lassen«, entgegnet er. »Solche Leute gehören bestraft.«
Ich sollte meine Gabe nicht unüberlegt einsetzen. Aber das hier ist eine abgeschiedene Gasse und ich kann der Versuchung einfach nicht länger widerstehen. Violetta, die meine Entschlossenheit spürt, zupft von außerhalb des Kreises in halbherzigem Protest an meinen Energiefäden. Ich beachte sie nicht, sondern stemme fest die Füße in den Boden und hebe langsam die Illusion von meinem Gesicht. Meine Gesichtszüge erzittern und verwandeln sich, bis nach und nach die lange Narbe auf der linken Seite sichtbar wird, die entstellte Haut an der Stelle, wo sich einst mein Auge befand. Meine dunklen Wimpern verfärben sich zu blassem Silber. Ich habe unermüdlich an meinen Illusionen gefeilt, bis ich sie so schnell oder langsam entstehen lassen konnte, wie ich wollte. Darum kann ich meine Energiefäden nun mit größter Präzision manipulieren. Stück für Stück enthülle ich dem Kreis von Leuten mein wahres Ich.
Sie starren, vollkommen reglos, auf die vernarbte Seite meines Gesichts. Erstaunt stelle ich fest, dass ich ihre Reaktion genieße. Sie bemerken gar nicht, wie der Malfetto-Junge aus ihrer Mitte krabbelt und sich gegen die nächste Hauswand presst.
Der Anführer stiert mich finster an und zieht ein Messer. »Ein Dämon«, sagt er mit einem Hauch von Nervosität.
»Möglich«, erwidere ich. Meine Stimme klingt kalt. Es ist eine Stimme, an die ich mich noch immer nicht ganz gewöhnt habe.
Der Mann will gerade zum Angriff übergehen, als plötzlich etwas auf dem Boden seine Aufmerksamkeit erregt. Er blickt auf das Kopfsteinpflaster – durch dessen Fugen ein dünnes, leuchtend rotes Band auf ihn zuzukriechen scheint. Es erinnert ein bisschen an ein orientierungsloses Tier, das sich vor- und zurückschlängelt. Der Mann runzelt die Stirn. Dann bückt er sich, um die winzige Illusion genauer zu betrachten.
In dem Moment zerteilt sich die Erscheinung mit einem Schlag in ein Dutzend weitere rote Linien, die in alle Richtungen davonstieben und blutige Spuren zurücklassen. Alle weichen zurück.
»Bei den Göttern, was –?«, beginnt er.
Meine Fäden schlängeln sich über den Boden und die Hauswände hoch, aus den Dutzenden werden Hunderte, Tausende, bis die ganze Straße von einem wirren Netz bedeckt ist. Ich schwärze das Licht der Laternen über uns und erschaffe eine Illusion scharlachroter Sturmwolken am Himmel.
Der Mann verliert mehr und mehr die Beherrschung und auf seinem Gesicht zeigt sich Panik. Seine Begleiter schrecken hastig vor mir zurück, als die blutigen Striemen sich weiter über die Straße ausbreiten. Angst regt sich in ihren Herzen und mich durchzuckt eine Welle aus Kraft und Verlangen. Meine Illusionen machen ihnen Angst und ihre Angst macht mich nur noch stärker.
Hör auf. Wieder nehme ich wahr, wie Violetta an meiner Energie zupft. Vielleicht sollte ich auf sie hören. Schließlich haben die Angreifer bereits ihre Geldgier überwunden. Doch stattdessen schüttele ich sie ab und fahre fort. Das Spiel gefällt mir. Früher habe ich mich für dieses Gefühl geschämt, jetzt jedoch denke ich nur – warum sollte ich keinen Hass empfinden? Warum sollte ich es nicht genießen?
Plötzlich hebt der Mann wieder sein Messer. Ich webe weiter. Du kannst das Messer nicht mehr sehen, verhöhnen ihn die flüsternden Stimmen in meinem Kopf. Wo ist es bloß hin? Gerade war es doch noch da – du musst es verloren haben. Ich habe das Messer weiterhin klar vor Augen, der Mann jedoch starrt wütend und verwirrt auf seine Hand. Für ihn ist das Messer komplett unsichtbar.
Schließlich beugen sich die Angreifer ihrer Furcht – ein paar von ihnen fliehen, während sich die restlichen ängstlich an die Hauswände drücken. Ihr Anführer macht kehrt und will davonlaufen. Ich fletsche die Zähne. Dann schlinge ich Tausende blutiger Linien um seinen Körper und ziehe sie so straff, wie ich kann, bis er das Reißen und Brennen rasiermesserscharfer Fäden spürt, die sich in sein Fleisch bohren. Einen Moment lang treten die Augen des Mannes hervor, bevor er kreischend zusammenbricht. Ich spanne die Fäden um ihn noch enger, wie eine Spinne, die ihre Beute in ihr seidenes Netz hüllt. Fühlt sich an, als schnitten die Fäden geradewegs in deine Haut, was?
»Adelina«, sagt meine Schwester eindringlich. »Die anderen.«
Ich nehme ihre Warnung gerade noch rechtzeitig wahr, um zu erkennen, wie zwei der anderen genügend Mut gefasst haben und auf mich zustürmen – die Frau von zuvor und ein Mann. Ich hebe die Arme und werfe meine Illusion auch über die beiden. Sie gehen zu Boden. Unter dem Eindruck, ihnen würde die Haut abgezogen, winden sie sich vor Qualen.
Ich konzentriere mich so sehr, dass meine Hände zittern. Der Mann kriecht mühsam auf das Ende der Straße zu und ich lasse ihn. Wie muss die Welt sich in diesem Moment in seiner Wahrnehmung anfühlen? Ich lasse meine Illusion weiter über ihn strömen und male mir aus, was er gerade sehen und empfinden mag. Jetzt beginnt er zu schluchzen und jede seiner Bewegungen bringt ihn näher an den Rand seiner Kräfte.
Es ist ein schönes Gefühl, Macht zu haben. Zu beobachten, wie sich andere meinem Willen beugen. So müssen Könige und Königinnen empfinden, die bloß mit ein paar Worten einen Krieg anzetteln oder ein Volk versklaven können. Es ist genau das, wovon ich schon als kleines Mädchen geträumt habe, während ich auf der Treppe in meinem alten Zuhause hockte und mir vorstellte, ich hätte eine schwere Krone auf dem Kopf und würde auf ein Meer kniender Gestalten herabblicken.
»Adelina, nein«, flüstert Violetta. Sie steht jetzt neben mir, aber ich bin so auf das konzentriert, was ich tue, dass ich ihre Nähe kaum wahrnehme. »Sie haben ihre Lektion gelernt. Nun belass es dabei.«
Ich balle die Fäuste und mache weiter. »Du könntest mich aufhalten«, antworte ich mit einem verschlagenen Lächeln, »wenn du es wirklich wolltest.«
Violetta widerspricht mir nicht. Vielleicht will sie insgeheim selbst, dass ich fortfahre. Sehen, wie ich mich verteidige. Und so legt sie mir, anstatt mich zum Aufhören zu zwingen, die Hand auf den Arm und erinnert mich an unser Versprechen.
»Der Junge ist entkommen«, sagt sie sanft. »Spar dir deine Wut für etwas Wichtigeres auf.«
Etwas in ihrem Tonfall dringt durch meinen Zorn zu mir durch. Mit einem Mal bemerke ich meine Erschöpfung, nachdem ich so viel gebündelte Energie verbraucht habe. Ich lasse den Mann frei. Er sackt auf dem Pflaster zusammen und schlingt die Arme um seine Brust, als spüre er noch immer die Fäden, die sich in sein Fleisch graben. Sein Gesicht ist nass vor Tränen und Speichel. Ich trete zurück und fühle mich plötzlich schwach.
»Du hast recht«, murmele ich Violetta zu.
Sie seufzt bloß erleichtert und stützt mich.
Ich beuge mich zu dem zitternden Anführer hinunter, sodass er einen ausführlichen Blick auf mein vernarbtes Gesicht werfen kann. »Ich werde dich im Auge behalten«, warne ich ihn. Ob meine Worte wahr sind oder nicht, spielt keine Rolle. Ich weiß, dass er sie in seinem derzeitigen Zustand nicht infrage stellen wird. Stattdessen nickt er hastig, ruckartig. Dann springt er auf und rennt davon.
Die Übrigen tun es ihm gleich. Ihre Schritte hallen durch die Straße und gehen schließlich im Lärm der Feierlichkeiten unter. Als sie um die Ecke verschwunden sind, atme ich tief aus, meine Wut ist verraucht und ich drehe mich zu Violetta um. Sie ist leichenblass. Ihre Hand umklammert meine so fest, dass unsere Fingerknöchel weiß schimmern. So bleiben wir eine Weile in der verlassenen Gasse stehen. Ich schüttele den Kopf.
Der Malfetto-Junge, den wir gerettet haben, kann nicht Magiano gewesen sein. Er war kein Begabter. Und selbst wenn er es gewesen wäre, jetzt ist er längst über alle Berge. Ich seufze und hocke mich hin, stütze die Hände auf den Boden. Der Vorfall hat nichts als Verbitterung in mir zurückgelassen. Warum hast du sie nicht getötet?, flüstern die erregten Stimmen in meinem Kopf.
Ich weiß nicht, wie lange wir so verharren, als uns plötzlich eine schwache, gedämpfte Stimme über unseren Köpfen zusammenzucken lässt.
»So viel zu deinem Vorsatz, brav zu sein, was?«, sagt sie.
Die Stimme klingt seltsam vertraut. Ich blicke an den Hausfassaden hoch, doch in der Dunkelheit ist es schwer, etwas zu erkennen. Ich trete einen Schritt zurück, bis ich in der Mitte der Straße stehe. In der Ferne höre ich Musik und Gelächter.
Violetta ergreift meine Hand. Ihr Blick liegt auf einem Balkon an der Häuserfront gegenüber von uns. »Da oben«, flüstert sie. Ich blinzele und schließlich erkenne ich eine maskierte Gestalt, die lässig an der Marmorbalustrade lehnt und uns schweigend beobachtet – es ist der Spielleiter mit den bunten Steinen.
Meine Schwester beugt sich zu mir herüber. »Er ist ein Begabter. Ihn habe ich die ganze Zeit gespürt.«
ADELINA AMOUTERU – Der Spielleiter reagiert …
Die Ironie des Lebens besteht darin, dass diejenigen, die sich hinter Masken verbergen, uns mehr über sich selbst preisgeben als jene, die uns ihr Gesicht zeigen.
Maskerade von Salvatore Laccona
ADELINA AMOUTERU
Der Spielleiter reagiert nicht, als wir zu ihm hinaufstarren.
Er steht einfach nur da, an die Brüstung gelehnt, und schnallt eine Laute los, die er auf dem Rücken getragen hat. Gedankenverloren zupft er an den Saiten, wie um das Instrument zu stimmen, dann reißt er sich mit einem ungeduldigen Schnauben die Dottore – Maske vom Gesicht. Ein Schwall dunkler geflochtener Zöpfe ergießt sich über seine Schultern. Sein Gewand, das bis zur Brust aufgeknöpft ist, flattert lose um ihn herum und seine Arme zieren dicke goldene Reifen, die sich glänzend von seiner bronzefarbenen Haut abheben. Sein Gesicht kann ich nicht genau erkennen, doch selbst von hier unten sehe ich, dass seine Augen einen auffälligen Honigton haben und im Dunkeln zu leuchten scheinen.
»Ich habe euch auf eurem Weg durch die Menge beobachtet«, sagt er schließlich mit einem durchtriebenen Lächeln. Sein Blick wendet sich Violetta zu. »Jemanden wie dich zu übersehen, ist kaum möglich. Die Spur gebrochener Herzen, die du hinterlässt, muss lang sein. Und doch bin ich mir sicher, dass sich die Verehrer dir immer wieder aufs Neue zu Füßen werfen, in der verzweifelten Hoffnung, deine Gunst zu erringen.«
Violetta runzelt die Stirn. »Wie bitte?«
»Du bist schön.«
Violetta wird feuerrot. Ich mache einen Schritt auf den Balkon zu. »Und wer bist du?«, rufe ich zu ihm hoch.
Nach und nach verwandeln sich die Lautentöne in eine Melodie. Das Lied verwirrt mich – er spielt wundervoll, was ich bei seinem überheblichen Auftreten gar nicht vermutet hätte. Beinahe hypnotisierend. Hinter dem alten Haus unserer Eltern standen ein paar hohle Bäume, in denen meine Schwester und ich uns als Kinder gern versteckt haben. Wenn der Wind durch die Blätter strich, klang es, als trüge er Gelächter mit sich, und wir stellten uns vor, es sei das Lachen der Götter, die den kühlen Frühlingsnachmittag genossen. An dieses Geräusch erinnert mich die Musik des geheimnisvollen Fremden. Seine Finger huschen über die Saiten und das Lied wirkt so natürlich und unverfälscht wie ein Sonnenuntergang.
Auch Violetta lauscht gebannt und mir wird klar, dass er die Melodie aus dem Kopf komponiert.
Er kann einen Menschen allein mit seinem Lautenspiel über den Rand einer Klippe in den Abgrund locken.
»Und du«, sagt der Junge über seine Musik hinweg zu mir. »Wie hast du das gemacht?«
Ich blinzele, noch immer wie benebelt. »Was?«
Er hält gerade lange genug inne, um mir einen ungeduldigen Blick zuzuwerfen. »Ach, nun zier dich doch um der Götter willen nicht so.« Seine Stimme bleibt locker, als er sein Spiel wieder aufnimmt. »Es ist offensichtlich, dass du eine Begabte bist. Also, wie hast du das gemacht, mit den blutigen Linien und dem Messer?«
Violetta nickt mir schweigend zu, bevor ich antworte. »Meine Schwester und ich suchen seit Monaten nach jemandem.«
»Ach, wirklich? Ich wusste gar nicht, dass mein Spielstand ein so beliebter Treffpunkt ist.«
»Wir suchen nach einem Begabten mit dem Namen Magiano.«
Er sagt nichts, sondern lässt bloß eine rasche Tonfolge erklingen. Seine Finger fliegen über die Saiten, doch jede einzelne Note ist klar und präzise, absolut perfekt. Es kommt mir vor, als würde er eine Ewigkeit so weitermachen. Die Töne, die er zu einer Melodie zusammenfügt, scheinen eine Geschichte zu erzählen, fröhlich und voller Sehnsucht, vielleicht sogar lustig, als verberge sich darin ein geheimer Witz. Ich will, dass er mir antwortet, aber gleichzeitig will ich nicht, dass er aufhört zu spielen.
Nach einer Weile hält er inne und blickt mich an. »Wer ist dieser Magiano?«
Violetta gibt einen gedämpften Laut von sich und ich kann nicht anders, als die Arme zu verschränken und ungläubig zu schnauben. »Du hast doch sicher schon von Magiano gehört«, sagt meine Schwester.
Er legt den Kopf schief und schenkt Violetta ein gewinnendes Lächeln. »Wenn du hergekommen bist, um mich nach meiner Meinung über erfundene Menschen zu fragen, mein Herz, dann verschwendest du deine Zeit. Der einzige Magiano, von dem ich jemals gehört habe, ist eine Schauergestalt, mit der Mütter ihren Kindern drohen, damit sie die Wahrheit sagen.« Er macht eine demonstrative Geste. »Ihr wisst schon. Wenn du weiter lügst, kommt Magiano und stiehlt dir deine Zunge. Wenn du am Sapientag nicht gebührend zu den Göttern betest, kommt Magiano und frisst alle deine Haustiere.«
Ich öffne den Mund, um etwas zu erwidern, doch er fährt fort, als rede er mit sich selbst. »Das ist doch wohl Beweis genug. Anderer Leute Haustiere essen ist widerwärtig und Zungen stehlen mehr als unhöflich. Wer würde denn so etwas tun?«
Ein Fünkchen Zweifel glimmt in meiner Brust auf. Was ist, wenn er die Wahrheit sagt? Jedenfalls gleicht er kein bisschen dem Jungen aus den Erzählungen. »Wie gelingt es dir, dein eigenes Spiel so oft zu gewinnen?«
»Ach, das.« Der Junge spielt einen Moment sein Lied weiter. Dann hört er unvermittelt auf, lehnt sich zu uns herunter und hebt beide Hände. Er schenkt uns abermals sein strahlendes Lächeln. »Mit Magie.«
Ich lächele zurück. »Du meinst wohl, mit Magianos Tricks.«
»Daher stammt dieses Wort?«, fragt er leichthin, bevor er sich wieder an die Brüstung lehnt. »War mir gar nicht bewusst.« Seine Finger finden erneut die Saiten der Laute. Ich merke, wie er das Interesse an uns verliert. »Mit reiner Fingerfertigkeit, geschickt platzierten Lampions und ein bisschen wohlgeplanter Ablenkung, mein Herz. Und, na ja, mit der Hilfe eines Assistenten. Wahrscheinlich verkriecht er sich immer noch irgendwo – halb verrückt vor Angst, der Dummkopf. Dabei habe ich ihn noch gewarnt, ja nicht wegzulaufen.« Er hält kurz inne. »Darum bin ich auch jetzt hier, müsst ihr wissen. Ich wollte euch beiden danken, dass ihr meinen Helfer gerettet habt, und jetzt genießt weiter die Festlichkeiten. Viel Glück bei eurer Suche nach diesem Begabten.«
Der Malfetto-Junge steckt also mit ihm unter einer Decke. Ich hole tief Luft. Etwas an der Art, wie er das Wort Begabter ausgesprochen hat, ruft eine Erinnerung in mir wach. Seine Stimme klingt so vertraut. Ich bin mir sicher, dass ich sie schon einmal vernommen habe. Aber wo? Ich runzele die Stirn, während ich versuche, die Erinnerung einzuordnen. Wo bloß, wo bloß …
Und dann fällt es mir wieder ein.
Mein Zellennachbar im Verlies. Als die Inquisition mich zum ersten Mal gefangen genommen und in den Kerker geworfen hat, saß in der Zelle neben meiner ein halb wahnsinniger Häftling. Ich erinnere mich an Lachen, Kichern und eine singende Stimme, von der ich damals glaubte, dass sie jemandem gehörte, der während seiner langen Gefangenschaft den Verstand verloren hatte.
Mädchen. Ist es wahr? Sie sagen, dass du eine von ihnen bist. Eine Begabte.
Er muss mir ansehen, dass ich ihn erkenne, denn er hält einen Moment mit dem Spielen inne. »Warum machst du so ein Gesicht? Hast du einen schlechten Lammspieß gegessen? Das ist mir mal passiert.«
»Wir waren zusammen im Kerker.«
Bei meinen Worten stutzt er. Erstarrt. »Wie bitte?«
»Wir waren im selben Gefängnis. In Dalia, vor ein paar Monaten. Du musst dich doch erinnern.« Ich hole tief Luft und lasse meine Erinnerung Revue passieren. »An dem Tag wurde ich dazu verurteilt, auf dem Scheiterhaufen zu sterben.«
Als ich in der Dunkelheit zu ihm hochschaue, fällt mir auf, dass sein Lächeln verblasst ist. Stattdessen starrt er mich nun unverhohlen an.
»Du bist Adelina Amouteru«, murmelt er vor sich hin, während sein Blick mit neu erwecktem Interesse über mein Gesicht wandert. »Ja, natürlich, natürlich bist du das. Ich hätte es sofort spüren müssen.«
Ich nicke. Einen Moment lang frage ich mich, ob ich ihm womöglich zu viel verraten habe. Weiß er, dass die Inquisition nach uns sucht? Was ist, wenn er uns die Soldaten von Merroutas auf den Hals hetzt?
Er mustert mich eine Weile, die mir wie Stunden vorkommt. »Du hast mir damals das Leben gerettet«, sagt er schließlich.
Verwirrt runzele ich die Stirn. »Was?«
Jetzt lächelt er wieder, aber dieser Ausdruck ist anders als das gutmütige Grinsen, das er Violetta geschenkt hat. Nein, ein solches Lächeln habe ich noch nie gesehen – beinahe katzenhaft verengt es seine Augen zu Schlitzen und verleiht ihm, wenn auch nur für einen kurzen Moment, etwas Wildes, Raubtierhaftes. Die Spitzen seiner Eckzähne blitzen. Der Ausdruck lässt sein Gesicht völlig verwandelt erscheinen, Furcht einflößend und gleichzeitig charismatisch. Jedes Quäntchen seiner Aufmerksamkeit ist nun auf mich gerichtet, als existiere sonst nichts auf der Welt. Violetta scheint er vollkommen vergessen zu haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich merke, wie meine Wangen sich zu röten beginnen.
Ohne zu blinzeln, fixiert er mich, während er beim Spielen sein Lied mitsummt. Dann löst er seinen Blick von mir und sagt: »Wenn ihr nach Magiano sucht, könntet ihr mehr Glück in den verlassenen Thermen im Süden von Merroutas haben, im Kleinen Bad von Bethesda. Geht morgen bei Tagesanbruch dorthin. Es heißt, er verhandele lieber an verschwiegenen Orten.« Er hebt einen Finger. »Aber seid gewarnt – er lässt sich von niemandem Befehle erteilen. Wenn ihr wollt, dass er euch zuhört, müsst ihr ihm einen guten Grund dafür liefern.«
Und bevor Violetta oder ich etwas erwidern können, stößt er sich von der Balustrade ab, kehrt uns den Rücken zu und verschwindet im Gebäude.
RAFFAELE LAURENT BESSETTE – Nebel. Früher Morgen. …
RAFFAELE LAURENT BESSETTE
Nebel. Früher Morgen.
Die Erinnerung an einen kleinen Jungen, der barfuß vor dem armseligen Haus seiner Familie hockte und mit Stöckchen im Matsch spielte. Er hob den Kopf und sah einen alten Mann auf dem Kutschbock eines Wagens sitzen, der von einem knochigen Gaul durchs Dorf gezogen wurde. Das Kind unterbrach sein Spiel. Es rief nach seiner Mutter und stand auf, als der Wagen sich näherte.
Der Mann hielt vor ihm. Die beiden starrten einander an. Etwas stimmte nicht mit den Augen im schmalen Gesicht dieses Kindes – das eine so warm wie Honig, das andere leuchtend grün wie ein Smaragd. Doch das war nicht alles – je länger der Mann den Jungen beobachtete, desto mehr wunderte er sich, wie im Blick eines so jungen Menschen so viel Weisheit liegen konnte.
Er betrat das kleine Haus, um mit der Mutter zu sprechen. Es kostete ihn einiges an Überzeugungskraft – sie wollte ihn nicht hereinlassen, bis er sagte, es gebe eine Möglichkeit, wie sie zu Geld kommen könnte.
»In dieser Gegend werdet Ihr nicht viele Leute finden, die Euren Plunder und Eure Tinkturen kaufen«, erklärte die Mutter dem Mann händeringend in der winzigen düsteren Kammer, die sie mit ihren sechs Kindern bewohnte. Er setzte sich auf den Stuhl, den sie ihm anbot. Ihr Blick huschte ununterbrochen umher, als fänden ihre Augen nirgends Ruhe. »Das Blutfieber hat uns ins Elend gestürzt. Letztes Jahr hat es mir meinen Mann und meinen ältesten Sohn genommen. Zwei meiner anderen Kinder sind gezeichnet, wie Ihr seht.« Sie deutete auf den kleinen Jungen mit den Edelsteinaugen, der wortlos zusah, und seinen Bruder. »Dies ist schon immer ein armes Dorf gewesen, Sir, aber jetzt stehen wir alle kurz vor dem Ruin.«
Das Kind bemerkte, dass der Blick des Mannes immer wieder zu ihm wanderte. »Und wie kommt Ihr ohne Euren Ehemann zurecht?«
Die Mutter schüttelte den Kopf. »Ich arbeite auf den Feldern. Und ich habe einige unserer Besitztümer verkauft. Unser Mehl wird noch ein paar Wochen für Brot reichen, aber es ist voller Würmer.«
Der Mann hörte aufmerksam zu. Für den Bruder des Jungen schien er sich nicht zu interessieren. Als die Mutter innehielt, lehnte er sich zurück und nickte. »Ich verschiffe Fracht zwischen den Häfen von Estenzia und Campagnia. Ich bin gekommen, um Euch nach Eurem jüngsten Sohn zu fragen, dem mit den zweifarbigen Augen.«
»Was wollt Ihr über ihn wissen?«
»Ich kann Euch fünf Goldtalente für ihn zahlen. Er ist ein hübscher Junge – in einer großen Hafenstadt könnte er viel Geld bringen.«
Als die Mutter verblüfft schwieg, fuhr der Mann fort: »In Estenzia gibt es Häuser, in denen Ihr mehr Juwelen und Reichtümer finden würdet, als Ihr es Euch je ausmalen könntet. Welten voller Prunk und Lebenslust – dort sind sie immer auf der Suche nach frischem Blut.« Er nickte in Richtung des Kindes.
»Ihr meint, Ihr würdet ihn an ein Bordell verkaufen.«
Wieder musterte der Mann den Jungen. »Nein. Für ein Bordell hat er ein zu zartes Gesicht.« Er beugte sich näher zu ihr und senkte die Stimme. »Eure gezeichneten Söhne werden es hier schwer haben. Ich habe Geschichten aus anderen Dörfern gehört, wo sie die Kleinen im Wald ausgesetzt haben, aus Angst, dass sie Krankheit und Unglück über alle bringen könnten. Ich habe gesehen, wie sie solche Kinder bei lebendigem Leib verbrannt haben, Säuglinge, mitten auf der Straße. Auch hier wird es eines Tages dazu kommen.«
»Nein, das wird es nicht«, entgegnete die Frau hitzig. »Unsere Nachbarn mögen arm sein, aber sie sind gute Menschen.«
»Verzweiflung kehrt bei jedem die dunkelsten Seiten hervor«, meinte der Mann mit einem Schulterzucken.
Die beiden diskutierten, bis der Abend hereinbrach. Die Mutter weigerte sich noch immer.
Der Junge hörte weiterhin schweigend zu und dachte nach.
Als es schließlich Nacht wurde, stand er auf und griff sanft nach der Hand seiner Mutter. Er sagte ihr, dass er mit dem Mann gehen würde. Die Mutter gab ihm eine Ohrfeige, fuhr ihn an, das komme gar nicht infrage, doch der Junge beharrte auf seinem Entschluss.
»Sonst werden wir alle verhungern«, erwiderte er leise.
»Du bist noch viel zu jung, um zu verstehen, was du opfern würdest«, schalt die Mutter.
Der Junge warf einen Blick zu seinen Geschwistern hinüber. »Es ist besser so, Mama.«
Die Mutter musterte ihren hübschen Sohn, bewunderte seine Augen, strich ihm mit der Hand durchs schwarze Haar. Ihre Finger glitten über die vereinzelten glänzend saphirblauen Strähnen. Dann zog sie ihn an sich und weinte. Lange hielt sie ihn im Arm. Er schmiegte sich an sie, stolz darauf, seiner Mutter helfen zu können, ohne zu wissen, was das für ihn selbst bedeutete.
»Zwölf Goldtalente«, sagte sie zu dem Mann.
»Acht«, erwiderte er.
»Zehn. Für weniger gebe ich meinen Sohn nicht her.«
Der Mann schwieg eine Weile. »Zehn«, willigte er schließlich ein.
Die Mutter wechselte noch ein paar leise Worte mit dem Mann, bevor sie die Hand ihres Sohnes losließ.
»Wie heißt du, mein Junge?«, fragte der Mann ihn, während er ihn auf seinen klapprigen Wagen hob.
»Raffaele Laurent Bessette.« Die Stimme des Jungen war ernst, sein Blick unverwandt auf sein Zuhause gerichtet. Schon jetzt erfüllte ihn Furcht. Würde seine Mutter ihn je besuchen kommen? Oder bedeutete dies, dass er seine Familie nie wiedersehen würde?
»Also, Raffaele«, sagte der Mann und tippte das Hinterteil der mageren Stute mit der Peitsche an. Dann gab er dem Jungen eine Scheibe Brot und ein Stück Käse, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. »Warst du schon mal in der Hauptstadt von Kenettra?«
Zwei Wochen später verkaufte der Mann den Jungen für tausend Goldtalente an den Fortunata-Hof in Estenzia.
Raffaeles Lider öffnen sich flatternd im schwachen Licht der Morgendämmerung, das zum Fenster hereinströmt. Draußen wirbeln kleine Schneeflocken durch die Luft.
Vorsichtig bewegt er sich. Nicht mal der flackernde Kamin und die Felle, die sich auf seinem Bett türmen, reichen aus, um ihn vor der eisigen Kälte zu schützen. Er zieht sich die Decken bis zum Kinn hoch und versucht, trotz seiner Gänsehaut wieder einzuschlafen. Doch die zwei Wochen, die er auf einem Segelschiff in den stürmischen Gewässern zwischen Kenettra und Beldain unterwegs war, fordern ihren Tribut. Sein ganzer Körper schmerzt vor Erschöpfung. Das Sommerschloss der beldischen Königin ist ein kalter, feuchter Bau, ganz anders als die glitzernden Marmorhallen und sonnendurchfluteten Gärten Estenzias. Er kann sich einfach nicht an diesen frostigen Sommer gewöhnen. Die anderen Dolche müssen auch Mühe haben, Ruhe zu finden.
Nach einer Weile seufzt er, schiebt die Felle von sich und steht auf. Das Licht fällt auf seinen flachen Bauch, die straffen Muskeln, den schlanken Hals. Auf leisen Sohlen geht er zu seinem Gewand, das am Fußende des Bettes liegt. Dieses Gewand hat er schon einmal getragen – vor ein paar Jahren hat es ihm die Herzogin von Campagnia geschenkt, eine kenettranische Edelfrau. Sie war derart in Raffaele vernarrt, dass sie die Dolche mit einem Großteil ihres Vermögens unterstützte. Viele seiner einflussreichen Kunden haben versucht, sich mit allen Mitteln seine Liebe zu erkaufen.
Er fragt sich, ob es der Herzogin wohl gut geht. Nach ihrer Flucht aus Kenettra haben die Dolche Brieftauben ausgeschickt, um ihre Unterstützer zu informieren. Die Herzogin ist eine von jenen, die nie geantwortet haben.
Raffaele schlüpft in das lange Gewand, das seinen Körper vom Hals bis zu den Zehenspitzen verhüllt. Der Stoff, schwer und üppig, legt sich in Falten um seine Füße und schimmert im Licht. Raffaele streicht sich mit den Fingern durch sein langes schwarzes Haar und steckt es lose zu einem eleganten Knoten auf seinem Kopf zusammen. Die saphirblauen Strähnen in seinem Haar glänzen in der kalten Morgensonne. Seine Hände fahren über den kühlen Stoff seiner Ärmel.
Er denkt zurück an die Nacht, in der Enzo ihn in seiner Kammer aufgesucht hat, in der er den Prinzen zum ersten Mal vor Adelina gewarnt hat. Seine Finger halten einen Moment inne, in Trauer erstarrt.
Es hat keinen Sinn, über die Vergangenheit nachzugrübeln. Raffaele wirft einen letzten sehnsüchtigen Blick auf den Kamin und verlässt dann lautlos die Kammer. Seine schwere samtene Schleppe gleitet hinter ihm her.
In den Korridoren hängt ein modriger Geruch – nach jahrhundertealtem, feuchtem Stein und der Asche längst verloschener Fackeln. Es wird mit jedem Schritt heller, bis der Gang schließlich in die Gärten des Sommerschlosses mündet. Die Blumen sind mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt, die bis zum Nachmittag geschmolzen sein wird. Von hier aus kann Raffaele die unteren Palasthöfe überblicken und in der Ferne Beldains felsige Küste erahnen. Ein kalter Windzug lässt seine Wangen taub werden und peitscht ihm lose Haarsträhnen ins Gesicht.
Sein Blick schweift zum Haupttor des Schlosses.
Normalerweise müsste der Hof um diese Zeit menschenleer sein. Heute jedoch wird er von Malfettos bevölkert, die aus Estenzia geflohen sind und sich, in alte Decken gehüllt, um kleine Lagerfeuer drängen. In der Nacht muss ein weiteres Schiff eingetroffen sein. Raffaele beobachtet die Grüppchen eine Weile, bevor er wieder ins Schloss zurückkehrt und sich auf den Weg nach unten macht.
Einige der Malfettos erkennen Raffaele, als er den Hof durchquert. Ihre Gesichter hellen sich auf. »Das ist der Anführer der Dolche!«, ruft einer von ihnen.
Jetzt stürzen die ersten herbei, um Raffaeles Hände und Arme zu berühren, in der Hoffnung, dass seine Gabe ihre Qualen lindert. Dies ist zu einem tagtäglichen Ritual geworden. Raffaele bleibt zwischen ihnen stehen. So viele Menschen auf der Suche nach Trost.
Sein Blick fällt auf einen kahlköpfigen Jungen, der ihn selbst um ein gutes Stück überragt und sein Haar vor langer Zeit durch das Fieber eingebüßt haben musste. Raffaele hat ihn schon am Tag zuvor gesehen. Er winkt ihn zu sich. Der Junge reißt überrascht die Augen auf und eilt an Raffaeles Seite.
»Guten Morgen«, begrüßt er ihn.
Raffaele mustert ihn aufmerksam. »Guten Morgen.«
Der Junge redet mit gedämpfter Stimme. Er wirkt nervös, jetzt, da es ihm gelungen ist, vor allen anderen Raffaeles Aufmerksamkeit zu erlangen. »Wärt Ihr so gütig, Euch meine Schwester anzusehen?«
»Natürlich«, antwortet Raffaele ohne Zögern.
Das Gesicht des kahlköpfigen Jungen hellt sich auf. Genau wie alle anderen scheint auch er regelrecht gebannt von Raffaeles Gesicht zu sein. Er fasst den jungen Kurtisanen am Arm. »Hier entlang«, sagt er.
Raffaele folgt ihm durch die Gruppe Malfettos. Ihm fällt ein unschönes dunkles Mal auf einem Unterarm auf. Ein vernarbtes Ohr und von silbrigen Strähnen durchzogenes Haar. Verschiedenfarbige Augen. Im Stillen prägt sich Raffaele jedes Zeichen ein, das er sieht. Geflüster brandet auf, als er vorübergeht.
Sie erreichen die Schwester des Jungen. Das Mädchen hockt in einer Ecke des Hofs, das Gesicht hinter einem Schal verborgen. Als es Raffaele erblickt, krümmt es sich noch enger zusammen und senkt den Blick.
Der Junge wendet sich Raffaele zu. »Sie ist einem Inquisitor in die Hände gefallen, in der Nacht, als sie all die Ladenfenster in Estenzia eingeworfen haben«, murmelt er ihm zu. Er beugt sich weiter vor und flüstert Raffaele noch etwas ins Ohr. Raffaele hört zu, während er das Mädchen mustert – eine Schramme hier, ein Bluterguss da, die Haut an ihren Beinen grün und blau verfärbt.
Als der Junge seinen Bericht beendet hat, nickt Raffaele verständnisvoll. Er rafft sein Gewand und kniet neben dem Mädchen nieder. Eine Welle ihrer Energie erfasst ihn. Er zuckt zusammen. Welch überwältigende Trauer und Furcht. Wenn Adelina hier wäre, würde sie diese Emotionen gierig in sich aufsaugen. Er achtet sorgsam darauf, das Mädchen nicht zu berühren. Es hatte Kunden gegeben, die ihn in einem ähnlichen Zustand in seiner Schlafkammer zurückgelassen hatten – zitternd und mit blauen Flecken übersät. Das Letzte, was er sich danach gewünscht hatte, war, eine Hand auf seiner Haut zu spüren.
Eine Weile sitzt Raffaele bloß da und sagt nichts. Das Mädchen sieht ihn wortlos an, betrachtet wie erstarrt sein Gesicht. Ihre Schultern bleiben angespannt. Raffaele nimmt Feindseligkeit und Misstrauen in ihrer Energie wahr. Schließlich fängt das Mädchen an zu reden. »Der Erste Inquisitor will uns alle zu Sklaven machen. Zumindest haben wir das gehört.«
»Ja.«
»Es heißt, die Inquisition hat Arbeitslager rund um Estenzia errrichtet.«
»Das stimmt.«
Sie registriert überrascht, dass er nicht einmal versucht, ihr die Wahrheit schonend beizubringen. »Sie sagen, wenn sie uns nicht mehr gebrauchen können, werden sie uns alle töten.«
Raffaele schweigt. Er weiß, das wird Antwort genug sein.
»Werden die Dolche ihn aufhalten?«
»Die Dolche werden ihn zerstören«, erwidert Raffaele. Die Worte klingen seltsam mit seiner sanften Stimme, wie ein Messer, das durch Seide fährt. »Dafür werde ich persönlich sorgen.«
Wieder wandern die Augen des Mädchens über sein Gesicht, ergründen die Schönheit seiner zarten Züge. Raffaele streckt ihr die Hand entgegen und wartet geduldig. Nach einer Weile hebt sie ihre eigene. Zögerlich berührt sie seine und keucht auf. Durch die Verbindung ihrer Finger bringt er die Saiten ihres Herzens sachte zum Schwingen, teilt ihren Schmerz, tröstet und beruhigt sie so gut er kann und vertreibt ihre Traurigkeit durch Zuversicht. Ich weiß, wie du dich fühlst. Tränen laufen über die Wangen des Mädchens. Eine Weile lässt sie Raffaele ihre Hand halten, zieht sie dann aber zurück und kauert sich wieder zusammen, das Gesicht gesenkt.
»Danke«, flüstert ihr Bruder. Andere haben sich hinter Raffaele versammelt und ehrfürchtig zugesehen. »Das ist das erste Mal, dass sie gesprochen hat, seit wir Estenzia verlassen haben.«
»Raffaele!«
Lucents Stimme durchbricht die andächtige Stille. Raffaele dreht sich um und entdeckt die wippenden Locken der Windzähmerin, die sich einen Weg durch die Menge bahnt. Hier in ihrem Heimatland – dicke Felle um Hals und Handgelenke geschlungen, eine Schnur mit klimpernden Perlen im Haar – ist nicht mehr zu übersehen, dass sie eine Beldin ist. Direkt vor ihm bleibt sie stehen.
»Ich unterbreche dich ja nur ungern bei deiner täglichen Visite«, sagt sie und bedeutet ihm, sie zu begleiten, »aber sie ist gestern am späten Abend angekommen. Und sie hat verlangt, uns zu sprechen.«
Raffaele nickt den Malfettos im Hof zum Abschied zu und folgt Lucent. Sie wirkt ungehalten, vermutlich, weil sie so lange nach ihm suchen musste, und reibt sich ununterbrochen die Arme. »Die kenettranischen Sommer haben mich verweichlichen lassen«, beklagt sie sich. »Mir tun die Knochen weh vor Kälte.« Als Raffaele nicht antwortet, lässt sie ihre Unzufriedenheit an ihm aus. »Weißt du sonst nichts mit deiner Zeit anzufangen?«, faucht sie. »Malfetto-Flüchtlingen deine Schulter zum Ausweinen zu bieten, hilft uns nicht dabei, die Inquisition zurückzuschlagen.«
Raffaele würdigt sie keines Blickes. »Der kahlköpfige Junge ist ein Begabter.«
Lucent stößt einen ungläubigen Laut aus. »Wirklich?«
»Das ist mir schon gestern aufgefallen«, fährt er fort. »Seine Energie ist unauffällig, aber sie ist da. Ich werde später nach ihm schicken lassen.«
Unmut zeigt sich auf Lucents Gesicht. Raffaele sieht die Zweifel in ihren Augen, den Ärger darüber, dass er sie damit überrumpelt hat. Kurz darauf zuckt sie mit den Schultern. »Stimmt, deine Nettigkeiten verteilst du schließlich nie ohne Hintergedanken, nicht wahr?«, brummt sie. »Also, Michel sagt, sie sind draußen auf dem Hügel.« Sie beschleunigt ihre Schritte.
Raffaele erwähnt nicht, dass sein Herz noch immer schwer ist, wie nach jedem seiner Aufeinandertreffen mit den Malfettos. Und auch nicht, dass er wünschte, er hätte länger bei ihnen bleiben und ihnen helfen können. Es hätte keinen Zweck. »Deine Königin wird mir die Verspätung verzeihen.«
Lucent schnaubt bloß und verschränkt die Arme. Doch hinter ihrer gleichgültigen Fassade spürt Raffaele, wie sich die Stränge ihrer Energie schmerzhaft umeinander winden, ein Knoten aus Leidenschaft und Sehnsucht, der sich über die Jahre immer fester gezogen hat, voller Ungeduld, endlich die beldische Prinzessin wiederzusehen. Wie lange ist es her, dass Lucent aus Beldain verbannt wurde – wie lange war sie von Maeve getrennt? Mitleid überkommt Raffaele. Er berührt sie kurz am Arm. Die Energiefäden um sie schimmern auf und er greift danach, um sie zu beruhigen. Sie hebt die Augenbraue.
»Du wirst sie gleich sehen«, sagt Raffaele. »Tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen.«
Lucent entspannt sich ein wenig unter seiner Berührung. »Ich weiß.«
Sie erreichen ein hohes Steintor, das auf die weite Grasebene hinter dem Schloss hinausführt. Ein Grüppchen Soldaten trainiert im Hof. Lucent muss Raffaele in einem weiten Bogen um die Duellpartner herumleiten, bis sie das Schloss schließlich hinter sich gelassen haben und durchs hohe Gras stapfen. Sie erklimmen einen kleinen Hügel. Raffaele erschaudert im Wind, blinzelt durch das dünne Schneegestöber und zieht seinen Mantel fester zu.
Als sie die Kuppe des Hügels erreichen, kommen auch die anderen beiden Dolche in Sicht. Michel, der Architekt, hat seine kenettranischen Kleider abgelegt und sich stattdessen bis zum Hals in beldische Felle gehüllt. Er unterhält sich leise mit dem Mädchen neben ihm – Gemma, der Sternendiebin, die nach wie vor stur ihr liebstes kenettranisches Gewand trägt. Doch auch sie hat sich einen beldischen Fellumhang um die Schultern drapiert und bibbert vor Kälte. Die beiden unterbrechen ihr Gespräch, um Lucent und Raffaele zu begrüßen.
Gemmas Blick verharrt am längsten auf ihm. Raffaele weiß, dass sie noch immer auf Nachrichten von ihrem Vater hofft. Doch Raffaele schüttelt bloß den Kopf. Baron Salvatore ist ein weiterer ehemaliger Unterstützer der Dolche, der nicht auf seine Brieftaube geantwortet hat. Enttäuschung breitet sich auf Gemmas Gesicht aus und sie schaut schnell zur Seite.
Raffaele richtet seine Aufmerksamkeit auf die anderen Personen auf der Lichtung. Innerhalb eines Rings aus Soldaten wartet eine Handvoll Edelmänner – Prinzen, ihren dunkelblauen Ärmeln nach zu schließen – und ein riesiger weißer Tiger mit goldenen Streifen. Sein Schweif peitscht träge durchs Gras und seine Augen sind zu schläfrigen Schlitzen verengt. Alle sind auf zwei in einen Schwertkampf vertiefte Gestalten konzentriert. Einer von ihnen ist ein Prinz mit hellblondem Haar und finsterer Miene. Gerade lässt er seine Klinge nach vorn schnellen.
Seine Gegnerin ist eine junge Frau – kaum mehr als ein Mädchen – in einem fellgesäumten Mantel. Ein leuchtend goldener Streifen zieht sich über eine ihrer Wangen und ihr Haar, halb schwarz, halb golden, ist zu einem komplizierten Muster aus Zöpfen geflochten, das an das gesträubte Nackenfell eines angriffslustigen Wolfs erinnert. Sie weicht dem Schwerthieb ihres Kontrahenten mit Leichtigkeit aus, grinst ihn kurz an und lässt dann ihr Schwert gegen seines krachen. Die Klinge schimmert im Licht.
Michel tritt näher zu Raffaele. »Sie ist jetzt die Königin«, murmelt er ihm zu. »Ihre Mutter ist vor einigen Wochen gestorben. Ich habe sie aus Versehen mit ›Prinzessin‹ angesprochen – mach bloß nicht denselben Fehler.«
Raffaele nickt. »Danke für die Warnung.« Ihre Majestät, die Königin von Beldain. Mit gerunzelter Stirn beobachtet er sie beim Duell. Sie ist von einer Aura umgeben, jener ungewöhnlichen Energie, die auf eine Begabte hindeutet. Niemand hat je so etwas über die Prinzessin von Beldain erwähnt – doch die Zeichen, in Form glitzernder Stränge, die sie umschwirren, sind unmissverständlich. Ob sie selbst davon weiß? Warum hätte sie es geheim halten sollen?
Raffaeles Blick fällt auf einen der Prinzen, die den Kampf verfolgen. Den jüngsten, dessen Gesicht unter einer Fechtmaske verborgen ist. Sein Stirnrunzeln wird noch tiefer. Auch dieser Junge ist von flackernden Energiesträngen umgeben. Aber es sind nicht die eines Begabten, keine Fäden der Stärke, aus der Welt der Lebenden. Raffaele blinzelt verwirrt. Als er sich bemüht, nach dieser seltsamen Kraft zu greifen, prallt seine eigene Energie zurück, als hätte sie sich an etwas verbrannt.