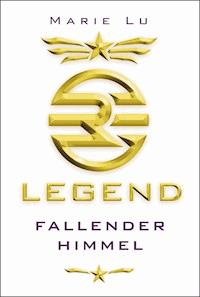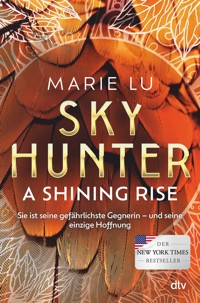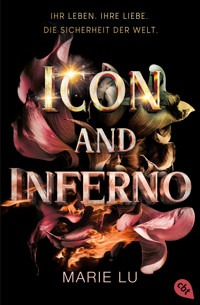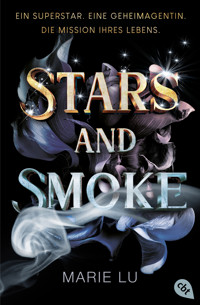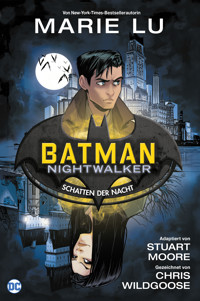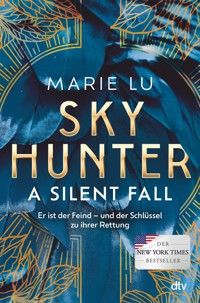
16,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Skyhunter-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Welt am Rande des Abgrunds. Eine junge Kriegerin, die bereit ist, alles zu riskieren. Und ein Gefangener mit einem tödlichen Geheimnis … Talin gehört zu den legendären Elitekriegern von Mara und verteidigt ihre Heimat gegen die Karensa-Föderation. Doch der Kampf gegen den übermächtigen Gegner scheint aussichtslos. Als Red, ein mysteriöser Kriegsgefangener, hingerichtet werden soll, spürt Talin, dass er mehr ist als nur ein Kämpfer der Föderation. Sie erwirkt seine Freilassung und rettet ihm so das Leben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn wenn Talin Reds Vertrauen gewinnen kann, könnte er der Schlüssel zu ihrer aller Rettung sein – oder ihr Untergang ... Der fesselnde Auftakt der Skyhunter-Dilogie mit einem faszinierenden Worldbuilding, atemberaubender Action und einer berührenden Slow-Burn-Romance. »Dieses Buch ist fantastisch. Talin ist eine herrlich authentische Heldin und Marie Lus Schreibstil ist mal schlicht und schnell, mal opulent und immer wunderschön.« Sabaa Tahir Alle Bände der Skyhunter-Reihe: Band 1: Skyhunter – A Silent Fall Band 2: Skyhunter – A Shining Rise Die Bände sind nicht unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Eine Welt am Rande des Abgrunds.
Eine junge Kriegerin, die bereit ist, alles zu riskieren.
Und ein Gefangener mit einem tödlichen Geheimnis …
Talin gehört zu den legendären Elitekriegern von Mara und verteidigt ihre Heimat gegen die Karensa-Föderation. Doch der Kampf gegen den übermächtigen Gegner scheint aussichtslos. Als Red, ein karensischer Soldat, festgenommen wird, rettet Talin ihm das Leben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn wenn Talin Reds Vertrauen gewinnen kann, könnte er der Schlüssel zu ihrer aller Rettung sein – oder ihr Untergang ...
Von Marie Lu ist bei dtv außerdem lieferbar:
Batman – Nightwalker
Marie Lu
Skyhunter
A Silent Fall
Band 1
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Petra Koob-Pawis
Für meine Mom, Survivor und Superwoman, die mich zu Talins Mutter inspirierte und zu allem andern auch
GEISTER SIND IN RUDELN UNTERWEGS.
Das ist die erste Lektion, die man lernt, wenn man ein Striker wird.
Geister waren einst menschlich, bevor die Karensa-Föderation sie festschnallte, ihnen dunkles Gift in die Kehle schüttete und sie in monströse Kriegsbestien verwandelte.
Jetzt sieht man sie in Gruppen von sechs oder mehr in den Wäldern an den Ausläufern der Berge jagen, ein grotesker Kontrast zur ruhigen, schneebedeckten Landschaft.
Ihre Gesichter sind weiß wie Asche, und ihre Haut hat tiefe Risse, durch die ihr scharlachrotes, ranziges Fleisch zu sehen ist. Sie sind größer und stärker als jeder Mensch, ihre Gliedmaßen sind deformiert und dürr wie Spinnenbeine. Geister riechen nach Blut und Erde.
Ihre Sehkraft ist zwar dürftig, aber das hindert sie nicht daran, Bewegungen zu erkennen. Ihr Gehör ist hervorragend, ihre Ohren sind lang und spitz. Sie können menschliche Stimmen aus einer Meile Entfernung wahrnehmen. In ihrem Territorium darf man nicht sprechen, wenn man nicht Gefahr laufen will, entdeckt zu werden, also bleiben wir still, unsichtbar für Auge und Ohr.
Auch ihre Zähne sind länger und schärfer als unsere, und sie wachsen unangenehm schnell, weshalb Geister ständig damit mahlen, was zu immer neuen Rissen in den ohnehin schon völlig zerfetzten und verrottenden Mäulern führt.
Daran erkennt man, dass sie kommen. An dem knirschenden Geräusch.
Aber vor allem eines muss man sich merken: Will man einen Geist töten, muss man seinen sich ständig regenerierenden Körper aushungern. Und um das zu tun, muss man ihm den Hals aufschlitzen, die einzige verwundbare Ader, und ihn ausbluten lassen.
Dafür habe ich mein ganzes Leben lang trainiert. Mein Name ist Talin. Ich bin eine Strikerin für Mara, die letzte unabhängige Nation auf dieser Seite des Meeres. Wir sind legendäre Todbringer, Meuchelmörder von Monstern.
Und die Einzigen, die zwischen unserer Heimat und der völligen Vernichtung stehen.
DIE KRIEGSFRONT
Die Nation von Mara
1
DIE MORGENDÄMMERUNG BRINGT Sonne und Regen. Nieseltropfen tanzen in den ersten Sonnenstrahlen und benetzen alles mit einem zarten, feuchten Schimmer.
Ein Sturm zieht auf, also ist bei unserem Rundgang Eile geboten.
Als ich mich auf den Weg zu den Haupttoren unserer Verteidigungsanlage mache, lässt kühler Wind meinen Mantel hinter mir flattern. Wir befinden uns an der Kriegsfront, fünfzig Meilen von den stählernen Mauern von Newage, der Hauptstadt von Mara, entfernt, dort, wo die südlichen Gebirgszüge in dichte Wälder und Täler übergehen.
Die anderen Seiten von Mara sind durch steile Klippen geschützt, die sich tausend Fuß über das Meer erheben – natürliche Formationen, die angeblich vor Hunderten von Jahren durch ein verheerendes Erdbeben entstanden sind. Aber hier im Süden ist Mara anfällig für Angriffe der Karensa-Föderation, deren riesiges Territorium sich mittlerweile bis jenseits des Passes erstreckt. Die Föderation schickt Geister in das Zwischenland, um eine Schwachstelle an unserer Grenze aufzuspüren. Deshalb machen wir jeden Morgen einen lautlosen Patrouillengang und töten alle Geister, die wir dort antreffen.
Inzwischen ist ein Monat vergangen, seit die Föderation einen Großangriff gestartet hat, den wir nur knapp mit einem vorübergehenden Waffenstillstand überstanden haben. Aber ein Kompromiss ist schwierig, wenn der Gegner unsere Nation und unser Land als Beute will. Die nächste Belagerung könnte schon heute drohen. Oder morgen. Vielleicht auch erst in einem Monat. Niemand weiß das.
Wenn man auf verlorenem Posten kämpft, sind die Nerven immer bis aufs Äußerste gespannt.
Das Morgenlicht hat den Himmel bereits rosa gefärbt, als ich bei unseren Verteidigungsanlagen ankomme. Im Vorbeigehen sehe ich die Metallarbeiter, die geschäftig hin und her eilen, während der Wind die Seidenkrempen ihrer Kappen erzittern lässt.
»Das ist doch die Kleine aus Basea«, sagt einer von ihnen mit einem spöttischen Grinsen.
Ein anderer stiert mich mit hochgezogener Augenbraue an. »Noch am Leben, was, kleine Ratte? Tja, wenn du vor Dienstag stirbst, gewinne ich trotzdem meine Wette.«
Worte wie diese haben sich schon viel zu oft in meine Brust gebohrt, bis mir das Atmen wehtat. Meist senkte ich dann nur beschämt den Kopf und huschte davon. Aber meine Mutter ermahnte mich stets, das Kinn zu heben. Zeig ihnen deinen Stolz, bis du ihn tatsächlich spürst, sagte sie zu mir, während sie mir die Wange tätschelte.
Also blinzle ich kurz, erwidere den Blick des Mannes und lächle insgeheim.
Der Metallarbeiter schaut weg, verärgert, dass sein Widerhaken sein Ziel verfehlt hat. Wortlos straffe ich die Schultern und gehe weiter.
Seit der Nacht, in der meine Mutter und ich an die Grenze von Mara geflohen sind und eine Giftgasgranate der Föderation die Klappen meiner Stimmbänder dauerhaft beschädigte, habe ich nicht mehr gesprochen. Damals war ich acht Jahre alt. Meine Erinnerungen an diese Nacht sind widersprüchlich – manche sind klar wie Kristall, andere kaum mehr als verschwommene Bilder von Soldaten und dem Schein der Flammen, die sich durch Häuser fressen. Ich kann mich nicht erinnern, was mit meinem Vater passiert ist. Ich weiß nicht, wo unsere Nachbarn hingegangen sind.
Mein Verstand hat wohl die meisten dieser Erinnerungen tief in mir begraben, sie in einen Schleier gehüllt, um mich zu schützen. Die Ereignisse jener Nacht haben die Haare meiner Mutter schneeweiß werden lassen. Und ich habe damals meine Stimme verloren. Seither ist die Innenseite meiner Kehle voller Narben. Bis heute bin ich nicht sicher, ob ich ihretwegen nicht sprechen kann oder wegen des Traumas unserer Flucht, wegen dem, was die Föderation unserem Volk angetan hat. Vielleicht liegt es an beidem. Eines aber ist gewiss: Wenn ich den Mund aufmache, kommt nur Schweigen heraus.
Inzwischen weiß ich diese Stille zu nutzen. Bei dem, was ich tue, ist sie sogar überlebenswichtig.
Von Anfang an hat mich genau dies an den Strikern fasziniert. Als ich klein war, mischte ich mich unter die Menge, um zu sehen, wie die berühmte Patrouille an den Mauern von Newage vorbeizog, bereit, sich den Monstern der Föderation entgegenzustellen. Sie sind die Elitetruppe des Landes, von allen verehrt und bei anderen Nationen geradezu berüchtigt. Meine Augen leuchteten beim Anblick der kunstvollen, eng um Schultern und Brust anliegenden Rüstungen, bei all den Pistolen und Messern und schwarzmetallenen Armpanzern, den Masken, die ihre Münder bedeckten, und den kreisförmigen Emblemen, die auf ihre bis zu den Stiefeln hinabreichenden saphirblauen Mäntel aus Seeseide gestickt waren.
Ich liebte ihr Schweigen. Es gefiel mir, dass Stille für sie Überleben bedeutete. Sie bewegten sich wie Schatten, ohne jedes Geräusch außer den gedämpften Schritten ihrer Stiefel. Ich konnte mich gar nicht daran sattsehen, balancierte auf dem Ast eines Baums, gebannt von ihrer tödlichen Anmut, und schaute ihnen nach, bis sie aus dem Blickfeld verschwunden waren.
Jetzt bin ich eine von ihnen.
Wenn man selbst diejenige ist, die dem Tod entgegenreitet, ist es weniger glamourös. Trotzdem ist es eine Arbeit, die es mir ermöglicht, meiner Mutter etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf zu geben.
Inzwischen haben sich die anderen Striker am Tor versammelt, bereit für unseren Rundgang. Corian Wen Barra, mein Schild, ist ebenfalls unter ihnen; er hat mir den Rücken zugewandt. In seinem hochgesteckten Haarknoten glänzen Tautropfen, und eine Brise versetzt seinen Mantelsaum in Bewegung.
Ich habe ihn heute Morgen aus seinem Zimmer kommen hören, als ich noch unter meinen Fellen lag. Er bewegt sich so flink, dass niemand sonst das leise Schließen seiner Tür bemerkt hätte.
Wie immer beruhigt sein Anblick meine Nerven. Hier bin ich sicher. Ich tippe ihm auf die Schulter, dann runzle ich scheinbar entrüstet die Stirn und gebärde: »Du bist ohne mich gegangen.«
Corian sieht mich von der Seite an. Er fasst sich ans Herz, als hätte ich ihn verletzt. »Was – ich soll die kleine Talin sich selbst überlassen haben? Das würde ich nie tun!«, gibt er mit spielerisch neckenden Handbewegungen zurück.
»Aber?«, frage ich stumm zurück.
»Aber sie haben heute Morgen frische Fischfrikadellen serviert.«
»Hast du mir wenigstens eine aufgehoben?«
»Habe ich, aber dann musste ich sie doch essen, weil du so lange gebraucht hast.«
Ich verdrehe die Augen. Er lacht amüsiert, dann greift er in seine Gürteltasche und wirft mir eine Frikadelle zu. Sie ist in ein Tuch eingeschlagen und noch heiß. Geschickt fange ich sie mit einer Hand auf, und prompt knurrt mein Magen.
Corian lacht erneut. »Na, du bist heute Morgen ja flink wie ein Reh.«
Achselzuckend beiße ich in die zarte Fischfrikadelle. Würziger Saft ergießt sich in meinen Mund, zusammen mit den körnigen Elritzen-Eiern in der Mitte.
Als ich fertig bin, stoße ich einen übertriebenen Seufzer aus und grinse. »Flink und hungrig«, gebärde ich.
»Wie wär’s mit: Danke, dass du für mein Frühstück gesorgt hast?«, schlägt er vor.
»Du bist mir immer eine willkommene Gesellschaft, Corian.«
Alle Striker arbeiten in Paaren. Von dem Moment an, in dem wir unseren Eid ablegen, sind wir bis zum Tod aneinander gebunden. Mit zwölf haben Corian und ich angefangen, zusammen zu trainieren, haben Seite an Seite gekämpft, konnten seitdem die Gedanken des jeweils anderen erraten. Ich bin mehr eine Schwester für ihn, als seine Blutsschwestern es je sein könnten. Wenn ich mich bewege, hält er mir den Rücken frei. Wenn ich führe, folgt er mir. Im Gegenzug tue ich das Gleiche für ihn. Unsere Leben sind miteinander verwoben, untrennbar für alle Zeit.
Er ist mein Kampfpartner, mein Schild, wie wir es nennen. Und ich bin seiner.
Doch wir sind ein seltsames Duo. Schon immer waren Corian und ich Gegensätze in jeglicher Hinsicht. Er ist ein Wen – der drittgeborene Sohn – und entstammt der Familie Barra, einer der reichsten in Newage. Seine Erscheinung ist durch und durch golden. Wenn er lacht, tut er das mit seinem ganzen Körper, der einem sich ständig verändernden Mosaik aus kräftigen Linien gleicht. Er hat die Art von Aura, zu der man sich unweigerlich hingezogen fühlt. An Festtagen wird er von unzähligen Leuten umringt, und alle wollen mit ihm gesehen werden.
Mein voller Name ist Talin Kanami. Ich bin ein Flüchtlingsmädchen aus Basea, einer Nation südlich von Mara, die vor zehn Jahren an die Föderation gefallen ist. Meine Haut ist hellbraun, meine Augen sind grün und schmal und haben lange Wimpern, mein Haar ist so schwarz, dass es blau schimmert wie ein Ölfleck im Licht.
Ich bin stolz auf meine baseanischen Züge, aber viele in Mara bezeichnen Geflüchtete wie mich als Ratten. Der Maranische Senat hat uns verboten, in den Patrouillen zu dienen. Ich bin nur hier, weil Corian das Erste Schwert bat, für mich eine Ausnahme zu machen.
Nachdem ich gegessen habe, prüfen Corian und ich routinemäßig unsere Waffen und stellen sicher, dass unsere Schwerter poliert und die Patronenlager bestückt sind.
»Dolche«, ruft er.
Ich fahre mit den Fingern über die Griffe meiner Dolche und ziehe einmal fest an meinen Schultergurten. Jeder von uns trägt ein Dutzend Dolche bei sich: sechs in einem Bandelier über die Brust geschnallt, zwei an den Rüstungsgurten um jeden Oberschenkel und einen an jedem Stiefel.
»In Ordnung«, gebe ich ihm ein Zeichen. »Schwerter.«
Wir fassen unsere beiden an den Hüften hängenden Schwerter, ziehen sie im Gleichklang heraus und stecken sie schwungvoll wieder zurück in die Halterung. Wie die Dolche sind auch sie aus einem nahezu unzerstörbaren Metall gefertigt, das fast alles durchtrennen kann.
Mit einem Nicken deute ich auf sein linkes Schwert. »Könnte einen zusätzlichen Schliff vertragen, Corian«, gebärde ich. »Die Klinge sieht ein wenig stumpf aus.«
»Um eine Kehle durchzuschneiden, reicht es allemal«, erwidert er. »Ich werde sie heute Abend schärfen.«
»Pistolen«, fahre ich fort.
Wir alle haben zwei mit Dämpfern ausgestattete Scharfschützenpistolen. Ein um meine Hüfte geschlungenes Stoffbandelier ist voll mit Munition. Corian wirft mir ein paar zusätzliche Patronen aus seinem Vorrat zu. Ich fange sie auf und stecke sie in die dafür vorgesehenen Schlaufen.
»Bogen«, sagt er abschließend. »Pfeile.«
Wir tragen eine Armbrust auf dem Rücken, dazu einen leichten Köcher mit Pfeilen, die mit einer Stoffhülle gepolstert sind, damit die Pfeile nicht klappern.
Zuletzt überprüfen wir unsere Armschützer und Handschuhe, dann die schwarzen Halbmasken, die unsere untere Gesichtshälfte bedecken und jeden lauten Atemzug, jedes raspelnde Husten dämpfen.
Als wir fertig sind, schreitet Aramin Wen Calla, das Erste Schwert, unsere Reihen für eine letzte Kontrolle ab. Unser Anführer ist jung; manche sind der Meinung, er sei zu jung für diese Position. Es ist noch nicht lange her, da hat er als Rekrut zusammen mit uns trainiert. Aber selbst ein paar kurze Jahre als Erstes Schwert haben für vorzeitige Silbersträhnen in Aramins dichtem, hohem Haarknoten gesorgt. Seine Augen sind hart und sturmgrau wie ein Gewitter, umrandet mit dunklem Puder, was ihm einen grimmigen Blick verleiht. Seine zusammengekniffenen Lippen tragen zusätzlich zu seiner stets finsteren Miene bei. Mehrere schwarze Kieferknochensplitter reihen sich wie Ringe an seinen Ohren. Der Tradition der Striker folgend, hat er diese Knochenteile aus den Geistern herausgeschnitten, die seine Schilde im Lauf der Jahre getötet haben.
Es ist schwer, in diesem Beruf alt zu werden. Befördert wird jeder, der sich eignet.
Er schreitet unsere Reihe ab, bleibt gelegentlich vor den neueren Rekruten stehen, um einen Gurt zu prüfen, ein Kinn anzuheben, ein paar mutmachende Worte zu sprechen.
»Talin«, sagt er, als er mich erreicht.
Grüßend schlage ich die Faust an meine Brust. Er grüßt in gleicher Weise, bevor er weitergeht.
Zum Abschluss stellt er sich ein letztes Mal vor uns hin. Es gibt keine glorreiche Rede, keine mitreißenden Schlachtrufe.
Niemand muss uns sagen, dass wir Maras letzte Bastion gegen die Föderation sind.
Über die Reihen der Striker legt sich Schweigen. Gleichzeitig ziehen wir unsere Masken hoch, bedecken die untere Gesichtshälfte mit schwarzem Tuch. Corian blickt geradeaus, seine Züge sind vor Konzentration beinahe ausdruckslos.
Mein Herz verhärtet sich. Mein Verstand verdrängt alles außer einem einzigen Ziel: mein Land zu beschützen.
Das Erste Schwert gibt den Befehl, und wir schreiten als Einheit hinaus in die stille Welt.
Wäre da nicht die Föderation auf der anderen Seite dieser gebirgigen Frontlinie und wären da nicht die Geister, die sich an den schmalen Pässen entlangpirschen – das Land wäre geradezu schmerzhaft schön. Die Luft ist kalt und frisch, die eine Hälfte des Himmels ist klar, die andere dunkelgrau. Der Mond hängt puderweiß über der Baumgrenze, seine Krater leuchten wie helle Sprenkel. Eine Wolke von Vögeln kreuzt die Nebelschwaden, die den Talkessel durchziehen. Das Wasser eines nahe gelegenen Bachs schimmert hellblau von den winzigen Elritzen, aus denen auch das heutige Frühstück bestand, allerdings wimmeln jetzt nur noch Tausende, wo einst Millionen waren. Weiter unten in der Ebene erblicke ich eine Herde seltener Zottelkühe, die im Nebel grasen. Selbst jetzt, vor dem Wintereinbruch, sind sie auf der Suche nach den süßen gelben Wildblumen, die die Ausläufer der Berge bedecken und wie Edelsteine im Schnee schimmern.
Aber was diese Landschaft wirklich atemberaubend macht, sind die Ruinen einer alten, längst vergangenen Zivilisation. Die Strukturen, die in den Hoheitsgebieten aller Nationen zu finden sind, erscheinen seltsam und schön zugleich – Gerippe purpurroter Stahlbrücken, die mehrere Hundert Fuß in die Luft ragen, neben bröckelnden weißen und dunklen Säulen, errichtet aus gigantischen, unglaublich perfekt geschnittenen Quadern. Stahl und Stein sind längst von einer üppig grünen Vegetation überwuchert.
Niemand weiß genau, wann diese Zivilisation hier gelebt hat, aber manche behaupten, sie sei bereits vor fünftausend Jahren entstanden. Wie auch immer dieses Erste Volk gewesen war, es war viel weiter fortentwickelt als wir. Unsere Vorgänger hinterließen ganze Städte. Maschinen mit Flügeln. Schiffe aus Metall. Platten aus bearbeitetem Gestein. Manche vermuten, dass einige unserer heutigen Spezies – so zum Beispiel die Wildrinder, die durch die Ebenen streifen – ursprünglich auf domestizierte Tiere zurückgehen. Aus den umgestürzten Stahlskelettkonstruktionen haben wir Teile abgebaut und sie zur Befestigung unserer Hallen, Türme und Brücken verwendet. Wir schufen Gewehre, Kugeln und Klingen aus den alten Waffen.
Die Föderation lernte aus ihren Büchern, wie man Menschen in Geister verwandelt.
Ich frage mich, wo das Erste Volk hin ist. Einer Theorie zufolge ist es ausgestorben, von einer Krankheit dahingerafft, und wir alle stammen von den wenigen Überlebenden ab. Eine andere Erklärung geht davon aus, dass unsere Ahnen die Erde verlassen haben, um anderswo zwischen den Sternen zu leben, und wir ihre zurückgebliebenen, in alle Welt versprengten Nachkommen sind. Vielleicht hatten auch sie mit Dämonen zu kämpfen und haben sich gegenseitig mit ihrem Hass zerstört. Ich frage mich, ob sie es gutheißen würden, wie wir die Überreste ihrer Zivilisation geplündert haben.
Inzwischen hat sich unser Trupp verteilt, und wir bahnen uns einen Weg durch das Grasland in Richtung der Wälder am Cornerwell Pass. Gelegentlich halten wir an, um zu lauschen, fragen uns, ob der Wind, der in den Kiefern flüstert, auch das Geräusch von knirschenden Zähnen mit sich führt.
Aber heute bleibt es still.
Wir erreichen den Waldrand, der in gedämpftes Licht getaucht ist. Durch das dichte Blätterdach blitzen hin und wieder Sonnenstrahlen und werfen helle Lichtpunkte auf den Boden. Umgestürzte Baumstämme türmen sich zu übereinanderliegenden grünen Schichten aus Moos und Farn. Der Geruch von kühler, feuchter Erde umgibt uns, und von irgendwo in der Ferne kommt das leise Rauschen eines Bachs.
Nach und nach nehme ich immer mehr Geräusche wahr. Wassertropfen, die auf ein Blatt fallen. Das Plumpsen eines Frosches, der über den weichen Waldboden springt. Corian bewegt sich einige Yards entfernt voran, aber unsere Körper drehen sich immer synchron, in einem durch jahrelanges Training verinnerlichten Rhythmus.
Da bemerke ich einen gebrochenen Zweig. Ich halte inne und beuge mich vor, um ihn näher in Augenschein zu nehmen.
Corian spürt die Veränderung in meiner Bewegung, ohne mich überhaupt anzusehen. In Windeseile ist er an meiner Seite. Wärme geht von ihm aus, sein Blick ist ebenfalls auf den Zweig gerichtet.
Ich gebe ihm mit meinen behandschuhten Händen ein Zeichen. »Siehst du den Abbruchwinkel?«
Corian antwortet ebenfalls in Gebärdensprache. »Die Kante verläuft nach unten. Nicht seitlich. Der Zweig wurde von etwas gebrochen, das größer ist als dieser Ast.« Er deutet in den Wald. »Es kam aus dieser Richtung.«
»Ein Hirsch?«
»Dann wären noch mehr Äste abgebrochen.«
»Ein Kundschafter vielleicht? Ein Spion?«
»Könnte sein«, antwortet er. »Ich habe gehört, dass die Südpatrouille heute Morgen einen Kriegsgefangenen bei seiner Flucht durchs Tal erwischt hat. Es könnte noch weitere wie ihn geben.«
Ein nasser Schimmer auf dem Waldboden fällt mir ins Auge. Ich gehe in die Hocke. »Blut«, stelle ich fest, während ich den einzelnen, frischen karmesinroten Fleck betrachte, dessen Farbe deutlich dunkler ist als das Blut eines Menschen.
Corian nickt zustimmend, seine Lippen sind nur noch ein schmaler Strich. Es ist weder ein Hirsch noch ein Kundschafter. Wir haben Hunderte von Geistern aufgespürt, mittlerweile reicht uns schon der kleinste Hinweis, um zu wissen, dass sie in der Nähe sind.
Ich zeige kurz hinauf zu den Bäumen. »Bezieh du da oben Posten. Ich warte auf dein Zeichen.«
Gleichzeitig legen wir die Faust an die Brust, dann geht er zu einem großen Baum. Mit zwei Schwüngen hangelt er sich in eine Astgabelung hinauf und lässt sich, von unten fast unsichtbar, im dunklen Geäst nieder.
Ich bewege mich auf dichtes Unterholz mit einer Reihe moosbewachsener Baumstämme zu. Im Training musste ich auf dem Boden entlangkriechen, über gestapelte Münzen hinweg, ohne die Hindernisse mit den Stiefeln umzustoßen. Jetzt gleite ich lautlos zwischen den Stämmen hindurch und lege mich in einer hohlen Baumspalte auf die Lauer.
Lange Minuten vergehen.
Das Trillern eines Vogels schreckt mich auf. Der Ruf kommt von Corian. Ich spähe zu ihm hoch. Er kauert immer noch im Schatten der Baumnische, gibt mir wieder ein Zeichen und deutet mit drei Fingern nach rechts. Dann drei Finger in meine Richtung.
»Drei Geister östlich von dir. Drei Geister nördlich. Entfernung etwa hundert Fuß.«
Sie sind hier.
Meine Hände ruhen auf den Griffen meiner Schwerter. Sie sind immer meine erste Wahl, denn sie sind am lautlosesten, haben die Reichweite, die ich brauche, aber vor allem kann ich mich mit ihnen schnell bewegen. Auf seinem Posten im Geäst zieht Corian eine Pistole aus dem Holster und legt den Finger an den Abzug.
Stille, dann erneut ein Kurzzeichen von Corian: »Warnung. Ganz nah.«
Durch die Ruhe des Waldes dringen leise Geräusche. Das Knacken von Zweigen an verrottenden Füßen. Das Schmatzen von aufgeweichten Blättern.
Dann, endlich, höre ich es.
Das Knirschen von blutbefleckten Reißzähnen.
Rechts von mir tauchen die ersten drei auf. Sie bewegen sich ruckartig auf allen vieren, ihre ausgestreckten Arme sind länger als die Beine. Eine Eisenmanschette schützt die verwundbare Halsschlagader. Der, der mir am nächsten ist, richtet seine milchigen Augen nach oben und sucht die Baumkronen ab, bevor er weiterstapft. Frisches Blut tropft von seinem menschenähnlichen Kinn.
Ich habe unzählige Stunden an der Kriegsfront verbracht, doch bis zum heutigen Tag lassen diese vierbeinigen Jäger mir immer noch die Nackenhaare zu Berge stehen.
Während hinter ihnen bereits die zweite Dreiergruppe in Sicht kommt, stellen sie sich auf zwei Beine, um zwischen den Bäumen hindurchzuspähen.
Ich konzentriere mich auf den Anführer der Gruppe. Er ist größer als die anderen, und seine eingerissenen Muskeln treten deutlicher hervor. Wie die Alligatoren in den südlichen Ländern werden die Geister immer größer und stärker, bis jemand sie tötet. Wenn das nicht geschieht, können sie ewig leben. Einige, so habe ich gehört, überragen irgendwann sogar Elefanten.
Wenn dieser hier sich zu seiner vollen Größe aufrichtet, sieht er wie eine riesige Bestie aus, deren Haut rissig ist und blutet.
Oben in den Bäumen duckt Corian sich wie ein Raubtier vor dem Angriff und hebt seine Pistole. Ich spanne mich an, wünsche mir mit aller Kraft, dass ihm nichts passiert. Meine Hände schließen sich um die beiden Schwertgriffe. Die lastende Stille des Waldes reizt meine Sinne, und meine Muskeln sind bis zum Zerreißen gespannt.
Man hat genau eine Chance für den Angriff. Danach ist weder Zeit für ein Zögern noch die Gelegenheit, sich auszuruhen oder neu zu formieren oder es sich anders zu überlegen. Alles – wirklich alles – hängt von der Geschwindigkeit ab. Entweder du schaltest die Geister schnell aus, oder sie schalten dich aus.
Corian zielt mit seiner Waffe auf den Anführer.
Und schießt.
Die Kugel trifft mit voller Wucht die Nackenmanschette, und das Eisen bricht. Der Anführer stößt einen ohrenbetäubenden Schrei aus und dreht sich mit einer Schnelligkeit nach Corian um, die angesichts seiner Größe verblüfft. Zornig wirft er sich gegen den Baum und schlägt mit den Krallen nach Corian.
Sofort wenden auch die anderen sich in diese Richtung.
Ich springe aus meinem Versteck hervor und ziehe gleichzeitig meine Klingen. Das vertraute Geräusch von Metall, das aus der Scheide gleitet, dröhnt unnatürlich laut in meinen Ohren. Meine Schwerter fangen das Licht ein. Ich renne an einem umgefallenen Baumstamm vorbei. Der Geist, auf den ich als Erstes treffe, sieht mich nicht einmal kommen, bevor ich mit einem weiten Satz aushole und mein Schwert gegen seinen Hals schwinge.
Es schneidet sauber in die Manschette und spaltet sie. Meine zweite Klinge durchtrennt seine Halsader. Er sackt zu Boden und zuckt heftig, während das Blut den grünen Waldboden purpurrot färbt.
Ich halte keine Sekunde inne. Die Geister sind jetzt in einem Wutrausch, ihre Bewegungen wie das Schnellen einer Kreuzotter.
Einer stürzt sich auf mich. Ich gleite auf die Knie und beuge mich so weit zurück, dass mein Kopf fast über den Boden schrammt. Seine Krallen verfehlen mich. Ich springe wieder auf und bringe ihm eine tödliche Halswunde bei, wirble in einer einzigen schnellen Bewegung herum, schneide durch die Manschette des Geists direkt neben ihm und ramme ihm meine zweite Klinge in die Kehle.
Von seinem Wachposten aus feuert Corian eine zweite Kugel auf den Anführer ab und trifft ihn erneut am Hals. Der Geist duckt sich weg, versucht dann jedoch, Corian vom Baum zu holen. Mein Herz macht einen Satz. Auf der anderen Seite des Stamms gräbt ein weiterer Geist seine Klauen in die Rinde und versucht vergeblich, hinaufzukommen.
Ich ziehe meine Waffe und feuere auf ihn. Die Kugel trifft ihr Ziel, der Geist schreit auf und stoppt vorübergehend seinen Angriff.
Corian richtet seine Waffe auf den verwundeten Geist und schießt dreimal. Die Kugeln zerschmettern die Halsmanschette. Corian feuert einen vierten Schuss auf die freiliegende Ader, und der Geist geht in die Knie.
Mit einem Schrei stürzt sich der fünfte auf mich. Mein Stiefel verfängt sich an einem Ast auf dem Waldboden. Es kostet mich nur den Bruchteil einer Sekunde – aber in diesem Moment schafft es der Geist, mein Bein zu packen. Er reißt mich von den Füßen, und ich falle der Länge nach ins Unterholz.
Als ich mich wieder aufrapple, stürzt er sich erneut auf mich. Ich will gerade meine Klinge heben, als sich plötzlich ein Pfeil von unten in seinen Kiefer bohrt und ihn daran hindert, sein Maul zu öffnen. Der Geist stößt ein wütendes Knurren aus. Hinter ihm nickt mir Corian vom Baum aus zu. Mit beiden Schwertern schlage ich auf die Manschette ein. Ein, zwei, drei Hiebe, und das Metall zerspringt. Ich ziehe einen Dolch und stoße ihn in die verwundbare Ader.
Jetzt ist nur noch der Anführer übrig. Von Pfeilen durchbohrt, stürmt er auf mich zu. Ich ziehe einen weiteren Dolch, umklammere mein Schwert und wappne mich gegen seinen Angriff. Hinter ihm lässt Corian sich zu Boden fallen. Wie aus dem Nichts hält er plötzlich seine Schwerter in den Händen.
Er rennt auf den Geist zu, weicht jedoch in letzter Sekunde zur Seite aus. Ich vollführe eine Drehung, um ihm zu folgen. Als ich Corian erreiche, geht er in die Hocke, und ich springe, stoße mich mit den Stiefeln an seiner Schulter ab und schnelle in die Luft.
Mit einem festen Stoß trenne ich die Manschette auf. Sie fällt auf den Waldboden. Ohne eine Sekunde zu verlieren, drückt sich Corian aus der Hocke hoch und schneidet dem Geist die Kehle durch.
Ein Schauer durchfährt das Monster. Während ich bereits leichtfüßig neben Corian lande, lässt der Geist sich auf alle viere fallen und kippt dann zur Seite.
Corian blickt auf die Leichen um uns herum. Meine Haare sind vom Kampf wirr und zerzaust, dunkle Strähnen kleben an meiner feuchten Stirn. Den Körper schützend Corian zugewandt, spüre ich wie immer das angespannte Kribbeln, wenn alle Sinne noch auf Kampf eingestellt sind.
Ich streiche mein Haar zurück und gebe Corian ein Zeichen. »Geht es dir gut?«
Er nickt. Wir tauschen ein kurzes Lächeln aus. Dann wendet er seinen Blick ab und untersucht nacheinander die leblosen Körper, um sicherzustellen, dass die Adern sauber durchtrennt sind. Ich tue dasselbe, halte jedoch kurz inne, als er vor dem sterbenden Anführer stehen bleibt.
Corian hat mir einmal gesagt, dass die Geister ihn am meisten an Menschen erinnern, wenn sie dem Tode nahe sind. Ihre Bewegungen werden langsamer, ihr ausgestoßener Atem kräuselt sich in der Luft, und ihre Schreie werden zu einem qualvollen Stöhnen, das Mitleid erregt. Mit Blut vermischte rosafarbene Tränen treten in ihre Augen. Angeblich weinen sie, weil ihre verrottenden, ewig wachsenden Körper die ganze Zeit über unerträgliche Schmerzen erleiden. Das Wimmern der Sterbenden ist ein Flehen um Gnade.
Ich warne Corian stets, dass ihr Herz nicht so schlägt wie seines, und er erinnert mich immer wieder daran, dass es aber einmal so gewesen ist: dass sie, bevor die Föderation ihnen Gift verabreichte, lächelten und lachten und verliebt waren, dass echte Herzen in ihrer Brust schlugen.
Obwohl Corian als Henker vor dem Anführer steht, greift er nach unten, um eine der vielen blauen Blumen auf dem Waldboden zu pflücken. Dann kniet er sich in der Mitte der Lichtung hin. Der lange Mantel bauscht sich kreisförmig um ihn, als er die Blume vorsichtig neben den Leblosen legt. Er zieht seine Maske herunter und senkt den Kopf. Mit den Fingern zeichnet er mit einem einzigen Schwung einen Bogen in die Erde. Seine Lippen bewegen sich lautlos. Das macht er immer, und deshalb respektiere ich ihn.
Er sagt damit: Mögest du Ruhe finden.
Zu spät sehe ich den siebten Geist.
Er ist kleiner als die anderen. Vielleicht war er bei seiner Verwandlung noch ein Kind. Geister sind in Rudeln unterwegs – aber dieser hier hatte nicht mithalten können.
Er taucht im Schatten des Waldes hinter dem knienden Corian auf. Seine Augen, milchweiß vor Hass, richten sich auf mein Schild, und seine Kiefer öffnen sich. Dann setzt er zum Sprung an.
Mein Blut wird zu Eis. Ich zücke meine Schwerter und stürme vor.
Doch es ist viel zu spät. Der Geist bohrt seine Zähne in Corians Schulter, bevor dieser sich umdrehen kann. Mit einer einzigen Bewegung schleudert er Corian auf den Rücken und stürzt sich dann auf seine Brust.
Corian hat bereits die Dolche gezückt. Immer wieder sticht er auf den Geist ein und versucht, die Halsader zu treffen, während ich mich auf die Bestie werfe. Das reicht, um deren Aufmerksamkeit von meinem Schild auf mich zu lenken. Entschlossen schneide ich dem Geist die Kehle durch.
Ich gleite an Corians Seite und drücke die Wunde an seiner Schulter ab. Mit einem Knurren stößt er mich weg. Er zittert bereits am ganzen Körper, seine Lippen sind wie von Kälte blau gefärbt. Immer wieder sagt er dieselben Worte zu mir.
»Tu es. Tu es.«
Und ich weiß, es ist vorbei.
Wenn dein Schild von einem Geist gebissen wird, musst du ihm die Kehle durchschneiden, bevor er sich verwandelt. Das ist das Letzte, was man uns lehrt – aus dem einfachen Grund, dass keiner von uns darüber nachdenken will, was es bedeutet. Aber manchmal muss das, was einem am meisten ans Herz geht, als Letztes gelehrt werden, weil es am schwersten wiegt.
Corian sieht mich an. In seinen Augen schimmern ungeweinte Tränen.
Ich packe meine Klinge fester und stelle mich über ihn. Die Welt verschwimmt wie in einem Traum. Unsere Blicke halten einander fest. Einen Moment lang denke ich, ich schaffe es nicht.
Aber mein Körper erinnert sich auch dann an die Bewegungen, wenn mein Geist sich verweigert.
Meine Klinge zischt durch die Luft. Es folgt ein entsetzliches Geräusch, dann ein Seufzen.
Der Wald ist wieder still, und ich bin die Einzige, die es hört.
Ich wende den Blick zum Himmel, weil ich es nicht ertrage, nach unten zu schauen. Regen prasselt gegen das Laubdach des Waldes. Das Licht umrandet die Blätter in eisigem Gold. Es dauert einen Moment, bis ich mein Zittern bemerke.
Wie immer gebe ich keinen Laut von mir. Aber ein Herz kann in der Stille trauern, also sinke ich neben Corian auf die Knie und lasse den Tränen freien Lauf.
NEWAGE – INNERE STADT
Das Volk Der Mara
2
WENN DEIN SCHILD IM KAMPF FÄLLT, ist es deine Pflicht als Striker, seine Uniform an seine Familie zu übergeben.
Dieser symbolische Akt ist das Zeichen unserer Scham und unseres Versagens, weil wir es nicht geschafft haben, uns gegenseitig zu beschützen. Wir vollführen ihn vor den Angehörigen in der Hoffnung, dass sie unsere Entschuldigung annehmen. Am frühen Morgen, eine Woche nach Corians Tod, befinde ich mich daher auf dem Weg ins Herz der Inneren Stadt von Newage. Corians saphirblaue Uniform habe ich zu einem ordentlichen Viereck gefaltet und sorgsam unter meinem Mantel verstaut.
Der Nieselregen während unseres Rundgangs vor einer Woche ist inzwischen zu einem unablässigen Sturm geworden, der das ganze Land in Nässe versinken lässt. Der Regen weht in glitzernden Wellen über den Fußweg vor mir, und ich ziehe schützend den Kragen höher. Die Uniformmütze auf meinem Kopf bietet nur wenig Schutz. Meine Haare hängen mir in schwarzen Strähnen ins Gesicht, aber ich mache mir nicht die Mühe, sie zurückzustreifen – vielleicht, weil ich genauso elend aussehen will, wie ich mich fühle. Corian, ein wahrer Sohn der Sonne, hatte den ersten schweren Regen des Winters immer gehasst. Es ist eine grausame Ironie, seinen Angehörigen an diesem Tag seine Uniform zu übergeben.
Der Wohnsitz der Familie Barra befindet sich auf einer Anhöhe. Von unten kann man ihn nicht einmal sehen – das auf den Überresten eines zerfallenen Tempels des Ersten Volks errichtete Anwesen ist vollständig von Zypressen umgeben, sodass man durch das grüne Dickicht nur einen flüchtigen Blick auf den weißen Stein erhascht.
Von hier oben bietet sich mir der Blick auf das sanft abfallende Stadtgebiet von Newage, auf die Anwesen und Wohnungen und Säulenhallen, die von zwei riesigen kreisförmigen Stahlwänden geschützt werden. Dahinter erstrecken sich meilenweit die Barackensiedlungen der Äußeren Stadt, wo meine Mutter und auch alle anderen Geflüchteten leben. Entlang des Horizonts zeichnen sich die Ruinen des Ersten Volks gegen den stürmischen Himmel ab.
Es gibt zwanzig große Ruinen in Mara, und die meisten anderen über das Land verstreuten, kleinen Städte wurden auf ihrem Grund oder um sie herum errichtet. Sie alle haben einen Namen. Da ist Houndsfang, eine Ruine, die wie eine gezackte Stahlnadel am Rande der Klippen in den Himmel ragt, umgeben von einer kleinen Stadt gleichen Namens. Da ist Morningman, eine Stadt, die um eine von Rosen überwucherte, kegelförmige Struktur aus Metall und Beton erbaut wurde. Und so weiter.
Newage, die Hauptstadt von Mara, wurde direkt auf den Überresten einer großen Stadt des Ersten Volks errichtet. Deshalb sehen unsere Straßen aus, als wären sie aus zwei verschiedenen Epochen zusammengeflickt worden – alte schwarze Stahlstreben sind das Gerüst für Wohnungen aus weißem Stein und Holz, und Zylinder aus einem seltsamen Metall bilden die Stützpfeiler der Nationalhalle. Der Untergrund der Inneren Stadt von Newage besteht aus einem geheimnisvollen dunklen Stein, der sonst nur noch bei den anderen Ruinen des Ersten Volks zu finden ist. Er absorbiert im Winter Hitze und hält die Stadt wärmer, als sie es sonst wäre. Und was die riesigen Stahlmauern angeht, die unsere Stadt umschließen … es gab sie bereits, als Mara noch gar nicht existierte. Über den Haupttoren steht ein vom Ersten Volk eingraviertes Mantra:
WIR SÄEN DIE SAAT DER EWIGEN BESTIMMUNG FÜR UNSERE KINDER, DAMIT SIE VON DIESER ERDE BIS ZU DEN STERNEN HERRSCHEN KÖNNEN.
Ewige Bestimmung. Die Karensa-Föderation ist überzeugt, dass diese Formulierung auf sie gemünzt ist, dass sie diese Kinder sind, dazu bestimmt, die Erben des alten Imperiums zu sein. Ich blicke auf die Stadt und frage mich, warum das Erste Volk das alles zurückgelassen hat. Die Mauern wurden vor Tausenden von Jahren gebaut, um die Stadt vor irgendetwas zu schützen – aber was auch immer es war, die großen Stahlwände haben ihre Aufgabe wohl nicht erfüllt.
Warum nur glauben wir, die Mauern könnten uns vor den Geistern der Föderation schützen? Und genauso sehr frage ich mich, warum ich dachte, meinen Schild vor dem Tod bewahren zu können. Ich weiß nicht einmal, ob ich meine Mutter jetzt noch beschützen kann. Als Mitglied der Striker verdiene ich genug, um ihr alle paar Wochen Geld in die Äußere Stadt zu bringen. Doch wie soll es nun weitergehen, ohne Corian, der für mich eintritt? Wird das Erste Schwert einer Baseanerin wie mir weiterhin erlauben, hierzubleiben?
Als ich am Haupttor des Anwesens ankomme, weiß die Familie Barra längst, warum ich hier bin – sie haben den handgeschriebenen Kondolenzbrief des Ersten Schwerts schon vor Tagen erhalten. Die beiden Wachen am Eingang machen sich nicht einmal die Mühe, nach meinem Namen oder dem Zweck meines Besuchs zu fragen. Ich stehe einfach nur da, schweigend und durchnässt, Corians gefaltete Uniform unter den Arm geklemmt und auf trauermüden Beinen schwankend, bis die Wachen hinter den Seitentüren verschwinden und das Tor für mich öffnen.
Der Sturm bringt nahezu alle Geräusche im großen Hof der Familie Barra zum Verstummen. Die gesamte Nachbarschaft meiner Mutter in der Äußeren Stadt könnte hier Platz finden. Meine Stiefel knirschen leise auf dem nassen Stein, als die Wachen mich zu den hell erleuchteten Fenstern der Eingangshalle führen. Die tropfenden Bäume, meine Atemwolken in der feuchten Luft, das Eingangstor, in das die Worte DEO OPTIMO MAXIMO des Ersten Volks eingemeißelt sind … all das kommt mir so unwirklich vor wie ein Traum.
Ich war bisher nur einmal hier, in jenem Sommer, als Corian mich als seinen Schild wählte. Er und ich hatten uns feierlich die Hände geschüttelt und dann unter dem grünen Blätterdach eben dieser Bäume in unseren kurzärmligen Hemden gefaulenzt, die Münder klebrig von den gepflückten süßen Trauben.
»Wenn du an jeden Ort dieser Welt gehen könntest«, fragte er mich, sein Gesicht dem Horizont zugewandt, »wohin würdest du gehen?«
»Basea«, antwortete ich.
»Wahrscheinlich ist es nicht mehr so wie früher«, erwiderte er behutsam in Gebärdensprache, »nachdem die Föderation die Macht übernommen hat.« Da war weder Bosheit noch Mitleid in seinem Blick, nur eine tiefe Ernsthaftigkeit. »Es ist nicht die Heimat, an die du dich erinnerst.«
»Ich weiß. Ich bin nur neugierig.« Ich sah ihn an. »Warum ist das wichtig für dich?«
»Warum ist was wichtig?«
»Wie ich über Basea denke.«
»Ich weiß es nicht. Sollte es nicht für jeden eine Rolle spielen?« Er steckte sich eine Weintraube in den Mund und bot mir eine ganze Rebe an. »Vielleicht wird es mir eines Tages mit Mara auch so ergehen«, zeigte er an. »Falls wir verlieren.«
Er war mitfühlend, aber auch beunruhigt. Ich hatte noch nie erlebt, dass ein hochgeborener Maraner sich mit jemandem aus Basea auf eine Stufe stellt. Überrascht starrte ich ihn an und nahm die Trauben, die er mir anbot.
»Auf unser Zuhause.« Ich hob die Trauben hoch, wie um ihm zuzuprosten.
»Auf unser Zuhause«, wiederholte er.
Jetzt winden sich die Weinstöcke braun und leblos an den Wänden entlang. Dieser Ort symbolisiert den Anfang und das Ende unserer Verbindung.
Die Wachen bleiben an der Eingangstür stehen und weisen mich an, einzutreten. »Meister Barra erwartet dich bereits«, sagt einer von ihnen.
Ich nicke ihm zu und trete ein.
Ein Schwall warmer, trockener Luft schlägt mir entgegen, der schwache Geruch von Holz, das in einem Marmorkamin brennt, erfüllt den Raum. Meine Stiefelschritte hallen auf dem Boden wider. Als ich nach oben blicke, sehe ich, dass die Haupthalle mindestens drei Stockwerke in die Höhe reicht. Durch die bunten Regenbogenglasfenster der gewölbten Decke scheint das fahle Winterlicht hinein. Architektur des Ersten Volks, die bewahrt werden konnte. Jenseits des Hauptatriums hat die Familie Barra ihre eigenen Verschönerungen vorgenommen – eine zweite Etage mit Balkongalerie, eine Wendeltreppe und ein Hauptgeschoss, das mit weichen, gepolsterten Sitzen und gesprenkelten Kuhfellen ausgestattet ist. Goldverzierte Gravuren entlang des weißen Marmorkamins. Gewölbte, von dünnen schwarzen Metallstäben unterteilte Fenster, die sich vom Boden bis zur Decke erstrecken und durch die das Licht weit hinein auf den weißgrauen Holzboden fällt. Strenge Schönheit, wohin man schaut, geschaffen von einer Familie, deren Wurzeln Jahrhunderte zurückreichen.
Umgeben von hellen Böden und weißen Wänden komme ich mir wie ein Schmutzfleck vor. Meine Mutter und ich haben unsere ersten Jahre in diesem Land überlebt, indem wir in den Barackensiedlungen gelegentlich Botengänge erledigten. Ich überbrachte in meinen Fäusten zerknüllte Nachrichten, schaufelte Pferdemist für die Betreiber der Ställe entlang der Stadtmauer, verkaufte Metall von den Schrottplätzen, die überall in der schlammigen Landschaft zu finden waren. Ich sammelte das spärliche Geld, das ich für meine Mutter auftreiben konnte. Die meiste Zeit kauerte ich am Rand der schmalen Wege, den Gestank von Fett, gebratenem Fisch und Abwasser stets in der Nase. Keiner schenkte mir einen Blick. Es gab zu viele Kinder wie mich, die in den Baracken ums Überleben kämpften. Ich war nur ein weiteres Gesicht, verloren in der Menge.
Jetzt bin ich hier, stehe im Haus einer Familie mit ungeheuerlichem Reichtum, und alles, was ich tun kann, ist, mir vorzustellen, wie ich als Kind war: schmutzig, verängstigt, hilflos. Wie kann es sein, dass Corian aus so einem Haus entstammte? Er muss ausgesehen haben wie eine Sonne, die durch diese Hallen streifte, alles an ihm war golden – Haar, Haut und Lachen inmitten von all dem Weiß. Und sofort ist wieder dieser abgrundtiefe Schmerz da, der an meinen Eingeweiden nagt. Die Welt um mich herum dreht sich, bis ich nichts mehr sehen kann.
Es ist niemand hier. Ich warte einen Moment und frage mich, ob ich vielleicht am falschen Ort bin – aber die Wachen haben mich ja selbst in diesen Raum geführt.
Schließlich höre ich aus einer Richtung das schwache Echo von Schritten. Es ist der feste, sichere Gang eines Aristokraten.
Ich warte nicht erst mit dem Niederknien, bis die Gestalt den Raum betritt, sondern lasse mich sofort auf beide Knie sinken. Durch den Stoff meiner Hose spüre ich den kalten Boden. Mit flach ausgestreckten Händen präsentiere ich Corians gefaltete Uniform. Dann verbeuge ich mich. Von Corians Mantel geht immer noch ein schwacher Duft aus, den ich in meiner gebückten Haltung wahrnehme. Es ist der Geruch von Rauch und Zucker, der von den Bonbons herrührt, die er immer in seinen Taschen versteckt hatte.
Die Schritte haben die Halle erreicht. Aus den Augenwinkeln sehe ich ein Paar schwarze Stiefel, auf Hochglanz poliert, und einen hellen Mantel, der gegen Hosenbeine schwingt.
Ich erinnere mich an die Farbe dieses Mantels. Corians Vater ist gekommen, um mich zu begrüßen.
Ich schlucke schwer. Ich weiß nicht, wie ich mich für den Tod seines Sohnes entschuldigen soll, kann ihm nicht sagen, wie sehr ich mich schäme, sein Lieblingskind nicht beschützt zu haben. Ich kann nichts anderes tun, als in dieser Position zu verharren und ihm Corians Uniform entgegenzustrecken. Und genau das tue ich, bleibe ganz still und warte darauf, dass der Mann etwas sagt.
Die Stiefel machen direkt vor mir Halt. Ich kann die lastende Schwere spüren, die von seinem Vater ausgeht.
Wenn ein Striker die Uniform seines gefallenen Schilds an dessen Angehörige übergibt, ist es Tradition, dass ein Mitglied der Familie die Uniform mit beiden Händen entgegennimmt. Da Kampfpartner wie Geschwister miteinander verbunden sind, umarmt der Verwandte den Überbringer der Uniform, als wäre er oder sie ein Teil der Familie.
Doch nichts dergleichen geschieht. Ich warte. Corians Uniform liegt schwer und unangetastet in meinen Händen, die Stiefel seines Vaters verharren bleiern vor mir.
Dann hallt seine Stimme wie ein tiefes Grollen über meinen Kopf hinweg. »Weißt du, warum mein Sohn dich als seinen Schild gewählt hat?«, fragt Meister Barra.
Ich wage es nicht, aufzublicken. Nur mit Mühe schaffe ich es, den Kopf zu schütteln.
»Weil Corian ein mitfühlendes Herz hatte«, fährt sein Vater fort. »Er hatte Mitleid mit dir. Das kleine Mädchen aus Basea, das immer wie ein Tier vor der Arena kauerte. Ich sagte ihm, er solle dich nicht wählen. Du warst nicht gut genug. Er tat es trotzdem.« Seine Stimme klingt rau, wird hart und kalt vor Kummer. »Deshalb ist mein Junge tot. Weil er eine Ratte als Schild gewählt hat.«
Ich sehe, wie die Stiefel des Mannes kehrtmachen und in die Richtung zeigen, aus der er gekommen ist.
Seine Stimme über mir knurrt vor Abscheu.
»Behalte seine Uniform«, sagt er. »Sie ist von den Händen beschmutzt, die meinen Sohn sterben ließen. Dieses Haus nimmt keinen Abfall als Opfergabe an.«
Dann verstummt die Stimme, und die Stiefel gehen weg und lassen mich auf dem Boden kniend zurück. Er hat sich nicht die Mühe gemacht, mich fortzuschicken. Aber ohne seine Erlaubnis bin ich gezwungen, hier auszuharren.
Familien lehnen die Uniformen ihrer gefallenen Kinder nicht ab. Ich zögere, verwirrt und unsicher, was ich jetzt tun soll. Meine Arme zittern von der Anstrengung des Stillhaltens. Meine Augen sind auf den Boden gerichtet. Das kunstvolle Muster endet abrupt an den Kanten der Holzdielen. Alles, was ich tun kann, ist, seine Worte zu wiederholen, die mir unablässig durch den Kopf schwirren.
Er hatte Mitleid mit dir. Dieses Haus nimmt keinen Abfall an.
Ich starre auf meine Hände und Arme und denke an Corians letzte Augenblicke. Ich sehe seine strahlend blauen Augen, die mich anflehen, sein Leben zu beenden, bevor es zu spät ist. Abfall. Ich weiß natürlich, dass ich das nicht bin. Aber es spielt keine Rolle.
Ich habe Corian sterben lassen. Ich habe ihn umgebracht, denn ich hätte nie eine Strikerin werden dürfen. Das Blut meines Schilds wird für immer an meinen Fingern haften.
Ich habe keine Ahnung, wie lange ich so knie. Niemand sonst kommt, um mit mir zu sprechen. Keiner nimmt Corians Uniform aus meinen ausgestreckten Händen. Niemand will die Entschuldigung akzeptieren, mit der ich gekommen bin. Das Haus von Barra wird dafür sorgen, dass ich allein die Last von Corians Tod trage.
Das Tageslicht schwindet, weicht der Abenddämmerung. Zitternd zwinge ich mich, auf meinem Platz zu bleiben. Wartend. Hoffend.
Ich weiß nicht, ob ich bis zum Morgengrauen durchgehalten habe. Ich weiß nur noch, dass ich mit der Wange an den kalten Boden gepresst aufgewacht bin, weil ein Hausangestellter leise an meinen Schultern rüttelte.
»Du musst gehen, sofort«, flüstert er mir zu. Ich blicke in die ernsten Augen eines jungen Dieners, der nervös die Hände ringt. Seine Augen huschen zur Halle hinter uns, während er mit der Hand Richtung Tür deutet. »Die Wachen werden dich hinausschaffen, wenn du nicht selbst gehst.«
Beschämt halte ich ihm die Uniform hin, als ob selbst ein niederer Diener des Hauses Barra, der mein Angebot annimmt, besser wäre als nichts. Aber der Junge schreckt zurück, wagt es nicht, sie anzufassen. Er wirft mir einen entschuldigenden Blick zu, dann richtet er sich auf und eilt davon.
Ich warte noch einen Moment, bevor ich mich langsam vom Boden erhebe. Corians Uniform klebt geradezu an meinen Händen. Meine Atemzüge sind langsam und flach, während ich darüber nachdenke, was wohl als Nächstes kommt.
Ich habe meinen Schild verloren, meinen engsten Freund. Aber es gibt noch mehr zu verlieren. Wenn das Haus Barra sich weigert, meine Entschuldigung anzunehmen, dann ist mein Ansehen als Strikerin in Gefahr. Sie werden an das Erste Schwert appellieren, damit er mich entlässt, sie werden sagen, man dürfe mir nie wieder das Leben eines anderen anvertrauen, und dass ich unfähig sei, dieses Land zu schützen. Corian war der einzige Grund, warum ich eine Strikerin werden durfte. Ohne ihn bin ich allem schutzlos ausgeliefert. Und ohne meine Unterstützung gilt das auch für meine Mutter.
Wenn das Haus Barra mich nicht akzeptiert, habe ich vielleicht gerade meine letzten Tage als Strikerin erlebt.
3
ICH TRÄUME WIEDER. Ich bin zwölf, und Corian ist da.
Ich kauere im Schatten des hinteren Tores, das in die Trainingsarena führt, in das riesige Amphitheater im Herzen der Inneren Stadt von Newage. Von hier aus kann ich sehen, wie die Lehrlinge ihre Angriffsformationen üben und wie ihre saphirblauen Mäntel im tödlichen Gleichklang schwingen. Es ist, als würde man einem Tanz zusehen, und ich bin immer wieder aufs Neue hypnotisiert.
Aber ich bin nicht die Einzige in Mara, die ihnen gerne beim Training zusieht.
Ich schaue an meiner Kleidung hinab. Sie ist zerlumpt. Der Stoff an meinen geflickten Ellbogen ist inzwischen sehr dünn, fast durchscheinend. Der Hunger schlägt seine Klauen in meine Rippen. Manchmal denke ich, dass ich mich nur deshalb danach sehnte, eine Strikerin zu werden, weil ich wusste, dass die Lehrlinge eine Unterkunft, drei Mahlzeiten am Tag und einen vernünftigen Wochenlohn bekommen. Damals stellte ich mir vor, all das zu haben und meiner Mutter die Sicherheit eines eigenen Zuhauses bieten zu können. Sooft es ging, schlich ich mich in die Innere Stadt, um die Truppe in der Arena trainieren zu sehen. Jetzt gilt meine Aufmerksamkeit den jüngsten Rekruten, die gegeneinander antreten. Sie sind etwa in meinem Alter, einige etwas älter. Bald werden sie ihre jeweiligen Partner finden, je nachdem, wer am besten zu ihrer Persönlichkeit passt und ihren Kampfkünsten entspricht.
Wenn man nicht sprechen kann, verbringt man viel Zeit mit Beobachten. Interpretieren. Zuhören. Zumindest das kann ich gut, also analysiere ich das Verhalten der Schüler und mache mir in Gedanken Notizen, wie erfolgreich sie sich zur Wehr setzen können. Auf den Schrottplätzen der Äußeren Stadt habe ich gelernt, mein Gewicht möglichst geschickt zu verlagern. Ich wusste genau, wie ich am besten an den wahllos aufgestapelten Metallteilen hochkletterte, ausrangierte Überbleibsel des Ersten Volks, die von Bauern und Bauarbeitern ausgegraben worden waren. Ich konnte mich in einen alten Motor hineinschleichen, um ihn zu zerlegen, und dann von einem Stapel zum nächsten springen, wenn er ins Wanken geriet. Ich tanzte auf instabilen Stahlblechen und benutzte einen Schneidbrenner, den meine Mutter erstanden hatte, um die wertvollen Teile abzutrennen und zu verkaufen. Ich wusste, wie man sich zwischen den Trümmern hindurchwindet, um sich vor größeren Kindern zu verstecken, die sich um die Plätze mit den besten Metallen stritten.
Während ich den Lehrlingen zuschaue, ahme ich ihre Schritte nach, und meine Bewegungen steigen und fallen in nahezu perfektem Einklang mit ihnen. Ein Lächeln umspielt meine Lippen, während die Übungen meine Glieder wärmen. Ich verliere mich in völliger Konzentration, bis ich mir einbilde, dass die Fetzen meiner Lumpenkleidung sich nicht von den wehenden saphirblauen Mänteln unterscheiden.
Ich bin schon eine ziemlich lange Zeit dort in der Dunkelheit und führe die Bewegungen durch – wie lange genau, weiß ich nicht –, als mir mitten im Sprung eine jugendliche Stimme aus Richtung des Tors etwas zuruft.
»Du bist wirklich gut, weißt du das?«
Die Stimme bringt mich aus dem Gleichgewicht. Ich lande so ungeschickt auf dem Boden, dass ich eine Staubwolke aufwirble. Ruckartig hebe ich den Kopf.
Ein Junge mit goldschimmernden Haaren, den Kopf nachdenklich zur Seite geneigt, lehnt lässig an der Brüstung des Tores. Selbst im Traum sind seine Gesichtszüge so klar und deutlich, als würde ich ihn durch ein Vergrößerungsglas betrachten. Seine Kleidung ist fein gesponnen, und an seinen Fingern funkeln Ringe. Seine Haltung ist selbstbewusst, mit geraden Schultern und erhobenem Kinn. Ein hochgeborener Maraner.
Plötzlich ist mein Grinsen wie weggewischt. Meine Mutter hat mich vor den reichen Jungen gewarnt.
»Seit Monaten bist du jeden Tag hier draußen«, stellt er fest. Es ist eine Stimme, die kein Zögern, keine Unsicherheit kennt.
Panik drückt mir die Kehle zu. Ich rapple mich auf und renne los.
»Hey!«, ruft er mir hinterher, aber ich traue mich nicht, zurückzuschauen. Geflüchtete dürfen ohne Erlaubnis nicht in die Innere Stadt. Was würde passieren, wenn man mich erwischt? Ich musste mit ansehen, wie einer Frau in den Kopf geschossen wurde, weil sie versucht hat, sich an den Mauerwachen vorbeizuschleichen. Ich habe gesehen, wie ein Geflüchteter zu Tode gepeitscht wurde, weil er versucht hatte, ohne Lizenz auf der Nachtbörse in der Inneren Stadt Seetangbüschel zu verkaufen.
Ich halte nicht an, um darüber nachzudenken, sondern gehe einfach weiter.
Plötzlich packt mich jemand mit großer Kraft, und ehe ich weiß, wie mir geschieht, liege ich mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Ich spüre den Atem des Angreifers über meinem Kopf. Instinktiv drehe ich mich um. Der Junge fliegt von mir herunter, als ich in die Hocke springe und die Fäuste hochreiße.
Er lacht und schüttelt sich den Staub aus den Haaren. Erstaunt stelle ich fest, wie wenig es ihn kümmert, dass er seine feine Kleidung beschmutzt hat. Ich versuche, meine zitternden Hände ruhig zu halten. Was für eine Strafe mich wohl erwartet?
»Du hast offensichtlich noch nie mit jemandem gekämpft«, sagt er mit einem Lächeln. »Aber ich habe dich beobachtet. Deine Reaktionsschnelligkeit ist unglaublich.«
Röte schießt mir ins Gesicht, als er mir beim Aufstehen helfen will. Ich starre auf seine ausgestreckte Hand und versuche herauszufinden, ob er es ernst meint oder mir einen Streich spielen will. Zögernd lege ich meine Hand in seine. Mit einer einzigen schnellen Bewegung zieht er mich auf die Beine, als hätte er sein ganzes Leben nur darauf gewartet. »Ich bin Corian«, stellt er sich vor.
Ich antworte nicht.
Stirnrunzelnd sieht er mich an. »Und?«, fragt er. »Wie heißt du?«
Ich klopfe zweimal an meine Kehle und antworte in Gebärdensprache: »Ich bin Talin. Ich kann nicht sprechen.«
Ich rechne nicht damit, dass er mich verstanden hat. Aber seine Augen weiten sich – und dann lächelt er und gebärdet: »Gut. Alle Strikerlehrlinge müssen die Gebärdensprache lernen. Das weißt du doch, oder?«
Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Moment – an seine ausdrucksvollen Hände, die lockere Art, wie er meine lautlosen Worte aufnahm, das freundliche Lächeln auf seinem Gesicht. Ich wusste, dass die Geister ein hervorragendes Gehör haben, aber ich wusste nicht, dass die Striker an der Front Gebärdensprache benutzen, um zu kommunizieren. Meine Lippen verziehen sich zu einem Lächeln. Er hat meine Worte verstanden. Dieser Junge versteht mich.
»Sie benutzen die gleichen Zeichen wie ich?«
»Sehr ähnliche. Du wirst sie in kürzester Zeit aufschnappen.« Bereits jetzt bemerke ich einige Unterschiede. So sind zum Beispiel manche Gesten vereinfacht, während andere aufwendiger sind.
»Du willst also eine Strikerin werden?«, fragt er.
Ich zucke mit den Schultern, unsicher, was ich sagen darf. »Will das nicht jeder?«
»Es überrascht mich, dass eine Baseanerin unser Land verteidigen will«, sagt er mit nun ernster Miene. »Mara behandelt euch nicht besonders gut.«
Erstaunt halte ich inne – ein hochgeborener Maraner hat mich noch nie auch nur eines Blickes gewürdigt und mir erst recht nicht echte Aufmerksamkeit geschenkt. Ganz zu schweigen davon, dass einer von ihnen auch nur einen Hauch von Verständnis gezeigt hätte.
»Wir haben alle denselben Feind«, antworte ich. »Mara ist nicht die Föderation.«
Er betrachtet mich nachdenklich. »Warum bewirbst du dich dann nicht für die Ausbildung?«
»Baseanern ist das nicht erlaubt.«
»Na und? Du bewegst dich so schnell wie jeder andere in dieser Arena.« Er deutet mit einem Nicken über seine Schulter. »Warum kommst du nicht einfach zu den Prüfungen? Wenn du willst, lege ich ein gutes Wort für dich beim Ersten Schwert ein.«
Als ich nur fassungslos dastehe, steckt er die Hände in die Taschen und wendet sich ab. Ich beneide ihn um seinen geraden Rücken, um das ungezügelte Selbstvertrauen in jeder Linie seiner Gestalt. Er glaubt wirklich, dass seine Worte diese Macht haben können. Und wahrscheinlich stimmt es tatsächlich.
In diesem Moment schwöre ich mir, so zu werden wie er. Ich werde einen Weg finden, so wie er durchs Leben zu gehen – voller Mut, durch und durch, bis in die Knochen.
»Fühl dich nicht gedrängt«, ruft er noch über die Schulter, während er wieder Richtung Arena geht. »Es ist nur ein Vorschlag.«
Die Sonne ist warm, der Himmel wolkenlos blau. Mein Herz hämmert gegen meine Rippen. Ich warte noch einen Atemzug länger. Dann endlich entkrampfen sich meine Beinmuskeln, und ich ertappe mich dabei, wie ich das tue, was ich auch in den darauffolgenden sechs Jahren tun werde – ich folge ihm. Ich renne und renne und renne.
Aber in meinem Traum hole ich ihn nie ein.
Ein Klopfen an meiner Tür weckt mich auf. Mein Gesicht ist immer noch tränenfeucht.
Ich schwinge meine Beine über die Bettkante. Blasses Morgenlicht streicht über meine Arme. Mein Kopf pocht in einem steten Rhythmus, kämpft noch mit Albträumen, an die ich mich nicht erinnern kann. Es dauert eine Sekunde, bis ich registriere, dass ich wieder in meiner Strikerunterkunft in Newage bin, und eine weitere, bis ich begreife, dass ich jetzt allein hier wohne. Instinktiv berühre ich die schwarzen Knochenstücke, die seit Neuestem meine Ohren zieren. Die Piercings sind noch so frisch, dass es wehtut, wenn ich sie berühre.
Es ist zwei Wochen her, dass ich versucht habe, Corians Uniform abzuliefern. Ich frage mich, ob ich jemals aufhören werde, von ihm zu träumen. In den dunklen Ecken spuken Schatten von einst. Auf der anderen Seite des Flurs ist sein Zimmer, die Tür ist geschlossen. Ich habe nicht mehr hineingeschaut, seit ich seine Uniform wieder in den Schrank gehängt habe. So muss ich wenigstens nicht sein Bett sehen, sauber und unbenutzt, seine ausgeräumte Kommode, den leeren Waffenschrank. Ich kann die Lücke, die er hinterlässt, um mich herum spüren, und die Erinnerung jagt jeden Morgen einen so scharfen Schmerz durch meine Brust, dass ich mich auf meinem Bett einrollen und in die Vergessenheit abdriften möchte, um hier zu liegen und niemals aufzuwachen, um in der Dunkelheit zu bleiben und zu bleiben, bis der Tod kommt und auch mich holt.
Corian würde mich verspotten, wenn er mich so sähe. Er würde mich aus dem Bett zerren und mir den Mantel an den Kopf werfen. Der Gedanke an seinen verärgerten Blick reicht fast aus, um mich trotz meines Kummers zum Lachen zu bringen.
Corian, denke ich. Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, hast du da jemanden mit Potenzial gesehen? Oder hat dein Vater recht? Hattest du wirklich nur Mitleid mit mir?
Was spielt das überhaupt für eine Rolle? Kein anderer Striker will sich mit mir zusammentun. Das Erste Schwert überlegt, wie es weitergehen soll. Bald, daran habe ich keinen Zweifel, erwartet mich der Rauswurf. Dann werde ich hilflos zusehen müssen, wie die Föderation durch die Tore von Newage marschiert. Genau wie an dem Tag, als meine Mutter und ich aus unserer Heimat flohen.
Das Hämmern gegen meine Tür setzt wieder ein.
Geh mit Mut, ermahne ich mich und denke an meinen Schwur, mehr wie Corian zu sein. Mit einem Seufzer zwinge ich mich, vom Bett aufzustehen, und greife nach meinem Hemd.
Als ich endlich die Tür öffne, sehe ich Adena Min Ghanna aus meiner Patrouille in ihrer Uniform dastehen, mit einem so breiten Lächeln, dass es ihr wehtun muss. Ihr gekräuseltes Haar ist zu einem ordentlichen Dutt zusammengebunden, und die Morgensonne verleiht ihrer dunklen Haut einen warmen Schimmer. Sie rückt eine Schutzbrille auf ihrer Stirn zurecht und rümpft die Nase über mich.
»Du siehst furchtbar aus«, schimpft sie und streicht mir ein paar Haarsträhnen aus den Augen. Dann zupft sie am Saum meines Shirts, das lose aus der Hose hängt. »Stopf es rein, du Heidin.«
»Ich dachte, Maraner haben keine offizielle Religion«, gebärde ich. Meine Laune lässt mich sarkastisch werden.
»Das ist ein Sprichwort, Talin«, erwidert sie.
»Warum siehst du aus, als hättest du einen Frosch verschluckt?«
»Alle Striker sollen sich heute Morgen in der Arena versammeln.«
Ich blinzle zum Himmel hinauf, mein Blick bleibt an den fernen Wolkenbändern hängen. »Wozu? Ist der Waffenstillstand schon vorbei?«
Adena schüttelt den Kopf. »Nein. Wir haben einen Deserteur der Föderation gefangen.« Sie beugt sich erwartungsvoll zu mir. »Er soll heute verhört werden, im Beisein von Publikum.«
Ein Kriegsgefangener. Jetzt erinnere ich mich. An dem Tag, als Corian starb, erwähnte er, dass bei der Durchsuchung jemand gefangen genommen wurde. Das muss der Soldat sein.
Mein Herz verhärtet sich. Traditionsgemäß ist das Erste Schwert für die Verhöre der gefangenen feindlichen Soldaten verantwortlich. Er befragt sie öffentlich in der Arena, oft unter Zuhilfenahme eines Steins oder einer Peitsche, bis sie uns sagen, was sie über die Föderation wissen. Wenn sie nicht kooperieren, werden sie öffentlich hingerichtet.
Einen Gefangenen zu Tode foltern klingt grausam. Aber manchmal ist Grausamkeit auch Katharsis. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, was Föderationssoldaten ihren besiegten Gegnern antun können. Den Frauen. Den Familien. Den Kindern.
Im Vergleich dazu ist die öffentliche Hinrichtung eine Gnade, ein klägliches Stück Gerechtigkeit für uns alle, die wir geliebte Menschen auf die grausamste Weise verloren haben.
»Du hast mich aus dem Bett geholt, nur weil wir heute einen Föderationsfeigling hinrichten?«
»Ist es deine neue Angewohnheit, mit mir zu streiten?«, erwidert Adena.
Ich hebe gespielt unschuldig die Hände, bevor ich antworte. »Ich stelle nur Fragen.«
»Befehl vom Ersten Schwert. Alle Striker in die Arena. Also hör auf, herumzutrödeln, und zieh deine volle Ausrüstung an.«
Adena stand Corian ebenfalls nahe, aber ihre Art, mit seinem Tod fertigzuwerden, besteht darin, sich hinter ihren akribischen Gewohnheiten zu verschanzen und bei allem pingelig zu sein, als könnte sie durch ihren Ordnungswahn die Trauer aus ihrem System hinausorganisieren. In den letzten zwei Wochen ist sie jeden Tag bei mir vorbeigekommen, hat herzhafte Pfannkuchen und in Stoff eingewickelte Fleischpasteten aus der Kantine mitgebracht und mich begutachtet, um zu sehen, ob ich auch genug schlafe und regelmäßig die Kleidung wechsle.
Ich hasse mich ein wenig für mein Verhalten. Ich vergesse immer wieder, dass auch andere über Corians Tod hinwegkommen müssen, hasse mich dafür, dass Adena die Rücksichtsvollere von uns ist, dass sie an mich denkt, auch wenn sie selbst mit dem Verlust zu kämpfen hat.
Noch musste ich meine Uniform nicht abgeben. Und der Hinrichtung eines Föderationssoldaten beizuwohnen, wird mich wenigstens für kurze Zeit aus meinem Trauernebel reißen. Ich nicke Adena kurz zu und wende mich ab. »Ich werde mich beeilen«, verspreche ich ihr.
Adena wartet in der offenen Tür, während ich mir das Gesicht wasche und meine Gurte und Waffen anschnalle. Wenige Minuten später stehe ich in voller Montur da, und gemeinsam gehen wir vom Quartier Richtung Trainingsplatz.