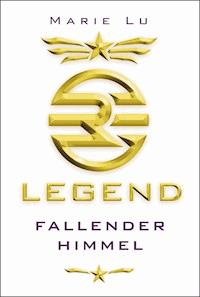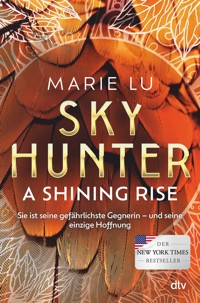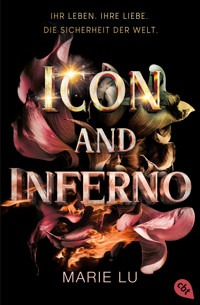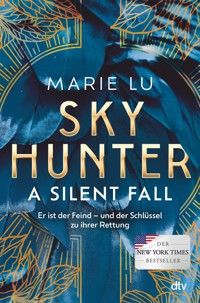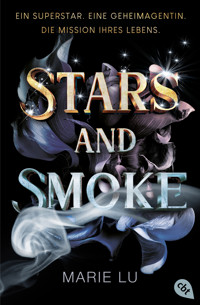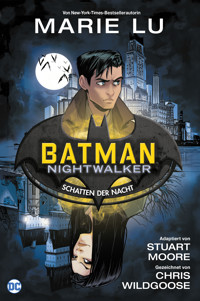Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Warcross
- Sprache: Deutsch
Mit Warcross liefert Bestsellerautorin Marie Lu den Auftakt zu einer temporeichen Cyberpunk-Jugendbuchreihe, die durch viel Action, Spannung und eine starke, coole Protagonistin überzeugt. Ein Muss für alle, die Videospiele und eSports lieben, aber nicht auf Romantik verzichten möchten! Die Welt ist verrückt nach Warcross, dem gigantischsten Videospiel aller Zeiten! Erfinder Hideo Tanaka wird wie ein Gott verehrt, eSport-Turniere füllen ganze Stadien und die Meisterschaft ist das größte Event der Welt. Kopfgeldjägerin Emika Chen erhält zu Beginn der Warcross-WM ein verlockendes Jobangebot von Hideo Tanaka: Undercover soll sie an dem Wettkampf teilnehmen und einen Hacker aufspüren, der Warcross sabotiert. Eine waghalsige Jagd beginnt, bei der Emika nicht nur ihr Leben aufs Spiel setzt, sondern auch ihr Herz … Warcross – Das Spiel ist eröffnet ist der erste von zwei Bänden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Widmung
Für Kristin und Jen, die mein Leben verändert haben und nach all den Jahren immer noch für mich da sind
Vorwort
Es gibt wohl keinen Menschen auf der Welt, der noch nicht von Hideo Tanaka gehört hat, dem jungen Genie, das mit gerade einmal 13 Jahren Warcross erfunden hat. Eine heute veröffentlichte weltweite Studie zeigt, dass überwältigende 90 Prozent aller Menschen zwischen 12 und 30 Jahren das Spiel regelmäßig, das heißt mindestens einmal pro Woche, spielen. Zur Warcross-Weltmeisterschaft dieses Jahr werden mehr als 200 Millionen Zuschauer erwartet. […]
Korrektur:
In einer früheren Version dieses Artikels haben wir Hideo Tanaka fälschlicherweise als Millionär bezeichnet. Er ist jedoch Milliardär.
–NEW YORK DIGEST
MANHATTAN
NEW YORK CITY, STAAT NEW YORK
Kapitel 1 – Es ist verdammt …
1
Es ist verdammt noch mal zu kalt für eine Jagd.
Zitternd ziehe ich mir den Schal über den Mund und wische mir ein paar Schneeflocken aus den Wimpern. Dann trete ich kräftig auf mein Elektroskateboard. Wie alles, was ich besitze, ist das Ding alt und abgenutzt, die blaue Farbe schon fast komplett abgeblättert, sodass das billige silberne Plastik darunter zum Vorschein kommt. Aber noch steckt ein bisschen Leben darin, und als ich mit der Ferse härter aufstampfe, springt das Board endlich mit einem großen Satz nach vorn, direkt in die Lücke zwischen zwei Autokolonnen. Mein regenbogenbunt gefärbtes Haar peitscht mir wild ums Gesicht.
»Hey!«, schimpft ein Fahrer, als ich mich an seinem Wagen vorbeimanövriere. Ich werfe einen Blick über die Schulter: Er droht mir durch das offene Fenster mit der Faust. »Du hättest mich fast erwischt!«
Doch ich drehe mich wieder um und beachte ihn nicht weiter. Normalerweise bin ich netter – zumindest hätte ich ihm eine Entschuldigung zugerufen. Aber heute Morgen nach dem Aufwachen habe ich einen gelben Zettel an der Tür meines Apartments gefunden, getippt in der riesigsten Schriftgröße, die man sich vorstellen kann.
RÄUMUNG IN72STUNDEN
Kleine Hintergrundinfo: Ich bin fast drei Monate mit der Miete im Rückstand. Wenn ich also nicht schleunigst 3450 Dollar auftreibe, sitze ich Ende der Woche auf der Straße.
So was würde wohl jedem den Tag verderben.
Der Wind brennt auf meinen Wangen. Zwischen den Wolkenkratzern blitzt grauer Himmel auf, der stetig dunkler wird, und in wenigen Stunden werden sich die paar Schneeflocken vervielfacht haben. Autos verstopfen die Straßen, eine endlose Spur von Bremslichtern von hier bis zum Times Square, untermalt von einem Hupkonzert. Hin und wieder durchschneidet der schrille Pfiff eines Verkehrspolizisten das Chaos. Abgasgeruch hängt schwer in der Luft und aus einem offenen Lüftungsschacht quillt Dampf. Auf den Bürgersteigen wimmelt es von Menschen. Jede Menge Schüler und Studenten sind auf dem Heimweg, leicht zu erkennen an ihren Rucksäcken und riesigen Kopfhörern.
Eigentlich müsste ich eine von ihnen sein. Dieses Jahr hätte ich mit dem College anfangen sollen, aber nach Dads Tod habe ich immer öfter die Schule geschwänzt und sie irgendwann ganz abgebrochen. (Na schön – genau genommen haben sie mich wohl rausgeworfen. Aber ich wäre da sowieso nicht mehr hingegangen. Dazu später mehr.)
Ich konzentriere mich wieder auf die Jagd und sehe erneut auf mein Handy. Vor zwei Tagen habe ich folgende Nachricht erhalten:
Polizei New York, ACHTUNG! Haftbefehl gegen Martin Hamer ausgestellt. Belohnung 5000 $.
Die zunehmende Kriminalität auf den Straßen New Yorks hält die Polizei dermaßen auf Trab, dass sie mittlerweile gar keine Zeit mehr hat, selbst nach kleinen Fischen wie Martin Hamer zu fahnden, der illegal auf Warcross-Spiele gewettet hat. Außerdem soll er verschiedenen Leuten Geld gestohlen und Drogen verkauft haben, um sich damit sein Glücksspiel zu finanzieren. Die Bullen schicken etwa einmal pro Woche solche Benachrichtigungen raus, mit dem Versprechen einer Belohnung für denjenigen, der den Gesuchten stellt.
Und dann schlägt meine Stunde. Ich bin Kopfgeldjägerin, eine von unzähligen in Manhattan, und fest entschlossen, Martin Hamer zu schnappen, bevor mir ein Konkurrent zuvorkommt.
Jeder, der schon mal schlecht bei Kasse war, kennt das – diesen nahezu unaufhörlichen Zahlenstrom, der mir auch jetzt wieder durch den Kopf rattert. Die Monatsmiete für das schäbigste Apartment New Yorks: 1150 Dollar. Lebensmittel: 180 Dollar. Strom und Internet: 150 Dollar. Packungen Käsemakkaroni, Ramennudeln oder Dosenfleisch, die sich zurzeit in meinem Vorratsschrank befinden: 4. Und immer so weiter. Dazu kommen noch die 3450 Dollar ausstehende Miete und 6000 Dollar Kreditkartenschulden.
Mein aktueller Kontostand: 13 Dollar.
Nicht gerade das, was ein normales Mädchen in meinem Alter beschäftigen sollte. Ich sollte mir Sorgen über Prüfungen oder Hausarbeiten machen. Oder darüber, dass ich meine erste Vorlesung verschlafen könnte.
Aber meine Jugend ist nun mal nicht wirklich normal verlaufen.
5000 Dollar, das ist die höchste Belohnung seit Monaten. Für mich erscheint es gerade wie alles Geld der Welt. Und genau darum tue ich seit zwei Tagen nichts anderes, als diesem Typen hinterherzujagen. Diesen Monat sind mir vier Kopfgelder hintereinander durch die Lappen gegangen. Wenn ich dieses hier auch nicht ergattere, stecke ich wirklich in Schwierigkeiten.
Dass diese Touristen immer die Straßen verstopfen müssen, denke ich, als ich gezwungenermaßen einen Umweg Richtung Times Square nehme, wo ich prompt hinter einer Karambolage aus Robotaxis auf einem Fußgängerweg stecken bleibe. Ich lehne mich auf meinem Board zurück, bremse und rolle langsam rückwärts. Dabei checke ich noch einmal mein Handy.
Vor ein paar Monaten ist es mir gelungen, mich in das Hauptverzeichnis aller Warcrosser in New York einzuhacken und es mit den Straßenkarten auf meinem Handy zu synchronisieren. Das war gar nicht so schwer – schließlich ist jeder auf der Welt auf irgendeine Art mit jemand anderem verbunden –, aber sehr zeitintensiv. Man muss einen Weg finden, in den ersten Account einzudringen, dann kann man das Ganze auf die Freunde des Inhabers ausweiten, dann auf deren Freunde und am Ende hat man den Standort jedes Spielers in New York City. So konnte ich endlich den aktuellen Aufenthaltsort meiner Zielperson herausfinden, aber mein Handy ist schrottreif und der Akku liegt in den letzten Zügen. Ständig versucht es, sich auszuschalten, um Energie zu sparen, und das Display ist so dunkel, dass ich darauf kaum etwas erkennen kann.
»Aufwachen«, murmele ich und studiere mit zusammengekniffenen Augen die Pixel.
Endlich rafft sich das Ding zu einem erbärmlichen Vibrieren auf und der rote Standortpfeil auf der Karte aktualisiert sich.
Ich schiebe mich an dem Taxiknäuel vorbei und trete mit der Ferse fest aufs Board. Zuerst protestiert es, aber dann schießt es vorwärts, ein winziger Punkt in einem Meer aus Menschen.
Als ich den Times Square erreiche, ragen ringsherum Großbildschirme auf und eine Welt aus Neonlicht und Lärm verschluckt mich. Jeden Frühling wird die Warcross-Meisterschaft mit einem riesigen Fest eingeläutet, bei dem zwei Mannschaften bestehend aus den Topspielern der ganzen Welt gegeneinander antreten. Die diesjährige Zeremonie findet in Tokio statt, und zwar heute Abend, weshalb alle Bildschirme irgendetwas von Warcross zeigen: einen hektischen Mix aus berühmten Spielern, Werbung und den Highlights vom letzten Jahr. An einer Gebäudeseite läuft Frankie Denas neuestes und bislang durchgeknalltestes Musikvideo. Sie ist gekleidet wie ihr Warcross-Avatar – das Kostüm mit dem Glitzercape gibt es in limitierter Auflage zu kaufen – und tanzt mit einer Gruppe Geschäftsmänner in knallrosa Anzügen. Unterhalb des Bildschirms bleiben ein paar aufgeregte Touristen stehen, um mit einem Typen in selbst gemachter Warcross-Montur für ein Foto zu posieren.
Auf einem weiteren Monitor sind gerade fünf der Superstars zu sehen, die heute Abend am Match teilnehmen werden. Asher Wing. Kento Park. Jena MacNeil. Max Martin. Penn Wachowski. Ich verrenke mir fast den Hals nach ihnen. Sie tragen alle die neuesten Kollektionen und lächeln zu mir herunter, ihre Münder so breit, dass sie die gesamte Stadt verschlucken könnten. Dann heben sie gleichzeitig Getränkedosen ins Bild und erklären Coca-Cola zum Softdrink ihrer Wahl. Unter ihnen läuft ein Textband:
TOPSPIELER TREFFEN IN TOKIO EIN –
WARCROSSEROBERT DIE WELT
Endlich bin ich über die Kreuzung und lande in einer kleineren Straße. Der rote Punkt auf meinem Handy, der meine Zielperson markiert, bewegt sich wieder. Sieht aus, als wäre Hamer in die 38. Straße eingebogen.
Ein paar Blocks lang schlängele ich mich weiter durch den Verkehr, bis ich schließlich vor einem Zeitungsstand halte. Der Standortpfeil schwebt über dem Gebäude vor mir, direkt über der Tür eines Cafés. Ich schiebe meinen Schal hinunter und atme erleichtert auf, worauf sich eine weiße Wolke in der eisigen Luft bildet. »Hab ich dich«, flüstere ich und gestatte mir ein kleines Lächeln beim Gedanken an die 5000-Dollar-Belohnung. Ich springe von meinem E-Board, ziehe die Tragegurte heraus und schlinge es mir über die Schulter, sodass es neben meinem Rucksack hängt. Es ist noch aufgeheizt. Die Wärme dringt durch meine Kapuzenjacke und ich krümme meinen Rücken, um möglichst viel davon abzubekommen.
Im Vorbeigehen werfe ich aus Gewohnheit einen Blick auf die Titelseiten am Zeitungsstand, immer auf der Suche nach Artikeln über meinen Lieblingsstar. Ich werde fast nie enttäuscht. Und auch jetzt ist er wieder auf dem Cover einer Zeitschrift zu sehen: ein hochgewachsener junger Mann, der entspannt in seinem Büro sitzt. Dunkle Hose, gestärktes Hemd, die Ärmel lässig aufgekrempelt, das Gesicht im Schatten. Unter ihm prangt das Logo von Henka Games, dem Studio, in dem Warcross entwickelt wurde. Ich bleibe stehen und lese die Schlagzeile.
HIDEO TANAKA WIRD21
EXKLUSIVER EINBLICK IN DAS PRIVATLEBENDESWARCROSS-ERFINDERS
Als ich den Namen meines Idols sehe, vollführt mein Herz einen altvertrauten Hüpfer. Schade, dass ich keine Zeit habe, um ein bisschen zu schmökern. Später vielleicht. Widerstrebend wende ich mich ab, schiebe Rucksack und Board auf meinem Rücken zurecht und setze meine Kapuze auf. Die Fenster, an denen ich vorbeigehe, zeigen mir ein Zerrbild meiner selbst – das Gesicht in die Länge gezogen, ebenso die Beine in den dunklen Jeans, schwarze Handschuhe, ausgetretene Boots, verwaschener roter Schal über schwarzem Hoodie. Unter der Kapuze quellen meine Regenbogenhaare hervor. Ich versuche, mir dieses Mädchen auf einem Zeitschriftencover vorzustellen.
Sei nicht so albern. Ich schiebe den lächerlichen Gedanken beiseite, wende mich dem Caféeingang zu und gehe im Geiste noch einmal die Checkliste der Ausrüstung in meinem Rucksack durch.
Handschellen
Kabelwerfer
Stahlkappenhandschuhe
Handy
Wechselklamotten
Elektroschockpistole
Buch
Auf einer meiner allerersten Jagden hat mich die Zielperson vollgekotzt, nachdem ich sie mit Nummer 6 traktiert hatte. Seitdem habe ich vorsorglich immer Nummer 5 dabei. Zwei Typen haben mich allen Ernstes gebissen, darum habe ich nach der nötigen Tetanusimpfung Nummer 3 hinzugefügt. Nummer 2 ist dazu da, um an schwer zu erreichende Stellen zu gelangen und schwer zu erreichende Menschen zu fangen. Mit Nummer 4 kann ich mich von unterwegs überall einhacken. Und Nummer 1? Na ja, das erklärt sich wohl von selbst.
Nummer 7 ist übrigens für lange Wartezeiten während einer Jagd. Jede Form der Unterhaltung, die keine Akkulaufzeit frisst, ist definitiv das Mitschleppen wert.
Jetzt betrete ich das gemütlich warme Café und zücke erneut mein Handy. An der Theke wartet eine Kundenschlange darauf, von einem der vier Robokassierer bedient zu werden. Die Wände sind von dekorativen Bücherregalen gesäumt und ein paar der Tische von Studenten und Touristen besetzt. Als ich die Handykamera auf die Leute richte, sehe ich auf dem Display ihre Namen über ihren Köpfen, was bedeutet, dass niemand seine Einstellungen auf »privat« gesetzt hat. Vielleicht ist der Typ, den ich suche, gar nicht auf dieser Etage des Gebäudes.
Ich schlendere an den Regalen entlang und lasse den Blick von Tisch zu Tisch wandern. Die meisten Menschen achten kaum auf ihre Umgebung. Wenn man irgendjemanden fragt, wie die Person neben ihm gekleidet war, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er es nicht mehr weiß. Ich wüsste es. Könnte Outfit und Verhalten jedes einzelnen Wartenden in der Kassenschlange aufzählen, könnte ganz genau sagen, wie viele Leute an welchem Tisch saßen und dass einer von ihnen die Schultern ein kleines bisschen zu sehr gekrümmt hielt. Sehe das Pärchen, das Seite an Seite sitzt, ohne ein einziges Wort zu wechseln, und den Mann, der peinlichst darauf bedacht ist, nur ja niemandem in die Augen zu schauen. Solche Szenen kann ich in mich aufnehmen wie ein Fotograf eine Landschaft – den Blick entspannen, analysieren, was sich mir darbietet, dann den richtigen Fokuspunkt suchen und auf den geistigen Auslöser drücken, um das gesamte Bild festzuhalten.
Ich bin stets auf der Suche nach dem Fehler im Muster, dem einen hervorstehenden Nagel.
Kurz bleibe ich an einer Gruppe von vier Jungs hängen, die auf zwei Sofas sitzen und lesen. Eine Zeit lang beobachte ich sie, lauere auf Anzeichen versteckter Kommunikation – heimlich weitergereichte Zettel oder Handynachrichten. Nichts. Ich wende meine Aufmerksamkeit der Treppe zu, die in den ersten Stock führt. Mit Sicherheit sind bereits andere Jäger dem Zocker auf der Spur – ich muss ihn mir schnappen, bevor mir jemand zuvorkommt. Eilig steige ich die Stufen hoch.
Oben ist niemand oder zumindest scheint es zunächst so. Dann aber dringen gedämpfte Stimmen an mein Ohr. Sie stammen von einem Tisch in der hintersten Ecke, abgeschirmt durch zwei Bücherregale, sodass er von der Treppe kaum zu sehen ist. Auf Zehenspitzen schleiche ich näher und spähe zwischen den Regalböden hindurch.
Am Tisch sitzt eine Frau über ein Buch gebeugt. Vor ihr tritt ein Mann nervös von einem Fuß auf den anderen. Ich hebe mein Handy. Beide haben ihre Einstellungen auf »privat« gesetzt.
Verstohlen drücke ich mich an die Wand, damit sie mich nicht entdecken, und lausche.
»Ich habe aber keine Zeit mehr bis morgen Abend«, sagt der Mann.
»Tut mir leid«, erwidert die Frau, »aber daran kann ich nicht viel ändern. Mein Chef kann Ihnen eine solche Geldsumme nicht zur Verfügung stellen, ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Jedenfalls nicht, solange ein polizeilicher Haftbefehl gegen Sie aussteht.«
»Sie haben es mir versprochen.«
»Wie gesagt, Sir, es tut mir leid.« Die Stimme der Frau klingt ruhig und zynisch, als hätte sie diesen Satz schon unzählige Male von sich gegeben. »Es ist nun mal Spielsaison. Die Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft.«
»Ich habe hier 300000 Noten. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, wie der Kurs dafür steht?«
»Natürlich. Das ist mein Job«, antwortet die Frau trocken.
300000Noten. Das kommt aktuell etwa 200000 Dollar gleich. Der Typ kleckert nicht mit seinen Einsätzen. Wetten auf Warcross abzuschließen, ist in den Vereinigten Staaten illegal, seit die Regierung kürzlich eine Reihe von neuen Gesetzen verabschiedet hat – ein verzweifelter Versuch, mit der Technik und der wachsenden Cyberkriminalität Schritt zu halten. Wenn man auf ein Warcross-Match setzt und gewinnt, erhält man Spielpunkte, Noten genannt. Und jetzt kommt’s: Man kann die Noten entweder online einsetzen oder draußen in der realen Welt damit zu einem Wechsler gehen, jemandem wie dieser Frau hier. Die gibt einem für die Noten bares Geld, wenn auch nicht, ohne eine Beteiligung für ihren Arbeitgeber abzuschöpfen.
»Aber das ist mein Geld«, protestiert der Typ weiter.
»Wir müssen uns nun mal schützen. Und diese zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen dauern ihre Zeit. Kommen Sie morgen Abend wieder, dann tauschen wir die Hälfte Ihrer Noten um.«
»Ich sage Ihnen doch, ich habe keine Zeit bis morgen Abend. Ich muss die Stadt verlassen.«
Und schon geht die Diskussion wieder von vorne los. Mit angehaltenem Atem höre ich zu. Die Frau muss mir nur noch seine Identität bestätigen.
Meine Augen verengen sich und meine Lippen verziehen sich zu einem zufriedenen kleinen Schmunzeln. Genau das hier ist der Moment, den ich an der Jagd am meisten liebe – wenn alle Puzzleteilchen, die ich bei meiner Spurensuche aufgedeckt habe, sich schließlich zusammensetzen, wenn meine Zielperson leibhaftig vor mir steht und ich nur noch zuschlagen muss. Wenn ich das Rätsel gelöst habe.
Hab ich dich.
Während das Gespräch immer hitziger wird, tippe ich zweimal auf mein Handydisplay und sende eine Nachricht an die Polizei.
Verdächtiger in körperlichem Gewahrsam.
Beinahe augenblicklich kommt eine Antwort.
NYPD IST UNTERWEGS.
Ich ziehe den Elektroschocker aus meinem Rucksack. Ganz kurz bleibt er am Reißverschluss hängen, was ein kaum hörbares Kratzen verursacht.
Das Gespräch verstummt. Durch das Regal sehe ich die Köpfe der beiden zu mir herumrucken – sie starren mich an wie Rehe im Scheinwerferlicht. Der Mann sieht die Entschlossenheit in meinem Blick. Sein Gesicht ist von einem dünnen Schweißfilm bedeckt und das Haar klebt ihm feucht an der Stirn. Ein Sekundenbruchteil verstreicht.
Ich drücke ab.
Er rast los – und ich verfehle ihn um Haaresbreite. Gute Reflexe. Auch die Frau springt auf, was mich jedoch nicht die Bohne interessiert. Ich setze dem Mann nach. Er stürmt die Treppe hinunter, nimmt immer drei Stufen auf einmal und stolpert fast in seiner Eile, wobei er sein Handy und ein paar Stifte verliert. Als ich das Erdgeschoss erreiche, sprintet er auf den Ausgang zu. Ich stürze ihm durch die Glasdrehtür hinterher nach draußen.
Jetzt sind wir beide auf der Straße. Passanten schreien auf, als der Mann sie grob zur Seite schubst – eine fleißig Fotos knipsende Touristin landet flach auf dem Rücken. In einer einzigen fließenden Bewegung reiße ich das E-Board von der Schulter zu Boden, springe auf und stampfe, so hart ich kann, mit der Ferse darauf. Begleitet von einem schrillen Wuschhhh macht das Board einen Satz nach vorn und saust los. Der Mann sieht sich um, erkennt, dass ich rapide zu ihm aufhole, und schlägt einen panischen Haken nach links, eine Seitenstraße hinunter.
Ich biege so scharf ab, dass die Kante meines Boards mit einem unschönen Geräusch über den Boden schrammt und einen langen, schwarzen Strich auf dem Asphalt hinterlässt. Ich ziele mit dem Elektroschocker auf den Rücken des Mannes und schieße.
Er brüllt auf und geht zu Boden. Sofort will er sich wieder hochrappeln, aber ich bin schon bei ihm angelangt. Er packt mich beim Fußknöchel und bringt mich zum Stolpern. Ich trete nach ihm. Mit wildem Blick zieht der Typ ein Messer – ich sehe es gerade noch rechtzeitig aufblitzen. Ich versetze ihm noch einen Tritt und rolle von ihm weg, bevor er mir die Klinge ins Bein rammen kann. Dann bekomme ich seine Jacke zu fassen. Wieder feuere ich den Elektroschocker ab, diesmal trennen uns nur wenige Zentimeter. Volltreffer. Sein ganzer Körper wird steif und er bricht zuckend auf dem Gehweg zusammen.
Ich werfe mich auf ihn und stemme ihm hart das Knie in den Rücken, bis er schluchzend stillhält. Polizeisirenen nähern sich, biegen um die Kurve. Um uns herum beginnen Schaulustige, sich zu sammeln, die das Ganze mit ihren Brillen filmen.
»Ich hab nichts gemacht«, wimmert der Mann immer wieder. Er ist kaum zu verstehen, so fest drücke ich sein Gesicht auf den Asphalt. »Die Frau im Café – ich kann dir ihren Namen nennen –«
»Klappe«, schneide ich ihm das Wort ab und lege ihm Handschellen an.
Überraschenderweise zeigt er sich folgsam. Das ist nicht immer so. Dennoch lasse ich ihn nicht los, bis ich rotblaues Licht über die Gebäudemauern flackern sehe und ein Polizeiwagen neben mir hält. Erst dann stehe ich auf und trete zurück, die Hände deutlich sichtbar für die Polizisten erhoben. Mein ganzer Körper kribbelt unter dem Rausch meines Jagderfolgs, während ich zusehe, wie zwei Beamten den Mann auf die Füße zerren.
5000Dollar! Wann hatte ich je auch nur die Hälfte einer solchen Summe zur Verfügung? Noch nie. Jetzt wird es mir zumindest eine Weile lang besser gehen – endlich kann ich den Mietrückstand begleichen, was den Vermieter fürs Erste beruhigen sollte. Und dann habe ich immer noch 1550 Dollar übrig. Ein Vermögen. Im Geiste gehe ich meine übrigen offenen Rechnungen durch. Vielleicht kann ich heute Abend ausnahmsweise mal etwas anderes als Instantnudeln essen.
Am liebsten würde ich Luftsprünge machen. Ich bin gerettet. Bis zur nächsten Jagd.
Es dauert einen Moment, bis mir auffällt, dass die Polizisten sich mit ihrem Gefangenen entfernen, ohne mich auch nur im Geringsten zu beachten. Mein Lächeln erlischt.
»Hey, Officer!«, rufe ich und jogge zu einer der Beamtinnen hinüber. »Nehmen Sie mich in Ihrem Wagen mit zur Wache und zahlen mir da meine Belohnung aus? Oder sollen wir uns dort treffen?«
Die Polizistin mustert mich auf eine Weise, die nicht gerade vermuten lässt, dass ich ihnen soeben einen Verbrecher auf dem Silbertablett serviert habe. Sie wirkt gereizt und die dunklen Ringe unter ihren Augen deuten auf Schlafmangel hin. »Du warst nicht die Erste«, sagt sie.
Ich bleibe stehen und blinzele verwirrt. »Was?«
»Ein anderer Jäger hat uns vor dir benachrichtigt.«
Ein paar Sekunden lang kann ich sie bloß anstarren.
Dann fluche ich drauflos. »So ein Schwachsinn! Sie haben doch selbst gesehen, wie ich ihn gestellt habe. Außerdem habe ich eine Bestätigung bekommen!« Ich hebe mein Handy, um ihr die Nachricht zu zeigen. Und natürlich macht genau in diesem Moment der Akku schlapp.
Nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte. Die Polizistin würdigt mich sowieso keines Blickes. »Das war nur eine automatische Antwort. Meinen Nachrichten zufolge stammte die erste Meldung von einem anderen Jäger. Und wer zuerst kommt, mahlt nun mal zuerst.« Sie zuckt bedauernd mit den Schultern.
Das ist so ziemlich die albernste Formalie, von der ich je gehört habe. »Von wegen!«, protestiere ich. »Wer soll denn dieser andere Jäger gewesen sein? Sam? Jamie? Die sind außer mir die Einzigen, die dieses Gebiet bearbeiten.« Entnervt winke ich ab. »Ach, was soll’s, da war doch sowieso kein anderer Jäger. Sie wollen nur nicht zahlen.« Die Frau wendet sich ab, aber ich lasse nicht locker. »Ich hab hier die Drecksarbeit für Sie erledigt! Das ist ja auch der Deal – wir Kopfgeldjäger kümmern uns um die Typen, die zu fangen Sie zu faul sind. Sie sind mir was schuldig und das –«
Der Partner der Frau packt mich am Arm und versetzt mir einen so heftigen Stoß, dass ich beinahe hingefallen wäre. »Schluss jetzt«, knurrt er mich an. »Emika Chen, richtig?« Seine andere Hand ruht auf seinem Pistolenholster. »Ja, an dich erinnere ich mich.«
Mit einer geladenen Waffe werde ich mich ganz sicher nicht anlegen. »Okay, okay.« Widerstrebend weiche ich zurück und hebe die Hände. »Ich gehe ja, in Ordnung? Bin schon weg.«
»Ich weiß, dass du schon mal hinter Gittern saßt, Kleine.« Sein Blick fixiert mich, bevor er sich wieder zu seiner Partnerin umdreht. »Zwing mich nicht, dir eine weitere Verwarnung zu geben.«
Ich höre, wie sie per Funk an einen anderen Tatort gerufen werden. Der Lärm um mich wirkt plötzlich gedämpft und das Bild der 5000 Dollar, die ich schon so greifbar vor Augen hatte, beginnt zu flimmern und verschwimmt bis zur Unkenntlichkeit. Innerhalb von nur 30 Sekunden wurde mir der sicher geglaubte Sieg entrissen und an jemand anderen weitergereicht.
Kapitel 2 – Geknickt verlasse ich …
2
Geknickt verlasse ich Manhattan. Es wird immer kälter und die vereinzelten Flocken haben sich in dichtes Schneegestöber verwandelt, aber der schneidende Wind in meinem Gesicht passt perfekt zu meiner Stimmung. Hier und da finden Straßenpartys statt und Leute in rot-blauen Trikots zählen lauthals die Minuten runter. Ich starre vor mich hin und lasse ihre Feierlaune an mir vorüberziehen. Das Empire State Building in der Ferne wird von allen Seiten mit Warcross-Bildern angestrahlt.
Früher, als ich noch im Heim gewohnt habe, bin ich oft aufs Dach geklettert, von wo aus man das Empire State Building sehen konnte. Stundenlang saß ich da, ließ die dünnen Beine baumeln und schaute mir die Warcross-Bilder an, bis die Sonne aufging und mich in goldenem Licht badete. Noch heute ergreift mich beim Anblick des Wolkenkratzers ein Hauch der alten Aufregung von damals.
Ein Piepsen meines E-Boards reißt mich aus meinen Tagträumen und ich blicke nach unten. Der Akku ist fast leer. Seufzend halte ich an und schlinge es mir über die Schulter. Dann krame ich in meinen Taschen nach Kleingeld und nehme den ersten U-Bahn-Eingang, den ich finden kann.
Die Dämmerung ist einem blaugrauen Abend gewichen, als ich schließlich den heruntergekommenen Apartmentkomplex in der Bronx erreiche, den ich mein Zuhause nenne. Diese Gegend, Hunts Point, ist die Kehrseite der Glitzerstadt New York. Die eine Wand des Gebäudes ist komplett mit Graffiti beschmiert. Im Erdgeschoss sind sämtliche Fenster mit rostigen Eisenstäben vergittert. Neben den Eingangsstufen türmt sich Müll – Plastikbecher, Imbissverpackungen, zerbrochene Bierflaschen –, teils gnädig verdeckt von einer dünnen Schneeschicht. Hier gibt es keine leuchtenden Werbebildschirme und über die schlaglochübersäten Straßen fahren keine schicken Robocars. Ich lasse die Schultern hängen, meine Füße sind schwer wie Blei. In meinem Magen gähnt noch immer ein Loch, aber im Moment weiß ich nicht, ob ich lieber was essen oder mich direkt ins Bett legen will.
Ein Stück die Straße hinunter richten sich ein paar Obdachlose für die Nacht ein. Vor dem heruntergelassenen Rollgitter eines Ladeneingangs schlagen sie ihre Zelte auf und breiten ihre Decken aus. Ihre abgewetzten Klamotten haben sie mit Plastiktüten gefüttert. Betrübt wende ich den Blick ab. Auch sie waren einmal Kinder, hatten vielleicht Familien, die sie geliebt haben. Wie sind sie hier gelandet? Wie würde ich an ihrer Stelle aussehen?
Ich quäle mich die Stufen zur Tür hoch. Im Flur stinkt es wie immer nach Katzenpisse und schimmeligen Teppichen und durch die dünnen Wände höre ich das Geschrei der Nachbarn, einen bis zum Anschlag aufgedrehten Fernseher, ein weinendes Baby. Ich entspanne mich ein bisschen. Vielleicht habe ich ja Glück und laufe meinem Vermieter nicht über den Weg, mit seinem Unterhemd, seiner Jogginghose und seinem roten Gesicht. Vielleicht kann ich wenigstens noch eine Nacht ungestört schlafen, bevor ich mich morgen früh mit ihm auseinandersetzen muss.
An meiner Tür klebt eine neue Räumungsmitteilung, genau dort, wo ich die alte abgerissen hatte. Einen Moment lang starre ich nur erschöpft darauf und lese sie noch einmal.
RÄUMUNGSMITTEILUNG
NAME DER MIETERIN: EMIKA CHEN
SOLLTE DER ZAHLUNGSRÜCKSTAND NICHT AUSGEGLICHEN WERDEN, ERFOLGT DIE RÄUMUNG IN72STUNDEN.
Musste er denn so dringend einen neuen Zettel aufhängen? Damit auch bloß jeder im Haus weiß, was los ist? Muss er mich noch mehr demütigen? Ich reiße die Mitteilung ab, zerknülle sie in der Faust und bleibe kurz stehen, den Blick auf die nun leere Stelle vor mir gerichtet. Eine vertraute Verzweiflung macht sich in mir breit, eine wachsende Panik, die in meiner Brust pocht, wie um aufzuzählen, was ich schuldig bin. Miete, Essen, Rechnungen, Kreditkarte. Wieder rattern mir die Zahlen durch den Kopf.
Wo soll ich nur bis übermorgen das Geld herbekommen?
»Hey!«
Ich zucke zusammen. Mr Aslo, mein Vermieter, kommt aus seinem Apartment und stakst mit finsterer Miene auf mich zu. Sein Gesicht weist Ähnlichkeit mit dem eines Fischs auf und sein dünnes orangerotes Haar steht zu Berge. Ein Blick in seine blutunterlaufenen Augen verrät mir, dass er mal wieder high ist. Na toll. Das bedeutet Diskussionen. Ich kann mich heute nicht mit noch jemandem anlegen. Hastig krame ich nach meinem Schlüssel, aber es ist zu spät – also straffe ich die Schultern und hebe das Kinn.
»Hey, Mr Aslo.« Ich habe es ziemlich gut raus, seinen Namen so auszusprechen, dass er wie Arschloch klingt.
Er stiert mich an. »Du gehst mir schon die ganze Woche aus dem Weg.«
»War keine Absicht«, wiegele ich ab. »Ich hab jetzt einen Job als Kellnerin, darum muss ich morgens immer früh raus und –«
»Wer braucht denn heute noch Kellnerinnen?« Misstrauisch kneift er die Augen zusammen.
»Na ja, die im Diner. Und andere Arbeit gibt es nicht. Ich hab gesucht.«
»Du wolltest heute zahlen.«
»Ich weiß.« Ich atme tief durch. »Ich komme später rüber, dann reden wir –«
»Hab ich was von später gesagt? Ich will die Kohle jetzt! Und du kannst gleich noch 100 Dollar draufschlagen.«
»Was?«
»Die Miete ist diesen Monat gestiegen. Im ganzen Block. Ist halt ’ne gute Wohnlage.«
»Das ist unfair!«, protestiere ich. »So was können Sie nicht machen – das haben Sie sich doch gerade ausgedacht!«
»Willst du mal wissen, was unfair ist, Kleine?« Mr Aslo funkelt mich an und verschränkt die Arme. »Dass du ganz umsonst hier haust.«
Ich hebe die Hände. Das Blut steigt mir in die Wangen, ich kann die Hitze spüren. »Ich weiß … aber ich …«
»Was ist mit Noten? Hast du mehr als 5000 davon?«
»Wenn ich die hätte, würde ich sie Ihnen geben.«
»Dann überleg dir halt was anderes«, schnauzt er und deutet mit seinem Wurstfinger auf mein Skateboard. »Wenn mir das Ding noch einmal unter die Augen kommt, mache ich Kleinholz draus. Verkauf es und gib mir das Geld.«
»Das ist doch höchstens 50 Dollar wert!« Ich mache einen Schritt nach vorn. »Hören Sie, ich tue alles, was Sie wollen, ich versprech’s Ihnen, ich schwör’s Ihnen«, purzeln mir die Worte in einem wirren Schwall aus dem Mund. »Aber bitte geben Sie mir noch ein paar Tage Zeit.«
»Jetzt pass mal auf, Kleine.« Er hebt drei Finger, einen für jeden Monat, den ich mit der Miete im Rückstand bin. »Von deiner Mitleidsmasche kann ich mir nichts kaufen.« Er lässt den Blick an mir herabwandern. »Wie alt bist du, 18?«
Ich erstarre. »Ja.«
Er deutet mit dem Kinn Richtung Haustür. »Frag mal beim Rockstar Club an. Die Mädels da machen 400 die Nacht, nur weil sie ein bisschen auf den Tischen tanzen. Du könntest vielleicht sogar 500 verdienen. Und die interessiert auch deine Polizeiakte nicht.«
Ich verdrehe die Augen. »Glauben Sie, das habe ich noch nicht versucht? Die nehmen nur Leute ab 21.«
»Ist mir egal, was du machst. Donnerstag ist die Bude leer, klar?« Mr Aslo brüllt jetzt, dass mir die Speicheltröpfchen ins Gesicht fliegen. »Und blitzsauber!«
»Als wär sie das beim Einzug gewesen!«, schreie ich zurück. Aber er hat schon kehrtgemacht und marschiert zurück zu seiner Wohnung.
Langsam atme ich aus, als er die Tür hinter sich zuknallt. Mein Herz hämmert gegen den Brustkorb und meine Hände zittern.
Ich muss an die Obdachlosen mit dem leeren Blick und den hängenden Schultern denken und dann an die Mädchen, die ich hin und wieder aus dem Rockstar Club kommen sehe, mit verschmiertem Make-up und in einer Wolke aus Rauch und Schweiß und billigem Parfüm. Mr Aslos Drohung ist eine Erinnerung daran, was aus mir werden könnte, wenn ich nicht bald ein bisschen Glück habe. Wenn ich nicht bald ein paar schwere Entscheidungen treffe.
Ich muss einen Weg finden, sein Mitleid zu wecken. Ihn weichzukochen. Geben Sie mir noch eine Woche und ich schwöre, Sie bekommen die Hälfte des Geldes. Versprochen. Während ich den Schlüssel umdrehe und die Tür öffne, übe ich das Gebettel schon mal im Geiste.
Bis auf das blaue Neonlicht, das durchs Fenster hereinfällt, ist es dunkel. Ich schalte das Licht ein, pfeffere meinen Schlüsselbund auf die Küchentheke und die zerknüllte Räumungsmitteilung in den Müll. Dann blicke ich mich um.
Das Apartment ist winzig, ein einziges, vollgestopftes Zimmer. Die gestrichenen Wände sind von Rissen durchzogen. Eine der Glühbirnen in der einsamen Deckenlampe ist kaputt und auch die zweite flackert leicht, wartet darauf, dass jemand sie ersetzt, bevor sie endgültig den Geist aufgibt. Auf dem ausklappbaren Esstisch liegt meine Warcross-Brille. Es ist ein älteres Modell, darum konnte ich sie billig mieten. Neben der Küchenzeile stehen zwei aufeinandergestapelte Pappkartons mit allem möglichen Zeug, vor dem Fenster liegen zwei Matratzen auf dem Boden und den restlichen Platz nehmen ein Uraltfernseher und eine durchgesessene senfgelbe Couch ein.
»Emi?«
Eine gedämpfte Stimme dringt unter der Decke auf der Couch hervor. Meine Untermieterin setzt sich auf, reibt sich übers Gesicht und fährt sich mit der Hand durch den blonden Haarwust. Keira. Offenbar ist sie mit ihrer Warcross-Brille eingeschlafen, deren Abdruck sich noch immer über ihre Wangen und Stirn zieht. Naserümpfend sieht sie zu mir hoch. »Hast du etwa wieder einen von deinen Typen dabei?«
Ich schüttele den Kopf. »Nein, heute nicht«, antworte ich. »Hast du Mr Aslo deine Hälfte der Miete gegeben?«
»Oh.« Sie weicht meinem Blick aus, lässt die Beine von der Couch baumeln und greift nach einer halb leeren Tüte Chips. »Ich geh am Wochenende zu ihm.«
»Dir ist schon klar, dass er uns Donnerstag rausschmeißt, oder?«
»Mir hat keiner was gesagt.«
Ich umklammere die Lehne unseres einzigen Stuhls. Sie hat die Räumungsmitteilung nicht gesehen, weil sie den ganzen Tag nicht die Wohnung verlassen hat. Ich atme tief durch, rufe mir in Erinnerung, dass auch Keira keine Arbeit findet. Nach fast einem Jahr vergeblicher Mühe hat sie schließlich aufgegeben und sich komplett in sich zurückgezogen. Mittlerweile verbringt sie den Tag mit nichts anderem als Warcross-Spielen.
Ich kenne dieses Gefühl der Hilflosigkeit nur zu gut, aber heute bin ich einfach zu abgekämpft, um noch viel Verständnis für sie aufzubringen. Ob sie wohl erst begreift, dass wir kein Zuhause mehr haben, wenn wir mit unserem Kram auf der Straße stehen?
Ich ziehe Schal und Kapuzenpullover aus und gehe in meinem Lieblings-Tanktop zum Herd, um Wasser aufzusetzen. Dann schlendere ich zu den beiden Matratzen.
Keira und ich haben zwischen unseren Betten eine provisorische Trennwand aus zusammengeklebten alten Pappkartons aufgebaut. Ich habe auf meiner Seite eine golden leuchtende Lichterkette befestigt, um sie so hübsch und gemütlich wie möglich zu gestalten. An der Wand daneben hängen eine Karte von Manhattan, voll mit meinen Kritzeleien, Zeitschriftencover mit Hideo Tanaka, eine handgeschriebene Bestenliste von Warcross-Amateuren und eine Weihnachtsbaumkugel aus meiner Kindheit. Das wertvollste Stück aus meinem Besitz ist ein altes Gemälde von meinem Dad – das letzte, das mir noch geblieben ist. Die Leinwand, die neben meiner Matratze an der Wand lehnt, ist eine einzige bunte Explosion, die Farben dick und strukturiert aufgetragen, als wären sie noch ganz frisch. Früher hatte ich mehr von seinen Bildern, aber mit der Zeit musste ich sie verkaufen, immer, wenn es finanziell eng wurde, musste ich Stück für Stück die Erinnerung an ihn fortgeben, um seine Abwesenheit zu überleben.
Ich lasse mich auf die Matratze plumpsen, die ein lautes Quietschen von sich gibt. Das Werbeschild des Schnapsladens gegenüber taucht die Wände in blaues Neonlicht. Ich liege ganz still, lausche dem ewigen Heulen der Polizeisirenen in der Ferne und starre auf einen alten Wasserfleck an der Decke über mir.
Wenn Dad jetzt hier wäre, würde er, ganz wie es sich für einen Dozenten für Modedesign gehört, geschäftig durch die Wohnung wuseln, Farben mischen und in alten Gläsern Pinsel auswaschen. Vielleicht würde er an seinem Lehrplan für das Sommersemester feilen oder über Entwürfen für die New York Fashion Week brüten.
Ich lasse den Blick durch den Raum schweifen und stelle mir vor, er wäre da, eine gesunde, nicht von der Krankheit gezeichnete Version von ihm: seine hochgewachsene, schlanke Silhouette im Gegenlicht an der Tür, sein blau gefärbtes Haardickicht, das im Dunkeln silbrig schimmert, sein sorgfältig getrimmter Dreitagebart, die schwarz gerahmte Brille, das verträumte Gesicht. Er würde ein schwarzes Hemd tragen, hochgekrempelt, sodass die bunten Tätowierungen an seinem rechten Arm zu sehen sind, und sein gesamtes Auftreten wäre absolut makellos – hochglanzpolierte Schuhe und perfekt gebügelte Hose –, bis auf die winzigen Farbspritzer an seinen Händen und in seinem Haar.
Ich muss lächeln bei der Erinnerung daran, wie ich mit baumelnden Beinen auf einem Stuhl saß und auf die Pflaster an meinen Knien hinuntersah, während mein Vater mir mit auswaschbarer Tönung bunte Strähnen ins Haar färbte. Meine Wangen waren noch tränenüberströmt, nachdem mich in der Schule ein anderes Kind so heftig geschubst hatte, dass ich schluchzend und mit Löchern in meiner Lieblingsjeans nach Hause rannte. Dad summte vor sich hin, während er sich um meine Haare kümmerte. Als er fertig war, hielt er mir einen Spiegel hin und ich schnappte entzückt nach Luft. Sehr trendy, sehr Givenchy, kommentierte er und tippte mir dabei sachte auf die Nase. Ich kicherte. Besonders, wenn wir es so frisieren. Siehst du? Er nahm mein Haar zu einem hohen Pferdeschwanz zusammen. Aber gewöhn dich nicht zu sehr daran – in ein paar Tagen wäscht sich das aus. So, und jetzt bestellen wir Pizza.
Dad hat immer gesagt, meine Schuluniform sei ein Pickel im Antlitz New Yorks. Und dass ich mich stets anziehen solle, als sei die Welt ein viel besserer Ort, als sie in Wirklichkeit ist. Wenn es regnete, füllte er das Haus mit Blumen. Er vergaß, sich nach dem Malen die Hände abzuwischen, und hinterließ überall bunte Fingerabdrücke. Von seinem bescheidenen Gehalt kaufte er am liebsten Geschenke für mich oder er gab es für Kunstmaterial, wohltätige Zwecke, Kleidung und Wein aus. Er lachte zu gern, verliebte sich zu schnell und trank zu viel.
Dann, als ich elf war, kam er eines Nachmittags nach Hause, setzte sich auf die Couch und starrte ausdruckslos vor sich hin. Er war beim Arzt gewesen. Und sechs Monate später war er nicht mehr da.
Der Tod hat die gemeine Angewohnheit, rücksichtslos all die Fäden zu durchschneiden, die man so sorgfältig zwischen Gegenwart und Zukunft gespannt hat. Den Faden, der zum Tag deines Collegeabschlusses führt, an dem dein Dad dich mit Blumen in deinem Wohnheim empfängt. Den Faden, an dessen Ende er dein Hochzeitskleid entwirft. Den, an dessen Ende er jeden Sonntag zum Essen in dein zukünftiges Zuhause kommt und sein schiefer Gesang dich so sehr zum Lachen bringt, dass dir die Tränen kommen. Ich hatte Hunderttausende dieser Fäden, doch dann wurden sie an einem einzigen Tag durchtrennt und ich blieb mit nichts als einem Stapel Rechnungen und Spielschulden zurück. Dads Tod ließ mir nicht mal ein Ziel, auf das ich meine Wut hätte richten können. Ich konnte nichts tun, als sie in den Himmel zu schreien.
Nachdem er gestorben war, fing ich an, seinen Look zu kopieren – wildes, buntes Haar (so ziemlich der einzige Luxus, den ich mir gönne) und ein Arm voller Tattoos (aus Mitleid gratis gestochen von Dads altem Tätowierer).
Ich betrachte die Bilder, die meinen linken Arm bedecken, und streiche leicht darüber, angefangen beim Handgelenk bis hoch zur Schulter: leuchtendes Blau und Türkis, Gold und Rosa – eine Pfingstrosenblüte (Dads Lieblingsblume), Häuser, die sich im Stil eines Escher-Gemäldes aus Meereswellen erheben, eine Abfolge von Noten, Planeten vor einem Weltraumhintergrund, zur Erinnerung an all die Nächte, in denen Dad mit mir zum Sternegucken aufs Land gefahren ist. Sie enden mit einer schmalen Zeile, die sich über mein linkes Schlüsselbein zieht, ein Mantra, das Dad mir eingebläut hat und das ich mir noch heute vorsage, wenn ich mal wieder die Hoffnung verliere.
Zu jeder verschlossenen Tür gibt es einen Schlüssel.
Zu jedem Problem gibt es eine Lösung.
Abgesehen natürlich von dem Problem, das ihn mir genommen hat. Und dem, das ich gerade habe. Bei dem Gedanken würde ich am liebsten die Augen zumachen und mich zusammenrollen, mich hinabsinken lassen an einen vertrauten dunklen Ort.
Das Brodeln des aufgesetzten Wassers reißt mich gerade noch rechtzeitig aus meiner Abwärtsspirale. Steh auf, Emi, ermahne ich mich.
Ich quäle mich aus dem Bett, schlurfe in die Küche und krame nach Instantnudeln. (Abendessen: 1 Dollar.) Mein Vorrat ist um eine Schachtel Makkaroni geschrumpft. Ich werfe Keira, die immer noch auf der Couch vor der Glotze hockt (gebrauchter Fernseher: 75 Dollar), einen finsteren Blick zu. Seufzend reiße ich die Nudelpackung auf und lasse den Inhalt ins Wasser gleiten.
Irgendwo im Gebäude wird gefeiert, wummernde Musik dringt an mein Ohr. Jeder Lokalsender zeigt heute irgendetwas, was mit der Eröffnungsfeier zu tun hat. Keira bleibt beim Zappen hängen, als ein Zusammenschnitt der Highlights aus dem letzten Jahr präsentiert wird. Dann gibt es einen Schnitt zu fünf Experten, die im obersten Stockwerk des Tokyo Domes sitzen und hitzig darüber debattieren, welches Team gewinnen wird und warum. Unter ihnen im Halbdunkel liegt die Arena mit 50000 jubelnden Fans, erleuchtet nur von herumwandernden roten und blauen Scheinwerfern. Goldenes Konfetti regnet von der Decke.
»Scheint, als wären wir uns alle einig, dass es noch nie eine so spannende Wildcard-Aufstellung gab wie dieses Jahr!«, schwärmt eine der Expertinnen, einen Finger aufs Ohr gedrückt, um über dem Lärm überhaupt etwas hören zu können. »Einer von ihnen ist sogar eine echte Berühmtheit.«
»Genau!«, stimmt ihr der Nebenmann enthusiastisch zu und auch die anderen nicken. Im Hintergrund startet ein Video, das einen Jungen zeigt. »DJ Ren hat sich bereits einen Namen in der französischen Underground-Musikszene gemacht – aber jetzt wird ihn Warcross ganz nach oben katapultieren!«
Während die Experten weiter über die neuen Spieler diskutieren, schlucke ich einen Anflug von Neid herunter. Jedes Jahr nominiert ein geheimes Komitee 40 Amateure, die sogenannten Wildcards, als Kandidaten für die Mannschaftsaufstellung. Wenn man mich fragt, sind das die größten Glückspilze der Welt. Meine Polizeiakte disqualifiziert mich leider automatisch dafür.
»Reden wir doch mal über Publikumszahlen. Glaubt ihr, wir brechen diesmal wieder einen Rekord?«, fragt die erste Expertin.
»Das letzte Jahr wird schwer zu toppen sein, aber möglich wäre es«, erwidert ein dritter Kollege. »Damals hatte das Endspiel insgesamt 300 Millionen Zuschauer. 300Millionen! Mr Tanaka muss wirklich stolz sein.« Wieder verändert sich der Hintergrund und zeigt nun das Logo von Henka Games, gefolgt von einem Video über den Warcross-Erfinder.
In dem Clip verlässt Hideo Tanaka in einem perfekt sitzenden Smoking einen Wohltätigkeitsball. An seinem Arm klammert sich eine junge Frau, der er seinen Mantel um die Schultern gelegt hat. Für einen 21-Jährigen wirkt er viel zu kultiviert und ich beuge mich vor, um ihn durch das Blitzlichtgewitter genauer in Augenschein zu nehmen. In den letzten Jahren hat sich Hideo von einem schlaksigen Teenie-Genie in einen eleganten jungen Mann mit eindringlichem Blick verwandelt. Höflich, so beschreiben ihn die meisten. Mehr weiß niemand mit Sicherheit, abgesehen von seinen engsten Vertrauten. Dennoch vergeht kaum eine Woche, in der er nicht die Titelseite irgendeiner Klatschzeitschrift ziert, die ihm Affären mit diesem oder jenem Starlet nachsagen und ihn immer wieder an die Spitze ihrer endlosen Listen setzen. Jüngster. Schönster. Reichster. Begehrenswertester.
»Dann wollen wir doch mal sehen, wie viele Zuschauer wir heute Abend haben!«, fährt die Expertin fort. Eine Zahl erscheint auf dem Bildschirm und alle applaudieren. 520 Millionen. Allein bei der Eröffnungsfeier. Damit ist Warcross offiziell das größte Event der Welt.
Ich nehme den Topf mit meinen Nudeln mit zur Couch und stopfe sie mechanisch in mich hinein, während Keira und ich weiter auf den Fernseher starren. Interviews mit kreischenden Fans, die gerade den Tokyo Dome betreten, die Gesichter bunt geschminkt, in den Händen selbst gebastelte Plakate. Stadionarbeiter, die ein letztes Mal die Technik überprüfen. Dokumentationen wie bei den Olympischen Spielen, die Fotos und Videos von jedem der Gamer zeigen. Danach folgen alte Spielszenen – zwei Mannschaften, die in Warcross’ endlosen virtuellen Welten gegeneinander antreten. Ein weiterer Schwenk auf die jubelnde Menge, dann sieht man die Profispieler backstage in ihren Garderoben. Lächelnd und mit erwartungsvoll funkelnden Augen winken sie in die Kamera.
Ein wenig verbittert macht mich das schon. Ich könnte eine von ihnen sein, wäre genauso gut wie sie, wenn ich die Zeit und das Geld hätte, den ganzen Tag zu spielen. Das weiß ich genau. Aber stattdessen sitze ich hier, esse Instantnudeln direkt aus dem Topf und frage mich, wie ich mich durchschlagen soll, bis die Polizei die nächste Kopfgeldjagd eröffnet. Wie das wohl ist, so ein perfektes Leben? Als Superstar, der von allen vergöttert wird? Wenn man seine Rechnungen pünktlich bezahlen und sich alles leisten kann, wonach einem der Sinn steht?
»Was machen wir denn jetzt, Em?«, bricht Keira das Schweigen. Ihre Stimme klingt hohl. Diese Frage stellt sie mir jedes Mal wenn es brenzlig wird, als wäre ich allein für unsere Rettung verantwortlich. Doch heute halte ich den Blick stur weiter auf den Fernseher gerichtet und antworte nicht. Angesichts der Tatsache, dass ich noch genau 13 Dollar besitze, ist meine Lage wohl aussichtsloser denn je.
Ich lehne mich zurück und jongliere fieberhaft mit Ideen. Ich bin eine gute – nein, eine hervorragende – Hackerin, aber niemand würde mir Arbeit geben. Ich bin zu jung und zudem vorbestraft. Wer würde schon eine verurteilte Identitätsbetrügerin einstellen? Wer lässt einen seine Geräte reparieren, wenn er weiß, man könnte dabei seine Daten stehlen?
So ist es nun mal, wenn man vier Monate Jugendknast in seiner Akte stehen hat – verbunden mit einer zweijährigen Computersperre. Na klar, hin und wieder benutze ich natürlich trotzdem mein aufgemotztes Handy und meine Brille – aber es hindert mich daran, mich für einen richtigen Job zu bewerben, einen, in dem ich wirklich gut wäre. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt dieses Apartment mieten durften. Alles, was ich bisher an Land ziehen konnte, sind vereinzelte Kopfgeldjagden und meine Teilzeitstelle im Diner – und von der kann ich mich auch verabschieden, sobald sie sich eine Robokellnerin zulegen. Ansonsten bliebe mir wohl nur noch, mich einer Gang anzuschließen oder auf Raubzüge zu gehen.
Gar nicht mal so abwegig.
Ich hole tief Luft. »Keine Ahnung. Ich könnte Dads letztes Gemälde verkaufen.«
»Em …«, fängt Keira an, redet aber nicht weiter. Ihr ist sowieso klar, dass mein Angebot sinnlos ist. Selbst wenn wir alles verscherbeln würden, was sich in unserem Apartment befindet, würden wir wahrscheinlich kaum mehr als 500 Dollar zusammenbekommen. Und die werden Mr Aslo bei Weitem nicht davon abhalten, uns auf die Straße zu setzen.
Eine vertraute Übelkeit nistet sich in meinem Magen ein und ich reibe mir über das Tattoo an meinem Schlüsselbein. Zu jeder verschlossenen Tür gibt es einen Schlüssel. Aber was, wenn das hier die Ausnahme ist? Wenn ich aus dieser Geschichte nicht heil herauskomme? Auf keinen Fall werde ich rechtzeitig genug Geld auftreiben können. Es gibt keinen Ausweg. Ich kämpfe gegen die Panik an, den Sog der Abwärtsspirale, und zwinge mich, ruhiger zu atmen. Mein Blick wandert vom Fernseher hinüber zum Fenster.
Egal, wo in der Stadt ich bin, ich weiß immer ganz genau, in welcher Richtung mein altes Kinderheim liegt. Und wenn ich es zulasse, verschwindet das Apartment um mich herum und ich bin zurück in den engen, dunklen Räumen mit der abblätternden gelben Tapete. Ich sehe, wie die älteren Kinder mich den Flur hinunterjagen und auf mich eindreschen, bis ich blute. Spüre die Bisse der Bettwanzen, den brennenden Schmerz von Mrs Devitts Ohrfeigen. Höre mich gedämpft in meinem Etagenbett weinen, während ich mir vergeblich vorstellte, wie mein Vater mich aus diesem Loch rettet. Fühle unter meinen Fingern den Maschendraht des Zauns, über den ich schließlich kletterte und floh.
Denk nach. Du findest eine Lösung, meldet sich eine hartnäckige Stimme in meinem Kopf. Das ist nicht dein Leben. Du wirst hier nicht ewig bleiben. Du bist nicht dein Vater.
Im Fernsehen werden nun die Lichter im Tokyo Dome gedimmt und der Jubel steigert sich zu ohrenbetäubendem Gebrüll.
»Und damit sind wir am Ende unserer Vorberichterstattung zur Warcross-Eröffnungsfeier!«, ruft einer der Experten mit heiserer Stimme. Er und seine Kollegen heben die Hände zum Victoryzeichen. »Liebe Zuschauer zu Hause, es wird Zeit. Setzen Sie Ihre Brillen auf und machen Sie sich bereit für das Event – des – Jahres!«
Keira hat ihre Brille bereits auf. Ich blicke zum Esstisch, wo meine eigene liegt.
Es gibt immer noch Leute, die Warcross für nichts als ein albernes Spiel halten. Andere behaupten, es sei revolutionär. Für Millionen von uns dagegen ist es der einzige absolut verlässliche Weg, unsere Probleme zu vergessen. Ein riesiges Kopfgeld ist mir durch die Lappen gegangen, morgen, wenn ich mich zu meinem Job ins Diner schleppen muss, wird wieder mein Vermieter vor der Tür stehen und lauthals sein Geld einfordern und in ein paar Tagen werde ich obdachlos sein und nicht wissen, wohin … aber heute Abend kann ich gemeinsam mit allen anderen meine Brille aufsetzen und mich im Zauber von Warcross verlieren.
Kapitel 3 – Ich erinnere mich …
3
Ich erinnere mich noch genau an den Augenblick, in dem Hideo Tanaka mein Leben verändert hat.
Ich war elf und mein Vater erst seit ein paar Monaten tot. Der Regen trommelte an die Fenster des Zimmers, das ich mir im Heim mit vier anderen teilte. Ich lag in meinem Bett und fand mal wieder nicht die Energie, um aufzustehen und in die Schule zu gehen. Unfertige Hausaufgaben lagen kreuz und quer über meine Decke verstreut, nachdem ich am Abend zuvor über den leeren Seiten eingeschlafen war. Ich hatte von zu Hause geträumt, von Dad, der uns Spiegeleier und Pfannkuchen mit jeder Menge Sirup machte. Seine Haare waren voller Klebstoff und Glitzer und sein dröhnendes, vertrautes Lachen erfüllte die Küche, drang zum offenen Fenster hinaus. Bon appétit, mademoiselle!, rief er verschmitzt. Und ich kreischte verzückt auf, als er die Arme um mich schlang und mir durchs Haar wuschelte.
Und dann wachte ich auf, das Traumbild verschwand und ließ mich in einem fremden, dunklen, stillen Haus zurück.
Ich regte mich nicht in meinem Bett. Ich weinte auch nicht. Nicht ein einziges Mal hatte ich seit Dads Tod geweint, sogar bei der Beerdigung nicht. Die Tränen, die ich vielleicht vergossen hätte, waren einer Art Schockstarre gewichen, als ich erfuhr, wie viele Schulden Dad angehäuft hatte. Als mir klar wurde, wie oft er sich seit Jahren in Onlinewettforen herumgetrieben hatte. Dass er sich überhaupt nicht im Krankenhaus hatte behandeln lassen, sondern stattdessen versucht hatte, einen Teil des Geldes abzustottern.
Und so verbrachte ich diesen Morgen genau wie jeden anderen Tag in den letzten paar Monaten: schweigend und untätig, wie betäubt. Jede Art von Gefühlen war schon lange in dem undurchdringlichen Nebel verschwunden, der sich in meiner Brust ausbreitete. Wenn ich wach war, starrte ich einfach vor mich hin – an die Zimmerwand, ans Whiteboard in der Schule, in meinen Spind, auf Teller mit nach nichts schmeckendem Essen. Meine Klausuren ertranken in roter Tinte. Eine permanente Übelkeit stahl mir den letzten Appetit. Meine Handgelenke und Ellbogen wurden immer spitzer und knochiger, die Ringe unter meinen Augen immer dunkler, was allen außer mir selbst auffiel.
Was hätte es mich auch kümmern sollen? Mein Vater war tot und ich war so unendlich müde. Vielleicht würde der Nebel in meiner Brust mich eines Tages ganz verschlucken und dann wäre ich endlich auch nicht mehr da. Ich rollte mich im Bett zusammen, sah zu, wie der Regen an die Scheiben peitschte und der Wind an den Silhouetten der Äste zerrte, und fragte mich, wie lange es wohl dauern würde, bis in der Schule jemand bemerkte, dass ich schon wieder fehlte.
Der Radiowecker – ein uraltes Ding, das als Spende ins Heim gelangt war, und außer den Betten der einzige Gegenstand im Zimmer – dudelte noch vor sich hin. Die anderen Mädchen hatten sich nicht die Mühe gemacht, ihn auszuschalten. Halbherzig lauschte ich den Nachrichten über den Stand der Wirtschaft, die Proteste in den Städten und auf dem Land, die Unfähigkeit der überlasteten Polizei, Verbrechen unter Kontrolle zu bekommen, und die Evakuierungen in Miami und New Orleans.
Dann begann eine Sendung, eine einstündige Dokumentation über einen Jungen namens Hideo Tanaka. Er war 14 Jahre alt und gerade erst ins Licht der Öffentlichkeit getreten. Ich horchte auf.
»Erinnern Sie sich noch an die Welt, bevor es Smartphones gab?«, fragte der Moderator. »Damals, als wir vor einem gewaltigen Quantensprung standen, als die Technik fast so weit war, aber eben noch nicht ganz, kurz bevor ein revolutionäres Gerät uns in ein neues Zeitalter katapultierte? Nun, letztes Jahr hat uns ein 13-jähriger Junge namens Hideo Tanaka in ein weiteres neues Zeitalter versetzt.
Und zwar, indem er eine kabellose Brille mit Metallbügeln und ausziehbaren Ohrhörern entwickelt hat. Täuschen Sie sich nicht. Diese hat nichts mit den Videobrillen zu tun, die Sie kennen – die aussehen, als hätte man sich einen Backstein vors Gesicht geschnallt. Nein, dieses ultraleichte Gadget wird NeuroLink genannt und trägt sich so leicht wie eine gewöhnliche Lesebrille. Wir haben hier das allerneueste Modell im Studio« – er machte eine Pause, um die Brille aufzusetzen –, »und Hand aufs Herz, etwas Sensationelleres habe ich noch nicht erlebt.«
NeuroLink. Davon hatte ich schon einmal in den Nachrichten gehört. Gespannt lauschte ich weiter.
Lange Zeit musste man, um eine einigermaßen überzeugende virtuelle Realität zu erschaffen, so detaillierte Simulationen wie möglich erstellen, was viel Geld und Mühe kostete. Aber so gut die Effekte auch waren, wenn man genau genug hinsah, konnte man immer noch einen Unterschied zur Realität erkennen. Im menschlichen Gesicht finden pro Sekunde tausend kleine Bewegungen statt, ein Blatt an einem Baum weht auf eine Million verschiedene Weisen. In der echten Welt existieren unzählige winzige Dinge, die der virtuellen fehlen. Und das ist dem Gehirn klar, wenn auch nur unterbewusst – irgendetwas wirkt immer falsch, auch wenn man nie genau sagen kann, was eigentlich.
Also ließ Hideo Tanaka sich eine simplere Lösung einfallen. Für eine perfekt wirklichkeitsgetreue Welt muss man nämlich gar nicht die detaillierteste, realistischste 3-D-Szenerie aller Zeiten kreieren.
Man muss dem Publikum nur vorgaukeln, sie sei real.
Und wer könnte das wohl am besten? Genau, das eigene Gehirn.
Ganz egal, wie verrückt ein Traum ist, im Schlaf halten wir ihn für Wirklichkeit. Dort erleben wir Dolby-Surround-Sound, Special Effects in 360 Grad und HD. Obwohl man nichts davon tatsächlich vor sich sieht. Das Gehirn erschafft die ultimative virtuelle Realität, ganz ohne Technik.
Also erfand Hideo das beste Hirn-Computer-Interface, das es je gab. Eine schlanke, leichte Brille. Den NeuroLink.
Einmal aufgesetzt, hilft er dem Gehirn, virtuelle Welten zu erschaffen, die in Aussehen und Ton nicht von der Realität zu unterscheiden sind. Und jetzt stelle man sich mal vor, man spazierte durch eine solche Welt – würde dort mit anderen interagieren, spielen, reden. Man stelle sich vor, man könnte durch das realistischste virtuelle Paris aller Zeiten schlendern oder an einer perfekten Simulation eines hawaiianischen Strandes liegen. Oder durch eine Fantasielandschaft voller Drachen und Elfen fliegen. Alles, was man nur will.
Mit einem winzigen Knopf am Gestell kann man wie bei einer polarisierenden Sonnenbrille sogar zwischen der virtuellen und der realen hin und her wechseln. Und wenn man die echte Welt durch den NeuroLink betrachtet, leuchten über den reellen Objekten und Orten Elemente der virtuellen Realität auf. Man kann Drachen über die Straßen von New York fliegen sehen. Namen über Geschäften, Restaurants und Menschen einblenden lassen.
Um zu demonstrieren, wie cool seine Brille ist, erschuf Hideo außerdem ein Videospiel, das es bei jedem Kauf kostenlos dazugibt. Das Spiel heißt Warcross.
Das Konzept ist einfach: Zwei Mannschaften treten gegeneinander an, wobei eine versucht, der anderen ihr Artefakt (einen funkelnden Edelstein) abzuluchsen, ohne dabei das eigene zu verlieren. Was das Ganze so spektakulär macht, sind die virtuellen Welten, in denen die Kämpfe stattfinden. Denn jede einzelne davon ist so realistisch, dass man, sobald man seine Brille aufsetzt, das Gefühl hat, man sei schnurstracks dorthin transportiert worden.
Im Laufe der Radiosendung erfuhr ich, dass Hideo in London geboren und in Tokio aufgewachsen ist und sich mit elf Jahren selbst das Programmieren beigebracht hat. Genauso alt wie ich damals. Kurz darauf baute er im Computerreparaturladen seines Vaters den ersten NeuroLink, unterstützt von seiner Mutter, einer Neurowissenschaftlerin. Seine Eltern halfen ihm bei der Finanzierung einer Auflage von 1000 Stück und schon bald konnte er die ersten Brillen an ihre Käufer versenden. Über Nacht stiegen die 1000 Bestellungen auf 100000 an. Dann auf eine Million, zehn Millionen. Investoren meldeten sich mit schwindelerregend hohen Angeboten. Es kam zu Patentstreitigkeiten. Experten diskutierten darüber, wie der NeuroLink sich auf den Alltag, Reisen, Medizin, Militär und Bildungssystem auswirken könne. Link Up lautete der Titel eines Frankie-Dena-Hits.
Und jeder – wirklich jeder – hatte einen NeuroLink. Manche bildeten Mannschaften und fochten mit vollem Einsatz stundenlange Warcross-Kämpfe aus. Andere lagen lieber an einem virtuellen Strand oder gingen auf Safari. Und wieder andere trugen ihre Brillen am liebsten, um in der echten Welt ihre virtuellen zahmen Tiger auszuführen oder die Straßen mit ihren Lieblingsstars zu bevölkern.
Wie auch immer die Leute es nutzten, für die meisten war der NeuroLink inzwischen ein wichtiger Teil ihres Lebens.
Mein Blick wanderte vom Radio zu den Hausaufgaben auf meiner Bettdecke. Hideos Geschichte hatte etwas in mir geweckt, das sich nun durch den Nebel in meiner Brust Bahn brach. Wie konnte ein Junge, der nur drei Jahre älter war als ich, die Welt so einfach im Sturm erobern? Ich blieb liegen, bis die Sendung vorbei war und wieder Musik gespielt wurde. Und dann noch eine Stunde länger. Schließlich richtete ich mich ganz langsam auf und griff nach einem der Arbeitsblätter.
Es stammte aus meinem Informatik-Grundkurs. In der ersten Aufgabe musste man den Fehler in einem einfachen, dreizeiligen Programmierungscode finden. Während ich mich auf die Suche machte, stellte ich mir einen elfjährigen Hideo an meiner Stelle vor. Er hätte sicher nicht bloß dagelegen und ins Nichts gestarrt, sondern die Aufgabe gelöst, und dann die darauffolgende und dann die danach.
Der Gedanke rief eine Erinnerung an meinen Vater wach, der auf meinem Bett saß und mir ein Rätsel auf der Rückseite einer Zeitschrift zeigte. Es bestand aus zwei scheinbar identischen Bildern und der Leser sollte die Unterschiede zwischen ihnen herausfinden.
Das ist doch ein Scherz, verkündete ich damals mit verschränkten Armen, nachdem ich die beiden Bilder genau studiert hatte. Die sind beide komplett gleich.
Dad lächelte nur und schob seine Brille zurecht. An jenem Tag hatte er mit neuen Materialien experimentiert, was seinen Haaren deutlich anzusehen war. Später musste ich ihm helfen, die klebstoff- und farbverschmierten Strähnen herauszuschneiden. Sieh noch mal genau hin, forderte er mich auf, zog den Bleistift hinter seinem Ohr hervor und führte ihn in einer schwungvollen Bewegung über die Seite. Denk an ein Gemälde an der Wand. Da kannst du ohne jegliche Hilfsmittel feststellen, ob es schief hängt – und sei es auch nur ein kleines bisschen. Du erkennst einfach, dass da was nicht stimmt. Oder?
Ich zuckte mit den Schultern. Hm, kann sein.
Menschen sind in der Hinsicht überraschend wahrnehmungsfähig. Wieder deutete Dad mit seinen farbbeklecksten Fingern auf die beiden Bilder. Du musst lernen, etwas in seiner Gesamtheit zu betrachten, nicht nur die Einzelheiten.Entspann den Blick. Richte ihn auf das Bild als Ganzes.
Ich versuchte es und lehnte mich zurück. Und in dem Moment sah ich den Unterschied, eine winzige Markierung auf einem der Bilder. Da!, rief ich aufgeregt und zeigte auf die Stelle.
Dad lächelte mir zu. Siehst du?, sagte er. Zu jeder verschlossenen Tür gibt es einen Schlüssel, Emi.
Mit den Worten meines Vaters im Ohr starrte ich auf das Arbeitsblatt. Wieder tat ich, was er gesagt hatte, lehnte mich zurück und ließ den ganzen Code auf mich wirken, wie ein Gemälde. Als suchte ich nach einem Fokuspunkt.
Und beinahe sofort erkannte ich den Fehler. Ich griff nach meinem Schul-Laptop, klappte ihn auf und tippte den korrigierten Code ein.
Er funktionierte. Hallo, Welt!, grüßte mich das Programm.
Bis heute kann ich nicht beschreiben, was für ein Gefühl es war, meine Lösung auf dem Bildschirm funktionieren zu sehen. Die Erkenntnis, dass ich die Macht hatte, mit nur drei kleinen Textzeilen eine Maschine exakt das tun zu lassen, was ich wollte.
Plötzlich begannen die Rädchen in meinem Kopf, ganz eingerostet vor Kummer, sich wieder zu drehen, und verlangten nach einer weiteren Aufgabe. Also löste ich die zweite. Und dann die dritte. Immer schneller wurde ich, bis ich schließlich nicht nur das Arbeitsblatt durchhatte, sondern gleich mein ganzes Informatikbuch. Der Nebel in meiner Brust lichtete sich und gab das lebendige, pochende Herz darin frei.