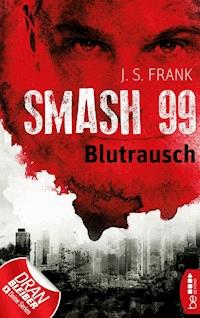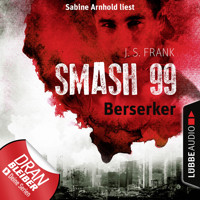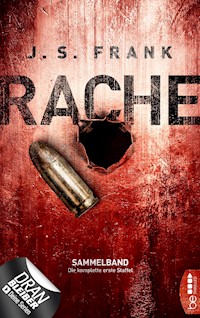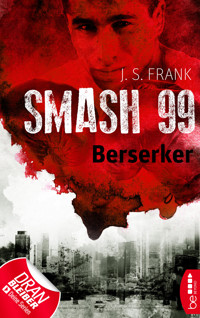
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Smash99-Dystopie
- Sprache: Deutsch
FOLGE 4 - BERSERKER: Gegen den Rat ihres Vorgesetzten reist die amerikanische TV- Journalistin Frances in ihre alte Heimat - dem neuen Mekka der Gewalt. Doch Frances sind die täglichen Gemetzel egal. Sie hängt schon lange nicht mehr an ihrem Leben. Auf der "Smasher-Street" lernt sie Cage-Fighter Joey und den ehemaligen Kommissar Lepko kennen. Wie Frances haben beide Männer schon zu viele Verluste erlebt, als dass der Tod sie noch schrecken könnte. Gemeinsam beschließt das ungleiche Trio, sich dem Smash-Wahnsinn in den Weg zu stellen ...
DIE SERIE: Ein fremdartiges Toxin verbreitet sich rasend schnell - Smash. Wer damit infiziert wird, verwandelt sich innerhalb von Sekunden in einen vor Wut rasenden Smasher, der seine Mitmenschen anfällt und zerfetzt, bevor er selbst stirbt. Niemand weiß, wer hinter der Verbreitung des Gifts steckt. Klar aber ist: In einer Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs sind Smasher nicht dein größer Feind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Serie
Folge 4: Berserker
Über den Autor
Titel
Impressum
1. Kapitel: Blutiger Asphalt
2. Kapitel: Töten und Übertöten
3. Kapitel: Die Schlangengrube
4. Kapitel: Die Kämpfer
5. Kapitel: Der Fremde
6. Kapitel: Die Rekrutierung
7. Kapitel: Das Himmelfahrtskommando
8. Kapitel: Startschuss
9. Kapitel: Showdown
10. Kapitel: Overkill
In der nächsten Folge
Die Serie
Ein fremdartiges Toxin verbreitet sich rasend schnell – Smash. Wer damit infiziert wird, verwandelt sich innerhalb von Sekunden in einen vor Wut rasenden Smasher, der seine Mitmenschen anfällt und zerfetzt, bevor er selbst stirbt. Niemand weiß, wer hinter der Verbreitung des Gifts steckt. Klar aber ist: In einer Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs sind Smasher nicht dein größer Feind.
Folge 4: Berserker
Gegen den Rat ihres Vorgesetzten reist die amerikanische TV- Journalistin Frances in ihre alte Heimat – dem neuen Mekka der Gewalt. Doch Frances sind die täglichen Gemetzel egal. Sie hängt schon lange nicht mehr an ihrem Leben. Auf der ›Smasher-Street‹ lernt sie Cage-Fighter Joey und den ehemaligen Kommissar Lepko kennen. Wie Frances haben beide Männer schon zu viele Verluste erlebt, als dass der Tod sie noch schrecken könnte. Gemeinsam beschließt das ungleiche Trio, sich dem Smash-Wahnsinn in den Weg zu stellen …
Über den Autor
J.S. Frank hat nach seinem Germanistik-Studium mehr als zwanzig Jahre für ein internationales Medien-Unternehmen gearbeitet. Seit 2013 ist er freier Autor mit einem ungebrochenen Faible für die anglo-amerikanische und französische Literatur. J.S. Frank ist ein Pseudonym des Autors Joachim Speidel, der mit seinen Kurzgeschichten bereits zweimal für den Agatha-Christie-Krimipreis nominiert war.
J.S. Frank
Smash99
FOLGE 4
Berserker
beBEYOND
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Uwe Voehl
Projektmanagement: Stephan Trinius
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock/501room; © shutterstock/Molodec; © shutterstock/Bildagentur Zoonar GmbH; © shutterstock/Nikolas_jkd
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3727-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1. Kapitel: Blutiger Asphalt
SAMSTAG, 06. FEBRUARDiese Szene werde ich nie vergessen: ein Clown am Boden. Mitten auf der Straße. Mit dem Bauch auf dem nackten Asphalt. Augen, die nicht lachen, sondern vor Angst schreckgeweitet sind. Eine bebende, rot getupfte Nase. Ein Mund mit hochgeschminkten Winkeln, der, wenn man genau hinsieht, verzerrt vor Schmerz ist. Der Clown hat eine frische Schusswunde im Rücken. Sein froschgrüner Frack saugt sich dort voll mit Blut.
Schaulustige, die in Hauseingängen stehen und aus den Fenstern von Kneipen starren, machen mit ihren Smartphones Fotos und nehmen Videos auf. Der Clown sieht sich hilfesuchend um. Unsere Blicke treffen sich. Er streckt mir die Hand entgegen. Seine Lippen formen ein Wort, das ich nur zu gut kenne.
Mein Puls ist bereits auf hundertachtzig, nun beginnt er, sich zu überschlagen. Ich kauere hinter einem umgekippten Bistro-Tisch am Eingang eines Cafés. Im nächsten Moment schnelle ich hoch. Verlasse meine Deckung. Renne in gebückter Haltung auf den Clown zu. Vielleicht nimmt mich gerade jetzt ein Heckenschütze ins Visier. Egal. Ich renne weiter.
Was für eine Szene! Nein, sie stammt nicht aus einem Albtraum. (Und mit Albträumen kenne ich mich aus!) Es hat sich tatsächlich so abgespielt. Wo? Na, hier! Hier in der Stadt! In der Karlstraße. In der Straße der Smasher, wie die Medien sie nennen.
Ich weiß noch, wie mich Mister T. davor gewarnt hat, nach Deutschland zu reisen. »Dieses Land ist das Mekka der Gewalt, der Zerstörung, der Barbarei! Eine absolute No-go-Area! Vor allem für Sie!« Mit erhobenem, lehrerhaftem Zeigefinger ermahnte er mich, jeglicher Gefahr aus dem Weg zu gehen. »Frances«, sagte er. »Sie haben bisher Risiken sehr gut einschätzen können. Aber seit dem Zwischenfall in Mexiko …«
»Fangen Sie nicht schon wieder damit an!«
Mr. T. ist kein farbiger, zwei Meter großer, mit Muskeln bepackter Action-Held, der einem in allen misslichen Lebenssituationen beisteht. Er ist mein Psychotherapeut. Mr. Leonard Turner. Ein kleines Männchen mit polierter Glatze und zwei schwarzen Haarbüscheln über den Ohren. Seit dem »Zwischenfall« in Mexiko glaubt er, dass der Tod für mich eine gewisse Anziehungskraft besitzt. Anders ausgedrückt: Er glaubt, ich sei selbstmordgefährdet.
»Gehen Sie am besten wohin, wo alles vollkommen harmlos ist. Was halten Sie von einem Zen-Kloster? Oder einem Aschram in Indien. Oder besuchen Sie mittelalterliche Kirchen in Europa.«
»In Deutschland gibt es sehr viele davon.«
»Nein! Hören Sie mit Deutschland auf! Frances, denken Sie daran, was Sie in Deutschland erwartet! Smash! Terroranschläge mit diesem teuflischen Gift!«
»Ach was? Wollen Sie mir Angst machen?«
Er blickte mich über den Rand seiner Brille an. »Lesen Sie keine Zeitung? Interessieren Sie sich nicht mehr für die Medien, Frances? Gerade Sie, eine ehemalige Auslandskorrespondentin?«
In der Tat interessierte ich mich nicht mehr sonderlich für die Medien. Ich sah keine Nachrichtensendungen mehr an und las oft nur noch die Headlines, die Überschriften.
Ich setzte eine betont unschuldige Miene auf. »Was ist eigentlich Smash? Was wissen Sie darüber?« Ich spielte bewusst die Naive und schlüpfte in die Rolle der Unwissenden. Damit er in die Rolle des Allwissenden schlüpfen konnte. Sie gefiel ihm außerordentlich gut.
»Ein Toxin«, fing er an. »Jeder kann damit vergiftet werden. Mutter, Vater, der Bäcker an der Ecke, der Taxifahrer, alle. Das Gift kann in Lebensmitteln stecken, oder irgendwelche Terroristen spritzen es einem genau in dem Augenblick, wo man nicht aufpasst.«
Er faltete die Hände vor dem Bauch und erging sich darin, sein lexikalisches Wissen abzuspulen. »Das Gift ist zumeist tödlich für den Vergifteten, aber weit schlimmer ist, dass Smash den Vergifteten kurz vor seinem Tod aufs Grausamste verändert. Er mutiert zu einem Berserker, zu einem sogenannten Smasher. Fällt Passanten, Freunde, Familienangehörige an und zerfetzt sie. Solche Gemetzel sieht man normalerweise nur in Zombiefilmen.«
Ich legte die Stirn in Falten. »Und was macht die deutsche Regierung? Schaut sie dabei tatenlos zu?«
»Sie hat mächtig in den Ausbau der inneren Sicherheit investiert. Wahrscheinlich ist es die einzige Möglichkeit, den Menschen wieder ein einigermaßen erträgliches Leben zu verschaffen. Aber zu welchem Preis? Frances, Sie sind hierhergekommen, in die USA, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie sind ein Mensch, der die persönliche Freiheit über alles liebt. In Deutschland existiert diese praktisch nicht mehr, weil überall Chaos herrscht. Die Polizei ist zwar omnipräsent und überall laufen schießwütige Sicherheitskräfte herum, aber wie wollen Sie sich entfalten, wenn Ihre Sicherheit mit jedem Schritt gefährdet ist?«
»Sie wollen mir also abraten, in mein Heimatland zu reisen?«
»Ich möchte Ihnen aufs Dringlichste davon abraten! Sie könnten da auf dumme Gedanken kommen!«
Ich muss zurückspulen. Rewind. Den Film auf Anfang setzen. Die Zeit zurückdrehen. Also: gestern Nachmittag (Freitag, 05. Februar) sechzehn Uhr. Der New Yorker Flughafen Newark. Ein Ticket nach Deutschland. Die Frau am Schalter der Fluggesellschaft – Typ: nett, freundlich, kurz geschnittene, blonde Haare, professionell distanziert – fragte zweimal nach, ob ich wirklich nur den Hinflug buchen wollte.
»Ja«, sagte ich. »Den Rückflug kann ich mir schenken.«
Sie lächelte mich immer noch an. Doch jetzt mit einem Ausdruck im Gesicht, als habe sie mich nicht richtig verstanden.
»Sie wissen aber, dass …?«, fing sie an.
»Weiß ich! Machen Sie sich keine Sorgen wegen mir. Ich kann auf mich aufpassen.«
Ihr verging das Lächeln. Sie warf einen Blick auf meine Personalien, murmelte meinen Namen: »Franz…« Sie hatte Schwierigkeiten mit der Aussprache. »Franziska Raue?«
»Richtig. Sie können mich aber auch Frances nennen.«
Ein kurzer, nüchterner Augenaufschlag, dann klärte sich ihre Miene auf. »Ich sehe gerade Ihr Geburtsdatum, Sie sind ja Widder? Als Widder können Sie ja …«
Ich beugte mich leicht über den Tresen. »Wissen Sie, Süße!« (Ich sagte wirklich Süße zu ihr. Wenn jemand so was zu mir sagen würde, würde ich durchdrehen, aber sie nervte mich, und ich hatte Lust, sie ein wenig zu verletzen.) »Ich finde es wirklich sehr niedlich, dass Sie mir hier auf dem Flughafen ein Horoskop stellen wollen. Aber ganz im Vertrauen – ich glaube weder an Astrologie, Telepathie, Hellseherei, Telekinese, an die Mächte des Schicksals oder an Ufos. Ich möchte einen Flug nach Deutschland. Mehr nicht.«
Ende der Diskussion. Die strittigen Punkte waren geklärt. Ich bekam mein Ticket, trieb mich noch eine Weile am Flughafen herum, stieg ins Flugzeug und landete nach einem Zwischenstopp in London um die Mittagszeit in Deutschland.
Um genau zu sein: Um elf Uhr fünfunddreißig betrat ich den Heimatboden. Ich überlegte kurz, ob ich niederknien und die Startbahn küssen sollte. Wie dieser Papst damals, der eine Schwäche für die Startbahnen der Welt hatte. Aber weshalb hätte ich so was tun sollen? Ich hatte nie eine besondere Verbindung zu Deutschland, keine Hass-, aber auch keine Liebesgefühle. Keine Eltern (die sind bei einem Zugunglück ums Leben gekommen), keine Geschwister (die sind nie geboren worden). Ein paar Freunde, mit denen ich gelegentlich Mails austausche oder skype, mehr nicht. Bin vor etwa fünf Jahren weggezogen, in die weite Welt hinaus, habe mich überall und nirgends aufgehalten, hatte jedoch immer eine Adresse in Atlanta, USA. Sogar die empfand ich damals als Einschränkung. Aber wenn man dort arbeiten wollte, brauchte man einen Briefkasten für die Post. Selbst wenn man als Auslandskorrespondentin die meiste Zeit rund um den ganzen Globus unterwegs war.
Also – Niederknien kam für mich nicht infrage. Dennoch hatte ich ein gutes Gefühl, wieder hier in der alten Heimat zu sein. Hier, wo mein Leben vor einunddreißig Jahren seinen Anfang genommen hatte und wo es – von mir aus – irgendwann in nächster Zeit auch sein Ende finden konnte.
Im Flughafengebäude schlenderte ich in Richtung Ausgang, als sich mir zwei Reinigungskräfte in orangefarbenen Anzügen und Mützen in den Weg stellten. Der eine, ich schätze mal ein Inder, sagte mit vorwurfsvollem Ton: »Haben Sie die Absperrung nicht gesehen?«
»Absperrung?« Ich sah mich um. Ein schmaler Streifen des Gangs war über eine Länge von vielleicht zwanzig Metern mit Signalband markiert worden. An dem einen Ende war es eingerissen, und ich war gedankenverloren hindurchspaziert.
Nicht weit entfernt sah ich die riesige Lache klebrigen, dunkelroten Blutes. Jetzt erst bemerkte ich auch, dass die Betonwand neben mir von oben bis unten mit Blut bespritzt war.
»Scheiße! Was ist hier denn passiert?«, fragte ich den Inder.
Er sah mich an, als käme ich vom Mond. »Na, was wohl! Das war wieder so ein Scheiß-Giftanschlag!«
Die beiden Reinigungskräfte ließen mich stehen und fuhren damit fort, das Blut aufzuwischen.
Draußen vor dem Flughafengelände winkte ich ein Taxi heran. Und dachte: Willkommen in Smasherland!
Ich hatte noch in den Staaten online ein Hostel gebucht. Einfache Ausstattung. Sauber. Makellos. Günstig. Es lag hinter dem Güterbahnhof. An der Rezeption ein dünnes Mädchen mit weiß gefärbten Haaren, die wie Stacheln nach allen Seiten wegstanden, und mit Unterarmen voller frischer Tattoos. Sie leuchteten ungesund rot. Das Mädchen war nicht gerade gesprächig, warf mir den Schlüssel hin und erklärte mit wenigen Worten, wie ich zu meinem Zimmer gelangte.
Die Fenster waren schallisoliert. Immerhin. Es gab ein Bett (sogar ein Doppelbett), einen Tisch, zwei Stühle, einen Kleiderschrank, ein Bad, ein Klo. Was braucht man mehr zum Leben? Oder für einen Kurz-Trip? Oder zum Sterben?
Nachdem ich meine Sachen verstaut und mich ausgehfertig gemacht hatte (feste Winterstiefel, gefütterte Daunenjacke – es war schließlich noch Februar!), ging ich wieder nach unten. Die Göre war auf einmal gar nicht mehr so maulfaul, nachdem ich wissen wollte, wie ich zu der berühmten Karlstraße kommen konnte. Sie blühte richtig auf, nannte mir sogar ihren Namen: Téa. Sie kannte die Straße. (Natürlich! Wer kennt sie nicht? Selbst in den Staaten ist sie mittlerweile der Inbegriff für alltägliche Gewalt in Großstädten!) Téa war schon dort gewesen. Sogar mehrfach. Hatte aber noch nie den Auftritt eines Smashers live miterlebt. Ich erfuhr von ihr, dass sie erst seit Kurzem – seit knapp vier Monaten – wieder in Deutschland war. Sie jobbte tageweise, manchmal auch nur stundenweise hier im Hostel. Erzählte was davon, dass sie mit ihren Eltern im Ausland gelebt hatte.
»Und deine Eltern?«, wollte ich wissen. »Wo sind die jetzt?«
Sie zuckte die Achseln. Spielte die Coole: »Keine Ahnung. Haben sich getrennt. Jeder ist seiner Wege gegangen. Und da haben sie mich vergessen.« Sie kratzte sich an dem Tattoo ihres rechten Unterarmes. Mit viel Fantasie konnte man so was wie einen Drachen erkennen.
Bevor ich ging, rief Téa mir noch hinterher: »He, passen Sie auf sich auf!«
Ich lachte. »Oh, hätte ich beinahe vergessen. Klar doch! Traust du mir es nicht zu?«
»Quatsch! Aber wir hatten auch schon Gäste, deren Sachen sind von den Bullen abgeholt worden.«
Eine Viertelstunde Fahrt mit der U-Bahn. Ein Hinweisschild, dass ich jetzt in die ZONE 2 kam. Ich hatte mich kurz vor meiner Abreise in den Staaten kundig gemacht: ZONE 2 hieß, dass hier die Observierung der Straßenzüge, der öffentlichen Plätze, der Einkaufsmöglichkeiten, der Wohnanlagen recht lückenhaft war. Wer sich in die ZONE 2 begab, tat dies auf eigene Verantwortung. Hier agierten nur private Security-Firmen. Polizei sah man hier bloß, wenn jemand starb. Oder getötet wurde.
Es war frostig, aber immerhin schien die Sonne. Ich reihte mich ein in die Menge der Leute, die in Richtung Karlstraße schlenderten. Schob mir unterwegs noch einen Hotdog rein.
Die Karlstraße hatte eine ziemliche Berühmtheit erlangt als die Straße mit den meisten Smasher-Vorfällen. Pro Monat trieben hier im Schnitt etwa zwanzig zu blutrünstigen Bestien mutierte Menschen ihr Unwesen. Meistens wurden sie rechtzeitig von Snipern der Sicherheitsdienste abgeknallt, bevor sie irgendwelche Passanten anfallen konnten. Es war ein offenes Geheimnis, dass nicht alle, die von den Snipern abgeknallt wurden, Smasher waren. Epileptiker, Besoffene, Randalierer waren ihnen schon ins Visier gelaufen und hatten dran glauben müssen. Die Scharfschützen mussten zwar pro forma mit Ermittlungen rechnen, aber die wurden meist nach wenigen Stunden wieder eingestellt.
Schon von Weitem war die Straße zu hören. Musik, Lachen Getöse. Wie auf einem Marktplatz. Oder wie Mardi Gras in New Orleans. Oder wie Karneval in Rio. Als ich um die Ecke bog, erkannte ich, dass ich mit Karneval gar nicht so verkehrt lag.
Die Karlstraße war brechend voll mit Menschen, jung und alt, alle Hautfarben, Männer, Frauen, Transen, Punker, Armani-Anzug-Träger, Touristen aus der ganzen Welt. Musik tönte aus Bars, Cafés, Stehimbissen, Kneipen. Ich war sofort mittendrin. Ließ mich mittreiben. Lachte, wenn die Menschen um mich herum lachten. Trank mit, wenn man mir eine Flasche reichte, legte meine Arme um fremde Schultern, so wie man mir Arme um die Schultern legte.
Das war also die berühmte Smasher-Street. Hier herrschte eine besondere Atmosphäre, nahe an der Hysterie. Hier traf man auf überbordende Lebensfreude, Adrenalin-geschwängert, wie beim Anstehen für die Achterbahnfahrt. Das Lachen war schriller, die Gesichtszüge verzerrter. Aber alle waren in höchster Aufmerksamkeit, die Ohren gespitzt. Die Sensorik auf hyper-fein gestimmt. Ein unbekanntes Geräusch, und der Kopf fuhr herum.
Nach vielleicht hundert Metern hatte ich genug. Quetschte mich an einen der vielen kleinen Tische, die vor einem französisch anmutenden Café namens Chez Paul standen, bestellte ein Glas Weißwein und gab mich der Stimmung auf der gefährlichsten Straße der Welt hin.
Wolken trieben über den Nachtmittagshimmel und schoben sich vor die Wintersonne. Schneeflocken kreiselten plötzlich durch die Luft. Ich zog mir den Kragen meiner Daunenjacke fester um den Hals.
Ich genoss den eisigen Hauch, der durch die Straße wehte. Sie leerte sich zusehends. Die Schar der Touristen und Schaulustigen dünnte sich aus, sie strömten in die Bars und Kneipen.
Ich überlegte mir gerade, ob ich mir noch ein zweites Glas Weißwein gönnen sollte, als auf einmal Rufe und Stimmen auf der Straße laut wurden. Da ich nichts erkennen konnte, stand ich sogar auf. (Ja, ja, diese Schaulustigen!) Was ich zu sehen bekam, lohnte sich. Jemand raste mit weiten, bunt karierten Hosen, einem wehenden froschgrünen Frack, einem Clownsgesicht und karottenroten Haaren die Smasher-Street hinab. Ein Laptop in der Armbeuge. Zwei Verkäufer eines Elektronikmarktes verfolgten ihn, riefen etwas Unverständliches (vielleicht »Haltet den Dieb!«) und ließen schon bald von ihm ab, da er einfach verdammt schnell war. Als eine Dame im Fuchsmantel, die von dem Spektakel nichts mitbekommen hatte, auf die Straße trat, die Nase über ihrem Smartphone, passierte es dann: Sie kreuzte den Weg des Clowns. Der konnte gerade noch ausweichen, er hüpfte zur Seite, aber das Laptop segelte durch die Luft und zerschellte auf der Straße. Die Frau erstarrte und riss den Mund vor Schreck weit auf, der Clown dagegen begann, theatralisch um sie herumzutanzen.
Die Umherstehenden fingen an zu lachen. Selbst die Frau im Fuchsmantel grinste leicht konsterniert. Der Clown verbeugte sich, raste wieder los, machte ein paar gekonnte Flickflacks und setzte seine Flucht fort.
Bis ihn die Kugel traf.
Im nächsten Moment kauerte ich hinter der runden Marmorplatte meines Bistro-Tisches, den ich zuvor umgekippt hatte. Ich wusste, wie sich der Schuss eines Heckenschützen anhörte. Ich war schließlich zweimal in Afghanistan gewesen, ganz vorne bei Patrouillengängen. In meiner Zeit als Reporterin. Du entwickelst ein Gespür dafür. Einen sechsten Sinn. Du hörst den Schuss, und du weißt, dass es auf jeden Sekundenbruchteil ankommt. Was in deinem Körper abläuft, ist eine Abfolge von Reflexen. Und gegen die kannst du nichts machen. Du hast komplett auf Autopilot geschaltet.
Die Kugel schlug dem Clown in den Rücken ein und trat vorne unterhalb des Brustbeins wieder aus. Er strauchelte, ruderte mit den Armen und stürzte zu Boden. Ein kollektives Aufstöhnen ging durch die Straße. Die Menschen rissen Augen und Münder auf. Und zückten im nächsten Moment ihre Smartphones.
Das war der Augenblick, als der Clown mich erblickte. Als er seine Hand nach mir ausstreckte. Als ich aufsprang. Als ich auf ihn zurannte.
Eine Kugel schnitt mir wie eine glühende Messerklinge in die Haut meines linken Handrückens, traf den Asphalt und schoss pfeifend und quengelnd als Querschläger davon. Ich stolperte, flog halb auf die Knie, halb auf die Oberschenkel, rutschte so auf den Clown zu, zog das Genick ein und packte seine Hand.
Weitere Kugeln pfiffen an mir vorbei. Ich spürte ihren Luftzug (oder glaubte es jedenfalls). Ein Schnellfeuergewehr hatte das Feuer auf mich eröffnet. Präzises Schießen sah aber anders aus. Ich versuchte, den Clown von der Straße zu ziehen, doch ich konnte ihn kaum bewegen. Er lag schwer und schlaff da, wie ein Sack Sand. Ein neuer Feuerstoß. Zwei Kugeln trafen seinen linken Oberschenkel. Er zuckte zusammen, stöhnte laut auf.
»Du musst mir helfen«, rief ich ihm zu. »Allein schaffe ich es nicht.«