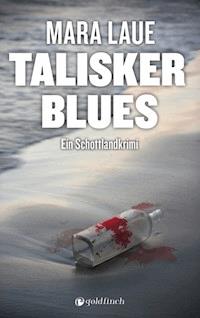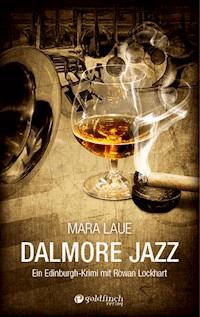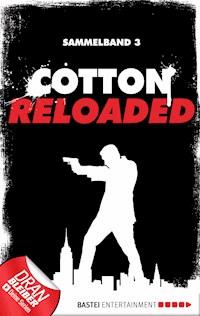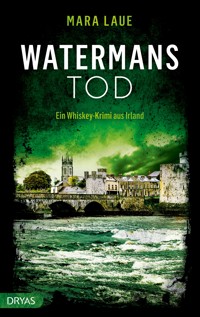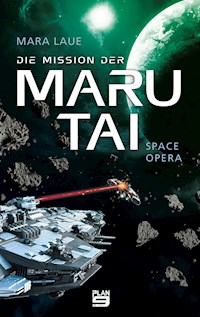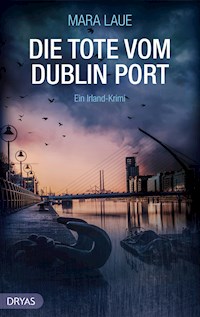2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: vss-verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Autoren.tips
- Sprache: Deutsch
„Wie wird man Schriftsteller?“ ist eine der am häufigsten gestellten Fragen an Autorinnen und Autoren. Besonders schreibbegeisterte Menschen, die davon träumen, eines Tages das Schreiben ebenfalls zum Beruf zu machen, möchten wissen, ob es ein Patentrezept gibt und vor allem, wie das reale Schriftstellerleben jenseits aller Klischees und Bestseller-„Hypes“ aussieht. Die Krimi- und Science-Fiction-Autorin Mara Laue beschreibt in diesem Buch ihren langen und oft steinigen Weg von der begeisterten Leseratte zur Berufsautorin. Sie legt damit nicht nur ein Zeitzeugnis über fast fünf Jahrzehnte ab, sondern hält auch ein nachdrückliches Plädoyer dafür, die eigene Ziele und Träume niemals aufzugeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mara Laue
So schnell die Finger tippen
Von der Leseratte zur Schriftstellerin
Impressum
Mara Laue – So schnell die Finger tippen
Von der Leseratte zur Schriftstellerin
2. eBook-Auflage – September 2018
© Edition Autoren.tips im vss-verlag, Frankfurt
Titelbild: Hermann Schladt (Foto: Mara Laue)
Lektorat: Hermann Schladt
1. DIE Frage
„Wie wird man eigentlich Schriftstellerin?“ Kaum eine Lesung, kaum ein Interview vergeht, ohne dass mir diese Frage gestellt wird. Besonders bei Lesungen vor Schulklassen kommt sie so sicher wie die nächste Nacht. Ein Teil der Antwort ist leicht zu geben: „Indem man viel liest, viel schreibt und das Handwerk erlernt.“ Nahezu alle Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben ihre Karriere als Leseratten begonnen. Aus der Beschäftigung mit fiktiven Geschichten entstand irgendwann der Drang – Drang, und zwar unwiderstehlich, nicht Wunsch! –, eigene Geschichten zu erzählen. Vom Erzählen bis zum Aufschreiben ist es danach nur noch ein sehr kleiner Schritt; oder man fängt sofort mit dem Aufschreiben an und lässt das mündliche Erzählen weg.
Dass das Schreiben von Geschichten – lang oder kurz – ein Handwerk ist, das man erlernen sollte, wenn man Erfolg haben will, hat sich zwar noch nicht bei allen Geschichtenerfindenden herumgesprochen, nichtsdestotrotz ist es eine Tatsache. Und wie alle Handwerkenden sollte man sein Handwerk beherrschen, andernfalls niemand einem die eigenen Produkte abkauft. Heißt: Wenn man will, dass Verlage und später ein möglichst großes Lesepublikum die Geschichten, Gedichte und Romane kaufen (und idealerweise davon begeistert sind), müssen diese ein Mindestmaß an Qualität besitzen. Da in Deutschland nur drei Universitäten Studiengänge für kreatives („literarisches“) Schreiben anbieten (Leipzig, Helmstedt und Berlin, ab Oktober 2017 soll es auch in Köln angeboten werden), bleibt das Erlernen des Handwerks hierzulande immer noch Privatsache.
Zum Glück gibt es seit vielen Jahren auch in Deutschland Fernlehrgänge, Workshops und Schreibratgeber, die einem dabei helfen. Jedoch haben die Lehrgänge große Qualitätsunterschiede und die Mehrheit der Ratgeber ist (noch) auf den amerikanischen und britischen Markt zugeschnitten, weil Ratgeber von deutschen Autorinnen und Autoren noch (!) in der Minderheit sind. Aber es gibt sie und wenn es den Lernwilligen gelingt, die in ihnen enthaltenen Tipps und Kniffe in den eigenen Texten umzusetzen, kann das bereits genügen, um einen Verlag zu überzeugen.
Als ich anfing zu schreiben (1970), gab es die meisten dieser Hilfsmittel nicht und die wenigen, die es gab, steckten noch in den Kinderschuhen. Außerdem haftete den Fernkursen, die in dieser Zeit entstanden, der Hauch von Unseriosität an. Die dafür immer wieder vorgebrachte Begründung, man könne kreatives Schreiben nicht wie einen Beruf erlernen, entbehrt jedoch jeder Grundlage. Schließlich gibt es funktionierende Techniken – angefangen beim Satzbau über Sprachstil, Konfliktaufbau, Spannungserzeugung, Dialogkonstruktion und andere –, die aus einem Text ein „geschmeidiges Gewebe“ machen, das beim Lesen Lust auf den Rest der Geschichte erweckt und die Lesenden nicht mit unzumutbaren Formulierungen oder gefühlloser Aneinanderreihung von Handlungen zu Tode langweilt.
Niemand käme auf den Gedanken zu behaupten, das Malen von Bildern, Entwerfen von Tanzchoreografien, das Schreiben von Drehbüchern und Theaterstücken oder das Komponieren von Musikstücken könne man nicht erlernen. Die entsprechenden gut besuchten Studiengänge an den Universitäten beweisen das Gegenteil. Träfe das auf das kreative Schreiben zu, gäbe es die wenigen Studiengänge für dieses Fach nicht und gehörte dieses Unterrichtsfach in anderen Ländern nicht zum Standard an jeder geisteswissenschaftlichen Universität. Das Handwerk zu erlernen ist also problemlos möglich.
Das Belegen von entsprechenden Kursen oder/und das Studieren von Schreibratgebern kürzt das Ganze aber erheblich ab, wenn man das Schreiben nicht studieren kann oder will. Ich habe es mir noch komplett selbst beigebracht durch – siehe oben – viel Lesen und viel Schreiben und dem damit einhergehenden Vergleichen meiner Texte mit denen erfolgreicher Autorinnen und Autoren. Womit ich mich in bester Gesellschaft befinde, denn die „Klassiker“ der Branche – Bettina von Arnim, Wolfgang von Goethe, Friedrich von Schiller, die Brontë-Schwestern, Agatha Christie, Edgar Allan Poe und Nobelpreisträger wie Hermann Hesse und Pearl Sydenstricker Buck – haben nie einen Schreibkurs besucht. Sie hatten lediglich eine gute (damals normale) Schulbildung, durch die ihnen ein vernünftiger Umgang mit Sprache beigebracht wurde.
Heutige angehende Autorinnen und Autoren haben es durch die Fülle von Ausbildungs-/Selbstbildungsmöglichkeiten in diesem Punkt erheblich leichter. In einem anderen Punkt dagegen nicht, womit ich zum zweiten Teil der Antwort auf „DIE Frage“ komme. Viele schreibbegeisterte junge Menschen, die noch die Schulbank drücken, träumen davon, ihr Arbeitsleben sofort nach der Schule als Schriftstellende beginnen zu können. Deshalb lautet eine nach Lesungen in Schulen immer wieder gestellte Frage: „Was muss ich tun, um gleich nach der Schule Autorin/Autor zu werden?“
Sofern man keinen entsprechenden Studienplatz im In- oder Ausland ergattert, lautet die ehrliche Antwort ungeschminkt: „Vergesst es!“ Vom Schreiben zu leben, ist sowieso harte Arbeit und ein schwer verdientes Brot. Sofern man noch keinen Bestseller geschafft hat oder zu den Vielschreibenden gehört, die jedes Jahr mindestens vier sich gut verkaufende Romane oder jeden Monat mindestens zwei Heftromane auf den Markt bringen, kann man von einer schriftstellerischen Tätigkeit überhaupt nicht leben. Jedenfalls nicht, wenn man menschenwürdig leben möchte und nicht mit weniger auskommen will, als einem bei aktuellen Hartz-IV-Sätzen zusteht. (Der Mindestverdienst, ab dem man sich als freischaffende/r Autor/in bei der Künstlersozialkasse renten- und sozialversichern lassen kann, liegt bei 3900 Euro pro Jahr – das sind 325 Euro im Monat. Von so einem Hungerlohn kann nur leben, wer keine Miete zahlt, kein Auto besitzt, keine Versicherungen außer einer Haftpflichtversicherung bezahlen muss, fast nie neue Kleidung braucht und Abstriche bei gesunder Ernährung macht.)
Fakt ist, dass nahezu niemand gleich von der Schulbank weg vom Schreiben leben kann. Selbst junge Autorinnen und Autoren, denen die erste, vielleicht sogar erfolgreiche Veröffentlichung noch zu Schulzeiten gelingt, müssen/sollten einen „Brotberuf“ erlernen, der ihnen das „tägliche Brot“ sichert. Getreu dem Motto, dass eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, garantiert ein einziger Bestseller oder Goodseller nicht, dass das Folgewerk, sofern es eins gibt, sich ebenso gut verkauft oder dass der einzige Bestseller auch ein Longseller wird, der „ewig“ mit in jedem Jahr ungefähr gleichbleibender Absatzzahl verkauft wird.
Völlig illusorisch ist es zu glauben, dass ein Bestseller oder wenige Bestseller ausreichen, um einen bis ans Lebensende zu versorgen; es sei denn, man wäre bereits mindestens siebzig. Dazu ändern sich die Gegebenheiten in der Buchbranche zu schnell. Selbst die Erfolgreichen, deren Werke verfilmt wurden, müssen ungefähr alle zwei bis drei Jahre oder in noch kürzeren Abständen einen neuen Roman nachschieben, um ihren Lebensstandard halten zu können.
Aus diesen Gründen finden sich in allen Biografien von Schriftstellenden, den erfolgreichen wie den weniger erfolgreichen, „Brotberufe“, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdienten, bevor sie – wenn überhaupt – vom Schreiben leben konnten. Die überwältigende Mehrheit aller Autorinnen und Autoren (weltweit ungefähr neunzig Prozent) schreibt deshalb nur im Nebenberuf. In Deutschland können nur drei bis fünf Prozent der Schreibenden tatsächlich ausschließlich vom Schreiben und den damit einhergehenden Tätigkeiten wie Lesungen und Schreibseminaren leben.
Ich hatte das Glück, das Schreiben zu meinem Brotberuf machen zu können. Doch bis dahin war es ein langer Weg, der von der ersten geschriebenen Geschichte bis zum Beginn des Erfolgs fünfunddreißig Jahre dauerte.
2. Träume
Den ersten Berufswunsch meines Lebens fasste ich, als ich (Jahrgang 1958) ungefähr fünf Jahren alt war: Ich wollte Tierärztin werden. Gemäß dem mir nachdrücklich vermittelten Wunsch meiner Eltern hätte ich Ärztin werden sollen, denn sie verbanden mit diesem Beruf der „Halbgötter in Weiß“ Prestige und Reichtum, was in den 1960er Jahren noch weitgehend zutraf. Da ich mich nicht im Mindesten für die Heilung von Menschen interessierte, aber Tiere innig liebte, war Tierärztin die zweite Wahl. Im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich mein eigener Wunsch war oder ob ich mich mit dieser Variante lediglich dem Drängen meiner Eltern als Kompromisslösung anpasste.
Meine zweite Wahl war jedoch vollständig mein eigener Wunsch: Astronautin wie mein damals glühend verehrtes Vorbild Valentina Tereschkowa, die 1963 als erste Frau in den Weltraum flog. Später kamen auch noch Reitlehrerin, (Kampf-)Sportlehrerin, Meeresbiologin und sogar Soldatin in die engere Wahl.
Für meine Eltern stand unabhängig von diesen Berufsplänen fest, dass ich aufs Gymnasium gehen musste. Meine Mutter hätte liebend gern selbst die höhere Schule besucht, aber das wurde ihr von ihren Eltern verwehrt, die eine höhere Schulbildung für ein Mädchen für überflüssig hielten, eine Einstellung, die damals (vor dem Zweiten Weltkrieg) gang und gäbe war. So wurde sie lediglich Stenokontoristin. Auch mein Vater wäre gern aufs Gymnasium gegangen, hätte auch liebend gern studiert, aber er wuchs als Waise bei Pflegeeltern auf, die sich nicht bemüßigt fühlten, für ein fremdes Kind eine gute Ausbildung zu finanzieren. Bafög gab es damals noch nicht und die Eltern oder der Vormund mussten die Studiengebühren aufbringen. So wurde er schließlich Elektriker.
Also sollte ich stellvertretend für meine Eltern aufs Gymnasium. Und ich kann nicht zählen, wie oft ich mir anhören musste, dass ich für diese Chance dankbar zu sein hatte, weil ihnen selbst diese Ausbildung verwehrt worden war. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich kam also im Jahr 1969 aufs Gymnasium, allerdings mit einer Falschinformation, die lautete: „Wenn du Abitur hast, stehen dir alle Berufe offen, dann kannst du alles werden, was du willst!“ Meine Eltern wussten damals nichts von der Existenz eines sich im Laufe der Jahre immer weiter verschärfenden Numerus Clausus, der den Zugang zu etlichen Studienfächern begrenzt, und waren vom Abitur als Freifahrtschein in alle Berufe überzeugt.
Doch zunächst hatte ich andere Probleme in der Schule. Ich war ein „Arbeiterkind“ und meine Mitschülerinnen (ich ging auf ein reines Mädchengymnasium) stammten ausnahmslos aus Akademikerfamilien. Weder sie noch manche Lehrkräfte machten einen Hehl daraus, dass ihrer Meinung nach ein Kind aus der Arbeiterklasse auf dem Gymnasium nichts zu suchen hatte. Ich wurde gemobbt, auch wenn man das damals noch nicht so nannte, und meine Leistungen blieben entsprechend suboptimal. Aber auch das ist eine andere Geschichte.
Um das tägliche Martyrium und seine Folgen zu verdrängen, wurden Bücher meine besten Freunde. Mit ihnen flüchtete ich mich in andere Welten und konnte die Realität ausblenden.
Jedoch hatten die damaligen Kinder- und Jugendbücher einen erheblichen Nachteil. Die Geschlechterklischees feierten darin fröhliche Urstände. Nur die Jungs/Männer erlebten die spannenden Abenteuer und hatten die interessanten Berufe, während die Mädchen/Frauen als ängstliche, weinerliche Zicken dargestellt wurden, die ohne männliche Hilfe gerade mal den Haushalt schafften und schon um einen Nagel in die Wand zu schlagen männliche Hilfe brauchten. Ihre primären Merkmale waren eine überdurchschnittlich entwickelte Tränendrüse, Verzagtheit und unterentwickelte Intelligenz. Obendrein bekamen sie kaum etwas auf die Reihe. Wenn sie Prinzessinnen waren, mussten sie gerettet werden, und allzu oft waren sie der dauerheulende Klotz am Bein des Helden. Die reinen Mädchenbücher erschöpften sich in für mich lahmen Internatsgeschichten, die sich mehr oder weniger um Zickenkriege und dumme Streiche drehten, die die Mädchen den Lehrkräften spielten. Mit anderen Worten: Positive weibliche Identifikationsfiguren existierten nicht. Das einzige Mädchen, das sich die Abenteuer eroberte (die Georgina/George aus „Fünf Freunde“ von Enid Blyton), verkleidete sich als Junge und gab sich einen männlichen Namen, um eben diese Abenteuer erleben zu können. Wahrlich kein gutes Vorbild für Mädchen!
Diese Klischees widersprachen aber meiner eigenen Lebensrealität. Die Frauen meiner Familie waren ausnahmslos zupackende Menschen, die sich von niemandem die Butter vom Brot nehmen ließen. Meine Großmutter und Großtanten waren gestandene „Trümmerfrauen“, die zeitweilig ohne Männer die Familie durchgebracht hatten, teilweise an der Front die Verwundeten versorgt hatten und durchaus auch mit Waffen umgehen konnten. Eine Großtante war sogar Jägerin, trank bevorzugt Rum, rauchte Zigarren und lebte im Laufe der Jahre mit verschiednen Männern in „wilder Ehe“. Meine Mutter und Tanten managten die Familien und trugen ganz selbstverständlich zu deren Lebensunterhalt bei. Schwach und schutzbedürftig oder auf Männer angewiesen war keine von ihnen.
Ganz anders das Bild in den Büchern. Frauen wie die in meiner Familie gab es darin nicht. Obendrein wurden solche wie die Jägerin – sofern sie überhaupt vorkamen – als negative Beispiele hingestellt, die sich nur deshalb so „unnatürlich“ verhielten, weil sie keinen Mann abbekommen hatten oder gleich lesbisch waren. In der Literatur gab es keine einzige Frau, mit der ich mich hätte identifizieren können. Außer Königin Brunhild von Island aus der Nibelungensage, Königin in ihrem eigenen Recht und eine formidable Schwertkämpferin. Aber die war eine Sagengestalt, ein Märchen. Ebenso Pippi Langstrumpf. Geschichten, die in der realen Welt spielten, zeigten alle dasselbe negative Bild von Frauen und Mädchen. („Ronja Räubertochter“ und die „Rote Zora“ entstanden erst Jahrzehnte später.)
Irgendwann hatte ich von den ewig tollen Jungs und den ewig blöden Mädchen so die Nase voll, dass ich diese Geschichten nicht mehr lesen mochte. Ich suchte in der Erwachsenenliteratur nach besseren Vorbildern, las die Krimis von Edgar Wallace, Science-Fiction-Abenteuer mit „Perry Rhodan“, Horrorromane von Poe und Lovecraft und etliche weitere Bücher, die ich heimlich lesen musste, weil ich sie nach elterlichem Willen im zarten Alter von elf/zwölf gar nicht lesen durfte – und fand überall dasselbe traurige Bild. Frauen, sofern sie überhaupt vorkamen, waren unwichtige Menschen zweiter Klasse. Und in den Horrorromanen grundsätzlich die Opfer, die blutig von irgendwelchen finsteren Wesen um die Ecke gebracht wurden. (Erst 1979 kam mit der Heftserie „Damona King“ eine starke Frau auf den Markt.)
Da ich in der Literatur keine Mädchen und Frauen finden konnte, die mir gefielen, schrieb ich eines Tages im Alter von zwölf Jahren meine erste eigene Geschichte. In der erlebte ein Mädchen im Wilden Westen Abenteuer mit einer Wildpferdstute. Leider fand das Werk keine Gnade vor den Augen meiner ersten Kritiker: meiner Eltern. Als Erstes wurde die Geschichte akribisch nach Rechtschreibfehlern durchforstet. Vor der intensiven und zunächst ausschließlichen Fahndung nach denen spielte der Inhalt überhaupt keine Rolle. Über den wurde später hergefallen. Unnötig zu erwähnen, dass der erst recht für mangelhaft befunden wurde: zu kurz, zu fad, zu fantastisch, zu unglaubwürdig. Obendrein ein Mädchen, das wie ein Junge Abenteuer erlebte: „Das glaubt doch kein Mensch!“ Und das von meiner Mutter, die aus einer Familie starker Frauen stammte, deren Mitglieder noch ganz andere „Abenteuer“ überlebt hatten. Ich verstand die Welt nicht mehr. (Zugegeben: Vorher hatte ich sie auch nicht verstanden.) Im Nachhinein zeigte mir das aber, wie tief verwurzelt solche anerzogenen Klischees sind. Sie überdauern sogar erlebte gegenteilige Erfahrungen.
Dass ich nach diesem vernichtenden Verriss das Schreiben nicht postwendend wieder aufgegeben habe, lag daran, dass das Erfinden meiner ersten Geschichte einen Hummelschwarm von Ideen auf den Plan gerufen hatte, der mir keine Ruhe mehr ließ. Mein Gehirn produzierte Ideen am laufenden Band. Kein Tag verging, an dem nicht mindestens eine neue entstand. Und sie alle bestanden darauf, in die Freiheit entlassen und geschrieben zu werden. Vor einigen Jahren fand ich das Notizbuch wieder, in dem ich diese Ideen als Stichworte oder Titelüberschriften aufgeschrieben hatte. Als ich sie nachzählte, stellte ich fest, dass es über fünfhundert waren. Und zu jedem Stichwort hatte ich sofort wieder die dazugehörige Idee im Kopf.
Ich schrieb also heimlich weiter und stellte fest, dass mir das so viel Spaß machte, dass ich einfach nicht mehr aufhören konnte. Bis heute nicht. Mit unzähligen weiteren Pferdegeschichten setzte ich diese Leidenschaft fort.
Schon ein Jahr später folgten, angeregt durch die Lektüre der Heftromanserie „Perry Rhodan“, Science-Fiction-Storys. Mit vierzehn kamen Western und Indianergeschichten dazu, mit fünfzehn die ersten Gedichte (die einzige Leidenschaft, die die Schule jemals in mir geweckt hat), mit sechzehn Grusel-Storys und mit achtzehn der erste Krimi mit dem Titel „Die dritte Seite“. Dieser war auch mein erster vollständiger Roman, nachdem ich bis dahin nur Kurzgeschichten oder Storys in Heftromanlänge geschrieben hatte. Zwei Jahre später folgten meine ersten Ausflüge ins Fantasy-Genre, das des Liebesromans und in die Erotik. Zum Glück habe ich von dem Vorurteil, „kein Mensch“ könne in fast allen Genres gleichermaßen gut schreiben, erst erfahren, als ich längst in allen oben genannten bereits erfolgreich war. Ich schrieb und schreibe das, was ich selbst gern lese. Und da ich fast alle Genres gern lese, tobe ich mich auch schreibend in ihnen aus.
Der Wunsch, das Schreiben zu meinem Hauptberuf zu machen, war mit der Vollendung von „Die dritte Seite“ gekeimt. Das Gefühl, ein vollständiges, selbst geschriebenes Romanmanuskript in den Händen zu halten, war dermaßen beglückend, dass ich es immer wieder erleben wollte. Wie musste es erst sein, ein eigenes gedrucktes Buch in den Händen zu halten? Ein Traum war geboren, der mich bis zu seiner Verwirklichung niemals losgelassen hat.