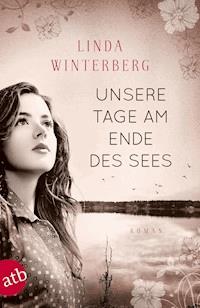9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bis wir einander wiederfinden! Frankfurt, 1938: Als Sängerin darf die Jüdin Anni nicht mehr auftreten. Nur mit Mühe kann sie für sich und ihre kleine Tochter Ruth sorgen. Die Angst vor dem NS-Regime wird immer größer, aber all ihre Bemühungen, gemeinsam auszureisen, scheitern. Schließlich ringt sich Anni zu der wohl schwersten Entscheidung für eine Mutter durch: Um wenigstens ihre Tochter in Sicherheit zu wissen, schickt sie Ruth mit einem der Kindertransporte nach England. So bald wie möglich will Anni ihr folgen. Doch dann bricht der Krieg aus, und sie kann das Land nicht mehr verlassen… Die berührende Geschichte einer jungen Mutter, die ihr Kind zu retten versucht, indem sie es auf eine Reise ins Ungewisse schickt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Linda Winterberg
Hinter Linda Winterberg verbirgt sich Nicole Steyer, eine erfolgreiche Autorin historischer Romane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Taunus und begann schon im Kindesalter erste Geschichten zu schreiben. Bei einer Reise nach Norwegen stieß sie auf die historischen Fälle, die diesem Roman zugrunde liegen und die sie nicht mehr losließen.
Informationen zum Buch
Bis wir einander wiederfinden
Frankfurt, 1938: Als Sängerin darf die Jüdin Anni nicht mehr auftreten. Nur mit Mühe kann sie für sich und ihre kleine Tochter Ruth sorgen. Die Angst vor dem NS-Regime wird immer größer, aber all ihre Bemühungen, gemeinsam auszureisen, scheitern. Schließlich ringt sich Anni zu der wohl schwersten Entscheidung für eine Mutter durch: Um wenigstens ihre Tochter in Sicherheit zu wissen, schickt sie Ruth mit einem der Kindertransporte nach England. So bald wie möglich will Anni ihr folgen. Doch dann bricht der Krieg aus, und sie kann das Land nicht mehr verlassen …
Die berührende Geschichte einer jungen Mutter, die ihr Kind zu retten versucht, indem sie es auf eine Reise ins Ungewisse schickt.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Linda Winterberg
Solange die Hoffnung uns gehört
Roman
Inhaltsübersicht
Über Linda Winterberg
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Nachwort
Dank
Impressum
Kapitel Eins
SEPTEMBER 1933, FRANKFURT
Anni blickte aus dem Fenster der kleinen Laubhütte in den idyllischen Garten, der gleich hinter der Synagoge begann und den Lärm der umliegenden Großstadt vollkommen fernzuhalten schien. Durch das laubbedeckte Dach der Hütte drangen einzelne Sonnenstrahlen zu ihr hinein. Kastanienketten, von fleißigen Kinderhänden gefertigt, hingen von der Decke, Nüsse und Äpfel lagen auf den Tischen neben Herbstblumen in kleinen Vasen. Eine Handvoll Frauen aus der Nachbarschaft hatte sich heute in der Laubhütte zusammengefunden. Es gab Kaffee, dazu selbstgebackenen Kuchen und Kekse. Anni war mit Marlene, ihrer Nachbarin, gekommen, kannte aber auch einige der anderen Frauen. Susanne Hofmann, die in einer großen Wäscherei im Westend arbeitete. Michaela Geigers Sohn war mit ihrer Tochter Ruth in den Kindergarten gegangen, und Simone Gärtner arbeitete im Lebensmittelgeschäft an der Ecke. Letztere war, wie sie selbst, Protestantin, einige der anderen Frauen waren Jüdinnen. Wer welchen Glauben hatte, war hier jedoch unwichtig, wenngleich der Anlass ihres Zusammentreffens, das Laubhüttenfest, ein jüdischer war.
Die Tradition, der Hütten als Zufluchtsort des jüdischen Volkes zu gedenken, erinnerte Anni an lang vergangene Erlebnisse ihrer Kindheit. Sie war zwei Jahre alt gewesen, als ihre Eltern zum evangelischen Glauben konvertierten. Ihr Vater war damals Klavierlehrer am berühmten Hoch’schen Konservatorium in Frankfurt. Vor allem seine Beschäftigung mit der christlichen Kirchenmusik hatte ihn irgendwann dazu bewogen, zum Protestantismus wechseln zu wollen. Annis Mutter war es nicht leichtgefallen, ihre jüdischen Wurzeln aufzugeben. Sie stammte aus Krakau, wo sie eine klassische Gesangsausbildung genossen hatte. Dennoch hatte sie in Frankfurt an keinem Theater Fuß fassen können, weshalb sie Gesangsstunden gab und sich um die musikalische Ausbildung ihrer Tochter kümmerte, wofür Anni ihr heute dankbar war. Ohne die Unterstützung ihrer Mutter wäre sie niemals zu der Sopranistin geworden, die sie heute war. Im Frühjahr jährte sich der Todestag ihrer Eltern zum achten Mal. Auf dem Weg zu einem Auftritt in Berlin waren sie beide bei einem Zugunglück ums Leben gekommen.
»Anni, hörst du überhaupt zu?«
Anni schaute hoch. Sämtliche Blicke der Frauen waren auf sie gerichtet. »Entschuldigt bitte, ich war in Gedanken. Was habt ihr gesagt?«
»Es geht um ein Geburtstagsfest in der jüdischen Gemeinde«, wiederholte Michaela Geiger. »Unser Rabbi, David Silberstein, wird sechzig Jahre alt. Wir haben gerade darüber gesprochen, für die Feier eine musikalische Darbietung zu organisieren, denn er liebt klassische Musik, ganz besonders die Oper. Marlene meinte, du würdest uns bestimmt den Gefallen tun und etwas für ihn singen.« Abwartend sahen die Frauen sie an.
»Warum nicht?«, meinte Anni. »Allerdings geht das nur, wenn sich das Fest nicht mit einem meiner Auftritte überschneidet. Welche Oper bevorzugt er denn?«
Die Frauen sahen sich fragend an.
»Das wissen wir gar nicht«, erwiderte Susanne. »Aber das lässt sich ohne Probleme in Erfahrung bringen. Ich werde gleich nachher seine Frau anrufen. Er wird sich bestimmt freuen.« Sie klatschte vor Begeisterung in die Hände.
Ein Geburtstagsständchen für einen Rabbi, dachte Anni. Wäre nicht jiddische Musik passender? Ihre Mutter wäre davon ausgegangen. Zuerst ein schnelles Lied zum Mitklatschen, dann ein trauriges für die Wehmut und am Ende etwas Fröhliches, um den Jubilar hochleben zu lassen. Jiddische Musik hat Seele, hatte ihre Mutter immer gesagt. Ach, wie sehr Anni sie doch vermisste. Besonders in den letzten Jahren hätte sie sich die geliebte Mutter an ihre Seite gewünscht, denn der frühe Tod ihres Mannes Johann war ein schwerer Schlag gewesen, von dem sie sich nur langsam erholte. Ihre Mutter hätte ihr in dieser schweren Zeit Kraft gegeben und Mut gemacht. Oftmals führte Anni auch jetzt noch stumme Zwiesprache mit ihr. Trotz ihres Übertritts zum evangelischen Glauben hatte ihre Mutter niemals aufgehört, an jüdischen Traditionen festzuhalten und jiddische Lieder zu singen. Als junges Mädchen war sie in Krakau mit einem gewissen Mordechaj befreundet, der tagsüber Tischler, nachts Liederschreiber gewesen war. Ihre Mutter hatte viele seiner Lieder gesungen, eines jedoch hatte Anni über all die Jahre nie vergessen. Ein Schlaflied mit dem Titel »Shlof shoyn mayn jankele«. Sie konnte es auswendig, verstand den Text zwar nicht vollständig, doch das war nicht wichtig. Die jiddischen Worte klangen für sie so vertraut wie eine zärtliche, Trost spendende Umarmung. Jeden Abend vor dem Einschlafen hatten sie das Lied gemeinsam gesungen. Es war ein wunderbares Ritual zwischen Mutter und Tochter gewesen, das sie heute an ihre kleine Tochter Ruth weitergab, die vor der Hütte mit den anderen Kindern fröhlich über den Rasen sprang. Anni beobachtete sie wehmütig. Auch in Ruths Grundschulakte war der Vermerk Jüdin eingetragen worden. Nun musste Ruth gemeinsam mit zwei weiteren Kindern in der hintersten Ecke des Klassenzimmers sitzen. Als wie grausam würde sich diese Welt erweisen, fragte sich Anni, wenn schon bei den Kindern solche Unterschiede gemacht wurden? Auch in ihrer Personalakte der Städtischen Bühnen war ihre jüdische Herkunft vermerkt worden, wobei man ihr zugesichert hatte, dass dies keine Auswirkungen auf ihre Arbeit haben würde. Sie war eine gesetzte Größe an der Frankfurter Oper, und so würde es auch bleiben. Einige Vorkommnisse an den Bühnen sprachen allerdings eine andere Sprache und ließen Zweifel in ihr aufkommen. Bereits mehrere ihrer Kollegen waren aufgrund ihrer jüdischen Herkunft entlassen worden. Wenn sie ihren Arbeitsplatz verlöre, wüsste Anni nicht, wie es weitergehen sollte. Ihre Arbeit an der Oper war ihr Leben, zu singen alles, was sie konnte. Doch sie schob den Gedanken beiseite.
Als hätte Marlene erraten, was in ihr vorging, wandte sie sich ihr zu und sagte: »Anni, du wirst uns doch auch jetzt eine Kleinigkeit vorsingen, oder? Es ist immer ein solcher Genuss, deine Stimme zu hören.«
Erneut waren sämtliche Blicke im Raum auf sie gerichtet.
»Ich weiß nicht«, sagte Anni zögernd. »Eigentlich wollte ich langsam aufbrechen. Ich muss noch in das Fotoatelier von Nini und Carry Hess wegen der Aufnahmen für das neue Programmheft.«
»Bitte. Für ein Lied bleibt doch immer Zeit«, bettelte Marlene.
»Ja, Mama. Sing«, erklang nun auch Ruths Stimme. Sie stand mit einem Keks in der Hand in der Tür. »Unser Lied. Das mit dem Jankele.«
»Meinetwegen«, gab Anni nach. Nini und Carry würden es ihr nachsehen, wenn sie sich etwas verspätete. Ruth kam lächelnd auf sie zu und kletterte auf ihren Schoß. Anni schlang die Arme um ihre kleine Tochter, die so herrlich süß duftete, und begann zu singen. Die Melodie des Liedes war voller Sehnsucht. Die jiddischen Worte machten aus der kleinen Laubhütte einen Ort des Friedens. Anni drückte Ruth fest an sich und genoss die Wärme ihres kleinen Körpers. Ihr Mädchen war der wichtigste Mensch ihres Lebens, die einzige Familie, die ihr geblieben war. Sie musste sie beschützen, sich kümmern, für sie da sein. Die Welt dort draußen hatte sich auf grausame Art und Weise verändert. Doch gewiss war alles nur ein Strohfeuer, und bald würden wieder bessere Zeiten kommen. An dieser Hoffnung galt es festzuhalten. Sie sang die letzte Strophe mit geschlossenen Augen. Ihre Stimme wurde leiser, weicher.
»Nu shlof zhe mir, mayn kluger khosn bokher,
dervayl ligstu in vigele bay mir.
s’vet kostn fil mi un mame’s trern,
bizvanen s’vet a mentsh aroys fun dir!«
Als sie verstummte, war es mucksmäuschenstill um sie herum.
»Wunderschön«, murmelte irgendwann eine der Frauen. »Diese Musik ist so voller Seele.«
»Das finde ich auch«, stimmte Anni zu. »Dieses Stück hat ein jiddischer Liedermacher aus Krakau geschrieben.«
»Den kenne ich«, sagte eine andere Frau. »Sein Name ist Mordechaj Gebirtig, nicht wahr?« Anni nickte. »Mein Vater hat eine Platte mit seinen Liedern. Ich kann mich jedoch nicht entsinnen, dein wunderschönes Schlaflied darauf gehört zu haben. Es ist wirklich zauberhaft.«
»Das ist es«, stimmte Anni zu. Sie spürte in sich den Schmerz der Erinnerung aufsteigen und sah das Gesicht ihrer Mutter vor Augen, glaubte, ihre Nähe zu spüren. Erneut hüllte Stille den Raum ein. Mordechajs Melodie hatte alle Anwesenden tief im Innersten berührt. Anni bemerkte, dass Ruth in ihrem Arm eingeschlafen war. Sie blickte zu Marlene, die ohne Worte verstand. Behutsam nahm sie Ruth von Annis Schoß, legte sie auf ein kleines Kanapee in der Ecke und deckte sie mit einer bunten Flickendecke zu.
»Ich komme sie später bei dir abholen«, flüsterte Anni Marlene zu. Marlene nickte.
»Natürlich. Bestimmt wird Walter mit ihr Klavier spielen. Das mag sie. Sie kann auch mit uns essen.« Dankbar drückte Anni die Hand ihrer Freundin, dann verabschiedete sie sich von den anderen und verließ den Raum.
Nur wenige Schritte weiter war Anni sofort vom Lärm der Großstadt und von dahineilenden Menschen umgeben. Als sie kurz darauf in der Straßenbahn am Fenster Platz nahm, lehnte sie den Kopf gegen die Scheibe und blickte zum Himmel. Die Sonne kam hinter einer Wolke hervor, und ihre hellen Strahlen fielen warm auf ihre Wangen. Sie schloss die Augen und suchte in sich die Geborgenheit, die sie eben in der Laubhütte noch empfunden hatte. Doch vergebens. Sie öffnete die Augen wieder. Die Straßenbahn hielt, und eine Gruppe SA-Männer stieg ein. Ihre Hände begannen zu zittern. Sie durfte die Angst nicht Oberhand gewinnen lassen, denn sie war ein schlechter Begleiter. Gewiss war der Anblick dieser Männer in der Stadt nur vorübergehend, schon bald würde alles wieder wie früher sein. Die Straßenbahn erreichte den Börsenplatz, und sie stieg gemeinsam mit den SA-Männern aus, die sie höflich grüßten. Mit Sicherheit hätten sie das nicht getan, wenn sie wüssten, dass sie Jüdin war, dachte Anni und überquerte ein Stück von ihnen entfernt die Straße. Aus dem Augenwinkel nahm sie noch wahr, wie sie einer alten Dame behilflich waren, deren Einkaufstüte gerissen war. Sie hoben Lebensmittel von der Straße auf, kümmerten sich darum, sie zu verstauen, lächelten freundlich. Wären nicht ihre respekteinflößenden Uniformen gewesen, hätte man sie für nette junge Burschen halten können. Leider waren sie es nicht. Mit Grausen dachte Anni an den Tag im April zurück, als genau dieselben jungen Männer die jüdischen Geschäfte beschmiert und beschädigt und ihre Besitzer mehr als nur beleidigt hatten. Auch das Fotoatelier von Nini und Carry Hess, das Anni jetzt erreichte, war attackiert worden. Nini und Carry hatten sich an diesem Tag in ihrem Atelier verschanzt und hinter der verrammelten Tür tausend Tode ausgestanden. Sie waren glimpflich davongekommen. Nur die Eingangstür war aufs Übelste beschmiert worden. Drecksjuden und Talmudgauner hatte darauf gestanden, was Nini einige Tage später abgewaschen hatte. Aufgeben liegt mir nicht, hatte sie zu Anni eine Weile nach den schrecklichen Vorkommnissen gesagt. Sie hatte entschlossen geklungen, doch Anni hatte sich nicht täuschen lassen. Nini Hess hatte Angst, genauso wie sie selbst, wie so viele in dieser Stadt.
Anni schob die Eingangstür auf und trat ins Treppenhaus, wo sie die vertraute Mischung von Parfüm und Bohnerwachs empfing. Sie eilte die steinernen Stufen hinauf. Fotografien, die größtenteils Künstler der Städtischen Bühnen zeigten, hingen an den Wänden. Als sie das Atelier betrat, wurde sie wie gewohnt von Nini in Empfang genommen.
»Anni, meine Liebe. Wie schön, dass du es einrichten konntest.« Sie umarmte Anni flüchtig und nahm ihr den Mantel aus der Hand.
»Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe«, entschuldigte sich Anni. »Marlene, unsere Nachbarin, hat mich in die Laubhütte bei der Synagoge mitgenommen und …«
»Dort hast du dich verquatscht«, ließ Nini sie nicht ausreden. Sie bedeutete Anni, ihr in den Schminkraum zu folgen, in dem bereits ihr Bühnenkostüm bereitlag. Heute sollten Aufnahmen für einen Sonderteil des neuen Programmheftes entstehen. »Ein Wunder, dass du überhaupt noch gekommen bist. Ich an deiner Stelle hätte den Termin bestimmt vergessen. Diese Hütte ist so ein wunderbarer und friedlicher Ort, selbst noch in heutiger Zeit.« Nini ließ Anni vor dem Schminkspiegel Platz nehmen. »Dort habe ich immer das Gefühl, es hätte niemals irgendwelche Veränderungen gegeben. Erst wenn man wieder in die Welt außerhalb der behüteten Mauern tritt, wird einem bewusst, dass man den Lauf der Geschehnisse nicht aufhalten kann. Wir leider auch nicht.« Sie seufzte. »Unsere Sorgen stehen vor der Tür und klopfen schon lautstark an. Bestimmt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis uns die Städtischen Bühnen die Verträge aufkündigen werden. Wie es dann weitergehen soll – daran will ich lieber gar nicht denken.« Sie winkte ab.
»Das glaube ich nicht«, suchte Anni sie zu beruhigen. »Eure Zusammenarbeit mit den Bühnen war doch immer gut. Eure Fotos sind in ganz Europa bekannt.« Anni nahm Ninis Hand und drückte sie. Sie wusste, dass Ninis offene Worte nicht selbstverständlich waren. Nur bei wenigen ihrer Kunden sprachen Nini und Carry ihre Ängste aus, was Anni als Vertrauensbeweis ansah. Ihre Beziehung war mehr als nur geschäftlich. Über die Jahre hatte sich eine Freundschaft entwickelt. Bei einem Treffen im Januar hatte Nini schon einmal ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht. Damals hatte Anni ebenfalls zu beschwichtigen versucht. Doch nach den Geschehnissen der letzten Monate hörten sich ihre Worte wie leere Phrasen an.
»Ich denke, die neuen Machthaber sehen das anders. Für sie sind es Bilder von Juden, nicht mehr und nicht weniger«, erwiderte Nini mit einem Achselzucken. Anni hätte ihr zu gern widersprochen, aber ihr fiel kein Gegenargument ein.
Nini griff zur Bürste, kämmte Annis Haar nach hinten und setzte ihre Rede fort: »Am Theater haben sie schon damit begonnen, die jüdischen Mitarbeiter rauszuwerfen. Hermann, einer der Bühnenbildner, hat mir davon erzählt.«
»Ja, leider«, stimmte Anni zu. In ihrem Hals bildete sich ein dicker Kloß. Sollte sie Nini davon erzählen, dass auch sie jüdische Wurzeln hatte? Sie verwarf den Gedanken, wofür sie sich innerlich schämte. Nini und Carry hatten Ehrlichkeit verdient. Sie dachte an jenen schlimmen Moment im Personalbüro zurück, als ihre jüdische Abstammung in ihre Akte eingetragen wurde. Den abfälligen Blick der Sekretärin würde sie niemals vergessen. Ihr, genauso wie ihrer über zehn Jahre älteren Kollegin Magda Spiegel, ebenfalls jüdischer Herkunft, war versichert worden, dass ihre Verträge erfüllt, wahrscheinlich auch verlängert wurden. Sie waren die Stars an der Frankfurter Oper. Magda eine Altistin, die man auf der ganzen Welt kannte, sie selbst eine herausragende Sopranistin. Doch ein fader Beigeschmack blieb. Keine von ihnen hatte im Ensemble über ihre Abstammung gesprochen. Offiziell war Anni Kluger Protestantin ebenso wie Magda Spiegel. Niemand außer der Verwaltung sollte etwas über ihre Herkunft erfahren. Wie lange es jedoch dauern würde, bis die ersten Gerüchte durch die Gänge zogen, war schwer zu sagen. Sie wusste, dass Nini verschwiegen war und nichts ausplaudern würde, doch wie oft kam es vor, dass man sich in einem Gespräch verplapperte. Nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn jeder im Theater über ihre Abstammung Bescheid wüsste.
Nini machte sich ans Werk. Sie steckte Annis Haar am Hinterkopf fest und fing an, sie zu schminken. Innerhalb weniger Minuten schaffte sie es, Anni in einen komplett neuen Menschen zu verwandeln.
»Noch etwas Rouge«, sagte sie. »Und es ist perfekt.« Verblüfft betrachtete Anni ihr Antlitz im Spiegel. »Du bist und bleibst eine Zauberfee, Nini.«
Nini legte den Pinsel zur Seite und platzierte die rote Perücke auf Annis Kopf, rückte sie zurecht, zupfte an den Locken und musterte das Ergebnis im Spiegel.
»Perfekt. Du wirst das Publikum wie immer betören.« Sie lächelte. Vielleicht würde sich ja alles zum Guten wenden, dachte Anni. Viele waren davon überzeugt, dass sich ihr Leben in den nächsten Monaten wieder normalisieren und auch der Hass gegen die Juden abnehmen würde. Daran sollte sie glauben und nicht den Teufel an die Wand malen, auch wenn es schwerfiel.
»Dann sehen wir mal zu, dass wir dich in das wunderschöne grüne Seidenkleid bekommen.« Nini nahm das Kleid vom Bügel, während sich Anni erhob und ihre Bluse aufknöpfte. Genau in diesem Moment betrat Carry mit einem strahlenden Lächeln den Raum.
»Anni, meine Liebe. Wie schön, dich zu sehen.« Küsschen rechts, Küsschen links auf die Wange, der schwere Geruch ihres Parfüms in der Nase. Carry, die eigentlich Cornelia hieß, war eine beeindruckende Frau, die einen mit ihrer lebensfrohen Art und ihrer klassischen Schönheit sofort in ihren Bann zog. Ihr dunkelbraunes Haar war in sanfte Wellen gelegt und saß perfekt. Die rehbraunen Augen strahlten Wärme aus. Im Gegensatz zu ihr wirkte die aschblonde Nini, die durchaus hübsch anzusehen war, beinahe farblos. Sie waren grundverschieden und bildeten doch eine Einheit.
Anni schlüpfte in den grünen Seidentraum voller Spitze, den sie schon bald auf der Bühne tragen würde. Nini schloss den Reißverschluss im Rücken.
Anni betrachtete sich in einem bodentiefen Spiegel, der neben einem Paravent an der Wand hing, von allen Seiten.
»Wie sehr ich die Verwandlungen des Theaters liebe«, sagte sie. »Heute bist du eine Königin, morgen deren Dienerin und in zwei Wochen eine Bettlerin. Ich will das alles niemals aufgeben.«
Nini blickte sie erstaunt an. Anni biss sich auf die Lippen. Jetzt war sie selbst diejenige gewesen, die sich verplappert hatte.
»Wieso solltest du deine Arbeit denn aufgeben müssen?«, fragte Nini. Anni sank zurück auf den Stuhl vor dem Schminktisch.
»Weil ich nicht viel besser dran bin als ihr. Wahrscheinlich ist es auch bei mir nur noch eine Frage der Zeit, bis sie mich vor die Tür setzen«, gestand sie.
»Aber wieso sollten sie das tun?«, fragte Nini.
»Weil sie Jüdin ist«, beantwortete Carry für Anni Ninis Frage. Ninis Augen weiteten sich.
»Aber, du bist doch … Ich meine, sagtest du nicht, du wärst evangelisch? Der Ärger mit deiner katholischen Schwiegermutter …«
»Richtig. Ich bin evangelisch. Meine Eltern sind konvertiert, als ich ein Kleinkind war«, führte Anni ihren Gedanken fort.
»Damit bist du Jüdin ersten Grades«, stellte Carry fest.
»Das sind ja interessante Dinge, die man hier einfach so nebenbei erfährt«, war plötzlich eine spitze Frauenstimme zu hören, die sie alle drei zusammenzucken ließ. In der Tür stand Leni Baumgartner und grinste hämisch. Anni erstarrte. Leni war erst vor einigen Monaten aus Wien nach Frankfurt gekommen und hatte schon bald klargemacht, dass sie eine ernsthafte Konkurrentin für Anni sein würde. Im neuen Stück war sie zuerst als ihre Zweitbesetzung gehandelt worden, hatte sich dann aber mit einem Platz im Chor begnügen müssen. Anni befürchtete, dass sich Leni mit dieser Entscheidung des neuen Generalmusikdirektors Bertil Wetzelsberger nicht lange zufriedengeben würde. Wie hatte sich Magda erst neulich äußerst treffend ausgedrückt: »Die Sorte Kollegin kenne ich. Geht über Leichen, wenn es sein muss.« Anni wusste, was Magda meinte. Unter Hans Wilhelm Steinberg, Wetzelsbergers Vorgänger, hätte es eine Diva wie Leni ohne Zweifel schwer gehabt. Jedoch war dieser vor einigen Wochen aufgrund seiner jüdischen Abstammung entlassen worden. Er hätte Leni, deren Gesangstalent sich in Grenzen hielt, sofort in ihre Schranken gewiesen. Wetzelsberger schien das anders zu sehen, was eher mit persönlichem Gemauschel als mit Talent zu tun haben mochte. Überlegenheit blitzte in Lenis Augen auf.
»Was für Neuigkeiten. Unsere Anni eine Jüdin. Stell sich das einer vor. Gerade eben konnte ich miterleben, wie eines der Orchestermädchen seine Kündigungspapiere erhielt. Das arme Ding hat schrecklich geheult.«
In ihrer Stimme lag kein Hauch von Mitleid. Anni wusste, dass sie mit einem alten Schulkameraden des neuen Generalintendanten Hans Meissner verlobt war, dem seine Stellung an der Oper von keinem Geringerem als dem Oberbürgermeister Friedrich Krebs verschafft worden war. Was aus diesen Kreisen zu erwarten war, wusste jeder.
Carry war die Erste, die sich von dem Schrecken erholte.
»Entschuldigen Sie bitte«, wandte sie sich an Leni. »Ich habe Ihren Namen leider nicht verstanden. Haben Sie einen Termin für heute?«
Leni wandte den Blick nicht von Anni ab, während sie antwortete:
»Leni Baumgartner. Ich bin die neue Zweitbesetzung von Anni Kluger.« Annis Augen weiteten sich. »Es sollen Bilder für das Programmheft angefertigt werden, wenn möglich im Kostüm.«
Endgültig begann es in Annis Ohren zu rauschen. Das konnte und durfte nicht sein. Sie hatte Verträge, feste Zusagen. Dieses gottverdammte Weibsbild. Wie hatte Anni auch nur einen Moment annehmen können, dass sie im Chor bleiben würde? Doch sie würde kämpfen. So leicht würde sie sich nicht vertreiben lassen. Sie war Anni Kluger, die gefeierte Sopranistin der Frankfurter Oper. Sie spürte Ninis Hand auf ihrer Schulter und blickte zu Carry. Ihre Miene war ernst. Anni ahnte, was die Fotografin dachte. Nichts galten gute Fotografinnen oder eine herausragende Sängerin in dieser neuen Welt, wenn sie jüdisch waren.
*
Die Frankfurter Oper war eine eigene, eine verrückte und bezaubernd chaotische Welt. Die Menschen draußen mochten davon nicht mehr als die glanzvollen Aufführungen sehen, die sie für wenige Stunden aus ihrem Alltag entführten. Für Ruth jedoch bedeutete dieser Ort Familie. Hinter den Kulissen wandelte sich das Bild der glanzvollen Darbietung und Illusion. Doch es wurde dadurch nicht weniger einzigartig – vielleicht sogar noch aufregender. So war für Ruth der schönste Ort in der Oper nicht die Bühne, sondern die Garderobe der weiblichen Darsteller. Hier gab es ein herrlich buntes Durcheinander von Kostümen, Perücken, Federboas, funkelnden Haarspangen und Kronen, glitzernden Tüchern, hübschen Schuhen und anderem Firlefanz. Von unzähligen Glühbirnen umrandete Spiegel säumten die Wände. Eine Duftwolke aus Parfüm und Haarspray erfüllte den Raum und legte sich auf alles und jeden, der sich länger als eine Minute in der Garderobe aufhielt. Um sie herum wirbelte das Ensemble wie ein aufgescheuchter Bienenstock. Kostüme wurden angezogen, Haare hochgesteckt, Lippen nachgezogen, Perücken aufgesetzt. Tuscheln, Tratschen, Trällern, lautes Lachen, nervöses Auf-und-ab-Wippen – und zwischen allem die laute Stimme von Georgina, dem Mädchen für alles, das eigentlich gar kein Mädchen war. Sein richtiger Name war Norbert, was kaum einer wusste. Georgina war ein bunter Vogel, geschminkt, mit Blumen im Haar, auffälliger Kleidung und Stöckelschuhen, die herrlich auf dem Boden klackerten. Er war die gute Seele der Garderobe, hörte zu, föhnte, toupierte, schminkte, zupfte zurecht, flickte Löcher, nahm in den Arm, lachte und weinte, gerade so, wie es gebraucht wurde. Und er hatte stets herrlich süße Sahnebonbons in seiner Tasche, die er großzügig mit Ruth teilte. Auch jetzt hatte Ruth, die auf einem Hocker hinter dem Schminktisch ihrer Mutter saß, eine der süßen Köstlichkeiten im Mund und genoss deren cremigen Geschmack auf der Zunge. Wie schnatternde Gänse eilten die letzten Mitglieder des Chores, allesamt in hellblaue Seidenkleider gehüllt, an ihr vorüber und verließen den Raum. Ihnen folgte Henriette, die in die Jahre gekommene Souffleuse, die sich, warum auch immer, stets in eines der mondänen Kostüme zwängte. Heute hatte sie ein orangefarbenes Seidentaftkleid mit einer passenden Stola gewählt, was sie wie eine reife Orange aussehen ließ. Mit einem charmanten Lächeln auf den Lippen hielt ihr Georgina die Tür auf. Als sich diese hinter Henriette schloss, schüttelte er seufzend den Kopf und murmelte: »Lieber Herrgott. Das hat das arme Kleid wahrlich nicht verdient. Wollen wir hoffen, dass es den Abend übersteht.«
Er zwinkerte Ruth fröhlich zu, trat hinter ein weiteres Mädchen, zupfte ihr Haar zurecht, prüfte mit strengem Blick das Make-up und scheuchte die Darstellerin mit wedelnden Händen aus dem Raum. Heute lag eine ganz besondere Aufregung in der Luft. Monatelang war geprobt worden, nun sollte es in wenigen Stunden die Premiere der »Entführung aus dem Serail« von Mozart geben. Jetzt, in den Nachmittagsstunden, stand die Generalprobe bevor. Ruths Mutter sang die Rolle des Blondchens, worauf sie mehr als stolz war. Ihre Kollegin Magda, die gerade mit Georginas Hilfe in ihr Kostüm schlüpfte, würde die Rolle der Konstanze übernehmen. Sie trug ein himmelblaues, aus Seidentaft gefertigtes Kleid mit Unmengen von Spitze an Saum und Ärmeln. Georgina hatte ihr langes schwarzes Haar kunstvoll hochgesteckt, was sie wunderschön aussehen ließ.
»Himmel, ich glaube, ich habe schon wieder zugenommen«, jammerte Magda, als Georgina die Schnürung des Kleides schloss.
»Kein bisschen, Kindchen«, erwiderte Georgina schmeichelnd. »Bist rank und schlank wie immer. Ich Dummerchen hab nur die Schnürung zu fest gezogen.«
»Unsere Georgina«, wandte sich Magda grinsend an Anni, die sich gerade die Wimpern tuschte. »Findet stets zur rechten Zeit die richtigen Worte.«
Anni stimmte lachend zu, während sie zu einem Lippenstift griff. Ruth beobachtete ihre Mutter dabei, wie sie ihre Lippen rot färbte. Sie liebte die Verwandlungen, die das Theater mit sich brachte. Für wenige Stunden in die Rolle eines anderen zu schlüpfen musste sich wunderbar anfühlen. Ihre Mutter sah unfassbar hübsch aus. Ihr halblanges braunes Haar war unter einer Perücke verschwunden. Lange rote Locken ringelten sich auf ihre Schultern herab. Sie trug ein grünes, mit Spitze und Perlen verziertes Seidenkleid, was sie zu einer richtigen Prinzessin machte. Versonnen beobachtete Ruth, wie ihre Mutter großzügig Rouge auf ihren Wangen verteilte. Im Spiegel sah Anni ihre kleine Tochter. Lächelnd drehte sie sich zu ihr um.
»Ruth, mein Schätzchen. Was meinst du: Kann deine Mutter sich so auf der Bühne blicken lassen?«
Ruth legte den Kopf zur Seite und musterte ihre Mutter von oben bis unten. Jedes Mal stellte Anni ihrer Tochter vor Beginn einer Vorstellung diese Frage, selbst vor den Proben, zu denen sie in alltäglicher Kleidung ging. Ruth bemühte sich stets um eine ernste Miene. Sie wollte genauso dreinblicken wie die Verkäuferinnen in den vornehmen Modehäusern auf der Zeil. Diese musterten ebenfalls zuerst prüfend, liefen um die Kundin herum, zupften am Stoff herum, liefen nochmals um die Kundin herum und verfielen dann in überschwängliche Begeisterungsstürme. Ruth hatte nicht nur einmal das Gefühl gehabt, dass dabei ordentlich geschwindelt wurde. Sie hatte während ihrer Zeit in der Garderobe einen guten Blick dafür bekommen, was besonders und geradezu einmalig war. Abwartend schaute Anni ihre Tochter an. Ruth nickte, zuerst mit ernster Miene, dann begann sie zu lächeln. Anni war erleichtert, sie nahm die Kritik ihrer kleinen Tochter ernst, auch wenn Ruth eigentlich so jung war, dass sie in der Garderobe eines Opernhauses nichts zu suchen hatte. Jedenfalls sagte das Henriette immer. Auf die alte Souffleuse hörte jedoch niemand. Vom ersten Augenblick an war vom Ensemble akzeptiert worden, dass Anni ihre Tochter mit in die Garderobe brachte. Sie war schwanger aufgetreten, jetzt hatte sie eben ein Kind, das es zu verwöhnen galt. In die glitzernde Welt der Oper hineingeboren, fiel es Ruth manchmal schwer, die reale Welt zu akzeptieren. Besonders die Schule konnte sie gar nicht leiden. Still sitzen in einem tristen Klassenzimmer voller Kinder, von denen sie nur wenige kannte, lag ihr nicht sonderlich. Auch musste sie in der letzten Bank sitzen, was ihr missfiel, denn sie hatte Probleme damit, die Schrift an der Tafel zu lesen. Luise, die im Haus gegenüber wohnte, saß gleich vor ihr. Mit ihr spielte Ruth ab und an auf dem Hof. Sie war ganz nett, den Kopf voller blonder Locken, ein Wirbelwind, der auch keine Scheu hatte, auf Bäume zu klettern. Meist begleitet von dem rothaarigen Fritz, der in einem der Nachbarhäuser wohnte. Von ihrer Straße war es nicht weit in den Güntersburgpark, wo man hervorragend auf Bäumen herumtoben konnte. Allerdings nur in einigen uneinsehbaren Ecken, denn der Parkaufseher mochte es nicht, wenn auf Bäume geklettert oder der Rasen betreten wurde. Nicht nur einmal hatte er sie als unerzogene Blagen beschimpft und fortgescheucht. Ruth war nie auf Bäume geklettert, denn sie fürchtete sich vor der Höhe und wollte keinen Kratzer bekommen. Abschürfungen, Mückenstiche oder, noch schlimmer: Pickel waren in der Oper gar nicht gern gesehen. Da benötigte es Unmengen von Make-up, um die schrecklichen Stellen, wie Georgina es nannte, zu überdecken. Luise und Fritz nannten sie deswegen manchmal einen Feigling, was ihr gleichgültig war. Bäume waren ihrer Meinung nach von unten am schönsten. Sie genoss es, unter ihnen im weichen Gras zu liegen und die Sonne durch das grüne Blätterdach funkeln zu sehen. Ihrem besten Freund Walter ging es genauso. Er wohnte im Hinterhaus und war zwei Jahre älter als sie. Häufig spielte er Klavier, in den Sommermonaten mit geöffneten Fenstern, so dass seine Musik weithin hörbar war. Ruth mochte es sehr, bei ihm zu sitzen, um ihm zuzuhören. Manchmal spielte er ihr zuliebe einfache Kinderlieder, »Hänschen klein« oder »Kein schöner Land«, die sie singen konnte. Oftmals sang sie auch mit ihrer Mutter, die streng darauf achtete, dass Ruth die richtigen Töne traf. Bald schon würde sie Gesangsunterricht erhalten. Für die Tochter einer berühmten Opernsängerin, die den größten Teil ihres Lebens in der bunten Welt des Opernhauses verbracht hatte, war diese Art der Ausbildung nur folgerichtig. So sagte es jedenfalls Walter. Ruth wusste nicht, was folgerichtig war und was nicht, es war ihr aber auch gleichgültig. Solange sie in ihrer Funkelwelt der Oper und in Walters Nähe bleiben konnte, würde schon alles seine Richtigkeit haben.
»Und was meinst du, mein kleines Sternchen«, fragte Magda, »kann auch ich mich auf der Bühne sehen lassen?«
Ruth drehte sich auf ihrem Hocker um und unterzog auch Magda einer eingehenden Musterung, bevor sie lächelnd den Daumen hob. »Da haben wir gerade noch mal Glück gehabt«, kommentierte Georgina Ruths Urteil und stemmte die Hände in die Hüften, »denn Zeit für ein erneutes Umziehen haben wir nicht mehr, meine Damen.«
Anni erhob sich. Ein letzter Blick in den Spiegel, ein rascher Kuss für Ruth, dann verließ sie in Begleitung von Magda den Raum. Hinter ihnen fiel die Tür ins Schloss, und es herrschte Stille. Ruth wusste, was nun käme, Georginas Worte waren stets dieselben.
»Jetzt wollen wir doch mal sehen, welches Kleid wir heute für dich finden, mein kleines Garderobenmädchen.« Wie gewohnt tätschelte Georgina ihr den Kopf, stöckelte an ihr vorüber zu den Kleiderständern und begann die Kostüme von links nach rechts zu schieben. »Eher das blaue Kostüm einer Fee mit Strasssteinchen oder doch lieber das rosafarbene Kleid einer Prinzessin mit viel Spitze? Obwohl das noch etwas lang sein könnte. Ich hätte auch eine Elfe im Angebot. Wunderhübsches Lila, mit Glitzersteinchen auf dem Oberteil und einem allerliebsten Tüllröckchen.« Er hielt den funkelnden Mädchentraum in die Höhe, und Ruth stimmte freudig zu.
»Und dazu eine lilafarbene Federboa«, rief sie aus und klatschte vor Begeisterung in die Hände.
»Aber gewiss doch«, sagte Georgina mit gespielt ernster Miene. »Ohne Federboa kann es unmöglich getragen werden.«
»Und ich brauche Rouge«, sagte Ruth. »Viel Rouge. Genau hier.« Sie deutete auf ihre Wange.
»Unbedingt«, stimmte Georgina zu. »Und eine Menge Lidschatten, dazu Wimperntusche und passenden Lippenstift.« Er trat neben Ruth und half ihr aus ihrem rot-weiß karierten Baumwollkleid, das Ruth nicht sonderlich leiden mochte, weil es so alltäglich war – und was konnte langweiliger sein als der Alltag, wie Georgina immer sagte.
Keine Minute später steckte Ruth in dem lilafarbenen Glitzertraum, der sich wunderbar zart auf der Haut anfühlte. Ihre Strumpfhosen, die leider am Knie einen winzig kleinen Fleck aufwiesen, verschwanden unter dem vielen Tüll. Sie ließ sie besser an, denn es war kühl in den Gängen, und eine Erkältung wäre das Letzte, was sie jetzt gebrauchen könnte. Georginas Worte klangen bestimmt. Bei einem gewissen Tonfall, das wusste Ruth, war mit dem Garderobier nicht zu verhandeln, obwohl sie viel lieber die hübschen Nylonstrümpfe der Erwachsenen angezogen hätte. Doch die hübschen durchsichtigen Strümpfe mit dem Strumpfband waren nicht für die kurzen Beine einer Sechsjährigen gemacht. Bis zum Haaransatz würden sie ihr reichen, wenn man sie denn so weit hochziehen konnte. Aber die hübschen lilafarbenen Absatzschuhe durfte sie anziehen, auch wenn sie noch etwas groß waren und sie darin kaum laufen konnte. Georgina stopfte Papier vorn rein, damit es einigermaßen ging. Sie setzte Ruth vor einen der unzähligen Spiegel. Umrandet vom warmen Licht der vielen Glühbirnen sah sie gar nicht so käsig aus wie in dem winzigen Spiegel, der in der Mädchentoilette der Schule hing, in der es nur das kalte Licht einer einzelnen Neonleuchte gab.
Gerade in dem Moment, als Georgina den Lidschatten auftragen wollte, wurde die Tür aufgerissen. Eines der Chormädchen betrat den Raum und redete aufgeregt los:
»Du musst schnell kommen, Georgina. Hanna ist gestürzt, und ihr Kleid hat am Ärmel einen Riss. So kann sie unmöglich auftreten.«
Georgina ließ sofort von Ruth ab, griff nach seinem Nähzeug, das stets bei seinen persönlichen Sachen neben der Tür lag, und verließ aufgeregt mit dem Mädchen den Raum. Die Tür fiel hinter ihnen ins Schloss. Ein kurzer Luftzug zog durch die Garderobe, Schritte entfernten sich, dann war es wieder still. Ruth blickte missmutig in den Spiegel. Ein Auge war bereits lila, das andere noch nicht. So konnte sie unmöglich zur Bühne gehen. Anständig musste sie aussehen, auch wenn niemand sie beachten würde. Auf keinen Fall wollte sie zwischen all den hübsch gekleideten jungen Frauen und Männern, die aufgeregt an ihr vorüberhuschten oder mit zittrigen Händen neben ihr standen, unfertig wirken. Entschlossen griff sie nach dem kleinen Pinselchen und schminkte das andere Auge lila. Das Ergebnis war nicht ganz so gelungen wie bei Georgina. Im Prinzip war nun alles rund um das Auge lila. Sie beschloss, das bereits geschminkte Auge anzupassen, auch wenn es etwas komisch aussah. Langsam ging ihr die Zeit aus. Alles noch einmal neu machen würde viel zu lange dauern, und ob es dann wirklich besser klappen würde, bezweifelte sie. Die Sache mit dem kleinen Pinselchen war komplizierter, als sie gedacht hatte. Bestimmt würde Mama gleich auf der Bühne stehen, und ihren Auftritt wollte sie auf keinen Fall versäumen. Sie griff nach dem großen Rougepinsel und färbte ihre Wangen großzügig rot. Danach zog sie ihre Lippen nach, ein wenig auch die Partie drumherum, aber was sollte es. Dann erschienen der Mund breiter und die Lippen voller. Schmallippig sollte keine Frau durchs Leben gehen, sagte Georgina immer, wenn er den Mädchen einen Kussmund aufmalte. Nach einem letzten prüfenden Blick in den Spiegel war sie mit ihrem Ergebnis zufrieden. Sie hopste vom Stuhl und schlüpfte in die hübschen Schuhe, aus denen sie, trotz des hineingesteckten Papiers, herausschlappte. Die Tür knarrte in den Angeln, als sie sie öffnete und auf den Flur hinaustrat. Kaltes Neonlicht empfing sie, das auf einen grauen Linoleumboden fiel, über den einige Staubflusen tanzten. Eine der Lampen flackerte surrend. Ruth hob den Kopf und straffte die Schultern. Sie wollte wie eine richtige Dame wirken, eine große Sängerin, die zu ihrem Auftritt eilte. Leider funktionierte das nicht so ganz, denn alle zwei Schritte verlor sie einen Schuh. Noch bevor sie das Ende des Ganges erreichte, gab sie es auf und ging auf Strümpfen weiter. Wenn sie gleich am Bühneneingang stehen würde, konnte sie die Schuhe wieder anziehen. Niemand würde merken, was für ein Missgeschick ihr passiert war. Sie eilte durchs Treppenhaus, einen weiteren Flur hinunter. Als sie hinter der Bühne eintraf, hatte die Musik bereits eingesetzt, und Magdas Stimme war zu hören. Hastig lief Ruth an den bunten Kulissen aus Pappe und Spanplatten vorüber und blieb neben den Chormädchen stehen, die auf ihren Einsatz warteten. Magdas Part endete, noch ehe sie in ihre Schuhe geschlüpft war. Jetzt betrat ihre Mutter die Bühne. Sie sah unglaublich schön im Licht der Scheinwerfer aus – anmutig, besonders und so zerbrechlich. Einen Moment war nur ihre Stimme zu hören, leise und sanft. Dann mischten sich die Klänge des Orchesters in ihre Melodie, ließen ihre Stimme stetig lauter, ihren Gesang leidenschaftlicher werden. Fort war die Zartheit von eben, und die Frau auf der Bühne wirkte entschlossen, ja beinahe wütend. In diesem Moment erschien ihre geliebte Mama Ruth wie eine Fremde. Sie war nicht Anni Kluger, sondern das Blondchen. Der Chor betrat die Bühne und stimmte in das Lied mit ein. Es war perfekt, genauso, wie es sein sollte, das spürte Ruth. Sie spähte hinter dem Vorhang vorbei auf die Ränge, die nicht vollkommen verdunkelt waren. In der vordersten Reihe, gleich hinter dem Orchester, saßen »die wichtigen Leute«, wie Georgina den Intendanten Hans Meissner und den ersten Kapellmeister Karl Zwissler bezeichnete. Die beiden entschieden an der Oper über alles und jeden. Die Musik endete, und ihre Mutter verließ die Bühne, genauso wie der Chor. Kurz breitete sich Dunkelheit aus, die binnen weniger Sekunden von dem erneuten Aufleuchten eines Scheinwerfers vertrieben wurde. Magda stand nun allein auf der Bühne. Sie strahlte eine andere, reifere Art von Schönheit aus. Trotz der sanften Töne, die sie anstimmte, hatte die Altistin nichts Zerbrechliches an sich. Ein Mann betrat die Bühne und sang die nächste Strophe. Das Lied wurde leidenschaftlicher, mitreißender. Eine Bewegung im Publikum ließ Ruths Blick erneut zur ersten Reihe wandern. Ein Mann war näher getreten und redete aufgeregt auf den Intendanten ein. Er hatte ein Stück Papier in den Händen, das er immer wieder in die Höhe hielt. Hans Meissner erhob sich. Gemeinsam mit dem Mann liefen sie am Orchester vorüber und zu einem der Seitenaufgänge. So vermutete es Ruth jedenfalls, denn sie verschwanden im Zwielicht und waren bald nicht mehr zu sehen. Irgendetwas musste passiert sein, sonst würde der Intendant seinen Platz nicht so hastig verlassen, dessen war sich Ruth sicher. Ihr Herz begann vor Aufregung schneller zu schlagen. In den letzten Monaten hatte es immer wieder sonderbare Vorfälle an der Oper gegeben. Beliebte Darsteller waren verschwunden, darunter auch Ilse, eines der Chormädchen, das sie so sehr gemocht und das laut ihrer Mutter eine echte Karriere vor sich gehabt hatte. Als Ruth neulich nach ihr fragte, hatten sich alle bedeutungsvolle Blicke zugeworfen. Irgendjemand sagte, dass es auch im Orchester zwei Männer getroffen habe und dass es eine Schande sei. Es fiel der Name des ehemaligen Dirigenten Hans Wilhelm Steinberg. Georgina hatte dann für Ruhe gesorgt und allen den Mund verboten. Es sei besser, nicht zu reden. Sie hatte Georgina gefragt, warum das besser sein solle. Eine befriedigende Antwort war er ihr schuldig geblieben. Und Ilse tauchte nicht mehr auf. Jetzt erinnerte sich Ruth daran, dass es vor Ilses Verschwinden ähnlich gewesen war. Während einer Probe war ein Mann mit einem Schreiben aufgetaucht, daraufhin hatte es eine Unterbrechung und heftiges Getuschel gegeben. Diesmal lief das Stück weiter, was Ruth nach einer Weile beruhigte. Endgültig entspannte sie sich, als sie bemerkte, dass die beiden Männer wieder ihre Plätze einnahmen. Der Akt endete, und der Vorhang fiel. Wie immer wurden nun die Kulissen gewechselt, und Ruth trat nach hinten, um niemandem im Weg zu stehen. Sie wanderte zu ihrem gewohnten Platz, einer schäbigen Holzbank, wo normalerweise ihre Mutter auf sie wartete, um sie zu fragen, wie es ihr gefallen habe. Heute jedoch war die Bank verwaist. Stattdessen trat Georgina neben Ruth und ging neben ihr in die Hocke.
»Deine Mutter ist in der Garderobe, meine Süße.« Er strich Ruth eine Haarsträhne aus der Stirn. In seinen Augen schimmerten Tränen. »Es tut mir so unendlich leid.« Seine Stimme brach.
Ruth trafen seine Worte wie ein Schlag ins Gesicht.
»Ilse?«, war alles, was sie herausbrachte. Georgina nickte mit ernster Miene. Er griff nach Ruths Hand, doch das Mädchen riss sich los. Sie wollte losrennen, stolperte jedoch nach wenigen Schritten über ihre Füße und fiel der Länge nach hin. Tränen liefen über ihre Wangen, während sie aufzustehen versuchte. Sie spürte Georginas Hände und ließ zu, dass sie der große Mann auf den Arm nahm und durch die Kulissen davontrug. Georginas Schuhe klackerten auf dem grauen Linoleumboden und hallten von den Wänden wider. Als sie die Garderobe betraten, saß Anni allein an ihrem Schminktisch. Sie hatte bereits die Perücke abgenommen und ihr braunes Haar gelöst. Vor ihr lag ein zusammengefalteter Brief neben dem Rougepinsel und dem Lippenstift.
»Jetzt ist es also so weit«, sagte sie mit leiser Stimme. Georgina trat näher, Ruth noch immer auf dem Arm.
»Wir wussten, dass es irgendwann passieren würde.«
Anni nickte. »Ich weiß, es ist nur …« Sie verstummte und blickte sich in der Garderobe um. »Was soll nur werden ohne all das, ohne die Bühne? Ich lebe dafür. Was habe ich ihnen getan, dass sie mich so behandeln?«
»Nichts hast du getan«, erwiderte Georgina und sank auf einen Stuhl. Annis Blick fiel auf Ruth. Sie nahm Georgina ihre Tochter ab, setzte sie auf ihren Schoß und umarmte sie fest. Ruth war wie erstarrt. Bedeutete das wirklich, was sie ahnte? Würden sie genauso verschwinden wie Ilse? Aber die Oper war ihr Zuhause, die Garderobe, die Bühne, Georgina und all die anderen. Sie gehörten doch dazu.
»Wenn nur Johann noch leben würde«, sagte Anni plötzlich. »Er wusste immer, was zu tun war.«
»Ich weiß nicht, ob er dir jetzt helfen könnte«, sagte Georgina. »Es ist zu groß, zu übermächtig.«
»Doch, er hätte geholfen«, suchte Anni in der Erinnerung an ihren Ehemann Zuflucht vor dem Unvermeidlichen. »Er wäre zum Intendanten gelaufen und hätte ihm den Marsch geblasen. Und am Theater war er jemand, ein Mann von Einfluss – einer, dem sie zuhörten.«
»Wer hört heute überhaupt noch jemandem zu?«, sagte Georgina schulterzuckend.
»Das frage ich mich auch manchmal«, erwiderte Anni leise.
»Niemand wollte es hören«, sprach Georgina weiter. »Ich hab es schon im Januar gesagt, als sie jubelnd durch die Straßen liefen und Heil Hitler riefen. Das Jahr wird nichts Gutes bringen, hab ich gesagt. So ist es gekommen, und es wird schlimmer werden.« Seine Stimme klang traurig, was Ruth, die noch immer auf dem Schoß ihrer Mutter saß, erschreckte. Georginas Stimme hatte niemals traurig geklungen, manchmal laut, wütend oder zynisch, aber niemals traurig. Der Garderobier erhob sich und tätschelte Annis Schulter. »Ist besser, wenn wir nicht weiterreden. Am Ende haben die Wände noch Ohren. Wir sehen uns. Ganz gewiss.«
Anni nickte schweigend. Sie brachte es nicht fertig, Worte des Abschieds auszusprechen. Sie wollte sich nicht von Georgina verabschieden, keine herzzerreißende Szene machen. Es sollte wie immer sein, auch wenn es das niemals wieder sein würde. Georgina öffnete die Tür, hielt dann jedoch inne und drehte sich um. »Ich hab da was aufgeschnappt. Steinberg organisiert irgendwas für jüdische Künstler. Hängt wohl mit einem Kulturbund in Berlin zusammen. Vielleicht wäre das ein Neuanfang für dich.«
»Vielleicht«, erwiderte Anni. Im Augenblick war sie zu sehr vor den Kopf gestoßen, um an Neues zu denken. Jetzt galt es, die nächsten Stunden zu überstehen. Gemeinsam mit Ruth nach Hause zu fahren – zum letzten Mal die gewohnte Strecke mit der Straßenbahn. Die Tür fiel hinter Georgina ins Schloss, und die beiden blieben in der Stille der Garderobe zurück. Nach einer Weile bat Anni Ruth, ihr mit dem Reißverschluss des Kleides behilflich zu sein. Sie schlüpfte aus dem grünen Seidentraum, hängte ihn hinter sich auf einen Bügel, setzte sich an ihren Schminktisch und begann sich abzuschminken. Genau in diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und Leni Baumgartner eilte in den Raum. Als sie Anni erblickte, blieb sie abrupt stehen.
»Du bist noch hier?«, stellte sie ohne Begrüßung fest.
Anni würdigte ihre Zweitbesetzung, mit der es in den letzten Monaten nicht nur einmal Streit gegeben hatte, keines Blickes.
»Ich bin angerufen worden«, sagte Leni und zog ihren Mantel aus. »Ist es also endlich so weit. Bis heute Morgen habe ich gedacht, sie lassen dich verkommene Jüdin tatsächlich noch auftreten.«
Lenis Beleidigungen und offen zur Schau gestellte Abscheu gegen alles Jüdische trafen Anni schon lange nicht mehr. Sie schwieg weiterhin. Was sollte sie auch sagen? Es war entschieden, der Kampf der letzten Monate verloren. Anni Kluger, die gefeierte Sopranistin, war ab dem heutigen Tag an der Frankfurter Oper Geschichte. Sie erhob sich, strich Ruth, die neben ihrem Schminktisch auf ihrem Hocker saß, über das braune Haar und schlüpfte in Rock und Bluse.
Leni berührte das seidene Kleid. Ein Lächeln huschte über ihre Lippen.
»Ich habe es immer gewusst. Das Blondchen ist wie für mich gemacht.« Sie wandte sich Anni zu. »Es ist nicht nur der jüdische Hintergrund. Ich bin die Bessere von uns beiden.« In ihren Augen blitzte Gehässigkeit auf. Anni, die damit begonnen hatte, ihre persönlichen Gegenstände vom Schminktisch in ihre Tasche zu befördern, schluckte die bissige Bemerkung hinunter, die ihr auf der Zunge lag. Es lohnte nicht zu streiten.
»Das glaubst auch nur du«, sprach plötzlich jemand anderes aus, was sie dachte. Beide Frauen blickten sich um.
In der Tür stand Georgina. Langsam trat er näher und blieb direkt vor Leni stehen. »An Anni Kluger wirst du mit deinem windigen Stimmchen niemals heranreichen. Aber es war schon immer nicht von Nachteil, den richtigen Mann zu heiraten.« Er machte eine wegwerfende Handbewegung. Leni schnappte nach Luft.
»Was für eine infame Unterstellung«, setzte sie an. Weiter kam sie jedoch nicht, denn Anni unterbrach sie.
»Lass es gut sein, Georgina. Die Entscheidung ist gefallen.« Sie griff nach ihrer Tasche, nahm Ruths Hand und trat neben den Garderobier. »Leni wird das Kind heute Abend schon schaukeln.« Sie blickte ihrer Konkurrentin direkt in die Augen.
Alle drei schwiegen für einen Moment, dann nickte Leni Baumgartner und erwiderte ohne jede Form von Gehässigkeit in der Stimme: »Gewiss doch.«
Anni nickte. Zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, so etwas wie Achtung in Lenis Blick zu erkennen.
»Komm, Ruth. Es ist Zeit zu gehen.« Ohne ein weiteres Wort trat sie zur Tür, öffnete diese und trat auf den Flur. Georgina folgte den beiden. Sie liefen den langen Flur entlang Richtung Eingangshalle, wo sie an einem der Seitenausgänge stehenblieben.
»Das soll es also gewesen sein«, sagte Georgina.
»Wir haben es doch alle geahnt«, erwiderte Anni. »Du hast gehört, was Magda eben hinter der Bühne gesagt hat. Auch um die Verlängerung ihres Vertrages steht es schlecht.« Georgina nickte mit ernster Miene und fragte: »Was wirst du jetzt machen?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Anni ehrlich. »Erst einmal nach Hause gehen.«
Georginas Blick fiel auf Ruth, die brav und still neben Anni stand. Er ging neben ihr in die Hocke, hielt ihr zwei Sahnebonbons hin und sagte: »Für den Heimweg.« Er umarmte sie und drückte sie fest an sich. Danach schloss er Anni in die Arme und flüsterte ihr ins Ohr: »Das heute ist kein Lebewohl. Es ist ein bis bald. Das weiß ich bestimmt.«
Er ließ Anni los. Sie nickte mit Tränen in den Augen und drückte noch einmal seine Hand. Dann verließ sie mit Ruth an der Hand endgültig das Opernhaus.
Draußen empfing sie helles Sonnenlicht. Für Ende Oktober war es ein ungewöhnlich warmer Tag. Vor der Oper hatte sich eine laut grölende Menschengruppe versammelt. Worte wie »elender Jude« fielen. Anni zog Ruth näher an sich heran. Sie versuchte, sich durch die Menge zu schieben, blieb jedoch im Gedränge stecken. Die vielen scheußlichen Schimpfworte gingen ihr durch Mark und Bein. Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass der Hohn und Spott der Menschen auch ihr galten. Ihr, die sie doch gar keine Jüdin mehr war, sich niemals als eine gefühlt hatte. Oder hatte sie sich alles nur schönreden wollen? Nur nicht darüber nachdenken, nicht hinsehen, dann würde es schon irgendwie gehen? Sie war evangelisch, ihr Mann war Katholik gewesen. Sie waren nicht strenggläubig, aber sie hatten Weihnachten gefeiert, waren ab und an in der Kirche, Ruth war feierlich im Dom getauft worden. Hätte sie sich vielleicht mehr engagieren sollen? Zählte das überhaupt? Den Beweis für ihre vermeintliche Herkunft hatte sie in ihrer Tasche, die sie fest im Arm hielt. Plötzlich hatte sie das Gefühl, sämtliche Umstehende könnten den Brief lesen, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihr als Jüdin der Vertrag gekündigt worden war. Sie wurde von der grölenden Menge vorangeschoben und sah den Auslöser für den Menschenauflauf. Nicht weit von ihr kniete ein älterer Mann vor einem Karikaturisten auf dem Boden. Anni kannte beide. Der Karikaturist hieß Friedrich. Er war ein in die Jahre gekommener Künstler, der jeden Tag vor der Alten Oper saß, um seinen Lebensunterhalt mit Zeichnungen für Passanten zu verdienen. Er hatte vor einigen Jahren sogar ein Gemälde von Johann angefertigt, das sie noch immer aufbewahrte. Vor ihm kniete Adolf Grünhut, der bis vor einem Jahr erster Chortenor des Ensembles gewesen war. Ein stiller und besonnener Mann, der aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden war, was viele bedauert hatten. Mitleidig beobachtete Anni, wie er sich nun mühsam vor dem Karikaturisten aufrechthielt. Sein Haar war noch dünner geworden und vollkommen ergraut. Anni glaubte, seine Panik zu spüren. Friedrich war mit dem Bild fertig und reichte es einem SS-Mann. Der stämmige Bursche zog Adolf auf die Beine und hängte ihm das Bild um den Hals. Ein Jude in einem langen Kaftan war darauf abgebildet. Darunter stand in großen Buchstaben:
Bänkelsänger und Jud vom Opernhaus.
Anni zuckte innerlich zusammen, als der SS-Mann Adolf mit dem Gewehr ins Kreuz schlug und ihn anbrüllte, dass er nach Hause laufen sollte, elende Judensau, die er war. Adolf setzte sich in Bewegung, langsam und schwerfällig. Der SS-Mann trieb ihn zur Eile an, prügelte regelrecht auf ihn ein, angetrieben von dem grölenden Mob. Die Menge entfernte sich vom Eingang der Oper. Anni und Ruth blieben zurück, genauso wie Friedrich, der Annis Blick auffing und mit den Schultern zuckte. Sie wandte sich ab. Ihr Herz schlug ihr vor Aufregung bis zum Hals, ihre Hände zitterten. Sie mussten fort von hier. Irgendwohin, wo die Angst nicht spürbar war, sie niemand argwöhnisch beäugen konnte. Gab es einen solchen Ort überhaupt noch? Ihre kleine Welt, in der sie sich nach Johanns plötzlichem Tod so mühsam zurechtgefunden hatte, schien heute endgültig ausgelöscht worden zu sein. Sie blickte der grölenden Menge hinterher, die bereits die Taunusanlage erreicht hatte. Heute war es Adolf, den es traf. Morgen vielleicht sie selbst. War sie nicht auch eine Jüdin?
»Wieso waren die Männer so gemein zu Adolf?«, riss Ruths Stimme sie aus ihren Gedanken. Sonderbarerweise beruhigte sie die kindlich unbefangene Frage. Ruth war das Wichtigste. Ihre Hand lag in der ihren. Anni musste sich kümmern, durfte jetzt nicht durchdrehen. Irgendein Weg würde sich finden. Jetzt mussten sie erst einmal nach Hause fahren.
»Wenn ich das wüsste«, antwortete sie ausweichend. »Komm, lass uns gehen. Vielleicht hat Walter Zeit zum Spielen. Das wäre doch schön.«
Annis Worte sollten arglos klingen, taten es aber nicht. Ihre Stimme zitterte. Walter war ebenfalls Jude, kam ihr in den Sinn, während sie zur Straßenbahn gingen. Und Walter war kein Konvertierter, wie sie es war. Er war auch kein Mischling wie Ruth. Mischling, wie sich das anhörte, dachte Anni, während sie in die Straßenbahn stiegen und Platz nahmen, Ruth wie immer am Fenster, weil sie es so sehr liebte, nach draußen zu blicken. Die Bahn setzte sich in Bewegung, und Frankfurts Straßen und Häuser strichen an ihnen vorüber. Bisher hatte Anni es zumeist genossen, die vorbeiziehende Welt vor dem Fenster zu betrachten. Heute jedoch machte ihr die vertraute Umgebung Angst. Zum ersten Mal nahm sie die Schilder gegen Juden in den Schaufenstern der Läden war. Bisher hatte sie sich nie darum geschert und einfach überall eingekauft. Bisher war ihre jüdische Herkunft nie ein Thema gewesen, weder für sie selbst, noch für andere. Jetzt sah die Welt anders aus. Gewiss würde bald jeder wissen, dass sie ihre Stellung bei den Bühnen verloren hatte. Wo sollte sie Arbeit finden? Eine Jüdin, die nichts anderes als Singen konnte, würde niemand haben wollen. Sie erreichten ihre Haltestelle und stiegen aus. Die Sonne versank hinter den Hausdächern, als sie in die vertraute Güntersburgallee mit ihren alten Stadthäusern, die meisten um die Jahrhundertwende gebaut, einbogen. Die Straße war beschaulich, mit einem Grünstreifen in der Mitte, und zum nahen Park war es nicht weit. Trotzdem hatte Anni sich anfangs schwergetan, sich im Nordend, wie der Stadtteil hieß, einzuleben. Nach Johanns Tod waren sie und Ruth von ihrer Schwiegermutter im Eilverfahren aus dem hübschen Reihenhaus in der Brommstraße hinauskomplimentiert worden, das sie ihrem Sohn niemals überschrieben hatte, obwohl er sie mehrfach darum bat. Urplötzlich hatte sie die Immobilie verkaufen wollen. Renate Kluger hatte in all den Jahren ihrer Ehe nur wenige und wenn dann unfreundliche Worte mit ihrer Schwiegertochter gesprochen. Die streng katholische Frau hatte es ihrem Sohn nachgetragen, dass er eine Protestantin geheiratet hatte. Ein Lutherweib, wie sie einmal abfällig sagte. Nach Johanns Tod setzte sie alles daran, die ungeliebte Schwiegertochter mitsamt der nicht standesgemäßen Enkeltochter loszuwerden. Selbst Ruth schaffte es nicht, dass Herz dieser starrköpfigen Frau zu erweichen. Das Haus in der Brommstraße war von einer nett aussehenden Familie gekauft worden, was Anni nur deshalb wusste, weil sie einmal, von der Sehnsucht nach ihrem alten Leben getrieben, dorthin zurückgekehrt war. Wie sehr sie Johann, die Liebe ihres Lebens, vermisste, war ihr beim Anblick des Hauses wieder richtig bewusst geworden. Seit seinem Tod hatte sie keinen Mann mehr in ihr Leben gelassen. Verehrer gab es genug, doch sie brachte es nicht fertig, sich auf jemanden einzulassen. Niemand würde jemals seinen Platz einnehmen können.
Im letzten Jahr hatte ihre Schwiegermutter das Zeitliche gesegnet. An einem kalten Februartag war sie auf dem Hauptfriedhof beigesetzt worden. An dem Tag plagte Ruth eine starke Erkältung, was Anni daran hinderte, zu dem Begräbnis zu gehen. Jedenfalls redete sie sich bis heute ein, dass der Schnupfen ihrer Tochter sie davon abgehalten hatte. Johann wäre hingegangen. Auch wenn das Verhältnis schwierig gewesen war, hatte er den Kontakt zu seiner Mutter nicht abreißen lassen. Aber sie war nicht Johann, sondern das verhasste Lutherweib. Sie war sich sicher, dass Renate eigenhändig aus dem Sarg geklettert wäre, um sie von ihrer Beerdigung zu vertreiben, wenn sie es denn gekonnt hätte. Der Gedanke daran hatte sie für einige Tage belustigt. Eine Weile danach kam das Schreiben eines Notars, und bei der darauffolgenden Testamentseröffnung versöhnte sich Anni ein wenig mit ihrer Schwiegermutter. Sie hatte für Ruth eine große Summe Geld angelegt, die für ihre Ausbildung verwendet werden sollte und bis zu ihrer Volljährigkeit unter Aufsicht des Notars stand. Ganz so hartherzig schien sie also doch nicht gewesen zu sein.
Jetzt, wo die Sonne weg war, bemerkte man, dass der November bevorstand. Der Oktober hatte sie mit milder Luft verwöhnt, doch der nahende Winter lauerte bereits, das Zepter zu übernehmen. Die Bäume verloren ihr buntes Kleid, das sich auf die Wege legte und unter den Füßen raschelte, was Ruth besonders liebte. Normalerweise blieb sie alle paar Meter stehen, um eine Kastanie oder eine Buchecker aufzuheben. Heute tat sie dies nicht. Ihre Miene war ernst, und sie war still. Die Ereignisse des Tages lähmten sie beide. Sie erreichten ihr Zuhause, einen vierstöckigen Bau mit hübschen Erkern, der ganz oben einen Balkon hatte. Sie bewohnten eine kleine Dreizimmerwohnung, die nach hinten rausführte und keinen Erker, geschweige denn einen Balkon hatte. Aber immerhin große Fenster, durch die in den Nachmittagsstunden Sonnenlicht in Ruths Zimmer fiel, was sie sehr liebte. Auch besaß die Wohnung ein kleines Badezimmer gleich neben der Küche, was nicht selbstverständlich war, denn oftmals hatten die alten Häuser Etagenbäder. Eine Mitarbeiterin der Städtischen Bühnen hatte damals eine Nachmieterin am schwarzen Brett gesucht. Ein bisschen Glück brauchte der Mensch ab und an im Leben, hatte Anni damals gedacht, als sie die gemütliche Wohnung zum ersten Mal betrat und sich sofort mit Luise und ihrer Vermieterin, einer dicklichen, schwerhörigen Frau, einigte.
Als Anni die Haustür aufschob, öffnete sich wie gewohnt die Tür von Hiltrud Meiser, die im Erdgeschoss wohnte. Anfangs hatte Anni die alte Nachbarin für eine unerträglich neugierige Person und Tratschtante gehalten, die mit Sicherheit jeden Klatsch der Straße kannte. Mit der Zeit hatte sie ihre Meinung dann geändert. Frau Meiser war vor allem einsam. Ihr Mann war im Ersten Weltkrieg gefallen, die Ehe war kinderlos geblieben. Im fernen Amerika lebte ihre Schwester Anneliese, die mit ihrem Mann in den zwanziger Jahren ausgewandert war und ab und an Briefe schrieb, denen sie Bilder ihrer Familie beilegte, die Frau Meiser traurig stimmten. Bei einer Tasse Tee, die sie Anni irgendwann regelrecht aufgezwungen hatte, hatte sie ihr die Bilder gezeigt. An diesem Nachmittag hatte Anni eine andere Hiltrud Meiser kennengelernt. Eine Frau, die einem nicht gelebten Leben hinterhertrauerte, niemals so mutig wie ihre Schwester gewesen war, und jetzt in diesem Haus saß und ein wenig Ansprache bei ihren Nachbarn suchte. Die meisten nahmen sie nicht für voll, hielten sie für neugierig und geschwätzig, aber keiner kannte sie wirklich. Zu Anni hatte Hiltrud bald Vertrauen gefasst, war sie doch ebenfalls Witwe und hatte dieses entzückende kleine Mädchen, das sie so gern mit Sahnebonbons und Schokolade verwöhnte.
»Guten Abend, Anni. Sie sind bereits zurück?«, fragte Frau Meiser. »Ich dachte, heute wäre die Premiere des neuen Stückes.« Ihr Blick fiel auf Ruth, die sich eng an ihre Mutter schmiegte.
»Mir ist übel geworden«, log Anni und drückte Ruths kleine Hand, obwohl sie wusste, dass Ruth die Lüge niemals verraten würde.
»Sie sehen auch recht blass aus, meine Liebe«, konstatierte Frau Meiser mit besorgter Miene. »Soll ja so ein schrecklicher Virus umgehen. Die Buben von Frau Glock gegenüber haben drei Tage flachgelegen, alle viere auf einmal, das muss man sich mal vorstellen. Es kommt einem Wunder gleich, dass Frau Glock gesund geblieben ist. Ich meide sie trotzdem, die Buben auch. Erst heute stand einer von ihnen beim Herz hinter mir in der Reihe. Da bin ich schnell ein paar Schritte zur Seite gegangen, man weiß ja nie. Untragbar, einen der Jungen kurz nach einer solchen Krankheit zum Metzger zu schicken. In meinem Alter ist mit so etwas nicht zu spaßen, meine Liebe, beileibe nicht.«
»Dann werde ich mal zusehen, schnell nach oben zu kommen«, nutzte Anni eine Atempause der alten Dame. »Ich will ja nicht, dass Sie sich bei mir anstecken.«
»Aber natürlich«, beeilte sich Frau Meiser zu sagen.
Anni verabschiedete sich und zog Ruth zur Treppe. »Und das ausgerechnet heute, wo Sie sich doch so auf die Aufführung gefreut hatten. Nun, da kann man wohl nichts machen.« Sie schüttelte den Kopf.
Anni und Ruth hatten bereits den mittleren Treppenabsatz erreicht, und Frau Meiser redete noch immer. »Scheint ja wirklich aggressiv zu sein, dieser Virus. Wollen wir hoffen, dass ihn das Kind nicht bekommt.« Anni erreichte den ersten Stock, schloss die Tür auf und sagte mit lauter Stimme: »Ja, das wollen wir hoffen. Einen schönen Abend noch, Frau Meiser.« Sie beeilte sich, die Tür zu schließen, und lehnte sich erleichtert von innen dagegen. »Guter Gott. Und ich hatte gehofft, wir könnten ihr heute ausnahmsweise entgehen.«
»Aber ihre Sahnebonbons sind lecker«, sagte Ruth.
Anni blickte auf ihre Tochter hinab. Ihre Worte brachten sie zum Lächeln. »Und ihre selbstgebackenen Kekse sind auch nicht zu verachten.« Liebevoll strich sie Ruth über die braunen Locken. Sonderbarerweise schien es Hiltrud Meiser mit ihrer vertrauten Redseligkeit geschafft zu haben, sie aus ihrer Erstarrung zu lösen. Das Leben brach nicht vollkommen entzwei, es folgte noch immer seinen Gewohnheiten, auch wenn es heute einige Risse bekommen hatte, die nur schwer zu kitten sein würden. Irgendwie würde es schon weitergehen, ging es doch immer.
»Sie ist ja auch eine liebe Person.« Anni zog ihren Mantel aus, ging in die Wohnstube und öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Doch nicht nur frische Luft drang in den Raum, sondern auch die vertrauten Klänge eines Klaviers, die Ruths Herz einen freudigen Satz machen ließen.
»Hab ich nicht gesagt, dass Walter da sein wird?«, sagte Anni und drehte sich lächelnd zu ihrer Tochter um. »Wenn du willst, kannst du gleich hinüberlaufen. Vielleicht singt er noch ein wenig mit dir.«
Das ließ sich Ruth, die ihren Mantel noch nicht abgelegt hatte, nicht zweimal sagen. Eilig drückte sie Anni ein Küsschen auf die Wange und verließ die Wohnung. Keine Minute später sah Anni ihre kleine Tochter über den Hof flitzen und die Tür zum Hinterhaus aufschieben. Sie wandte sich vom Fenster ab. Ihr Blick fiel auf das Telefon, das auf der Kommode stand, und plötzlich kamen ihr Georginas Worte wieder in den Sinn. Steinberg macht da irgendetwas mit einem Kulturbund. Kurz entschlossen griff sie zum Hörer und wählte seine Nummer, die neben dem Telefon in einem Adressbuch stand. Als er sich meldete, sank sie erleichtert auf das Sofa und begann zu erzählen.