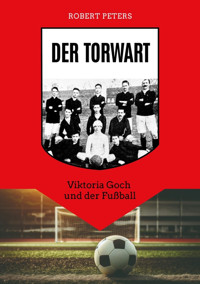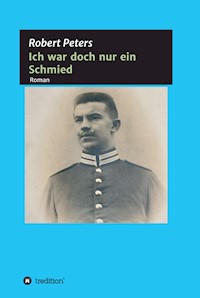7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Reginald hat nicht nur einen seltsamen Namen, er ist auch schon lange tot. Trotzdem erinnert er sich gut an den Sommer 1971, als das Transformatorhäuschen am Freibad zum Treffpunkt der Jugend wurde. Hier verbringen die Langhaarigen, die Möchtegern-Hippies und Kleinstadt-Revolutionäre und ihre ständig wechselnden Freundinnen ihre Nachmittage, hier sitzen sie herum, rauchen und hören ihre Musik. Jeder von ihnen hat sein eigenes Lied, in dem die Eigenarten und die Träume aufbewahrt sind. Heike träumt vom Sommer in Kalifornien (California Dreamin'), Hüppie ist fasziniert von den Beatles (A Day in the Life), Udo hört Iron Butterfly (In a gadda da vida). Reginald sieht sie in diesem Sommer auf der Wiese, er wandert in ihren Gedanken herum, und er kann manchmal sehen, was aus in ihnen geworden ist und ihre Geschichten erzählen. Es sind zwölf Geschichten und zwölf Lieder. Sie handeln vom langsamen Tempo der Kleinstadt, vom Aufbruch aus der Kindheit, vom Glauben an die Kraft der Musik und von vielen Enttäuschungen. Reginald fragt sich, ob das einem großen Plan folgt. Er hat ja viel Zeit, sich viele Fragen zu stellen. Natürlich handeln die Geschichten gelegentlich auch vom Tod – nicht nur beim Ich-Erzähler Reginald. Die frühen Siebziger Jahre sind in der Kleinstadt an der holländischen Grenze auch die Zeit der Drogen. Haschisch gibt es im nahen Holland, und weil die Helden der Kleinstadt-Jugend, die Musiker der Woodstock-Generation, Drogen nehmen, tun es die Jugendlichen ebenfalls. Drogenkonsum ist so etwas wie der Ausweis, dazu zu gehören. Und es bleibt bei vielen nicht beim Joint. Einige Drogenkarrieren enden tödlich. Zum Beispiel die von Berg, der sich mit geklauten Zigaretten aus dem Laden seines Vaters beliebt machen will und der seine Minderwertigkeitskomplexe mit Heroinkonsum bezwingt. Er setzt schließlich gemeinsam mit seinem Drogenfreund Udo ein Auto vor den Baum. Das ist so banal wie die Geschichten anderer Jugendlicher, die sich am Transformatorhaus am Freibad treffen, um Zeit zu verbringen. Ihre kleinen Sensationen sind der langhaarige Abiturient, der sich bei seinem Vater dafür rächte, dass ihm im Schlaf die Haare geschnitten worden waren, indem er die Hose des besten Anzugs seines Erziehungsberechtigten auf Shortslänge änderte. Oder die seines Klassenkameraden, der seinen Abituraufsatz zum Thema "Was ist Mut" mit dem schlichten Wort "DAS" bestritt. Die Geschichten begleiten das Herumtasten jener Generation ins Leben, die man heute die der Babyboomer nennt und die sich nun als Rentner fragt: War das alles? Und warum ging das so schnell?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Imagine there′s no heaven, it's easy if you try,
no hell below us, above us only sky.
Imagine all the people, living for today.
John Lennon
Handlung und handelnde Personen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Geschehnissen und lebenden oder gestorbenen Personen wäre rein zufällig.
Für Niko, Veronika und all die Anderen
Robert Peters
Sommer 1971
Soundtrack einer Kleinstadt-Jugend
© 2024 Robert Peters
Coverfoto von: Franz Peters
Verlagslabel: Robert Peters
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Robert Peters, Hauptstraße 232, 41236 Mönchengladbach, Germany.
Inhalt
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1 - Reginald
Kapitel 2 - Hüppie
Kapitel 3 - Harry
Kapitel 4 - Udo
Kapitel 5 - Heike
Kapitel 6 - Ginger
Kapitel 7 - Chris
Kapitel 8 - Angelika
Kapitel 9 - Karlo
Kapitel 10 - Tüllmann
Kapitel 11 - Shag
Kapitel 12 - Heinrich
Sommer 1971
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1 - Reginald
Kapitel 12 - Heinrich
Sommer 1971
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
Kapitel 1 - Reginald
Sänger: Joe Cocker
Lied: With a Little Help from my Friends
Ich bin nun schon lange tot. Aber ich komme trotzdem immer wieder her. Heute ist hier ein Kindergarten, und in den früheren Häusern der englischen Soldaten wohnen längst deutsche Familien. Der Anstrich hat sich nicht geändert, die Häuser sehen immer noch aus wie Pfefferminzbonbons in einem englischen Laden, staubig blau, staubig grün oder staubig rötlich. Kunstlehrer würden wahrscheinlich sagen: Es sind Pastelltöne.
Früher gab es hier eine kleine Wiese mit vielen braunen Flecken, Rasen konnte man das nicht nennen, und vor einem Zaun, der die Wiese von den Häusern dahinter abtrennte, stand ein Transformatorhäuschen. Darauf war ein gelbes Schild befestigt, das vor den großen Gefahren warnte, wenn einer auf die Idee verfallen sollte, das Ding unbefugt zu öffnen. Auf die Idee ist nie jemand gekommen, soviel ich weiß.
Im Laufe der Jahre habe ich die Wiese verschwinden sehen und das Freibad daneben, ich sah den Kindergarten wachsen und die Baukräne. Irgendwann waren auch die weg. Es müssen Jahre gewesen sein, viele Jahre, obwohl mein Zeitgefühl nachgelassen hat, seit ich tot bin.
Ich hab mir früher immer vorgestellt, wie die Ewigkeit wohl sein könnte. Ich habe gedacht, das muss ein ganz schönes Gedränge da oben sein, wenn das mit dem Himmel stimmt – oder mit der Hölle, dann wäre das Gedränge irgendwo ganz unten oder oben und unten. Und weil der Teufel in den alten Geschichten Herr der Lüfte ist, auch noch dazwischen. Auf jeden Fall Gedränge. Überall.
Jetzt weiß ich, dass die Ewigkeit die Konturen von Zeit und Raum einfach aufweicht und langsam, ganz langsam zerfließen lässt, ungefähr so wie auf den Bildern von Dalí. Die hab ich noch zu Lebzeiten gesehen und bewundert. Verstanden habe ich sie erst jetzt.
Aber auch Dalí hat sich bestimmt nicht wirklich vorstellen können, wie das in der Ewigkeit ist. Und fragen, wie er es sich vorgestellt hat, kann ich ihn nicht. Denn die Toten treffen sich nicht. Das war für mich ebenso eine Überraschung wie die Tatsache, dass ich die alten Orte immer wieder besuchen kann. Im Religionsunterricht habe ich damals gelernt, dass Jesu Geist über den Wassern schwebte – oder war es der Geist Gottes? Es macht wohl keinen großen Unterschied, wenn das mit der Dreifaltigkeit stimmt. Mein Geist schwebt über Goch, denn da bin ich geboren, und da bin ich auch gestorben. Dazu später mehr.
Vielleicht schweben hier auch die Geister all der anderen, die hier geboren und gestorben sind. Das weiß ich nicht. Manchmal glaube ich ihre Anwesenheit zu spüren. Besonders an diesem Ort, an dem das Transformatorhäuschen stand. Dort spüre ich auch, dass sogar die Lebenden ihre Spuren hinterlassen. Die Spuren fühlen sich elektrisch an, wenn ich richtig hinhöre, dann summen sie ein wenig.
Ich sehe sie dann vor mir, wie sie damals waren, im Sommer 1971, dem Sommer, als die Wiese am Transformatorhäuschen unser Treffpunkt war. Ich sehe tatsächlich in sie hinein, in ihre kleinen Geschichten, ihr kleines Leben. Manchmal spüre ich, was aus ihnen geworden ist. Meistens aber erlebe ich nur ein bisschen mit, wie sie damals waren. Ich höre ihre Lieblingsmusik vorbeischweben, blättere ein wenig in ihren Gedanken herum. Und ich kann sagen: Viel war das nicht, was sie dachten. Da waren sie gar nicht anders als ich. Ich denke erst jetzt so richtig. Das hilft allerdings nicht unbedingt weiter. Jetzt nicht mehr.
Inzwischen sind viele gestorben. Das ahne ich manchmal, manchmal weiß ich es. Andere leben gerade ihr Leben. Das schwebt ebenso nutzlos herum wie ich, es summt und brummt und schwingt nur leise. Unsere Welt hat kein richtiges Ziel, das habe ich schon lange erkannt. Ob das andere auch erkennen? Wahrscheinlich nicht, sonst würden sie nicht so eifrig herumhasten und vorgeben, ein Ziel zu verfolgen, das aber nur ihrer Einbildung entspringt, einem Wunsch nach Sinn.
Wir kamen damals nach der Schule oder nach dem Feierabend auf der Lehrstelle zum Transformatorhäuschen, manche zu Fuß, manche mit dem Rad, die Älteren mit Mopeds. Wir lagen in kleinen Gruppen auf der Wiese, rauchten Zigaretten und Joints, ja, auch Joints, das war gerade ganz besonders verwegen und deshalb besonders angesagt. Wir hörten Musik aus kleinen Transistorradios oder Kassettenrekordern, und manchmal machten wir selbst Musik. Also: Wir ist jetzt nicht ganz richtig, einige von uns. Ich nämlich nicht, ich litt an einem langfristig gestörten Verhältnis zu Instrumenten, das ich mir nicht einmal selbst austreiben konnte.
Viele Jungs trugen die Haare lang und ließen sie ins Gesicht fallen, wenn sie im Schneidersitz dasaßen, als wollten sie das Gesicht vor der Welt verstecken. Sicher wollten sie das auch. Wir trugen Jeans und bunte Cordhosen, die wenigen Mädchen hatten ihr Haar in der Mitte gescheitelt, und über ihren weiten Blusen schaukelten bunte Ketten. Sie sahen aus, wie sich die bei unseren Müttern so beliebte Zeitschrift Brigitte Hippies vorstellte, bunt und brav, so wie zur Karnevalszeit, die neben Ostern und Weihnachten die wichtigste Zeit des Jahres in der Kleinstadt war.
An diesem Ort sind sie immer noch da, oft hoffe ich gegen alle Erfahrung, mit ihnen sprechen zu können, was mir schon damals selten gelang, denn ich trug das Haar kurz, hatte eine Brille mit dicken Gläsern und saß nur am Rande dabei. Dafür schaute ich gut hin, und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich es schon damals wusste, wie es ihnen ergehen, was aus ihnen werden würde. Das kann allerdings auch eine Täuschung sein, weil sich Erinnerung, Tatsachen und Vorstellungen gegenseitig überlappen. Dass sich die Konturen der Welt verschieben und damit auch Kategorien wie Wissen und Daten, wenn man einmal tot ist, habe ich ja schon gesagt.
Die Erinnerung aber bleibt unter allen Schichten der Wahrnehmung, sie kann nicht alt werden – genauso wenig wie ich selbst. Beides ist nicht immer schön. Manchmal wird es ein bisschen schwierig, weil sich die Erinnerungen an die vielen Jahre gegenseitig zu widersprechen scheinen. Vielleicht bringe ich dann etwas durcheinander. Dafür bitte ich schon mal um Entschuldigung. Es ist nicht meine Absicht, jemanden zu verwirren. Ich bin selbst verwirrt genug, immer noch.
Wie es am Transformatorhäuschen war, weiß ich jedoch ganz genau. Ein normaler Sommertag dort ist so: Im Freibad nebenan herrscht der übliche Betrieb. Kinder kreischen, auf den Beton-Rängen am Schwimmerbecken lagert das Publikum für die Kunstspringer vom Dreimeterbrett, und auf den Wiesen liegen auf Decken ganze Familien, in den Ferien schon morgens. Es riecht nach Chlor, nach Sonnencreme, nach trockenem Rasen, in den Umkleidekabinen ein bisschen nach Käse, Schweiß, Fisch, muffigen Unterhosen und klebrigen Träumen. Ich wollte schon damals nie so oft darüber nachdenken.
Wir gehen selten ins Freibad, da muss man vorsichtig sein mit dem Rauchen, denn der Bademeister hat uns auf dem Kieker und schleicht überall herum. Wenn man gerade nichts Böses denkt, erscheint er plötzlich wie ein Geist (ulkig, dass ich das sage) und sächselt den befürchteten Befehl: Nun aber mal her mit der Zigarette! Es hört sich an wie Zigaredde und ist auf jeden Fall blöd.
Da helfen dann nämlich nicht mal die einfallsreichsten Ausreden (Muss ich gerade mal festhalten, mein Kumpel kommt gleich zurück, der ist schon 18). Der Schwimmmeister schiebt den Schirm der Kapitänsmütze ein bisschen höher und nimmt mit den Zigaretten, denn er beschlagt immer die ganze Packung, einen würdevollen Abgang.
Gelegentlich verspricht er dabei, das alles „mal der Muddi" zu sagen, die er natürlich kennt. Hier kennt jeder jeden. Er sagt es der Muddi aber nie, die Drohung reicht ohnehin für eine halbe Woche klamme Unsicherheit und bange Blicke bereits beim Frühstück. Das weiß er wahrscheinlich. Schlechtes Gewissen nennt man das in kirchlich gut unterrichteten Kreisen. Und zu diesen gut unterrichteten Kreisen gehörte ich auf jeden Fall. Diesen Unterricht habe ich nicht vergessen, bis heute nicht. Auch „Heute“ ist ein sehr dehnbarer Begriff geworden.
Um den Hals des Schwimmmeisters hängt an einer silbernen Kette die Trillerpfeife, in die er bläst, wenn wieder jemand vom Rand ins Becken springt. Dann schaut er streng, denn das ist verboten, und es kommt wegen der strengen Blicke auch nicht so häufig vor. In den weißen Shorts, die er selbst an kühlen Tagen trägt, stecken die Schlüssel zu all den wichtigen Räumen im Freibad mit den großen Maschinen und den Eimern mit Chemikalien. Er ist der König in diesem kleinen Reich. Und so bewegt er sich.
Manchmal steht er ganz oben auf der rot gestrichenen Rutsche am Nichtschwimmerbecken, den einen Fuß aufgestützt am blau-weißen Geländer, die Kapitänsmütze leuchtet geradezu, und er schaut in die Weite. Das sieht aus wie auf einem Plakat. Das soll es wohl auch. Er kommt sich dann bestimmt so vor wie Hans Albers auf der Kommando-Brücke von irgendeinem Spielfilmschiff. Es fehlt nur, dass er „La Paloma“ singt. Den Gedanken finde ich heute ziemlich lustig.
Sein Stellvertreter hat keine Kapitänsmütze. Dafür ist er immer gut gebräunt und stolziert gern mit bloßem Oberkörper über die Wiese – immer mit einem heimlichen Seitenblick zu den Damen, die ihn natürlich ganz genau beobachten. Man muss ja zeigen, was man hat.
Im Bund seiner weißen Shorts steckt ein Päckchen HB. Der Stellvertreter hält sich erkennbar für unwiderstehlich. Und wenn das Hausfrauenkränzchen am Morgen mit den Plastikblumen-Badekappen vorsichtig im Brustschwimmstil mit hochgerecktem Kopf das Becken quert, ist er tatsächlich der Hahn im Korb. So hat er es am liebsten.
Er darf so manchen Rücken mit rostrotem Sonnenöl einreiben und grinst dabei anzüglich. Die Ehemänner der Hausfrauengruppe sind bei der Arbeit. Zum Glück. Und die Kinder werden in den Ferien am Morgen entweder aus dem Becken gejagt oder zu Anstand und Ruhe verpflichtet. Wehe, ein Spritzer trifft eine Badekappe. Dann gibt's Ärger mit dem Stellvertreter. Er plustert sich ordentlich auf, drückt den Rücken durch, zieht die kleine Plauze ein, schaut gebieterisch durch die Pilotenbrille und sieht ein bisschen aus wie ein dicker, brauner Hahn ohne Federn.
Die Damen tuscheln hocherfreut wie 14-jährige Schulmädchen. Es ist für sie eine Beschwörung der eigenen Kindheit, die die meisten von ihnen nicht hatten, weil der Krieg dazwischen gekommen war. Da war keine Zeit für Kindheit, und danach waren alle nützliche Teilchen des Aufbaus, der keine Ausgelassenheit duldete.
Mit der geordneten Freibadwelt, in der jeder Gedanke an die Nachkriegszeit hinter fröhlicher Selbstvergewisserung unter der Überschrift „Wir sind wieder wer“ verscheucht wird, wollen wir nichts zu tun haben. Während das Kreischen der Kinder durch Zaun und Hecke schallt, die den Platz vor dem Transformatorhäuschen vom Freibad trennen, richten sich auf unserer Wiese die Gruppen ein.
Die 13-, 14-Jährigen sitzen unter sich, schauen scheu und sind froh, wenn sie überhaupt jemand zur Kenntnis nimmt. Da sind sie wie ich, obwohl ich schon 15 bin. Alle rauchen ständig selbstgedrehte Zigaretten aus Drum- oder Samson-Tabak, den sie in Holland gekauft haben, weil in Goch jeder Geschäftsinhaber weiß, dass sie zu jung zum Rauchen sind und ihnen nichts verkaufen würde. Zum Glück ist die Grenze nah. Sie unterhalten sich mit Kennermiene über Jimi Hendrix.
Das haben sie mit den anderen Gruppen auf der Wiese gemein, weil in diesem Sommer Woodstock über unsere Stadt gekommen ist – im Kino, aber alle glauben ernsthaft, sie seien wirklich dabei gewesen, weil der Film sie mitten hineingetragen hatte. Im Kino trugen sie blaue Stirnbänder mit der Friedenstaube darauf und dem Gitarrenlogo und einige trugen bunte Jacken oder Westen.
Die blauen Bänder hat der Kinobesitzer verteilt, weil der Filmverleih und sein Sohn Wolfgang das zu Recht für eine gute Idee hielten, und die bunten Jacken haben Mütter gegen den Protest ihrer Ehemänner genäht. So viel Hilfe durfte dann doch sein, auch wenn damit die Grenzen des guten Geschmacks und der mindestens ebenso guten Gesellschaft deutlich überschritten wurden. Das wurde im Stillen der Jugend und ihren Verirrungen gutgeschrieben. Wir waren schließlich alle mal jung. Ja, ja.
Dass Woodstock schon zwei Jahre her ist und dass Jimi Hendrix vor einem Jahr gestorben ist, stört niemanden. Hier beginnt er gerade zu leben. In der Provinz ist das so, es ist alles ein bisschen später. Aber es ist auch nicht so wichtig, wann etwas passiert. Hauptsache, es passiert. Es passiert ja sowieso nicht viel. Das kann ich euch sagen, denn ich weiß es. Es hat sich nie geändert. Es ist das Gesetz der Provinz. Das habe ich gelernt.
Die Gruppe der 13-, 14-Jährigen hat keinen richtigen Mittelpunkt. Alle hoffen, bald zu den Größeren zu gehören. Sie wissen nur nicht genau, wie sie das anstellen sollen. Sie denken mit einiger Berechtigung, dass es wohl irgendwann von allein geschieht. Aufnahmeprüfungen oder formelle Versetzungen wie in der Schule gibt es ja nicht. Am Ende entscheidet die Gunst des Geburtstages, der im Laufe der Zeit immer weiter zurückliegt und damit eine immer bessere Zahl wird.
Die Größeren und Älteren, die im deutlichen Bewusstsein der Gnade ihres früheren Geburtstags stehen, haben ihre zentralen Figuren, die wie Chefs behandelt werden, zu denen alle aufblicken und deren Meinung Gesetz ist. Natürlich sitzen die Chefs stets in der Mitte, und die Jünger nach Rangordnung um sie herum, fast wie auf alten Bibel-Bildern, in denen die Propheten in der Mitte sitzen (war das nicht beim letzten Abendmahl ebenso?). Leider habe ich kein Anschauungsmaterial.
Hier wie dort gilt das Wort des Propheten. Wenn die Chefs sagen: Jimi Hendrix spielt gleichzeitig Bass und Leadgitarre, dann ist das so. Nachforschung zwecklos, Widerspruch ausgeschlossen. Und wenn sie sagen, dass jeder Hermann Hesse (nur so zum Beispiel) lesen muss, dann lesen alle Hermann Hesse. Ich fand Hermann Hesse langweilig und versponnen. Aber ich hütete mich, das zu sagen. Wahrscheinlich hätte es ja auch niemanden interessiert.
Einer, schon erwachsen, kommt gelegentlich wie zu einer Audienz. Er reist zur späten Nachmittagszeit mit seiner Honda Dax an, weil er lange schlafen muss und über die Welt nachdenken, bevor er sich ihr präsentiert, hat richtig lange Haare und einen ordentlich fusseligen Bart. Er stammt aus Berlin und ist an den Niederrhein gekommen, um bei der Bundeswehr in einem Bunker an elektronischen Geräten zu arbeiten, obwohl Berliner eigentlich gar nicht zum Bund müssen. Er ist geblieben, und weil er wirklich alles weiß über Musik, Bücher (nicht nur Hermann Hesse) und Kunst, und weil seine Berliner Schnauze allen zeigt, wer hier aus der Weltstadt kommt, hängen alle an seinen Lippen, wenn er die großen Geheimnisse der Menschheit enthüllt. So einer hat hier gefehlt.
Er sagt, dass es eines Tages ein Netz aus Elektronengehirnen geben wird, das die ganze Welt umspannt und alle miteinander verbindet. Das glaubt ihm natürlich kein Mensch, aber es bestreitet auch keiner. Könnte ja sein, dass er bessere Informationen hat – aus dem Bunker, aus seinen Büchern oder aus Berlin. Wenn er für die Jüngeren ein gutes Wort oder nur einen Gruß hat, dann glänzen deren Augen tagelang.
Paul, ebenfalls erwachsen, weiß vielleicht nicht so viel über Musik und Elektronengehirne, aber er fährt einen ehemaligen Leichenwagen und war damit schon in Marokko. Das ist für die meisten so unvorstellbar weit weg, dass er auch einer der Stars auf der Wiese ist. Er ist ständig high, und die Mädchen – wir nennen sie Frauen – finden seine dunklen, ein bisschen schläfrigen Augen unheimlich anziehend. Es sieht immer so aus, als wenn er sie von unten anschauen würde, ein kleines optisches Kunststück. Das macht sie ganz zappelig.
Er trägt silberne Ringe an vielen seiner langen Finger, die wie die Finger eines Pianisten aussehen – eines Pianisten mit reichlich Dreck unter den Nägeln. Die Fingernägel sind lang – etwa so lang wie bei den klassischen Gitarristen, die allerdings nur die Nägel an der Zupfhand (nennt man das so?) lang wachsen lassen. Paul hat an beiden Händen lange Nägel. Er trägt eine bestickte Weste, schwarz und bunt – natürlich aus Marokko und nicht aus mütterlicher Herstellung, über seine Eltern ist nichts bekannt. Und in seinem Leichenwagen stehen neben der Matratze Trommeln mit einem Körper aus Ton.
Bei den älteren Gymnasiasten dreht sich alles um Georg. Er ist der Sänger einer Band, die in der Schule probt, und es ist nicht zu übersehen, dass Mick Jagger sein großes Vorbild ist. Tatsächlich ist er genauso dünn, und die Farbenpracht seiner Kleidung lässt wenig zu wünschen übrig. Er sieht immer so aus, als müsse er gleich auf die Bühne. Die enge rote Hose steckt in hohen schwarzen Stiefeln, über den schmalen Schultern hängt selbst im Sommer ein fast bodenlanger Mantel, wie ihn Ian Anderson von Jethro Tull trägt, der mit angezogenem Knie auf der Querflöte Gitarrenriffs spielt und auch ein großer Held dieser Jahre ist.
Gekauft hat Georg den Mantel im Theaterfundus der Kreisstadt Kleve. Das verrät er aber nicht. Die anderen vermuten manchmal laut, der Mantel stamme aus London. Da widerspricht er nicht. Die Gymnasiasten diskutieren schon mal über Politik, und dann gucken sie ganz wichtig. Sie reden dann von außerparlamentarischer Opposition und von Rudi Dutschke. Nicht nur Woodstock kam hier ein bisschen später an.
Sie finden, dass der Schriftsteller Günter Grass ein Schleimer ist, weil er sich an die SPD ranwirft, die ohnehin seit Jahren dabei ist, die Arbeiterklasse zu verraten. Bei einem Werbeauftritt von Grass für die SPD in der Aula der Schule sind ein paar von ihnen auf die Bühne gesprungen und haben Parolen gerufen. Der Auftritt ist geplatzt, und sogar die Zeitung hat darüber geschrieben. Der Schuldirektor war außer sich.
Er ließ die ganze Oberstufe antanzen und hielt eine Stunde lang einen Vortrag über die Vorzüge der humanistischen Bildung und das Grauen der Anarchie. Er schaute streng wie die Wandbilder der alten Philosophen, die Stirn furchten zornige Falten, und leise bebte seine dunkle Stimme. Die Gymnasiasten hockten stumm und ergeben, den Blick artig und schuldbewusst zu Boden gerichtet. Für 60 Minuten waren sie gehorsame Schüler und keine Revolutionäre.
Am Nachmittag aber blätterten sie auf der Wiese in ihrer roten Mao-Bibel, damit es jeder sieht. Ich bin sicher, dass sie niemals richtig in dem Büchlein gelesen haben. Ich hab's mal versucht und einfach irgendwo aufgeschlagen.
Da stand: Das Gewehr gebiert die Macht. Man kann die Welt nur mit der Hilfe des Gewehrs umgestalten.
Ob das die Friedensjünger vom Gymnasium wussten, die sich das Peace-Zeichen auf ihre Schultaschen gemalt hatten?
Haro ist noch ein junger Kerl, ungefähr in meinem Alter. Aber er kann mächtig austeilen, und selbst 18-Jährige fürchten sich vor ihm. Er kennt nämlich keine Angst, dafür fehlt ihm die Fantasie, und er ist von seinem Vater, dem Gärtner, schon so oft verdroschen worden, dass ihm Schläge nicht wehtun. Sein Anhang umgibt ihn mit vorsichtigem Respekt, denn man kann leicht das Falsche sagen, und dann wird Haro ziemlich ungemütlich.
Untereinander rivalisieren seine Anhänger auf eine sehr männliche Art um ihren Platz in der Rangliste. Sie raufen, mal spielerisch, mal halbernst, mit dem Reden haben sie es nicht so. So richtig gern sind die anderen auf der Wiese nicht mit ihnen zusammen, es riecht immer nach Krach. Aber aus dem Weg gehen kann man sich in einer Kleinstadt eben nicht. Nur wenn man zu Hause bleibt. Aber wer will das schon?
Deshalb lagern alle auf dieser Wiese, solange es nicht regnet, wie ein Querschnitt des Orts, der bei aller Zufälligkeit wie eine Gemeinschaft aussieht. Sie lassen den Tag vergehen mit Rauchen, Musik aus leiernden Kassettenrekordern, deren Batterien nach spätestens drei Stunden schlapp machen, und Gesprächen, die sich um Rockmusik, Fußball und manchmal Schule drehen. Die stärkste Klammer ist die Musik, die so anders klingt als all das, was die Eltern hören oder was sie auch nur hörenswert finden. In der Musik liegt die Hoffnung, einen entscheidenden Schritt aus den festen Fügungen zu tun, aus vorherbestimmten Bahnen, hinein ins Bunte, Freie, jedenfalls Neue.
Ebenso wie die Musik und ihre Wirkung schliert dieser Wunsch am Rande des Bewusstseins. Und auch deshalb wird darüber so wenig gesprochen, sondern viel mehr gefühlt. Vielleicht ist es mir darum so klar.
Der ehemalige Soldat hat mal ein altes Berliner Lied zitiert, das die Tage am Transformatorhäuschen äußerlich ganz gut zusammenfasst: So ham wir doch nen Tag verbracht, nen Tag voll Müh und Sorjen. Und ham wir auch nicht viel jemacht, so ham wir doch den Tag verbracht. Den Rest, den mach mer morjen.