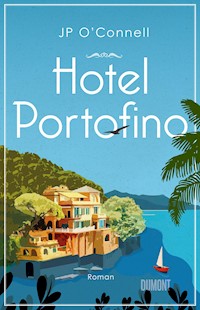12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hotel Portofino
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
1927 an der italienischen Riviera: Es ist ein neuer Sommer in Portofino, wo das britische Upperclass-Ehepaar Cecil und Bella Ainsworth ein gleichnamiges Hotel eröffnet hat. Nach der Trennung des Paares verwaltet Bella das Haus nun allein und plant bereits den Ausbau. Als die Nachricht eintrifft, dass verdeckte Hoteltester in Ligurien unterwegs sind, gilt es, ihre Identität zu enthüllen und ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten. Als wäre das nicht Aufregung genug, steckt Bellas und Cecils Sohn Lucian in einer Ehekrise, vor der er in das Hotel seiner Familie flüchtet. Dort lebt und arbeitet auch seine heimliche Liebe Constance. Doch während die beiden einander näherkommen, ist Lucians Ehefrau ebenfalls auf dem Weg nach Portofino. Sein bester Freund Nish hat sich derweil einer antifaschistischen Gruppierung angeschlossen und schwebt in großer Gefahr. Mit ›Sommer im Hotel Portofino‹ entführt JP O’Connell seine Leser*innen erneut in einen nostalgischen Urlaub nach Ligurien. Die Hotel-Portofino-Reihe: Hotel Portofino Sommer im Hotel Portofino Alle Bände sind eigenständige Romane und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Ähnliche
1927 an der italienischen Riviera: Es ist Juni in Portofino, wo das britische Upperclass-Ehepaar Cecil und Bella Ainsworth ein exklusives Hotel eröffnet hat. Nach dem Bruch mit ihrem Mann verwaltet Bella das Haus erfolgreich allein und plant bereits den Ausbau. Dann trifft die Nachricht ein, dass verdeckte Hoteltester in Ligurien unterwegs sind. Fortan gilt es, deren Identität zu enthüllen und ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten. Als wäre das nicht Aufregung genug, steckt Bellas Sohn Lucian in einer Ehekrise, vor der er ins Hotel Portofino flüchtet – zu seiner heimlichen Liebe Constance, die hier lebt und arbeitet. Doch während die beiden einander näherkommen, ist Lucians Ehefrau ebenfalls auf dem Weg nach Italien. Sein bester Freund Nish hat sich derweil einer antifaschistischen Gruppierung angeschlossen und schwebt in großer Gefahr.
»Die Sprache ist so elegant und angenehm spöttisch wie der Roman selbst.«
DONNA ÜBER ›HOTEL PORTOFINO‹
JP O’Connell hat viele Jahre als Journalist gearbeitet, u.a. für The Guardian, The Times und The Daily Telegraph. Er ist Autor mehrerer Sachbücher, u.a. von ›Bowies Bücher‹ (2020). In ›Hotel Portofino‹ (DuMont 2022) nimmt die Geschichte um die Familie Ainsworth ihren Anfang. JP O’Connell lebt in London. Die Serienverfilmung von ›Hotel Portofino‹ läuft seit 2022 bei Magenta TV.
Eva Kemper studierte in Düsseldorf Literaturübersetzen. Zu ihren Übersetzungen zählen Werke von Junot Díaz, Jarett Kobek, Emma Stonex und Cathy Park Hong.
JP O’Connell
SOMMER IM HOTELPORTOFINO
Roman
Aus dem Englischenvon Eva Kemper
Von JP O’Connell ist bei DuMont außerdem erschienen:
Hotel Portofino
William Butler Yeats ›Das Zweite Kommen‹ [1] wurde zitiert nach: William Butler Yeats, Die Gedichte. Neu übersetzt von Marcel Beyer, Mirko Bonné, Gerhard Falkner, Norbert Hummelt, Christa Schuenke.
Die Rechte an der deutschen Übersetzung von Mirko Bonné liegen beim Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Die englische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel ›Hotel Portofino. Lovers and Liars‹ bei Simon & Schuster, London.
Copyright © The Writers’ Room Publishing Limited 2024
Published by arrangement with Simon & Schuster UK Ltd
1st Floor, 222Gray’s Inn Road, London, WC1X8HB
A Paramount Company
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system without permission in writing from the Publisher.
E-Book 2024
© 2024 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Eva Kemper
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Adobe Stock
Satz: Fagott, Ffm
E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1013-1
www.dumont-buchverlag.de
PROLOG
Juni 1927
Bella sah verträumt aus dem Fenster, als ein lautes Klopfen sie aus ihren Gedanken riss. Sie blickte auf und sah Betty, die Köchin des Hotels Portofino, mit finsterem Blick durch die Milchglasscheibe ihres Büros starren. Bella rief: »Herein!«, und die Tür wurde aufgestoßen.
»MrsAinsworth.« Betty, eine kleine, stämmige Frau mit einem Gesicht so faltig wie eine Walnuss, keuchte vor Anstrengung. »Lorenzo, der Metzgerjunge, ist mit dem Kalbfleisch da. Aber das Tor ist abgeschlossen, und der Schlüssel ist verschwunden.«
Kaum waren die Worte ausgesprochen, fielen die Blicke der Frauen auf die linke Seite von Bellas Eichenschreibtisch, wo der gesuchte Schlüssel in einer Keramikschale lag. »Ah«, sagte Bella betreten. »Ich habe gestern Abend vergessen, ihn wieder in die Küchenschublade zu legen. Tut mir leid, Betty.«
Betty versuchte, ihren Ärger zu unterdrücken. »Das macht doch nichts, MrsAinsworth. Er wartet erst seit fünf Minuten. Wenn ich es die Zufahrt hinaufgeschafft habe, liegt das Fleisch im Handumdrehen in der kühlen Speisekammer.«
Sie trat vor und wollte den Schlüssel gerade aus der ausgestreckten Hand ihrer Arbeitgeberin nehmen, als Bella diese wieder schloss. »Wissen Sie, was? Mir ist nach einem Spaziergang. Ich übernehme das und laufe schnell zum Tor.«
Betty wirkte erleichtert, aber auch zufrieden, als betrachtete sie das als angemessene Buße für Bellas Fehltritt. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wäre es eine große Hilfe. Dann kann ich mich um die Kartoffeln kümmern. Die schälen sich nicht von selbst, wissen Sie?«
Damit machte Betty auf dem Absatz kehrt und marschierte zurück in die Küche.
Bella rieb sich die Augen, dann saß sie einen Moment mit dem Kopf in den Händen da und dachte an Marco, den Bauleiter und Architekten, den sie für die Errichtung des neuen Thermenbereichs des Hotels engagiert hatte.
Abgesehen davon, dass er mit den wärmsten Empfehlungen gekommen und in Portofino geboren und aufgewachsen war, wusste Bella wenig über ihn. Aber herrje, sah er gut aus, und herrje, fiel es ihr schwer, nicht ständig an ihn zu denken, auch wenn natürlich nichts zwischen ihnen vorgefallen war und nichts vorfallen konnte. Wichtig war, dass sie endlich wieder träumen konnte. Seit ihrer Hochzeit mit Cecil hatte sie diese Freiheit nicht mehr besessen.
Es hatte sich so viel verändert, seit Cecil im letzten Sommer kleinlaut zurück nach England geflohen war. Er hatte sie furchtbar behandelt und war schließlich auf erschütternde Weise gewalttätig geworden. Danach hatten sie sich nur noch ein einziges Mal gesehen, als Lucian und Rose geheiratet hatten. Bella hatte es wochenlang davor gegraut, aber wie es bei solchen Dingen immer war – als sie erst einmal im windigen Yorkshire vor der Kirche stand und die Gäste begrüßte, Cecil stumm und verlegen an ihrer Seite, war es gar nicht so schlimm.
Sie hatte für Lucian stark sein wollen; sie und Cecil sollten als traut vereintes Paar auftreten. Und so hatten sie einen Weg gefunden, zusammen und doch getrennt an allen wichtigen Formalitäten teilzunehmen: der Trauung, dem Termin mit dem Fotografen, dem Hochzeitsfrühstück. Aber sobald der Tag vorbei war, gingen sie wieder getrennte Wege – sie nahm den Zug zum Hafen, er kehrte in seine Wohnung irgendwo in London zurück. Chelsea, hatte jemand gesagt.
Die Wanduhr schlug zehn. Obwohl es jetzt Juni war, stieg die Hitze erst im Laufe des Tages an, und vormittags konnte es in Portofino noch recht frisch sein. Bella zog ein Tuch über ihr mandelgrünes Leinenkleid, schlüpfte in ihre Sandalen und lief mit leisen Schritten durch die Küche – vorbei an Betty und ihrer Helferin Paola – zur Seitentür, die zur Zufahrt führte.
Es war ein goldener, sanfter Morgen mit einem strahlend blauen Himmel. Unter Bellas Füßen knirschte satt der Kies. Der Weg war auf beiden Seiten von ordentlich gestutzten Palmen gesäumt, die wie Speere in den Himmel ragten. Sie genoss die Geräusche fast so sehr wie den Ausblick – das Zirpen der Zikaden, das gerade richtig aufklang, und in der Ferne das leise Tuckern eines kleinen Fischerboots.
Bella liebte den Beginn des Sommers, der in den letzten zehn Jahren nach und nach den Winter als beliebteste Zeit für wohlhabende Italienreisende abgelöst hatte. Tatsächlich liebte sie Portofino das ganze Jahr über, aber außerhalb der Saison – darüber hatte sie mit den anderen Hotelbesitzern gesprochen, und sie empfanden ebenso – beschlich sie gelegentlich das Gefühl, sie sei hier fremd, eine Hochstaplerin im Exil, die eigentlich an einen anderen Ort gehörte.
Doch jetzt schien die Sonne, und Portofino erwachte zum Leben. Den ganzen Tag lang schoben Jugendliche aus dem Ort Karren mit Sonnenliegen und Schirmen und zerlegbaren Badekabinen hinunter zum Strand von Paraggi. Oben in der Stadt hatten sich die Cafés neue karierte Tischdecken zugelegt und zum Teil auch ihre bunten Markisen ausgetauscht.
Bella drehte sich um und betrachtete das Hotel. Das elegante und beeindruckende Gebäude war alles geworden, was sie sich damals beim Kauf erhofft hatte. Sicher, mittlerweile boten andere Hotels in der Gegend eine ähnliche Erfahrung, aber keines von ihnen kam ganz dem Hotel Portofino gleich.
Sie erinnerte sich noch gut an das erste Mal, als sie diese blassgelbe Villa gesehen hatte. Sie war vor etwa vierzig Jahren von einem ligurischen Unternehmer erbaut worden, und wenn Bella nur an die anstrengenden Renovierungsarbeiten dachte, spürte sie noch immer die Erschöpfung. Es hatte drei Monate gedauert, die Fenster neu zu verkitten und zu streichen, und zwei weitere, die Fensterläden aufzuarbeiten, die von der Sonne Blasen geworfen hatten. Zu den ersten Wörtern Italienisch, die Bella gelernt hatte, gehörten cacciavite – »Schraubenzieher« – und mano di vernice – »Anstrich«.
In Italien hatte sich vieles im Namen des Fortschritts verändert, aber die schönsten Traditionen überdauerten. Die Felder an den steilen Berghängen wurden noch immer mithilfe von Ochsen gepflügt, und jeder Ort achtete voll Stolz darauf, seine Trockensteinmauern instand zu halten. Doch es war auch eine traurige Tatsache, dass immer mehr Menschen Automobile fuhren. Als sie vor einem Vierteljahrhundert hier mit Cecil ihre Flitterwochen verbracht hatte, waren ihr auf der gewundenen Küstenstraße große, schwerfällige Ausflugskutschen voller Touristen begegnet, gezogen von bis zu acht Pferden, herausgeputzt wie für eine Zirkusparade. Sie hatten Glocken um den Hals getragen und wippende Federn in ihren geflochtenen Mähnen. Vorne hatte meist ein geschäftstüchtiger Hotelier gesessen und in ein Kutscherhorn geblasen.
All das war vorbei. Statt Hörnern hörte man jetzt die Hupen der Kraftfahrer, mit denen sie sich vor den Haarnadelkurven ankündigten.
Trotz alldem – und trotz der sich zuspitzenden politischen Lage, die ihr enorme Sorgen bereitete – konnte Bella sich nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben, und ganz sicher würde sie niemals dauerhaft nach London zurückkehren.
Wie hieß es in dem Gedicht von Browning? Sie lächelte, als ihr die Zeilen einfielen:
»Öffne mein Herz, und in Versalien
steht eingraviert dort ›Italien‹.«
Lorenzo wartete geduldig auf sein Fahrrad gestützt, das Fleisch hatte er eng an eng in dem Weidenkorb am Lenker verstaut. Ein drahtiger Junge von etwa vierzehn Jahren mit struppigen Haaren, der stärker sein musste, als er aussah, denn wie in aller Welt hätte er sonst dieses Gewicht den Hügel hinaufschaffen sollen? Er war mit Bettys Sohn Billy befreundet, der im Hotel als Page arbeitete, und Bella wusste, dass er Kontakte zum antifaschistischen Widerstand pflegte. Sie tauschten ein verschwörerisches Lächeln, als sie das Tor aufschloss und kräftig daran zog.
»Buon giorno, Lorenzo. Come sta tuo padre?«
»Impegnato, signora. Ma bene, grazie.«
Der Junge radelte an ihr vorbei zum Haus und hinterließ eine säuberliche, gerade Reifenspur im Kies. Bella folgte ihm langsam. Dann blieb sie stehen. Marco kam ihr voller Elan von der Küchentür aus entgegen. Selbst von Weitem sah sie, dass er lächelte. Sie errötete.
Marco blieb vor ihr stehen. Falls er bemerkte, wie verlegen sie war, ließ er sich nichts anmerken. Seine braunen Augen funkelten unter den dicken dunklen Brauen. »Signora Ainsworth! Ich habe gute Neuigkeiten. Wir müssen die Decke doch nicht abstützen.« Er sprach hervorragend Englisch, besser als Bella Italienisch. »Als wir die Wand zwischen den Zimmern entfernt haben, habe ich das befürchtet. Aber im Bericht des Bauingenieurs steht, dass das nicht notwendig sein wird.«
»Das sind fabelhafte Neuigkeiten«, sagte Bella. Unwillkürlich strahlte sie ihn an, fast wie ein Schulmädchen. Ihr Blick wanderte zu der Kuhle an Marcos Hals, prächtig betont durch das kragenlose weiße Hemd, das er immer bei der körperlichen Arbeit auf der Baustelle trug. »Wie weit sind wir gekommen?«
»Die großen Umbauarbeiten sind fast beendet. Jetzt können wir verputzen und streichen. Und Sie können den Thermenbereich ausstatten, wie Sie wollen.«
Bella nickte. Es hatte ihr die Sprache verschlagen, ein ungewohntes Gefühl. Sie senkte den Blick und suchte nach Worten.
Aber Marco sprach weiter, ohne ihr Unbehagen zu beachten. »Ich mag dieses Hotel sehr. Was Sie daraus gemacht haben. Ich weiß noch, dass wir früher manchmal hergekommen sind, als ich noch ein Kind war, meine Familie und ich. Mein Vater war mit dem Besitzer befreundet. Die Villa war immer hübsch, eine der schönsten der Gegend. Aber Sie haben sie verwandelt, mit Ihrem … Stil. Ihrem Geschmack.«
»Sie sind sehr freundlich.«
Er lächelte. »Das ist nicht nur reine Höflichkeit, versprochen. Mir fallen kleine Details auf – das gehört zu meiner Arbeit. Die Tapete von William Morris in der Ascot Suite ist erlesen. Und die Badezimmer –« Er unterbrach sich. »Verzeihen Sie mir. Ich habe mich oben umgesehen.«
»Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich hätte Sie herumführen sollen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht getan habe.«
»Morris hat etwas Wunderbares gesagt. Vielleicht kennen Sie es? ›Man sollte nur Dinge in seinem Haus haben, die schön sind oder die man für nützlich hält.‹«
»Sehr treffend«, stimmte Bella zu. »Und nein, das kannte ich noch nicht.«
»In diesem Haus ist vieles schön.«
Bella errötete. Ohne nachzudenken, sagte sie: »Ich wünschte, mein Mann würde ebenso denken.«
»Ihr Mann?« Marco wirkte überrascht. »Ich wusste nicht …« Er räusperte sich. »Verzeihung, ich habe ihn bei meiner Arbeit hier noch nicht gesehen. Ich dachte, Sie wären vielleicht Witwe.«
»Nein, nein. Signor Ainsworth ist … außer Landes. Fort.« Bella hatte sich in eine unangenehme Lage gebracht. »Er ist nach England zurückgekehrt. Aus geschäftlichen Gründen.«
»Verstehe. Und er mag das Hotel nicht?«
»Oh, er hat nicht direkt etwas dagegen. Aber er ist ein traditioneller Engländer. Ihm ist schweres, verschnörkeltes Mobiliar lieber. Viel Mahagoni.«
Marco zuckte mit den Schultern, als wollte er sagen: Jeder, wie er mag.
Auf dem Weg zurück zum Haus herrschte zwischen ihnen einträchtiges Schweigen. Beiläufig und mit einem unschuldigen Ton, den Bella nicht recht überzeugend fand, fragte Marco: »Wann kommt Signor Ainsworth zurück?«
Bella lächelte. »Das klingt vielleicht seltsam«, sagte sie, »aber ehrlich gesagt habe ich nicht die leiseste Ahnung.«
EINS
Das Schlafzimmer lag im dritten Stock und bot Ausblick auf die Gärten in der Mitte des Gevierts. Beide Schiebefenster waren geöffnet, die Gardinen bewegten sich leicht in der warmen Brise. Aus dem angrenzenden Badezimmer drangen das Geräusch von schwappendem Wasser und Julias unmelodisches Summen.
Ein grauer Aschestängel fiel von Cecils Zigarette auf die seidene Tagesdecke. Cecil schnalzte mit der Zunge und wischte die Asche weg, auf den Läufer neben dem Bett. Der Tabakgeruch vermischte sich angenehm mit dem Moschusduft des Potpourris, das Julia in einer Schale auf ihren Nachttisch gestellt hatte, um die etwas abgestandene Luft aufzufrischen.
Das Haus in Belgravia hatte bessere Zeiten erlebt, trotzdem war es eine ganz andere Welt als das triste Apartment mit Conciergediensten in Chelsea, in dem Cecil Ainsworth jetzt leben musste. Als Cecil sich nun umschaute, versetzte ihm der Neid einen schmerzlichen Stich. Aber er konnte das Gefühl unterdrücken, denn immerhin war er hier – im Ehebett, im ehelichen Schlafzimmer. Dem Allerheiligsten.
Im Grunde war es Julias Zimmer. Julias Haus. Ihr Mann Andrew hatte seit Jahren nicht mehr hier geschlafen – er war auf seinem Anwesen in Yorkshire glücklicher und mied London, wenn er nur irgend konnte. Allerdings bemerkte Cecil interessiert, dass Julia der Einrichtung hier und da noch ihre männliche Note gelassen hatte: die gerahmten Drucke von Jagdmotiven und Karikaturen aus der Vanity Fair waren noch da, ebenso der Ledersessel mit Ziernägeln, der besser in den Athenaeum Club gepasst hätte, und das hässliche kleine Heizgerät auf einem Backsteinpodest vor dem Kamin.
Vielleicht, dachte Cecil, brauchte sie die Spuren von Andrew um sich, wenn sie allein in London lebte. Vielleicht bestand die Ehe doch weniger zum Schein, als die Leute sagten.
Mit einem Klicken öffnete sich die Tür, und Julia kam in einer Dampfwolke aus dem Badezimmer. Sie trug einen weißen Bademantel und hatte sich ein weißes Handtuch um den Kopf gewickelt. Cecil sah ihr gebannt zu, als sie lautlos zur mit Chintz bezogenen Chaiselongue gegenüber dem Bett ging. Sie nahm seufzend Platz und schlug die langen, noch immer wohlgeformten Beine übereinander.
Ihre Blicke trafen sich, und ein Lächeln legte sich auf Julias Lippen. »Du siehst aus, als hättest du es gemütlich«, sagte sie.
»Das ist ja auch ein gemütliches Bett.« Cecil klopfte auf den freien Platz neben sich. »Willst du nicht wieder herkommen?«
Sie schaute weg und brach damit den Zauber. »Ich muss Besorgungen machen. Wenn du etwas essen willst, musst du es dir selbst holen. Ich habe den Dienstboten den Nachmittag freigegeben.«
»Wie großzügig.«
Julia zog eine Augenbraue hoch. »Du kennst mich doch. Die Güte in Person.«
Ungeduldig, als hätte sie es schon längst tun wollen, stand sie auf und öffnete die Vorhänge mit einem entschiedenen Ruck. Das harsche Morgenlicht fiel auf ihr ungeschminktes Gesicht und betonte ihre Stirnfalten und die dunklen Ringe unter ihren Augen. Wenn man sie jetzt ansah, hätte man nicht vermutet, dass Julia früher weithin für ihre Schönheit gerühmt wurde. Sie war hager geworden, und ihre ehemals strahlende Haut hatte einen fahlen Ton angenommen. Aber Cecil fühlte sich noch immer zu der Erinnerung hingezogen, wie sie früher ausgesehen hatte, und als er ihr letzten Sommer in Portofino begegnet war (sie war auf seine Einladung hin angereist, um ihre Rose mit seinem Lucian zu verkuppeln), hatte es ihn überrascht, wie tief und nachdrücklich diese Erinnerung war.
Bella war ganz anders – größer, üppiger, aber jetzt leider auch unnahbar, vielleicht für immer.
Die Atmosphäre ungezwungener Intimität, die er mit Julia heraufbeschwören konnte, erstaunte Cecil manchmal. Er führte sie darauf zurück, dass sie sich schon so lange kannten – weit über zwanzig Jahre.
Damals waren Dutzende von Männern in Julia verliebt gewesen, und im Salon ihrer Familie hatte es an den Wochenenden von Verehrern nur so gewimmelt. Julia spielte mit ihnen und schürte Rivalitäten, so lange, bis ihr ein gewisser Ruf vorauseilte. Nach und nach versiegten die Angebote, und als sie mit sechsundzwanzig noch unverheiratet war, tauchte Andrew auf und rettete sie.
Wegen der strengen Anforderungen ihrer Familie war Cecil nie als Bewerber infrage gekommen, aber das hatte ihn damals nicht gestört und tat es auch jetzt nicht. Das zwanglose Arrangement, das sie jahrelang beibehalten hatten – bis die Hochzeit mit Bella ihn gezwungen hatte, es zu beenden –, passte besser zu ihnen. Cecil war überzeugt davon, dass in fast jeder Ehe heimlich betrogen wurde. Hier herrschten dagegen nur Ehrlichkeit und klare Verhältnisse. Cecil wusste, wie hart und kaltherzig Julia sein konnte, und passte seine Erwartungen entsprechend an. Julia ihrerseits fühlte sich von seiner ruchlosen Seite angezogen, davon, dass er ein Opportunist und Schurke war. Wenn er mit ihr zusammen war, musste Cecil sich für nichts rechtfertigen. Das übernahm Julia schon für ihn.
Als er in Ungnade gefallen aus Italien zurückgekehrt war, hatte Cecil sich sofort bei Julia gemeldet. Vordergründig, um die anstehende Hochzeit von Lucian und Rose zu besprechen, doch insgeheim hoffte er, ihre körperliche Beziehung wiederaufleben zu lassen. In Portofino hatte Julia durchblicken lassen, dass ihr ein solches Ansinnen zusagen würde. Und Cecil bildete sich etwas darauf ein, solche Anspielungen stets richtig zu deuten.
Anfangs hatten sie sich des Öfteren zufällig – in Wahrheit sorgsam geplant – bei gesellschaftlichen Anlässen getroffen. Dann hatten sie es mit ein oder zwei Hotels versucht, an denen Julia allerdings immer etwas auszusetzen hatte. Cecil vermutete, dass sie nervös geworden war, obwohl sie ein relativ geringes Risiko eingingen. Aber es war tatsächlich immer lustvoller, wenn sie sich hier in ihrem Haus liebten.
Wer hätte gedacht, dass Vorsicht ein Aphrodisiakum ist?
Bei ihrem ersten verstohlenen Stelldichein hatte Cecil auf dramatische und parteiische Art seine Eheprobleme geschildert. Seiner Erzählung zufolge hatten Bella und ihr Möchtegernliebhaber Henry weit mehr getan, als nur Briefe auszutauschen. Bella habe es zugegeben, behauptete Cecil, deshalb habe er die Hand erhoben, als habe er sie schlagen wollen. Er war nicht stolz darauf, aber es war nun einmal geschehen.
Natürlich, fügte er schnell hinzu, hatte er nichts dergleichen getan. Was für ein Mann schlug denn seine Frau? Aber Cecils Geste musste Bella auf eine Idee gebracht haben, denn als er sie das nächste Mal sah, hatte sie furchtbare Blutergüsse auf der Wange und an der Lippe. Er konnte sich nur vorstellen, dass sie, nun ja, gegen eine Tür gelaufen war …
»… oder sie hat sich selbst geschlagen«, warf Julia ein, die nackt neben ihm lag. »So etwas kommt vor. Davon habe ich schon gelesen. Manche Frauen schrecken vor nichts zurück.«
»Das stimmt«, pflichtete Cecil ihr bei, auch wenn er den Teufel auf seiner Schulter dabei noch deutlicher spürte als sonst.
Seit der Hochzeit von Lucian und Rose im Februar hatte er Bella nicht mehr gesehen und auch keinen nennenswerten Kontakt zu seinen Kindern gehabt. Soweit er wusste, kam das frisch vermählte Brautpaar ganz gut miteinander aus. Alice war nach Italien zurückgekehrt, um ihre Mutter bei der Leitung des Hotels zu unterstützen – eine unglaublich undankbare, ermüdende Aufgabe.
Die sittsame, zugeknöpfte Alice schien sich in ihrem Witwentum fest einzurichten. Nicht das Schicksal, das Cecil sich für sie vorgestellt hatte. Sie schrieb ihm gelegentlich, immerhin, und aus diesen Briefen hatte er erfahren, dass Bella die unansehnlichen Kellerräume des Hotels in eine Therme verwandeln wollte.
Diese Neuigkeit hatte ihn verärgert, nicht nur, weil Thermen die Art modischen Unfugs waren, für den Bella schon immer eine Schwäche gehegt hatte, er war auch überzeugt davon, dass der Ausbau die Einnahmen nur so zum Sprudeln bringen würde. Wie furchtbar ärgerlich, nicht dabei zu sein, wenn Bella einen Dukatenesel auftat, wie sein Bankiersfreund Geoffrey gern sagte.
Während er grübelte, zog Julia sich an. Cecil konzentrierte sich wieder und beobachtete, wie seine Geliebte schnell und geschickt ihre Bluse zuknöpfte. Als sie fertig war, kam sie zu ihm, setzte sich auf die Bettkante und musterte ihn eindringlich mit ihren braunen Augen.
»Musst du rauchen?«, fragte sie.
»Ja, muss ich.«
»Du riechst wie ein Aschenbecher.« Julia wandte sich kurz ab. Als sie ihn wieder ansah, lächelte sie, aber ihr Lächeln überspielte nur halbherzig eine gewisse Boshaftigkeit, die direkt auf Cecil zielte. »Das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit dem neuen Dienstmädchen, das Rose und Lucian eingestellt haben. Edith oder wie sie heißt. Die mit der furchtbaren Frisur.«
»Ach ja?«
»Lucian hat sie gebeten, für Italien zu packen. Aber nur einen Koffer. Für ihn.«
Cecil runzelte die Stirn. »Er will allein nach Portofino? Ohne seine neue Frau?«
»Offenbar.«
»Wann?«
»Sofort, soweit ich es verstanden habe.«
»Hast du mit Rose gesprochen?«, fragte er träge.
»Natürlich. Sie hat mir bestätigt, dass Lucian allein fährt. Sie sagt, sie fühlt sich für die Reise zu unwohl.«
»Unwohl auf welche Art?«
»Ach, das Übliche.« Julia winkte leicht ab. »Die Nerven. Kopfschmerzen. Übelkeit, das ist das Neueste.«
»Vor der Hochzeit hast du nicht erwähnt, dass Rose so … gebrechlich ist.«
Julia warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Meine Tochter ist nicht gebrechlich.«
Cecil kam ein Gedanke. »Du hast gesagt, ihr sei übel. Du weißt, was das bedeutet.«
»Ich weiß, was es bedeuten kann. Aber ich fürchte, in diesem Fall tut es das nicht.«
Julias beiläufig zur Schau gestellte Gewissheit verdutzte Cecil. »Wie in aller Welt kannst du so sicher sein?«
Sie lachte herablassend. »Cecil, sie schlafen in getrennten Zimmern. Schon seit der Hochzeit.«
»Wer hat dir das erzählt?«
»Edith.«
»Aber das ist doch absurd.«
»Auf jeden Fall ist es bedauerlich.«
Cecil verspürte den eigenartigen reflexhaften Drang, die Männlichkeit seines Sohns zu verteidigen. »Dass sie nicht im gleichen Zimmer schlafen, heißt nicht, dass sie nicht … du weißt schon. Bella und ich haben auch nicht immer im selben Zimmer geschlafen.«
»Habt ihr nicht?« Julia zog spöttisch eine Augenbraue hoch.
»Ach, komm. Sag mir nicht, du und Andrew würdet noch das Zimmer teilen.«
»Doch, das tun wir. Wenn ich oben in Yorkshire bin.«
Cecil zog tief an seiner Zigarette. »Du warst seit der Hochzeit nicht mehr in Yorkshire.«
Julias Tonfall wurde eisig schroff. »Wenn du es unbedingt wissen willst: Dieser Teil unserer Ehe war immer äußerst erfreulich.« Sie stand auf. »Und es ist mir wirklich ernst, Cecil. Rose’ Ehe muss funktionieren.«
So reagierte Julia manchmal. Geplauder und Tratsch kippten plötzlich zu einer gereizten, unangenehmen Diskussion. Zudem störte Cecil die Vorstellung, dass sie immer noch mit Andrew intim war. Nicht weil er eifersüchtig gewesen wäre, sondern weil er es in gewisser Weise als demütigend empfand, nicht mit seiner eigenen Frau schlafen zu können: Wie die Dinge standen, würde Bella ihn nie wieder in ihre Nähe lassen.
Er spürte, dass er sich vor lauter Missmut innerlich zurückzog, und überlegte, wie er sich daraus befreien konnte. Die Lösung, beschloss er, bestand darin, mit besonders zärtlicher Stimme ein Mittagessen im Savoy vorzuschlagen.
»Ich hätte Lust auf scharfe Lammnierchen«, verkündete er. »Willst du mir nicht Gesellschaft leisten? Wir könnten danach ins Filmtheater gehen. Und uns Ivor Novello in Der Mieter ansehen.«
Aber Julia wirkte entsetzt. »Das Savoy? Also wirklich, Cecil, ich will nicht, dass ganz London von uns erfährt. Und was die Lammnierchen betrifft«, sagte sie naserümpfend, »so etwas essen Angestellte.« Sie prüfte ihr Make-up im Spiegel ihrer Puderdose, dann nahm sie ihre Sachen. »Sei so gut und finde selbst hinaus … Um vier Uhr musst du verschwunden sein.«
Auf dem Heimweg von dem Architekturbüro, in dem er ein Praktikum absolviert hatte, ging Lucian mit unsicheren Schritten die Old Brompton Road entlang. Sein verletztes Bein bereitete ihm heute wieder Probleme. Ohne erkennbaren Grund schmerzte es an manchen Tagen und an anderen nicht. Er hatte zwar allerlei Theorien gehört – es läge am Luftdruck, extremer Kälte, extremer Wärme … –, aber keine überzeugte ihn. Wer konnte schon genau wissen, was die Schmerzen auslöste?
Es war später Nachmittag und so sonnig und windstill, dass ein Optimist geglaubt hätte, der Sommer sei gekommen. Aus einer Laune heraus machte er bei einer Konditorei halt und kaufte ein paar Törtchen, in der Hoffnung, Rose würde sich darüber freuen.
Wenn sie die Törtchen sah, wenn sie vor ihr standen, würde sie vielleicht davon essen. Vielleicht.
Das Praktikum in dem Büro in Bayswater war die Idee seiner Mutter gewesen. Schon durch die Einrichtung hatte er sich in die Schule zurückversetzt gefühlt: Sechs Zeichentische waren in zwei Reihen aufgestellt, an der Wand vor ihnen hing eine riesige Uhr. Anfangs hatte ihn an der Architektur gereizt, wofür sie stand – sie vereinte Kunst mit dem menschlichen Grundbedürfnis nach einer anständigen Behausung. Nur gab es bei Shipman & Colville keinen Platz für Innovationen. Man tat, was einem gesagt wurde, egal, wie eintönig es war.
Zum Beispiel war es Lucians zentrale Aufgabe gewesen, beim Entwurf eines Wohnblocks in Shepherd’s Bush zu helfen. Wohnungen für die Armen. Der leitende Architekt, sein Vorgesetzter, hatte die Entwürfe als »im Stil von Sir Christopher Wren« beschrieben, aber für Lucian sahen sie nicht danach aus. Trotz der Rokokoschnörkel wirkten die Wohnungen düster und unwirtlich, kein Ort, an dem man freiwillig leben wollte. Ihr Reiz würde sein, dass zu jeder Wohneinheit ein eigenes Bad gehörte, und Lucian leuchtete ein, dass das wichtig war. Tagelang arbeitete er an verschiedenen Möglichkeiten, an Fluren und Wohnzimmern Platz zu sparen, damit die Bäder so groß wie möglich werden konnten.
Er hatte auf etwas Resonanz gehofft, bevor sein Praktikum heute endete, aber keine bekommen. Stattdessen hatte ein Streit den Tag überschattet, eine überraschend gehässige Auseinandersetzung darüber, ob im großen Geviert ein Kriegsdenkmal aufgestellt werden sollte.
Als ehemaliger Soldat hatte Lucian zwiespältige Gefühle gegenüber solchen Denkmälern. Aber seine Zwiespältigkeit dem biederen alten Shipman & Colville gegenüber war noch größer. Er hatte in Zeitschriften über den Internationalen Stil gelesen und träumte von gläsernen Fassaden und glatt verputzten Wänden. Warum konnten Architekten diese neuen Stilelemente nicht auch nutzen, wenn sie Häuser für normale Menschen entwarfen? Warum baute man für die Zukunft mit den Materialien der Vergangenheit? Das war doch unsinnig.
Die größere Frage lautete aber, warum er überhaupt versuchte, ein Architekt zu werden, wenn er im Grunde seines Herzens Maler werden wollte.
Zumindest, dachte Lucian, hatte er sich gut bewährt. Der Büroleiter schien mit seiner Arbeit zufrieden zu sein und hatte angedeutet, dass er dort eine Stelle finden würde, sollte er zurückkommen wollen. Es war zwar eine beruhigende Aussicht – eine gute, feste Arbeit, auf die er stolz sein konnte und bei der sein beträchtliches Talent bestens zum Einsatz kam –, aber nichts reizte ihn so sehr wie die Freiheit. Nicht, gestand er sich mit einem schuldbewussten Schaudern ein, um mehr Zeit mit Rose zu verbringen, sondern um wieder reisen zu können. Er wollte nach Italien zurückkehren und sich wieder auf seine Malerei stürzen. Seine Mutter und Alice sehen. Constance sehen …
Die Straße beschrieb einen Bogen und gab den Blick auf das Haus frei, das ihm und Rose im Ehevertrag zugebilligt worden war. Es war eine behagliche viktorianische Villa mit vier Schlafzimmern (eines davon unter dem Dach für das Dienstmädchen) und einem Badezimmer mit WC. Vor vier Jahren war das Haus renoviert und mit Elektrizität versorgt worden, aber Rose wollte das Licht nicht einschalten, weil sie fürchtete, es könnte ein Feuer auslösen. Stattdessen bestand sie darauf, eine Öllampe mit an ihr Bett zu nehmen.
Alles in allem war das Haus in Lucians Augen mehr, als er verdient hatte. Er fühlte sich in letzter Zeit ohnehin seltsam und war häufiger als sonst geneigt, die Einsamkeit zu suchen. Er genoss die Zeit, wenn Edith gerade ihre Arbeit beendet hatte und Rose zu Bett gegangen war; dann kam es ihm vor, als hätte er das ganze Haus für sich allein. Besser gesagt genoss er es eine halbe Stunde lang, dann legte sich ein Schalter um, Lucian versank in einem Sessel und wurde von so tiefer Verzweiflung gepackt, dass er kaum noch atmen konnte.
Rose ihrerseits wirkte verloren, überfordert von ihrem neuen Stand als verheiratete Frau mit dem Leben einer Erwachsenen in ihrem eigenen Haus. Lucian war sich nicht ganz sicher, womit sie den Tag verbrachte, wenn er nicht in der Nähe war. Sie machte weder Besorgungen, noch traf sie Verabredungen, soweit er wusste. Sie las nicht. War sie noch auf, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, fand sie oft keine Ruhe. Sie aß vielleicht ein paar Löffel Suppe mit ihm. Dann wanderte sie mit gedankenverlorenem Stirnrunzeln von Zimmer zu Zimmer, als suchte sie etwas, das sie verlegt hatte.
Lucian blieb vor der Haustür stehen und atmete tief ein. Dann schloss er auf. Nachdem er seinen Mantel ausgezogen und an den Kleiderständer gehängt hatte, stellte er die Tüte mit den Törtchen auf den Flurtisch. Er kam sich dumm vor, weil er dafür Geld verschwendet hatte. Vielleicht würde Edith die Törtchen haben wollen.
Das neue Dienstmädchen war noch im Haus. Sie war Anfang dreißig, klein und rundlich mit mausbraunen, asymmetrisch kinnlangen Haaren. Julia hatte sie gefunden und Lucian und Rose bedrängt, sie einzustellen. Vielleicht war Lucian ihr gegenüber deshalb misstrauisch geworden. Sie gab sich betont unterwürfig, aber Lucian hatte gesehen, wie sich ihr Gesichtsausdruck veränderte, wenn sie sich unbeobachtet wähnte. Der Blick ihrer kleinen Rosinenaugen huschte ständig suchend umher. Im Gespräch war sie mit keiner Antwort, die man ihr gab, zufrieden und hakte jedes Mal neugierig nach. Es wirkte, als wollte sie sich stets einen umfassenden Überblick verschaffen.
Sie kam die Treppe herunter, und Lucian entging nicht, dass ihr die Tüte mit den Törtchen auffiel. »Oh, Sir. Ich bin gerade mit dem Packen für Sie fertig.«
»Danke, Edith.«
»Sind acht Hemden genug? MrsAinsworth sagte, Sie fahren für einen Monat …«
»Das stimmt.«
»… aber wenn es länger wird, brauchen Sie vielleicht mehr?«
Lucian versicherte ihr, er würde nicht länger als einen Monat wegbleiben, obwohl er das in Wirklichkeit nicht wusste.
Resigniert hörte Lucian sich an, was es zu essen gab – ein schönes Stück gekochtes Rindfleisch gefolgt von Syllabub. Edith konnte Betty als Köchin nicht das Wasser reichen.
Er erkannte vorgetäuschtes Desinteresse in ihrer Stimme, als sie fragte: »Und wird MrsAinsworth ihr Abendessen heute unten zu sich nehmen?«
Lucian sagte, das wisse er nicht, weil er noch nicht mit ihr gesprochen habe.
»Es ist nur schade, dass Sie beide nicht zusammen essen. An Ihrem letzten Abend in London …«
Wollte Edith andeuten, dass sie bereit wäre, für Rose einzuspringen und ihm gegenüber am Tisch Platz zu nehmen?
»Es ist, wie es ist«, sagte Lucian lächelnd. »Und nehmen Sie gern die Törtchen mit, wenn Sie gehen. Ein Kollege hat sie mir geschenkt. Aber wir machen uns beide nicht viel aus so etwas.«
Mit schweren Schritten stieg Lucian die Treppe hinauf. Die Tür zum großen Schlafzimmer war geschlossen. Er klopfte zweimal, bevor er sie öffnete, blieb kurz auf der Schwelle stehen und ging dann leise über den mit Teppichen ausgelegten Holzboden zu Rose, die in ihrem Bett lag. Die Luft schmeckte muffig und abgestanden. Durch die Spalte neben den fest zugezogenen Samtvorhängen sickerten schmale Lichtstreifen herein.
Lucian setzte sich auf die Bettkante und betrachtete seine Frau. Sie lag auf Kissen gebettet, die Hände neben sich. Eine große Schlafmaske aus Satin verdeckte ihre obere Gesichtshälfte. Ihre langen, dicken Haare, die Edith ihr kämmte, bevor sie sich hinlegte, umgaben ihren Kopf wie ein Heiligenschein. Im Halbdunkel erinnerte sie an eine steinerne Statue auf einem Grabmal.
»Rose?« Er streckte die Hand aus und berührte ihre Wange.
Sie zuckte zurück. »Wer ist das? Lucian?«
»Ja.«
»Ich würde dich gern ansehen«, sagte sie schwach, »aber ich ertrage nicht einmal das geringste bisschen Licht.«
»Ich verstehe«, sagte Lucian, obwohl ihm das zunehmend schwerfiel. Auch die Ärzte, die Rose in den letzten Monaten untersucht hatten, verstanden es nicht. Ihre Diagnose lautete immer gleich und erschien Lucian vage und wenig hilfreich – Neurasthenie oder »Nervenprobleme«. Organisch lag nichts vor, erklärten sie. Die schweren Migräneanfälle, die Rose mehrmals die Woche quälten, waren Teil einer allgemein angeschlagenen Verfassung. Die Ärzte hatten Bettruhe verordnet und dazu Tabletten namens Veronal, die angeblich hervorragend gegen Angstzustände halfen und den Schlaf förderten. Das Problem war, dass Rose das Veronal nicht gern nahm, weil es, wie sie sagte, ihre Kopfschmerzen verschlimmerte; außerdem wollte sie keine »Drogensüchtige« werden.
Lucian versuchte, sich von der Situation nicht die Kraft rauben zu lassen. Er sagte sich immer wieder, dass es für Rose schlimmer war. Allerdings gab es ein weiteres Problem, ein sehr privates, von dem er vermutete, dass es mit den Kopfschmerzen zusammenhing. Nur sah er sich außerstande, es den Ärzten gegenüber anzusprechen, weil es zu peinlich war und weil Rose ihn angefleht hatte, niemandem etwas zu sagen. Am Ende blieben sie untätig, aber lange konnte das Leben so nicht weitergehen.
Rose drückte sich vorsichtig hoch, als würde es sie enorme Kraft kosten und als wäre sie nicht sicher, ob ihre knochigen Ellbogen sie tragen würden. Lucian beugte sich vor und legte ihre Kissen zurecht. »Du bist gut zu mir«, sagte sie. Ihre Stimme war schwach und entrückt.
Sie sprachen über Alltägliches, wie gewohnt. Lucian erzählte ihr ein wenig von seiner Arbeit und machte dabei aus einer kleinen Meinungsverschiedenheit einen ausgewachsenen Streit, den er glorreich gewonnen habe. Rose erzählte ihm von dem Rotkehlchen, das sie im Garten gesehen hatte, als sie sich einen Moment lang kräftig genug gefühlt hatte, sich nach draußen zu setzen. Dann sagte sie: »Ich kann kaum glauben, dass du morgen wegfährst.«
Lucian errötete schuldbewusst. »Es ist wirklich seltsam«, gab er zu.
»Was wirst du anziehen?«
Die eigenartige Frage überrumpelte ihn. »Ich weiß nicht. Meinen weißen Leinenanzug, glaube ich. Er ist bequem und bietet sich für die Reise an …«
»Ja.«
»… allerdings knittert er auch leicht.«
Rose drückte seine Hand. »Bitte Edith, ihn für dich zu bügeln.«
Das würde er, versicherte Lucian.
»Es ist schwer vorstellbar«, sprach Rose weiter, »dass du bald auf der Terrasse Limonade trinkst und im Mittelmeer schwimmst.«
Wollte sie ihm ein schlechtes Gewissen machen? Das konnte Lucian bei ihr nicht immer erkennen. »Ich habe dich gefragt, ob du mitkommen willst«, erinnerte er sie. »Und du wolltest nicht.«
Sie lächelte fast unmerklich. »Ich könnte es nicht. Es geht mir einfach nicht gut genug. Außerdem mag ich keine Limonade. Und wie du immer wieder erwähnst, kann ich nicht schwimmen.«
Es war eine sanfte Spitze, die ihn trotzdem traf. Lucian begegnete ihr mit einer vorbereiteten Rede, dass diese Reise eher der Arbeit als dem Vergnügen diente. Er kehrte nur nach Portofino zurück, um seiner Mutter zu helfen, einige Kellerräume zu einer Therme auszubauen. Unter normalen Umständen würde sein Vater dort sein und das übernehmen, aber wie Rose wusste, waren die Umstände nicht normal …
»Ich weiß«, seufzte sie schicksalsergeben. »Du trägst eine große Verantwortung.«
»Das habe ich dir ja noch gar nicht erzählt – ich mache unterwegs für ein paar Tage in Paris Station. Mutter hat mich gebeten, ein paar Kunstwerke für das Hotel auszuwählen.«
Rose runzelte die Stirn. »Paris? Ist das nicht schrecklich gefährlich?«
»Ganz und gar nicht. Es ist eine sehr achtbare Stadt.«
»Man hört so viele Geschichten.«
»Die sicher alle unwahr sind.« Eine gewaltige drückende Stille machte sich breit, bis Lucian fragte: »Kommst du zum Abendessen nach unten?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht. Könntest du Edith bitten, mir etwas heraufzubringen? Vielleicht schwachen Tee.«
»Du solltest mehr zu dir nehmen. Du musst bei Kräften bleiben.«
Ärger blitzte auf. »Was bringt es mir, etwas zu essen, wenn ich es nicht bei mir behalten kann? Du verstehst das nicht. Du hattest noch nie solche Kopfschmerzen, Lucian.«
Das stimmte, deshalb sagte Lucian nichts. Jedes Atom seines Körpers wehrte sich gegen die Situation. Er wollte das Zimmer verlassen, weggehen, einfach so, in die Freiheit.
Rose spürte offenbar, dass etwas nicht stimmte. »Du bist böse auf mich«, sagte sie.
»Natürlich nicht. Wie könnte ich?«
»Schreib mir, ja? Jeden Tag.«
»Ich werde es versuchen.«
»Ich nehme an, dass du schrecklich früh aufbrichst.«
»Um sechs Uhr.«
»Dann wollen wir uns jetzt verabschieden. Ich möchte nicht geweckt werden.«
Als er später Zuflucht in seinem Arbeitszimmer genommen hatte, ließ Lucian sich mit einer Zigarre und einem Glas Whisky in einen Sessel fallen. Mit leerem Blick starrte er auf seinen Schreibtisch, die reichlich bestückten Bücherregale, das große Fenster mit dem beeindruckenden Blick auf die Eiche am Ende des Gartens. Materiell mangelte es ihm an nichts. Emotional sah es anders aus.
Der Himmel verfinsterte sich, dunkle Flecken breiteten sich aus wie auf verdorbenem Obst, und vor Lucian erstreckte sich ein weiterer einsamer Abend.
An ihrem Hochzeitstag hatte Rose Kopfschmerzen bekommen und geklagt, sie fühle sich »kraftlos«. Schon während der Planung hatten sich ihre Familien in Lager aufgeteilt, beide Seiten hatten völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was wünschenswert oder auch nur möglich war. Rose’ Mutter hatte darauf bestanden, dass sie auf dem Anwesen der Familie in Yorkshire heirateten – im Frühling, damit Lucians Mutter ausreichend lange vor Saisonbeginn wieder in Italien sein konnte. Zum Anwesen gehörte eine reizende kleine Kirche, die einen malerischen Ort für die Trauung abgegeben hätte, wäre das Wetter nicht so scheußlich gewesen: grauer Himmel und Eisregen, der stach wie winzige Nadeln.
Bei der Hochzeit begegnete Lucian zum ersten Mal seinem künftigen Schwiegervater. Er stellte sich als untersetzter Mann heraus, recht enthusiastisch, mit schütterem rötlichen Haar und der Angewohnheit – einem Tick eher –, blinzelnd an seiner linken Augenbraue zu kratzen, wenn er mit jemandem sprach. Ihm gebührte Respekt: Andrew Drummond-Ward hatte die Somme überlebt, wo er als Offizier des 9. Battaillons der King’s Own Yorkshire Light Infantry gedient hatte.
»Du bist also der Bursche, der mir Rose abnimmt?«, hatte er gefragt. »Ich hoffe, du weißt, worauf du dich einlässt.«
Als scherzhaftes Geplänkel unter Männern wäre das nicht weiter bemerkenswert gewesen. Aber Lucian konnte in der Stimme des älteren Mannes keinen humorvollen Unterton feststellen, und so klang seine Bemerkung wie eine Warnung, fast wie ein Vorwurf. Es hatte sein Gefühl verstärkt, er habe die Verbindung verloren, nicht nur zu dem lärmenden Hochzeitszirkus, sondern zu sich selbst. Lucian sorgte sich, alles würde herauskommen, jeder hätte bereits erraten, was er sicher wusste – diese Ehe war ein Schwindel.
Falls er vor der Hochzeit nicht ans Fegefeuer geglaubt hatte, so tat er es danach. Wohin er sich auch wandte, aus jeder Ecke überfielen ihn Freunde und Verwandte der Drummond-Wards. »Hubert Rawlingson, Rose’ Patenonkel …«, »Godfrey Hart, Jagdherr …«.
Julia fing ihn auf dem Weg zur Kirche ab, das Gesicht eine Kabukimaske, weiß mit dick aufgetragenem Rouge auf den Wangen. »Das Wetter ist nicht so wie erhofft. Deine Mutter musste ja auf einer Hochzeit im Frühjahr bestehen …«
Die langsame Prozession zum Altar war wie ein schlechter Traum. Die kalte, parfümierte Luft, das Husten und Tuscheln. Was sagten die Leute? Lachten sie ihn aus? Rose sah wunderschön aus, keine Frage, sie trug dasselbe Hochzeitskleid wie schon ihre Mutter und ihre Großmutter – ein Mieder mit Balltaille, der Ausschnitt und die kurzen Puffärmel mit Spitze besetzt –, aber es war eine leere, blasse Schönheit.
Mit Lucian geschah etwas Bemerkenswertes, etwas Schreckliches, etwas, von dem er sich vielleicht nie würde lösen können.
Dann folgte der schlimmste Teil – die Hochzeitsnacht.
Als Lucian daran zurückdachte, umklammerte er schaudernd seinen Whisky. Er leerte das Glas und schluckte die Scham und Verlegenheit, die ihn noch immer quälten, herunter.
Nein. Diesen Moment konnte er nicht noch einmal durchleben.
Am nächsten Morgen verließ Lucian das Haus, ohne Rose zu wecken, wie sie es erbeten hatte. Edith zündete gerade den Herd an. »Keine Sorge, Sir«, sagte sie, während sie ihr Tuch gegen die morgendliche Kälte enger um sich zog. »Ich passe auf MrsAinsworth auf.«
Darauf möchte ich wetten, dachte er.
Das Taxi kroch auf den Bahnhof Charing Cross zu. Lucian wischte Kondenswasser vom Fenster und schaute hinaus zum silbergrauen Himmel und dem Nieselregen, der die Sonne vom Vortag abgelöst hatte; auf die Straßenbahnen, die zahllose Männer mit Hüten und Mänteln vor den Büros im West End ausspuckten. Sie hielten am Taxistand neben dem Eleanor-Kreuz. Sofort fand Lucian einen Träger für seinen Koffer und seine zweite, kleinere Tasche. Er machte bei WH Smith halt, kaufte die neueste Ausgabe vom Bystander und erreichte den Zug zum Hafen zehn Minuten vor Abfahrt.
Diese Strecke kannte er gut. Folkestone war während des Krieges ein wichtiger Knotenpunkt für die Truppen gewesen. Man hatte nicht umsonst gesagt, dass die Westfront eigentlich auf der englischen Seite des Kanals begann.
Die baufälligen Hafengebäude waren das Letzte, was er 1917 von England gesehen hatte, und wieder das Erste ein Jahr später, nach seiner Entlassung aus dem Genesungsheim in Trouville, wo er seinen wunderbaren Freund Nish kennengelernt hatte. Deshalb war diese Reise für ihn eine Art Pilgerfahrt, eine erzwungene, aber hoffnungsvolle Wiederholung.
Lucian machte es sich auf seinem Sitz bequem und fühlte sich zum ersten Mal seit Monaten optimistisch und entspannt. Er bestellte Frühstück, las seine Zeitschrift und ließ ganz leise den Gedanken daran zu, was – oder besser besagt wer – ihn in Portofino erwartete.
Vor seinem geistigen Auge huschten Szenen vorbei – lächerliche Fantasien. In einer lag er mit Constance in seinem Zimmer im warmen Sonnenschein, durch das Fenster strömte die würzige Meeresluft. In einer anderen schlenderte er mit ihr durch einen märchenhaften Garten mit Hecken aus Myrten und Aloe. Sie blieben stehen, und sie hob das Gesicht seinem entgegen. Er strich ihr mit den Fingerspitzen ein Haar aus dem Gesicht und küsste sie auf die Lippen, erst sanft, dann inniger, als er spürte, dass ihre Zunge seine suchte …
Hatte Rose je eine ähnlich intensive Rolle in seiner Vorstellung gespielt? Nein. Man konnte Rose und Constance nicht vergleichen, auch nicht wie Lucian für sie empfand.
Ein paar Stunden später stieg Lucian am Hafen von Folkestone aus – der Zug brachte seine Fahrgäste bis ans Meer. Ungläubig stellte er fest, dass das »neue« Schiff, das ihn übersetzen sollte, dasselbe war, das ihn in den Krieg gebracht hatte, die gute alte Biarritz, wenn auch überholt und aufpoliert, mit höheren Schornsteinen und einer Einfassung um das Promenadendeck.
Soso. Das konnte doch nur eine Art Omen sein.
In den Schützengräben hatte sein Freund Peter, ein Altphilologe, gern Heraklit zitiert, bis zu dem Moment, in dem er von einer Granate zerfetzt wurde.
»Der Weg nach oben und der Weg nach unten sind ein und derselbe«, hatte er oft gesagt.
»Ja«, hatte Lucian geantwortet. »Aber woher weißt du, welche Richtung welche ist?«
»Gar nicht. Genau darum geht es.«
Jetzt dachte Lucian: Geht es für mich nach oben oder nach unten?
Er wollte von Boulogne aus nach Paris reisen, wo er zwei Tage lang die Atmosphäre von Montparnasse und des Quartier Latin aufsaugen würde, um dann mit dem Train Bleu nach Nizza zu fahren. Dort würde er ein Automobil mieten und auf der Küstenstraße vorbei an Sanremo und Savona nach Portofino fahren. Dafür plante er fast einen ganzen Tag ein.
Die Geschichte, dass Lucian auf Bellas Wunsch hin Kunstwerke für das Hotel beschaffen sollte, war nicht die ganze Wahrheit. Im Grunde wollte er einfach eine Weile allein sein, er wollte Zeit haben, um seinen Schwärmereien zu frönen und wieder mehr zu sich selbst zu finden.
War er verschlossener geworden? Zum Teil war er es immer gewesen, schon als Kind. Im Internat lernte man schnell, dass es inakzeptabel war, seinen Eltern irgendetwas zu erzählen. Deshalb hatte niemand je erfahren, dass Lucians Kopf dort einmal in eine Toilettenschüssel gedrückt worden war, während sein Erzfeind Lawrence Barr-Heston die Spülung betätigte. Als sich ein Junge, der noch viel schlimmer als Lucian drangsaliert worden war, in der Kapelle erhängte, sprach niemand darüber. Es gab keine Schulversammlung, keine Untersuchung, niemand übernahm die Verantwortung. Den Schülern musste nicht erst gesagt werden, dass sie den Vorfall verschweigen sollten. Sie taten es von sich aus.
Und jetzt tat er es wieder, aber dieses Mal war Constance sein Geheimnis. Seine Liebe zu Constance. Seine Hingabe zu ihr.
Für Lucian war Italien Constance und Constance Italien. Sie war eins mit den mittelalterlichen Städtchen auf den Berggipfeln, mit den würdevollen, vornehmen Villen, die umgeben von Zypressen in der hügeligen Landschaft standen, und mit der frischen, heißen italienischen Luft, erfüllt von Licht und Farbe.
Das Problem war, dass seine Liebe zu Constance nicht mehr ganz geheim war – seine Schwester Alice hatte offensichtlich Verdacht geschöpft –, deshalb musste er seine Gefühle unbedingt besser verstecken.
Alice war allzeit wachsam. Sie hatte über nichts anderes nachzudenken und nichts anderes zu tun, als ihre Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken. Verbittert und rachsüchtig hatte sie ihr Witwentum zu ihrer ganzen Persönlichkeit gemacht und schien den Rest ihres beengten, missgünstigen Lebens als Nonne verbringen zu wollen. Erst letztes Jahr hatte sie die Annäherungsversuche des armen alten Grafen Albani, eines Hotelgasts, so heftig zurückgewiesen, dass er Lucian leidgetan hatte.
Nun, das konnte sie machen, wenn sie wollte. Aber Lucian hatte nicht vor, sich solchen Gefühlen zu versperren.
Der einzige Mensch, der sein Dilemma vielleicht verstehen würde, war Nish. Aber Nish war nach Genua gezogen und führte ein radikales, gefährliches neues Leben. Ein eigenartiger Weg, um Erfüllung zu finden, hatte Lucian anfangs gedacht, aber je länger er überlegte, desto klarer wurde ihm, dass sie sich in vergleichbaren Lagen befanden.
Beide begriffen, dass man für seine Erfüllung Opfer bringen musste.
Vor seiner Abreise aus London hatte Lucian an die Adresse in Genua geschrieben, die er von Nish hatte, und ihn eingeladen, ihn in Portofino zu besuchen.
Ob Nish den Brief bekommen hatte? Ob er ihn je bekommen würde? Die Reling fest gepackt, den Blick auf das unablässig aufgewühlte graue Wasser gerichtet, hoffte Lucian, die Antwort laute »Ja«.
Alice stand mitten im Speisesaal und schaute sich um. Das Kontrollieren lag ihr, sie konnte auf zehn Schritte erkennen, ob irgendwo eine Gabel fehlte. Was sie erblickte, waren allerdings zwanzig fehlende Gabeln – die Aufgabe war nur halb erledigt. Nach dem Frühstück waren alle Tische abgeräumt und mit frischen Tischdecken versehen worden, aber nur auf einigen lag Besteck. Das bedeutete noch eine halbe Stunde Arbeit. Was in aller Welt ging hier vor sich?
Sie würde mit Paola sprechen müssen, dem italienischen Zimmermädchen, was nie einfach war. Zum einen lag es an der Sprachbarriere, zum anderen an der schlichten Tatsache, dass Paola sie nicht mochte. Aber es war nicht Alice’ Aufgabe, gemocht zu werden. Ihre Aufgabe war es, für reibungslose Abläufe im Hotel zu sorgen, damit sie Geld verdienen und ein faules Zimmermädchen wie Paola bezahlen konnten.
Auch wenn das Hotel noch nicht voll belegt war, mussten die Standards aufrechterhalten werden. Ehrlich gesagt vermisste Alice die Zeit, als das Hotel leer gewesen war. So gefiel es ihr am besten, wenn diese gedämpfte Atmosphäre herrschte und man nichts hörte als das Läuten der fernen Kirchenglocken und das leise Scharren, wenn Constance die Treppen fegte. In den Nächten sah es anders aus. Wenn die Saison vorbei war und es Winter wurde, senkte sich eine schwere, dunkle Stille auf die Menschen, und man empfand eine unglaubliche Einsamkeit und Kälte.
Ich bin müde, dachte Alice. Ich muss immer mehr Verantwortung übernehmen, und niemand sieht es oder dankt es mir.
Nun, das stimmte nicht ganz. Ihre Mutter wollte sie überreden, mit Freundinnen in den Urlaub zu fahren. Ihre alte Schulfreundin Dorothy hatte bereits Zimmer im Hotel Majestic in Nizza gebucht. Alice hatte eingewandt, ein Aufenthalt in einem Hotel bedeute mehr Arbeit als Urlaub, weil sie ständig die Leistung der Angestellten beäugen und die Tischwäsche nach Brandflecken absuchen würde, aber ihre Mutter hatte erwidert, sie solle nicht albern sein. Dorothy schrieb ihr immer wieder und schwärmte von Olivenhainen und wie reizend es sei, im Schatten von Eukalyptusbäumen Tennis zu spielen, ohne zu ahnen, dass Alice in Portofino alle Olivenhaine und Tennisplätze hatte, die man sich nur wünschen konnte.
»Die große Mode dieses Jahr ist das Sonnenbaden«, hatte Dorothy geschrieben.
»Sonnenbaden klingt furchtbar«, hatte Alice geantwortet. Sie mochte die Sonne nicht, schützte sich vor ihr, so gut es ging, und war stolz auf ihren zarten Teint.
Das andere Problem mit einem Urlaub war, dass ihre Mutter erst vor Kurzem Constance March zur stellvertretenden Hoteldirektorin befördert hatte. Wenn Alice sich freinahm, und sei es nur eine Woche, würde Constance bei ihrer Rückkehr sicher das gesamte Hotel und wahrscheinlich ganz Portofino übernommen haben, wie ein mythologisches Wesen, dem immerzu neue Köpfe und Arme wuchsen.
Nichts ärgerte Alice mehr als Mamas unerklärliche Zuneigung zu der kleinen March, die – das musste offen ausgesprochen werden – recht gewöhnlich war und dazu eine liederliche Person. Nur Alice durchschaute Constance’ wahre Absicht: Lucian zu verführen, seine Ehe zu zerstören und ihn dazu zu bringen, für ihren unehelichen Sohn den Vater zu spielen.
Nun, das würde Alice nicht dulden.
Ein lautes Klopfen, tief aus dem Innersten des Hotels, hallte in den oberen Räumen nach. Alice rieb sich die Stirn. Sie hätten für die Dauer der Bauarbeiten schließen sollen, aber Mama war dagegen gewesen. Sie fand, sie könnten das Hotel geöffnet lassen, wenn sie die Zimmerpreise senkten und die Gäste offen auf den möglichen Lärm und die Unannehmlichkeiten hinwiesen. Sie hatte eine Personalversammlung einberufen, bei der alle versprochen hatten, ihr Bestes zu geben.
Wenn Paola hier ihr Bestes gegeben hat, dachte Alice, als sie die Gabeln verteilte, dann Gnade uns Gott, wenn sie sich weniger Mühe gibt.
Die Arbeiten an der Therme hatten im Januar begonnen, als es noch kalt gewesen war, und hätten mittlerweile abgeschlossen sein sollen, aber wie sich herausstellte, waren italienische Bauarbeiter noch unzuverlässiger als englische. Dieser Marco, nun, er mochte Mama mit seinem markant guten Aussehen und seiner unschuldig-bescheidenen Art für sich gewonnen haben, aber Alice kannte diese Sorte Mann und ließ sich keinen Moment zum Narren halten.
Sie ging vom Speisesaal in die Küche, um Paola die Leviten zu lesen. Als sie dort ankam, herrschte aber bereits ein solcher Tumult, dass sie nicht noch dazu beitragen wollte. Das italienische Zimmermädchen wischte energisch die Terrakottafliesen, während Betty hinter ihr mit Kochtöpfen herumpolterte, den Kopf schüttelte und vor sich hin grummelte.
Der Grund der Aufregung war offensichtlich. Bruno und Salvatore, die italienischen Arbeiter, die Marco für die Umbauten im Keller mitgebracht hatte, hatten in einer leeren, ungenutzten Ecke der Küche Zementsäcke deponiert. Betty hatte dieser Regelung widerwillig zugestimmt, unter der Voraussetzung, dass sie nur vorübergehend galt. Leider hatte sich herausgestellt, dass die Säcke undicht waren, und jedes Mal, wenn einer durch die Küche und die Seitentür in den Garten getragen wurde, hinterließ er eine feine Staubspur – nicht nur auf dem Boden, sondern auch in der Luft. Der Zement setzte sich auf dem Herd und den Kupferpfannen ab, auf den Ciabatta-Brötchen, die auf einem Rost abkühlten, und auf dem gehackten Gemüse und den eingeweichten Borlotti-Bohnen für die Minestrone.
Betty sah Bruno und Salvatore kopfschüttelnd nach. »Diese Therme«, sagte sie zu niemand Bestimmtem, »bringt mich noch ins Grab.«
»Seien Sie nicht lächerlich«, sagte Alice, die gelernt hatte, dass man mit Betty entschieden und direkt sprechen musste. Wieder einmal schwang sie sich zur Verteidigung der Therme auf. »Wir haben das schon so oft besprochen. Wir müssen eine Möglichkeit finden, die Saison zu verlängern. Das Hotel profitabler zu machen. Die Schweizer und die Deutschen lieben Thermen, und sie verreisen früh im Jahr, schon im März.«
»Völlig aberwitzig, wenn Sie mich fragen.«
»Nun ja, die Kälte macht ihnen nichts aus. Im Gegensatz zu den Einheimischen, die trauen sich erst im Juni ans Meer.«
»Es ist ja alles schön und gut, was Sie sagen«, meinte Betty, »aber wenn den ganzen Tag Leute durch meine Küche laufen, leidet das Essen.«
»Das verstehe ich«, versicherte Alice ihr, »nur kann das Hotel Portofino nicht stillstehen. Es muss konkurrenzfähig sein. Neulich habe ich von einer Therme in Baden-Baden gehört – sie hat zweiundfünfzig Baderäume, in denen natürlich warmes Wasser aus den Quellen fließt. Es gibt da auch Dampfbäder, Schlammbäder, einen Inhalationsraum, einen Massageraum …« Sie zählte die Angebote an den Fingern ab.
»Aber wir sind keine Therme in wo auch immer, oder?«, unterbrach Betty sie. »Wir sind das Hotel Portofino – und stolz darauf.«
Insgeheim stimmte Alice ihr zu. Sie fand Thermen dekadent und unhygienisch und sah keinen Grund, etwas zu bauen, nur weil irgendwelche Deutschen es so wollten. Trotzdem nutzte sie die Gelegenheit, Betty für ihre respektlose Antwort zu tadeln. »Achten Sie bitte auf Ihren Tonfall, wenn Sie mit mir sprechen.«
»Ja, Ma’am.« Betty wandte sich den Zwiebeln zu, die sie gerade gehackt hatte.
Gekränkt ging Alice ins Foyer, wo Mama mit Constance plauderte. Die zwanglose Vertrautheit der beiden machte Alice wütend. Schon der Ton, in dem sie miteinander sprachen – so leise und formlos.
Ihre Mutter schien mit jedem Tag jünger zu werden: Ihre Haut strahlte, ihre Haltung war leicht und anmutig. Sie war zerstreuter und öfter in Gedanken versunken, ja, aber auch selbstsicherer. Mit einem Schaudern merkte Alice, dass sie eifersüchtig war. So fühlte sie sich oft, wenn andere Menschen sich veränderten, weil sie nicht glaubte, dass sie selbst dazu in der Lage war. Manchmal versuchte sie ganz bewusst, etwas anders zu machen, trug eine neue Frisur oder ließ sich ihren Ärger nicht so anmerken, aber die Gewohnheit holte sie jedes Mal ein, und sie war bald wieder die alte Alice.
Bella dagegen blühte auf, seit Alice’ Vater Cecil Italien verlassen hatte. Sie war nicht mehr so angespannt, seit das Hotel die Anfangsschwierigkeiten überwunden hatte und florierte. In der Gemeinde hatte sie an Ansehen gewonnen und gute Verbindungen zu den Lieferanten und Amtsträgern im Ort aufgebaut (abgesehen von Danioni, diesem Scheusal aus dem Gemeinderat).
Es war erstaunlich, dachte Alice, wie wenig ihr Vater vermisst wurde. Niemand erwähnte ihn je. Es war, als hätte er nie existiert. Auch wenn sie den Grund dafür verstand – er hatte sich eindeutig nicht mit Ruhm bekleckert –, erschien es ihr doch ungerecht, um nicht zu sagen unverhältnismäßig. Es wurde insgesamt unterschätzt, wie viel er zu diesem Hotel beigetragen hatte, fand Alice.
Sicher, er konnte unangenehm werden – wer nicht? –, aber sie hatte sich ihm immer nah gefühlt und war ehrlich überzeugt davon, dass er ihrer Mutter im Laufe der Jahre gutgetan hatte, indem er dafür sorgte, dass ihre wunderlichen Ideen nicht ausuferten. Obwohl Alice stets ein behutsames Vorgehen bevorzugte und die grenzenlose Risikofreude ihres Vaters ablehnte, hatten kleine Dramen hin und wieder doch ihr Gutes. Sie rüttelten die Leute auf, spornten sie an und schafften Anreize. Ohne ihren Vater erschien ihr das Leben manchmal schal und farblos.
Und jetzt interessierte ihre Mutter sich mehr für Constance als für ihre eigene Tochter.
Um den trauten Moment zu stören, räusperte Alice sich und ließ ihre Autorität spielen. »Constance? Könnten Sie Paola helfen, die Tische zu decken? Wir hängen schrecklich hinterher …«
»Natürlich, Ma’am.« Ohne sie anzusehen, huschte Constance mit gesenktem Kopf davon.
Bella wandte sich Alice zu. »Was sollte das?«
»Sie muss Paola helfen. In der Küche ist das Chaos ausgebrochen.«
Bella starrte sie an, ihr Blick bohrte sich tief in ihre Tochter, bis Alice wegschauen musste. »Bemüh dich bitte, netter zu Constance zu sein. Du hast von ihr nichts zu befürchten, weißt du?« Alice errötete. Sie drückte ihre Fingernägel fest in die Handflächen. »Deine Position im Hotel wartet auf dich, wenn du aus Frankreich zurückkommst.« Bella lächelte. »Ich sollte wohl sagen: ›Falls du zurückkommst‹, es wird bestimmt sehr schön …«
»Natürlich komme ich zurück. Falls ich überhaupt fahre …«
»Was meinst du damit?«
»Ich überlege, ob es das Richtige ist. Ob es mir dort überhaupt gefallen würde.«
Ihre Mutter legte ihr eine Hand auf den Arm. »Sieh mich mal an«, bat sie. Alice hob den Blick. »Ich weiß, wie hart du arbeitest. Und ich bin sehr dankbar dafür. Aber du bist noch eine junge Frau. Wirf nicht die besten Jahre deines Lebens weg. Nach allem, was du durchstehen musstest, hast du es verdient, dich zu vergnügen.« Sie stockte. »In deinem Alter zur Witwe zu werden … Das muss furchtbar sein. Glaub nicht, das wäre mir nicht bewusst.«
Alice unterdrückte die Tränen, die zu ihrem Entsetzen fließen wollten, und nickte. »Danke, Mama.«
»Gern«, sagte Bella. »Dafür bin ich ja da.«
ZWEI
Als er sah, dass er vor Lord Heddon im Club angekommen war, machte Cecil es sich im Rauchersalon neben dem Wintergarten mit einem Gin Tonic bequem.
Aber bevor er auch nur einen Schluck trinken konnte, kam sein Bruder hereingerauscht und beklagte sich seufzend über alles Mögliche: den unbekümmerten Tonfall seines Taxifahrers, die Art, wie Frauen sich heutzutage kleideten, sogar über Cecils Bitte, sich an diesem fürchterlichen Ort zu treffen …
Wusste Cecil nicht, dass dieser Laden ausgedient hatte? Dass jeder Mann von Format in den Garrick Club abgewandert war?
Die Beleidigung traf ihr Ziel, Cecil bebte vor Wut und Scham. Als jahrzehntelanges Mitglied des Beefeater Clubs hatte er sich in seiner Jugend bei zahlreichen Junggesellenabenden und Blackjack-Partien in den weitläufigen, behaglichen Räumen an der Pall Mall vergnügt.
Letztes Jahr hatte Bella angeregt, er solle seine Mitgliedschaft auslaufen lassen. Sie zogen nach Italien, warum sollte er sie behalten? Sie mussten »in allen Bereichen ihre Ausgaben prüfen«, hatte sie gesagt, ganz die Fabrikantentochter, die sie war. Cecil hatte sie ignoriert. Im Handbuch des Clubs, erinnerte er sich, stand, er sei ideal für »den Mann, dessen Heim den angemessenen Komfort entbehrt« – was ihn genau beschrieb.
Seit seiner Rückkehr nach London hatte Cecil hier mindestens einmal die Woche zu Abend gegessen. Er liebte die alten Ledersofas, die abgelaufenen Teppiche und die Gemälde illustrer Mitglieder, die ihn von blutroten Wänden herunter anstarrten.
Cecil ging voran in den Speisesaal, in dem ein aufwendiger Kristalllüster mattes Licht verströmte. Sie setzten sich – auf Heddons Wunsch hin – ans Fenster, und Cecil bemerkte mit seinem raubtierhaften Instinkt für die Schwächen anderer, wie korpulent sein Bruder geworden war. Der ältere Mann keuchte und ächzte, als er seinen stämmigen Körper in den Sessel quetschte.
Cecil plante, das Abendessen mit ungezwungener Plauderei zu verbringen und so die richtige Grundlage für das Gespräch zu schaffen, das er anschließend führen wollte. Nur stand Heddon nicht der Sinn nach Smalltalk. Kaum hatten sie bestellt – zufälligerweise das Gleiche: Garnelen in Butter gefolgt von Shepherd’s Pie –, herrschte er Cecil wegen seiner Whiskygeschäfte an.
Auf Cecils Bitte hin hatte Heddon ihn seinem Freund Viscount Dalwhinnie vorgestellt, der eine Whiskydestillerie in Schottland führte, eine recht große Brennerei in Glen Ord.
»Dalwhinnie hat mir erzählt«, donnerte Heddon, »dass du bei ihm eine laufende Bestellung von neunhundert Litern pro Monat aufgegeben hast, die direkt nach Bermuda verschifft wird.«
»Das stimmt«, sagte Cecil, bemüht, sich seine Verärgerung über Heddons Einmischung nicht anmerken zu lassen.
»Das ist eine Menge Whisky.«
»Wirklich?« Cecil gab sich erstaunt und zog die Augenbrauen hoch.
Heddon beugte sich vor. »Werde mir nicht frech, Cecil. Glaubst du, ich wüsste nicht, was Schleichhandel ist?«
Cecil lachte. »›Schleichhandel.‹« Spöttisch ließ er sich das Wort auf der Zunge zergehen. »Du liest zu viel in der Zeitung.«
»Möglich.« Heddon dachte darüber nach. »Aber vielleicht liest du auch zu wenig.«
»Was in aller Welt meinst du damit?«
»Hast du von Roy Olmstead gehört?«
»Hilf mir auf die Sprünge«, bat Cecil, dem der Name nichts sagte.
»Amerikaner. Ehemaliger Polizist. Der Bursche hat kanadischen Whisky von einer Destillerie in Victoria über die Haro-Straße transportiert. Hat sie unterwegs nach Seattle auf D’Arcy Island gebunkert. Er hat gut verdient, zweihunderttausend Dollar im Monat. Dann hat die Polizei sein Telefon abgehört. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Vier Jahre Zwangsarbeit und achttausend Dollar Geldbuße.«
»Also wirklich, Heddon«, sagte Cecil mit gespielter Empörung. »Was ich hier mit der Hilfe eines italienischen Geschäftspartners – mit einem hohen Posten in der Lokalpolitik und allerbesten Beziehungen – auf die Beine gestellt habe, ist ein seriöses Import-Export-Geschäft. Was mit dem Whisky passiert, wenn er Bermuda erreicht hat, ist nicht mein Problem.«
»Die Polizei wird das anders sehen.« Heddon zögerte. »Ich frage mich, ob es klug ist, dich so bald nach der Geschichte mit dem Rubens auf neue fragwürdige Geschäfte einzulassen.«
»Daran war nichts fragwürdig.«