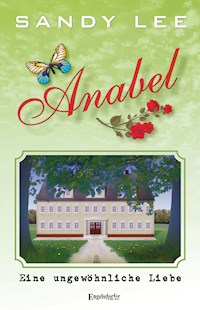Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als ihr Opa stirbt, möchte die 16-jährige Sophie mehr über ihre Herkunft erfahren. Sie weiß nur, dass der Urgroßvater William amerikanischer Besatzungssoldat in ihrer Heimatstadt Sternbach gewesen ist und dass die Villa, in der die Familie lebt, die ehemalige Kommandantur beherbergte. Beim Nachforschen entdeckt das Mädchen gemeinsam mit ihrem Freund Jonas alte Dokumente, die sie zu einem unerwarteten Erbe sowie zum früheren Besitzer der Villa führen, der vor 150 Jahren Bürgermeister der Stadt gewesen und auf ungewöhnliche Weise gestorben ist. Und nicht zuletzt ist da noch diese seltsame Wand im Keller des Hauses, hinter der sich etwas verbirgt. Pfarrer Engel hilft den jungen Leuten, Licht in die Vergangenheit zu bringen. So erfährt Sophie schließlich von einer beeindruckenden Frau und stößt auf ein altes Geheimnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information durch die
Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte
bibliografische Daten sind im Internet über
https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2024) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte bei der Autorin
Titelgestaltung: Sandy Lee
Clips © 2024 Sandy Lee, Corel Corporation
und seine Lizenzgeber.
Alle Rechte vorbehalten.
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
www.engelsdorfer-verlag.de
Für Silvia
DANK an meine Testleser Carmen, Erik, Natalie und Silvia
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Epilog
PROLOG
Sturm peitschte die alten Bäume an der regennassen Straße, fegte die gelben Blätter von deren Ästen. Das Heulen des Windes hüllte die Nacht in ein unheimliches Gewand. Pfützen spiegelten das schwache Licht der Gaslaternen wider, verzerrt durch die in rascher Folge aufschlagenden Tropfen. Irgendwo jaulte ein Hund, was jener Novembernacht des Jahres 1880 einen noch gespenstischeren Anschein gab. Kein Mensch traute sich bei diesem Wetter auf die Straße, die kleine Stadt lag wie ausgestorben zwischen den sie umgebenden Hügeln.
Plötzlich schlug das Jaulen des Hundes in lautes, warnendes Gebell um. Gleichzeitig waren hastige Schritte auf dem nassen Straßenpflaster zu vernehmen. Sie stammten von schweren Stiefeln und klangen in der Eintönigkeit des heulenden Sturmes wie ein angstvoller Herzschlag. Wer konnte sich bei diesem Unwetter herauswagen, sich den Unbilden der anscheinend rasend gewordenen Natur aussetzen?
Ein dunkler Schatten tauchte an der Straßenecke auf, ein Lichtschein erhellte ihn schwach. Dem Aussehen nach musste es ein älterer Mann sein, schon etwas gebeugt dastehend und sich, eine Laterne schwenkend, umschauend. Die Gestalt war in einen weiten Umhang gehüllt, der Kopf unter einer Kapuze versteckt. Nach einer kurzen Pause lief der vor Nässe triefende Passant eilig weiter.
Die Straße ›An der Bleiche‹ zog sich in einem sanften Linksbogen dahin, der weiter vorn in eine abrupte Kehre überging. An jener Stelle, auf der Wiese an der Außenseite der Kehre, breiteten früher die Frauen ihre Wäsche zum Bleichen in der Sonne aus. Das Gelände stieg sanft an und zeigte nach Süden, eine ideale Lage für diesen Zweck.
Die Bleiche gab es nicht mehr, das Grundstück war verkauft worden. Da, wo einst Laken in unschuldigem Weiß das Grün des Grases unterbrachen, reckte sich nun eine Gründerzeit-Villa in den Himmel. Herrschaftlich blickte sie auf die Häuser im Inneren des Straßenbogens herab, die Aussicht von keinem Bauwerk behindert, bis sie auf die Silhouette der Stadtkirche traf.
Aus dieser Richtung kam der einsame Nachtwandler, der sich nun zielsicher auf die Villa zu bewegte. Im Lichtkegel der Straßenlaterne an der Grundstücksmauer hielt er nochmals an, um ein wenig zu Atem zu finden. Als er durch das Gittertor zur Villa aufblickte, erhellte das Gaslicht kurz sein Gesicht. Das müde Antlitz eines vielleicht sechzigjährigen Mannes verbarg sich unter der Kapuze. Kinn und Wangen waren von einem schütteren grauen Bart bedeckt, die Nase unter den dunklen Augen knollig. Auf der Stirn, über dem rechten Auge, hatte der Mann eine alte, zweifingerbreite Narbe.
Der Alte drückte gegen das Gittertor, welches sich mit leisem Quietschen einen Spalt weit öffnete. Er zwängte sich hindurch und lief hastig den gepflasterten Weg hinauf.
Sebastian Haustein war verärgert. Er hatte das Abendessen kaum angerührt, welches ihm Agnes, die Haushälterin, liebevoll zubereitet hatte. Jetzt schritt er unruhig durch sein Arbeitszimmer, die Hände hinter dem Rücken verschränkt.
»Seit Wochen sehe ich meine Tochter kaum noch, weiß nicht, wo sie sich aufhält – und nun dieser Brief.« Er schlug mit der flachen Hand auf das Blatt Papier, welches auf seinem Sekretär lag. »›Suche mich nicht, ich bin gut aufgehoben! Ich werde nicht nach Hause zurückkehren.‹ Was erlaubt sich die ungehorsame Dirne eigentlich?«
Agnes, die Einzige, die den Ausführungen Hausteins zuhören konnte, zuckte mit den Schultern.
»Wenn Sie das nicht selbst wissen, Herr Bürgermeister …«
Sebastian Haustein war ein Mann von zweiundfünfzig Jahren, untersetzt und würdevoll. In jüngeren Jahren war er Handwerker gewesen, hatte bei einem Schmied die Kunst der Stahlbearbeitung gelernt. Ein Handwerk, welches in Kriegszeiten goldenen Boden hatte. Im Deutsch-Französischen Krieg hatte er ein gutes Gefühl dafür, wie man sein Geld vermehren konnte und war dadurch zu Ansehen und Einfluss gekommen. So war aus der Schmiede schließlich eine Fabrik geworden, die neben Werkzeugen und Maschinen auch Waffen herstellte. Schon damals war er Mitglied des Stadtrates gewesen, weil man ihn als Menschen mit Visionen, mit Plänen schätzte – und weil er diese Pläne auch durchzusetzen wusste.
Im Gründertaumel nach dem von den Franzosen schmählich verlorenen Krieg kaufte sich der Fabrikherr Haustein die Bleichewiese und ließ sich eine ansehnliche Villa hinsetzen, einen zweistöckigen Bau mit großem Empfangsbereich und einem Turm. Er kandidierte für das Amt des Bürgermeisters, gewann die Wahl und fühlte sich seitdem auf seinem Hügel als Feldherr, der die Geschicke des Städtchens lenkte.
Im Jahre 1862 hatte er Amalia Landgraf, die Tochter eines Großgrundbesitzers, geehelicht, die ihm im folgenden Jahr ein Kind gebar, Sophia. Das Mädchen war der ganze Stolz der Mutter, während der Vater sich einen Erben für seine Fabrik wünschte. Nachdem die Villa Mitte der siebziger Jahre stand, war die Erfüllung seines Wunsches zum Greifen nah – Amalia war erneut schwanger. Doch das Glück sollte ihnen nicht hold sein. Das Kind, ein Sohn, starb gleich nach der Geburt, die Mutter kurz darauf im Wochenbett.
Auf einmal lag die Welt des Sebastian Haustein in Scherben. Alles, was er sich erarbeitet hatte, sein Erfolg, sein Reichtum, zählte plötzlich nicht mehr. Die große Villa war von einem auf den nächsten Tag für ihn kalt und leer geworden. Sein einziger Halt blieb ihm in seiner Tochter Sophia, die nun versuchte, die entstandene Lücke auszufüllen und den Vater wieder aufzurichten. Eine schwere Aufgabe für eine gerade Zwölfjährige.
Das war vor fünf Jahren. Und nun ging die noch Minderjährige ihre eigenen Wege – viel zu früh. Wo trieb sie sich nur herum?
Der Bürgermeister lief wie ein gefangenes Tier in seinem Arbeitszimmer hin und her. Agnes hatte ihn fragend angeschaut, ob er ihre Dienste noch brauchte, und er hatte nur müde abgewinkt. Gerade wollte sie sich auf ihr Zimmer zurückziehen, da schellte es am Eingang.
Haustein sah durch die offene Arbeitszimmertür, wie die Haushälterin umschwenkte, um dem späten Besucher zu öffnen. Das große, schwere Portal lag genau auf der anderen Seite des weitläufigen Foyers.
Als Agnes die Tür erreichte, begann die Glocke gerade erneut zu schellen.
»Wer ist denn da?«, wollte sie sich vor dem Öffnen versichern.
»Der Nepomuk. Ich muss dringend den Herrn Bürgermeister sprechen.«
Die Haushälterin schob den Riegel zur Seite und öffnete die Tür einen Spalt. Draußen stand ein klatschnasser Mann im weiten Umhang, der sich gerade die Kapuze aus dem Gesicht zog.
Sie hieß ihn eintreten und im Foyer warten.
»Herr Bürgermeister! Der Nepomuk möchte sie dringend sprechen«, rief die ältere Frau laut, noch bevor sie das Arbeitszimmer erreicht hatte.
Sebastian Haustein, der alles durch die offene Tür mitverfolgt hatte, kam ihr entgegen.
»Sie können jetzt gehen, Agnes.«
Dann wandte er sich an den Gast, der inzwischen den tropfnassen Umhang abgelegt hatte.
»Nun Nepomuk, was gibt es? Lässt der Herr Pfarrer etwas Wichtiges ausrichten?«
Damit komplementierte er den Alten in Richtung seines Zimmers.
Nepomuk war seit langem die rechte Hand des Pfarrers Heimboldt. Kaum jemand kannte seinen Familiennamen, er war der Nepomuk. Es ging das Gerücht, er sei ein Findelkind und hätte bei einem der Vorgänger Pfarrer Heimboldts eines Tages auf den Kirchenstufen gelegen. Und so sei er da aufgezogen und von einem zum nächsten weitergereicht worden. Doch wie es aussah, würde der jetzige Gottesdiener wohl sein letzter Brotherr sein, denn Nepomuk stand im zweiundsechzigsten Lebensjahr, während Heimboldt noch zehn Jahre davon entfernt war.
»Nun, was gibt es so Unaufschiebbares, dass Sie der Herr Pfarrer um diese Zeit und vor allem bei solchem Wetter auf Botengang schickt?«
Haustein wandte sich zu ihm um, nachdem er die Zimmertür geschlossen hatte. Nepomuk hielt die leinene Kappe, die er sonst immer trug, in seiner Hand und knautschte sie.
»Es ist …«, druckste er herum.
»Nun, was?« Der Gastgeber wurde langsam ungeduldig.
Der Alte atmete tief durch.
»Ihre Tochter, die Sophia, ist beim Herrn Pfarrer. Sie wollte nicht, dass Sie es erfahren, Herr Bürgermeister. Doch dem Herrn Pfarrer plagte das Gewissen, da er ja von der längeren Abwesenheit des Fräulein Tochter wusste.«
Sebastian Hausteins innere Anspannung löste sich, als er die Nachricht gehört hatte.
»Es ist gut, dass Sie mich informiert haben, Nepomuk. Aber sie ist doch beim Herrn Pfarrer gut aufgehoben, das hätte bei diesem Unwetter nicht solcher Eile bedurft.«
Er schaute zum Fenster, an das aus der Dunkelheit heraus der Regen peitschte.
Nepomuk trat verlegen von einem Fuß auf den anderen.
»Oh doch – der Herr Pfarrer meinte, es wäre besser, wenn Sie mitkämen. Ihr Fräulein Tochter ist nicht allein erschienen.«
Der Bürgermeister fuhr herum.
»Sie ist nicht allein? Wer, zum Teufel, ist denn bei ihr?«
»Das sollten Sie sich besser selbst anschauen«, flüsterte der Pfarrdiener.
Sebastian Haustein hatte sich seinen Macintosh, den wasserdichten Regenmantel, übergezogen und gewohnheitsgemäß zum Zylinder gegriffen. Das war ein Fehler, denn er musste die Kopfbedeckung immerfort festhalten, damit sie der Sturm nicht sofort wegblies.
Zehn Minuten nach Verlassen der Hausteinschen Villa erreichten sie die Kirche. Der Bürgermeister wollte das Hauptportal am Markt benutzen, doch Nepomuk zog ihn in eine Nebenstraße, die zur Pfarrei führte.
Die Pfarrei war ein kleines, unscheinbares Häuschen, welches sich in den Schatten der Stadtkirche duckte. Nur wenige Schritte aus der Tür über einen unbefestigten Weg, schon stand der Pfarrer vor dem Eingang zur Sakristei. Während er im großen Gotteshaus ganz im Dienste des Herrn stand, warteten in der Pfarrei die weltlichen Obliegenheiten der Institution Kirche auf ihn. Dort befanden sich sein Büro und seine Dienstwohnung.
Der Pfarrdiener zog zweimal am Klingelzug, gleich darauf noch zweimal. Dieses Zeichen war mit Pfarrer Heimboldt verabredet. Schritte waren im Flur zu vernehmen, dann öffnete sich die Tür.
»Kommen Sie herein, Herr Bürgermeister!«
Der Pfarrer flüsterte fast; überhaupt hatte alles den Anschein, als solle es unbemerkt vor sich gehen. Laut sagte er dann: »Es ist gut, Nepomuk. Ich brauche dich nicht mehr.«
Pfarrer Anton Heimboldt war ein großer, schlanker Mann Anfang fünfzig. Er war ein wenig blass, wodurch das Schwarz seines Gewandes noch dunkler im Kontrast wirkte – ebenso wie seine tiefschwarzen Haare. Von Natur aus ein regsamer Mensch, war er für seine uneigennützige Hilfsbereitschaft bekannt und genoss hohes Ansehen bei den Einwohnern.
Was hingegen mancher nicht wusste: Sebastian Haustein und Anton Heimboldt kannten sich schon aus der Schule. Genauso wenig, wie ersterer als Fabrikherr geboren war, lag letzterem seine christliche Berufung bereits in der Wiege. Zu der fand er erst, als er auf einer Reise schwer erkrankte und von Mönchen in einem Kloster gepflegt wurde. Seitdem erwies er sich als Gottes Stimme auf Erden für seine Heilung dankbar.
»Setz dich, Sebastian!« Der Pfarrer wies auf die Stühle am Wohnzimmertisch. Waren die beiden Männer unter sich, duzten sie sich aus alter Freundschaft.
Der Bürgermeister nahm Platz.
»Was ist mit meiner Tochter, Anton?«
»Sie tauchte vorhin plötzlich auf und bat mich um Hilfe. Ein kräftigendes Essen hatte sie wahrhaft nötig.«
»Und wo ist sie jetzt?«
»Ich hab ihr angeboten, hier zu übernachten. Sie schläft nebenan.«
Haustein überlegte eine Weile.
»Gut, dann soll sie heute hier bleiben. Aber morgen hole ich sie ab, und sie kommt mit mir nach Hause.«
»Das werde ich ganz sicher nicht tun!«
Die beiden Männer schreckten hoch. In der Tür stand eine junge Frau mit zerzaustem rotblonden Haar. Sie hatte den Satz laut herausgerufen, ja fast geschrien.
Der Bürgermeister fasste sich als erster.
»Aber Sophia – warum, um alles in der Welt …«
Er wusste nicht weiter, wurde jedoch sowieso von seiner Tochter unterbrochen.
»Ich hab dich gebeten, nicht nach mir zu suchen, weil ich die Zeit für mich brauchte. Und du, du scherst dich einen Dreck um meinen Wunsch. Verrate du mir lieber, warum!«
»Sophia, du bist mein Kind. Ich mache mir Sorgen, wenn du so einfach verschwindest.«
Sophia trat an den Tisch heran, schaute dem inzwischen aufgestandenen Haustein in die Augen.
»Hat dich das früher interessiert, Vater? Du brauchtest doch nur einen Erben für dein Stahl-Imperium.«
»Sophia, bitte hör mir zu!«, mischte sich jetzt Pfarrer Heimboldt ein. »Wenn hier jemanden eine Schuld trifft, dann mich. Ich hab dich gesehen, wie du nass und hungrig zu mir gekommen bist. Ich kenne deinen Vater sehr gut und hab mir Sorgen gemacht. Und ja, gegen deinen Willen hab ich Nepomuk nach ihm geschickt. Ich hab geglaubt, es wäre für euch beide besser so.«
Die junge Frau blickte etwas verstört und ratlos von einem zum anderen.
»Sie waren das?« Einen kurzen Moment verharrte sie in stillem Überlegen.
»Ja, ich habe deinen Vater förmlich gedrängt, sofort zu kommen.«
»Sie trifft keine Schuld, Herr Pfarrer. Wie Sie schon sagten: Sie kennen meinen Vater gut. Doch von mir wissen Sie recht wenig. Und deshalb hätte er auf meinem Wunsch beharren müssen. –
Aber da du nun schon da bist, Vater«, sie ergriff dessen Hand und zog ihn mit sich, »werde ich dir jetzt etwas zeigen.«
Sebastian blickte fragend auf seinen Freund Anton. Der saß am Tisch und hatte das Gesicht in seine Hände geborgen – wohlwissend, was der Vater nun zu sehen bekommen würde.
Sophia verschwand mit diesem im Nachbarzimmer und schloss die Tür. Man hörte beide leise miteinander reden, dann trat Stille ein.
Auf einmal erklang ein gurgelndes Geräusch, als ob jemand nach Atem rang. Und gleich darauf war ein dumpfer Aufschlag zu vernehmen, als sei etwas Schweres zu Boden gefallen. Ihm folgte ein markerschütternder Schrei Sophias. Heimboldt blickte erschrocken hoch und sprang von seinem Stuhl auf. Mit fahrigen Händen riss er die Tür zum Zimmer auf.
Die junge Frau kniete am Boden, sie atmete heftig und schüttelte den vor ihr liegenden Vater. Dessen Augen waren nach oben verdreht und starrten leblos zur Decke.
Heimboldt hockte sich ebenfalls hin, hielt sein Ohr vor das Gesicht seines Freundes, suchte am Hals nach einem Pulsschlag. Sekunden später schaute er zu Sophia auf und schüttelte resigniert den Kopf.
Tränen stürzten plötzlich über deren blasses Gesicht, tropften ihr vom Kinn. Sie streichelte dem Vater zitternd über das Haupt. Der Pfarrer sah, dass sie einer Ohnmacht nah war und hob sie auf. Er zog den Kopf des vor Trauer völlig aufgelösten Mädchens an seine Schulter und flüsterte ihr ins Ohr: »Er war ein guter Mensch. Der Himmel ist ihm gewiss.«
Sophia hob den Kopf und blickte den Gottesdiener ungläubig an.
Auf dem Friedhof am Rande der Stadt waren Dutzende von Trauergästen versammelt. Erster Schnee hatte die Welt, durch die sich der Menschenzug hinter dem Sarg schlängelte, eingezuckert.
Pfarrer Heimboldt hatte auf der Trauerfeier bewegende Worte für den ersten Mann der Stadt gefunden. Er würdigte dessen Engagement und die Errungenschaften, die auf seiner Initiative fußten, ebenso seine Einsatzbereitschaft zum Wohle der Stadt. Er hob den Bürgermeister, den Fabrikanten und vor allem den Menschen Sebastian Haustein hervor.
Seine Freunde waren anwesend, auch der gesamte Stadtrat und eine Delegation aus seiner Fabrik. Die Haushälterin Agnes vergoss dicke Tränen. Nur seine Tochter suchte man unter all den Trauergästen vergebens.
Als der Sarg ins Grab gelassen wurde, huschte ein Schatten hinter einem Baum vorbei. Im gleichen Augenblick begann es wieder zu schneien, wie, um den teuren Verblichenen mit einer feingewebten weißen Decke einzuhüllen.
Pfarrer Heimboldt saß am Tisch im Wohnzimmer der Villa. Agnes brachte Kaffee, schenkte ein und setzte sich ebenfalls.
»Und Sie haben wirklich keine Ahnung, wo sich Sophia aufhalten könnte?«, setzte der Pfarrer das Gespräch fort.
»Leider überhaupt nicht. Sie kam kurz hier vorbei, um sich ein paar ihrer Sachen zu holen. Dann verabschiedete sie sich von mir und ging ohne ein Wort.«
Agnes traten Tränen in die Augen. »Ich glaube nicht, dass sie noch einmal zurückkehrt. Das war so … so endgültig, dieser Abschied.« Sie schluchzte tief.
Heimboldt seufzte ebenfalls.
»Was soll denn nun mit dem Haus werden, und mit der Fabrik? Die Fabrik braucht einen Direktor, das Haus einen Hausherrn. Ich kann doch keine Entscheidung ohne das Einverständnis von Fräulein Sophia fällen.«
Die Haushälterin schaute den Pfarrer fragend an.
»Hat der Herr Bürgermeister denn kein Testament verfasst, welches über seinen Nachlass verfügt?«
Ratlos hob der Gottesmann beide Hände etwas an.
»Er hat mit mir darüber gesprochen, vor längerer Zeit. Und damals, nach dem Tode seiner Gattin, sollte sämtlicher Besitz in die Hände seiner Tochter fallen. Er hatte ja sonst niemanden.«
Agnes erhob sich.
»Sollten wir nicht einmal in seinem Arbeitszimmer nachschauen. Da gibt es einen Tresor. Vielleicht, dass da …«
»Wir bräuchten den Schlüssel. Wissen Sie, wo er den aufbewahrt hat?«
»Wo denken Sie hin?!« Die Frau schüttelte den Kopf. »Wieso sollte er das gerade mir mitteilen?«
Heimboldt folgte ihr ins Foyer und weiter in das Arbeitszimmer des Bürgermeisters.
»Was ist das?« Der Pfarrer zeigte auf den Sekretär. Mitten auf der Schreibplatte lag ein Brief.
Agnes folgte seinem Finger und bemerkte ihn auch.
»Der lag vorher nicht da. Fräulein Sophia muss ihn vorm Weggehen dahin gelegt haben.«
Pfarrer Heimboldt griff in eine Tasche seines Gehrocks, den er heute trug, und beförderte seine Lesebrille zutage. Mit ihr ausgerüstet, langte er nach dem Brief. Dabei rutschte ein Schlüssel aus dem gefalteten Papier hervor – ein seltsames Exemplar mit mehreren Bärten.
»Da hätten wir den Tresorschlüssel. Fräulein Sophia war so nett, uns den zu präsentieren.«
Auf der Außenseite des Briefes stand in geschwungener Schrift:
Herrn Pfarrer Heimboldt persönlich
Der Adressat setzte sich auf den Stuhl am Sekretär, und nachdem er das Schriftstück überflogen hatte, befand er es für wichtig genug, dieses im Beisein einer Zeugin, der guten Agnes, laut zu verlesen.
Werter Herr Pfarrer.
Es tut mir so leid, dass ich Ursache all dieser schrecklichen Umstände gewesen bin. Ich weiß, dass all das nichts mit einer juristischen Schuld zu tun hat, dennoch fühle ich mich verantwortlich und werde die Konsequenzen ziehen. Ich verlasse die Stadt und die Gegend für immer, weil ich deren Bürgern, die auf meinen Vater gebaut haben, niemehr in die Augen sehen kann. Andererseits wäre es kaum zu vermeiden, dass mit Fingern anklagend auf mich gezeigt würde. Seht, sie hat ihren Vater auf dem Gewissen!
Mein Vater hat mir seinen Besitz testamentarisch vererbt. Ich kann und will dieses Erbe jedoch nicht beanspruchen. Deshalb verfüge ich als eine Art Testament meinerseits, welches sofort in Kraft treten soll, dass Haus und Fabrik verkauft werden. Wenn Sie die Freundlichkeit hätten, Herr Pfarrer, dies in die Wege zu leiten. Von dem Gelde soll zum einen für Agnes gesorgt werden, dass sie ein Heim und ein Aushalten hat. Von all dem übrigen Geld machen Sie selbst bitte Gebrauch, um es Bedürftigen zukommen zu lassen und anderweitig Gutes zu tun.
Mit den besten Wünschen für Ihrer beider Wohlergehen verbleibe ich
Sophia Haustein
P.S. Behalten Sie mich in guter Erinnerung.
Pfarrer Heimboldt legte den Brief behutsam auf die Arbeitsplatte zurück.
»Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Mädchen macht mich einfach zum Erben des gesamten Haustein-Vermögens. Und Sie, liebe Agnes, bekommen auch Ihren Teil davon ab.«
Die Angesprochene war noch ganz ergriffen von dem Gehörten. Sie schluckte ein-, zweimal schwer, bevor sie sprechen konnte.
»Sie hat das Beste getan, was man überhaupt mit so viel Geld bezwecken kann. Aber sagen Sie, Herr Pfarrer: Wieso kommt Fräulein Haustein auf diese Idee mit der Schuld? Sie waren doch dabei, wie Sie selbst erwähnten.«
Der Pfarrer schüttelte den Kopf.
»Nicht direkt. Ich saß im Nebenzimmer und kann nicht sagen, was da zwischen den beiden vorgefallen ist. Sie haben nicht laut gestritten, nur miteinander gesprochen. Und dann ist er zusammengebrochen. Tja, wir werden es wohl nie erfahren.«
Man sagt, eine junge Frau mit einem kleinen Wagen sei auf dem Weg nach Norden beobachtet worden. Keiner hat sie erkannt, niemand hat sie je wieder in dieser Gegend gesehen.
Sternbach
1
Schnee bedeckte den Boden – nicht viel, nur so hoch, dass die Sohlen der Schuhe darin einsanken. Schnee war in diesem Winter 2021/22 eine Rarität gewesen, und der Januar ging nun auch vorüber. Die Winter waren immer wärmer geworden, und inzwischen pfiffen sogar die Spatzen das Lied vom Klimawandel von den Dächern.
Etwa zwei Dutzend Menschen standen da, alle in dunkler Kleidung, so dass ein Schwarzweißfoto genau das Gleiche gezeigt hätte wie ein Schnappschuss in Farbe. Beinahe das Gleiche, wäre da nicht der ockergelbe Farbton des Holzes gewesen – Bretter, zusammengefügt, um einem Menschen die letzte Heimstatt zu geben.
»Wir nehmen Abschied von George Hill, einem lieben Menschen, Ehemann, Vater, Großvater. Wir trauern mit der Familie des teuren Verstorbenen. Möge er in Frieden ruhen.«
Mehr gab es nicht zu sagen. Sein Leben und seine Verdienste waren in der kleinen Kapelle vom Redner schon in aller Form gewürdigt worden. Hier, zwischen all den Gräbern derer, die vor ihm gegangen waren, erfüllte der Pfarrer nur seine Pflicht, den Körper des Verblichenen der Erde zu übergeben.
Langsam senkte sich der Sarg in die ausgehobene Grube, begleitet vom Blick der dunklen Menschenansammlung rings um die Grabstätte. Als die Seile entfernt waren, trat eine ältere Frau an den Rand des Grabes.
»Auf Wiedersehen, mein lieber Schorsch. Ein Leben ist kurz, und bald werde ich wieder bei dir sein.«
Sie ließ ein von Trauerflor zusammengehaltenes Gebinde weißer Rosen auf den Sarg fallen. Dann stand sie da, einfach so, in Erinnerungen versunken.
Eine andere Frau von etwa vierzig Jahren trat zu ihr, legte ihren Arm um die Schulter der Älteren.
»Mutter … du kannst auch zuhause an Vater denken. Komm jetzt, bitte!«
Bevor sie die Witwe wegführte, ließ auch sie ein kleines Gebinde zurück.
Ihr folgte ein Paar, Mitte dreißig, danach eine junge Frau.
»Opa, ich vermisse dich. Ich hatte doch noch so viele Fragen.«
Das schmächtige Mädchen mit dem kastanienbraunen Zopf seufzte tief, dann griff sie in die Schale mit den Streublümchen und warf ein paar von ihnen in die Tiefe.
»Sag, gibt es ein Leben nach dem Tod?«, fragte der Junge neben ihr. Er mochte zehn, elf Jahre alt sein, und man sah seinem Gesicht die Ähnlichkeit mit dem jungen Mädchen an.
Sie schaute ihn geistesabwesend an, dann zuckte sie mit den Schultern.
»Ich weiß es nicht, Ben.«
Mit ihrer Hand auf seiner Schulter, trat sie, den Jungen sacht vorwärts schiebend, zur Seite, um für die anderen Anwesenden Platz zu machen.
Am Hauptweg traf sich die Familie.
»Kommt, Kinder! Oma ist es kalt, wir wollen nach Hause gehen.«
Die Witwe warf einen letzten Blick in Richtung der Grabstätte, wo immer noch Freunde und Bekannte leise Abschied nahmen.
»Nun ist er wieder mit Vater und Sohn zusammen, mein Schorsch. Nicht wahr, Anna?«
Die Schwiegertochter folgte dem Blick der alten Dame.
»Ja, das sind sie.«
Ihre Stimme klang belegt, sie hatte Mühe zu sprechen.
Die alte Pflasterstraße zwängte sich zwischen ebenso betagten Häusern hindurch, die meisten waren zwischen hundert und zweihundert Jahren alt. Oftmals zweistöckige Ziegel-, teils auch Fachwerkbauten, mit kleinem Vorgärtchen, hatten sie schon vieles gesehen: Freude, Hoffnung, aber auch sehr viel Leid. Zwei Weltkriege hatten sie überstanden, einige sogar den Deutsch-Französischen Krieg von 1870 / 71. Und seit den Sechzigern verlief nur wenige Kilometer ostwärts der Todesstreifen zur DDR – fast dreißig Jahre lang.
Die Straße war frei von Schnee, Fahrzeuge hatten ihn zu Matsch gefahren und diesen auf den noch weißen Fahrbahnrand gespritzt. Sie verlief in einem leichten Bogen nach links, der sich weiter vorn in einer Kehre fortsetzte. Genau am Scheitel dieser Kurve gab es keine Häuser, dort führte hinter einer niedrigen Mauer ein sanfter Hang zu einer alten Villa.
Der Himmel war bleigrau und färbte die ganze Landschaft in eine düstere Stimmung. In dieses trostlose Bild mischte sich nun die Kirchturmglocke, welche die zwölfte Stunde anzeigte. Das tat sie seit mittlerweile dreihundertfünfzig Jahren, immer auf die gleiche monotone Weise. Damals, im Jahre 1672, läutete sie zur Einweihung der neuen Stadtkirche. Ihre armselige Vorgängerin war den Wirren des Dreißigjährigen Krieges nicht gewachsen, beschädigt worden und über die Zeit hinweg zerfallen.
Das dumpfe Dröhnen der Glocke im Rücken, marschierten auf dem Bürgersteig sechs dunkel gekleidete Menschen der Straßenkehre zu. Gerade waren sie an einer Kreuzung von der schmalen Querstraße eingebogen. Ein Laternenmast vor dem ersten Haus trug das Straßenschild ›An der Bleiche‹. Gegenüber, am Straßenrand der Querstraße, zeigte ein Hinweisschild den Weg zum Friedhof in jener Richtung, aus der die Sechs gekommen waren, an.
Mehr als zwei Personen konnten auf dem schmalen Weg nicht nebeneinander gehen, so hatten sich drei Grüppchen gebildet. Vorn liefen die beiden jüngsten, gefolgt von dem Pärchen, das vor ihnen Abschied genommen hatte. Den Schluss bildeten, mit ein wenig Abstand, die Witwe und ihre Schwiegertochter.
»Sophie, lauft bitte nicht so schnell! Oma kommt bei dem rutschigen Pflaster nicht so gut vorwärts.«
Der Junge drehte sich um.
»Ich möchte aber schnell ins Warme. Es ist so ungemütlich im Freien.«
Die Frau am Arm des großen, dunkelblonden Mannes lächelte den Kleinen an.
»Bist du wirklich so eine Memme, Ben? Was machst du, wenn mal zehn Grad unter Null sein sollten?«
Ben blinzelte sie an.
»Glaubst du noch daran, Tante Mandy?«
Mandy stupste den Blondschopf an.
»Hörst du das, Robbie? Die Jugend von heute.«
Der Große zeigte seine Zähne mit einem breiten Lächeln.
»Was hast du nur? Er gibt bloß die Fakten wieder, wie sie heute jeder hört. Und nach denen werden Winter, wie wir sie noch kennen, immer seltener werden.«
»Wie ihr sie noch kennt? Mein lieber Robert, als du noch im Schnee gespielt hast, waren die richtig knackigen Winter auch schon auf dem Rückzug«, ließ sich eine Stimme von hinten vernehmen.
Der Angesprochene drehte sich um.
»Ach ja! Und wie war das Silvester ’78? Als meine Mutter mit mir aus der Entbindungsklinik kam, ist das Land buchstäblich erfroren, liebste Schwiegermama.«
»Davon weißt du selbst doch gar nichts, das hast du nur gehört«, erwiderte die alte Dame schmollend.
»Genau, wie dein Enkelsohn – womit wir wieder am Anfang wären.« Robert grinste.
Die Schwiegermutter winkte müde ab.
Inzwischen hatten die Kinder das schmiedeeiserne Gartentor an der niedrigen Mauer erreicht. Ben drückte es auf, worauf die Tür mit lautem Quietschen antwortete.
»Oma Maria, hast du etwas Öl im Haus? Dann kann ich das Quietschen beseitigen.«
Die alte Dame nickte zum Tor hin.
»Seht ihr, das sind die naheliegenden Probleme.« Und zum Enkel gewandt: »Im Keller sollte eine Flasche stehen, in Opas Werkzeugschrank.«
»Ich mach’s dann gleich.«
»Und die Kälte?«, mischte sich jetzt auch die Mutter ein. »Gerade noch wolltest du ganz schnell nach Hause.«
Der Junge überlegte einen Augenblick mit vorgestülpten Lippen, dann lachte er die anderen an.
»Ich bin doch keine Memme!«
Es dunkelte bereits, doch die Familie saß immer noch beieinander. Sie hatte sich im ehemaligen Salon im Obergeschoss der Villa zusammengefunden, einen Raum, der jetzt nur selten genutzt wurde. Maria und Anna saßen in den bequemen Sesseln am Fenster, Mandy hatte neben Robert auf dem Sofa an der anderen Tischseite Platz genommen. Sie äußerte gerade ihre Bedenken.
»Mutter, wirst du es denn ohne Vater schaffen, deine Wohnung zu unterhalten? Das Haus ist groß, auch wenn ihr euch zu zweit hineinteilt.«
Ungläubig blickte Maria ihre Tochter an.
»So groß war der Anteil deines Vaters an der Hausarbeit nicht, dass ich den nicht noch mit übernehmen könnte. Wenn ich’s richtig überlege, hat er die meiste Zeit in seiner Bibliothek oder im Keller verbracht. Es wird sich also kaum etwas ändern.«
Robert erriet den Gedanken seiner Frau und ging noch einen Schritt weiter.
»Wir meinen, ob euch beiden Frauen die Arbeit auf Dauer nicht zu viel wird. Anna, du arbeitest im Rathaus – wochentags und oft auch am Wochenende. Mutter, du bist jetzt siebzig. Es ist kein Mann im Haus«, er warf einen Blick zu Ben, der sich neben seiner lesenden Schwester auf eines der Sofas gelümmelt hatte und mit seinem Smartphone spielte, »falls eine schwere Arbeit anfällt. Und wir können nicht immer da sein, wenn ihr Verstärkung braucht. Von Frankfurt hierher sind es über hundert Kilometer.«
Argwöhnisch schaute Anna erst zu ihrer Schwägerin, dann fixierte sie deren Mann.
»Auf was läuft deine Rede hinaus, Robert? Ich kann mir zwar schon einen Reim darauf machen, doch ich möchte es aus deinem Mund hören.«
Der Angesprochene räusperte sich, holte sich mit einem Seitenblick auf Mandy geistige Verstärkung und traute sich endlich, den entscheidenden Satz zu sagen.
»Wollt ihr euch nicht etwas Kleineres suchen?«
Für einige Sekunden wurde es still im Raum. Sophie unterbrach das Lesen und schaute von ihrem Buch auf, Ben ließ das Handy sinken und starrte auf seinen Onkel. Der Satz stand in der Luft und fror die Zeit für einen Augenblick ein.
Gerade setzte Anna zu einer Erwiderung an, da kam ihr Maria zuvor.
»Mich müsst ihr nicht fragen. Ich erledige, was ich kann, und wenn ich es einmal nicht mehr kann, ist der Tag nicht so fern, an dem ich mich zu meinem Schorsch lege. Die kurze Zeit, die mir dann noch bleibt, kann ich auch in einem Heim verbringen. Aber hier«, sie nickte zu ihrer Schwiegertochter hinüber. »Anna ist noch jung. Vielleicht findet sie irgendwann einen passenden Mann. Und unsere Sophie – es ist gut möglich, dass sie im Ort bleibt und eine eigene Wohnung haben muss. Was auch auf Benjamin zutreffen kann. Haltet euch an die drei und stellt nicht gutgemeinte Ratschläge in den Raum, ohne alles vorher zu bedenken!«
Robert wollte seinen Gedanken verteidigen, doch in diesem Moment spürte er Mandys Hand auf seinem rechten Arm und schwieg.
»Mutter hat recht«, nahm sie den Faden auf. »Das Haus ist seit Kriegsende das Heim der Familie Hill gewesen. Und da diese noch in mehreren Generationen existiert, besteht kein Grund, es wegzugeben. Es muss auch andere Möglichkeiten geben, alles in Schuss zu halten.«
Anna warf einen Blick zur Uhr auf dem Kaminsims.
»Es ist schon spät, und wir müssen keine Lösung aus dem Boden stampfen. Die Situation ist da, doch sie wird sich nicht innerhalb von Tagen rasant verschärfen.«
Sie erhob sich aus dem Sessel, ging zum Fenster und blickte auf das Städtchen hinab. Die Laternen hatten sich schon eingeschaltet und warfen da, wo sie noch auf Schnee trafen, einen hellen Schein. Ohne sich umzudrehen, fragte sie: »Soll ich euch das Gästezimmer fertigmachen?«
»Nein, das ist nicht nötig. Robert und ich, wir müssen morgen beide arbeiten. Wir fahren heute noch zurück.«
Mandy stand auf und begab sich ebenfalls zum Fenster.
»Schön ist es hier. Man steht so … so über den Dingen. Nein«, sie blickte über die Schulter zu ihrem Gatten, »ihr solltet euch dieses Heim wirklich bewahren. So etwas Schönes findet man nicht so leicht wieder.«
Sophie konnte nicht einschlafen. Zu viele Gedanken schwirrten in ihrem Kopf herum, sorgten für Unruhe, beinahe Unwohlsein. Seit ihrer Geburt lebte sie in diesem Haus, ihre Eltern wohnten hier, die Großeltern und Urgroßeltern. Und vorher? Woher kamen ihre Vorfahren, und wem gehörte die Villa vor dem Krieg? Wer waren diese Menschen, in welchem Verhältnis standen sie zu dieser Stadt?
Langsam erhob sich das Mädchen. Es machte wenig Sinn, Schlaf zu suchen, wenn der Geist wach war. Sie wollte, nein, sie musste mehr über ihre Familie erfahren. Nichts fühlte sich in ihrer Vorstellung bedrückender an, als ein einsames Staubkorn im Strudel der Geschichte zu sein, nicht zu wissen, auf welchem Platz man bei allem, was um einen herum geschah, selbst stand.
Die Sechzehnjährige setzte sich vor den Spiegel auf dem kleinen Schminktischchen. Gedankenverloren drückte sie auf den Schalter, der die Lämpchen im Spiegelrahmen aufflammen ließ. Rehbraune Augen in einem von kastanienbraunem Haar umrandeten Gesicht blickten sie fragend an. Sophie Hill, Tochter von Anna und Thomas Hill – wer bist du eigentlich?
›Also‹, dachte sie vor sich hin, ›ich bin Sophie Hill, geboren am 15. April 2005. Ich hab einen Bruder, Benjamin Hill, geboren am 11. September 2011. Meine Mutter heißt Anna, geborene Peters, Jahrgang 1979. Mein Vater war Thomas Hill, Jahrgang 1973, durch einen tragischen Unfall 2012 ums Leben gekommen …‹
Die Gedanken blieben stecken. Vater … Sie konnte sich nur an weniges von ihm erinnern. Groß war er gewesen, wie die Hills vor ihm. Und sanfte graue Augen hatte er gehabt. Ja, und Fernfahrer war er gewesen, immer auf Tour, durch ganz Deutschland. So auch an jenem Novembertag. Er hatte eine dringende Lieferung nach Hamburg zu bringen – immer die A 7 entlang. Und dann war da diese Baustelle. Er hatte gebremst, doch sein Hintermann war abgelenkt oder was auch immer. Jedenfalls war er voll in Papas Lkw geknallt, der von der Fahrbahn gestoßen wurde und sich überschlug. Ihr Vater hatte den nächsten Tag nicht überlebt.
Sophies Augen wurden feucht. Sie hatte ihren Papa danach so oft vermisst, auch viele Jahre später. Immer wenn andere Kinder erzählten, was sie mit ihren Vätern Tolles unternommen hatten, konnte sie nicht mitreden. Ein Teil ihres Herzens war an jenem Novembertag zusammen mit ihrem Vater gestorben.
Ein verweintes Gesicht schaute das Mädchen aus dem Spiegel an. War sie wirklich so einsam, wie sie sich in diesem Augenblick fühlte? So unbedeutend, klein, so … hilflos?
Sie riss eines der Tücher aus der Spenderbox neben dem Spiegel und trocknete die Tränen weg. Dann löschte sie das Licht – nicht, um schlafen zu gehen, sondern, um sich zum Schreibtisch zu begeben.
Im Schein der kleinen Nachtlampe am Bett zog Sophie das unterste Schubfach auf. Im Kasten befanden sich neue Schreibutensilien, falls ihr mal etwas ausging. Sie wählte ein A4-Ringbuch mit karierten Seiten aus, klappte den Rückdeckel herum und legte es mit der aufgeschlagenen letzten Seite auf die Arbeitsplatte.
»Ich muss das alles aufschreiben«, sagte sie leise vor sich hin.
Bevor sich das Mädchen hinsetzte, griff sie nach dem über die Stuhllehne geworfenen Morgenmantel und schlüpfte in das flauschige Kleidungsstück. Ein Griff zur Schreibtischlampe, dann ließ sie sich auf den gepolsterten Bürosessel nieder.
Hell warf das bis auf die blassen Karos weiße Papier den Schein der Leuchte zurück, wartete die leere Seite darauf, mit mehr oder weniger sinnvollen Zeichen beschrieben zu werden. Sophie nahm sich einen roten Fineliner aus der Stiftbox, überlegte einen Moment und begann oben, genau in der Mitte. Sekunden später stand da in schönen Druckbuchstaben:
Sophie Hill
* 2005
›Das ist also die Gegenwart, heute. Das bin ich, der jüngste Spross der Hills.‹
Sie zögerte einen Augenblick. Der Gedanke war falsch. Sophie legte den roten Stift weg, holte sich dafür einen blauen und ergänzte rechts daneben:
Benjamin Hill
* 2011
Okay – Mädchen rot, Jungen blau. Geschwister nebeneinander, Generationen untereinander. Und abwärts immer weiter in die Vergangenheit.
Nach und nach füllte sich das Blatt mit den Namen und Daten der Eltern Thomas Hill und Anna Peters, mit den Großeltern George Hill und Maria Hartmann, den Urgroßeltern William Hill und Sophie …
Wie hieß Uroma Sophie, nach der sie ihren Vornamen erhalten hatte, eigentlich mit dem Mädchennamen? Sophie II. fiel es nicht ein.
›Muss ich halt Mama oder Oma danach fragen. Aber Papas Schwester Mandy und ihren Mann Robert Kreutzer kann ich noch eintragen, und Mamas Schwester Emma.‹
Sophie starrte auf die Seite. Das ergab gerade mal vier Generationen, und Uropa Bill war der erste, der in die Villa eingezogen war – damals, in den letzten Kriegstagen.
Plötzlich überkam sie die Müdigkeit, breitete sich im ganzen Körper aus, machte Arme und Beine schwer. Und schließlich sank der Kopf des Mädchens auf das Heft herunter und sie selbst in tiefen Schlaf.
2
Sophie, aufstehen! Die Schule wartet nicht.«
Nachdem sich das Mädchen nicht gerührt hatte, begab sich Anna zum Zimmer ihrer Tochter. Sie klopfte laut an die Tür und öffnete sie, als sich immer noch nichts regte.
Sophie lag bäuchlings auf dem Bett, immer noch im Morgenmantel. Langsam drehte sie den Kopf zur Tür.
»Was ist?«
Die Mutter machte die paar Schritte zum Bett und rüttelte die Verschlafene an der Schulter.
»Was ist?!«, wiederholte sie ungehalten. »Das möchte ich gern von dir wissen. Aber bitte erst am Nachmittag, denn du musst jetzt schleunigst in die Gänge kommen. Also hoch mit dir, du Schlafmütze!«
Mühsam richtete sich Sophie auf. Wie gern würde sie jetzt noch zwei Stunden weiterschlafen. Doch sie wusste, dass ihre Mutter in dieser Beziehung unerbittlich war und sie notfalls selbst auf die Beine stellen würde.
Als sie schließlich stand und müde in den neuen Tag blinzelte, wandte sich Anna zum Gehen. In der Tür drehte sie sich aber nochmals um.
»Leg ein wenig Tempo zu, du Nachtschwärmer! Abends nicht schlafen und morgens nicht raus – was soll bloß aus dir werden?«
Das Mädchen neigte den Kopf schräg und grinste die Fragende an: »Nachtwächterin.«
Die Mutter zeigte lachend eine Faust, dann schloss sie die Tür.
Der Unterricht begann halb acht Uhr, jetzt war es zehn Minuten vor halb. Sophie schnappte sich das Fahrrad, obwohl der Weg nicht so weit war. Das Gymnasium lag nur ein paar Straßen hinter der Kirche. Unterwegs traf sie Jonas, der auch spät dran war.
»Moin, Sophie. Wie kommt es denn …«
In diesem Moment, als das Mädchen sich zu ihm umwandte, stockte er mitten im Satz.
»Was?«, fragte sie lauernd.
»Oh Mann, hast du heute vergessen, dein Gesicht zu bügeln? Du hast ja noch die Abdrücke vom Bettzeug drin.«
»Ja, hat mir meine Mutter schon vorgebetet. Leg lieber mal den nächsten Gang ein!«
Sophie war Jonas wegen dessen Ausdrucksweise nicht böse. Im Gegenteil, beide waren sehr gut miteinander befreundet, und jeder wusste, dass es nur Neckerei vom anderen war, wenn solche Wörter fielen. Jonas sah gut aus, schlank und dunkelhaarig. Sein Vater war der Bürgermeister von Sternbach, und so kannten sich die Elternteile schon von Berufs wegen aus dem Rathaus.
Die beiden waren an der Schule angelangt, hatten die Räder abgestellt und stürmten in den zweiten Stock des Gebäudes. Gerade als es zur Stunde läutete, riss Jonas die Klassenzimmertür auf.
»Auf den allerletzten Drücker«, hörten sie eine Stimme hinter sich.
Frau Hildebrandt, die Klassenlehrerin, folgte ihnen auf dem Fuß.
Antonia Hildebrandt war die Klassenlehrerin der G7. Sie unterrichtete ihrer Ausbildung gemäß Geschichte und Latein, half aber auch mal in Deutsch oder Französisch aus. Mit ihren neunundzwanzig Jahren gehörte sie zu den beliebten Lehrern, die sich mit ihren Schülern schon aufgrund des geringeren Altersunterschieds bestens verstand. Ältere Kollegen hielten ihr manchmal vor, dass man sich mit Freundschaft seine Autorität verscherzte, doch glaubte die junge Frau fest daran, dass sich beides unter einen Hut bringen ließe.
Frau Hildebrandts G7 umfasste neunzehn Schüler, eine übliche Größe in ländlichen Gegenden. Nicht alle kamen aus Sternbach, auch einige der umliegenden Ortschaften gehörten zum Einzugsbereich. Mit Kleinbussen wurden zwei Linien aufrecht erhalten, die alle Auswärtigen der Primar-, Sekundar- und Gymnasialklassen beförderten.
Sophie interessierte sich schon seit der Sekundarstufe für Geschichte, sie bewunderte den Einfallsreichtum und die Tatkraft jener Menschen, die zu allen Zeiten der treibende Keil in der Entwicklung der Gesellschaft waren. Ob die großartigen Baumeister der Antike, die Entdeckungsreisenden des Mittelalters oder die hervorragenden Erfinder der Neuzeit – sie alle genossen Sophies uneingeschränkten Respekt. Manchmal hatte sie sich in den Unterrichtsstunden gewünscht, sie hätte bei dem einen oder anderen Meilenstein des Fortschritts dabei sein dürfen.
Der Lehrerin war das besondere Interesse des Mädchens aufgefallen, und so hatte sie Sophie eines Tages zur Seite genommen und nach ihren beruflichen Vorstellungen gefragt. Das war vor etwa drei Jahren gewesen, und die gerade Vierzehnjährige hatte mit großen Augen zugehört, welche Möglichkeiten sich solcherart Interessierten boten.
Auf diese Weise hatte die damals erst neue Lehrkraft einen Funken in dem Mädchen geschürt, das nun anscheinend Feuer gefangen hatte. Sophie war wild entschlossenetwas über die Geschichte des Ortes und speziell ihrer Familie herauszubekommen.
In der Villa hing an diesem Dienstagvormittag Maria ihren Gedanken nach. Alle waren aus dem Haus, Anna arbeitete im Standesamt, die Kinder besuchten die Schule. Und in diesem Moment, da sie die einzige menschliche Person in dem herrschaftlichen Anwesen war, kam sie sich wirklich sehr klein und sehr einsam vor.
Vertieft in ihren Erinnerungen, durchstreifte sie das Haus. Die ehemals prächtige Gründerzeitvilla hatte im Laufe der Jahrzehnte kräftig Federn lassen müssen. Der Stuck an den Decken war ergraut, das Parkett abgelaufen. Von den Fensterrahmen bröckelte die Farbe ab. Durch den nachträglichen Einbau einer Heizung sowie notwendiger Elektroinstallationen waren überall die Spuren der Bauarbeiten zu sehen, teils überpinselt, teils nur verputzt.
»Ich bin alt, das Haus ist alt. Beide zeigen wir das sehr offensichtlich, und es macht wenig Sinn, die Augen davor zu verschließen. Bloß ist dir, mein altes Häuschen, mit ein paar fähigen Handwerkern recht schnell zu helfen. Ich hingegen muss schauen, wie lange mir mein Körper auf dieser Welt noch gute Dienste leisten wird.«
Maria bewohnte das Untergeschoss der Villa. Links des Foyers gab es zwei Räume, die als Wohn- und Schlafzimmer eingerichtet waren. Außerdem befand sich da noch eine kleine Abstellkammer. Auf der rechten Seite befanden sich Küche und Bad sowie ein großes Gästezimmer. Zwischen dem doppelten Treppenaufgang schließlich hatte George seine private Bibliothek eingerichtet, ein nicht besonders großer, holzgetäfelter Raum mit Regalen an den Wänden, einem Schreibtisch und einer kleinen Sitzecke.
Im Obergeschoss wohnte Anna mit den Kindern. Es war ähnlich eingerichtet, nur befand sich direkt über dem Foyer der ehemalige Salon und anstelle von Küche und Gästezimmer gab es die beiden Kinderzimmer.
Der Clou allerdings war der Treppenaufgang. Nachdem sich die Stufen, auf halber Höhe von einem Absatz unterbrochen, kreuzten, erreichten sie das obere Stockwerk genau über ihrem Beginn parterre. Über der Bibliothek zog sich dagegen ein von verglasten Rundbögen umgebenes Rondell hin, in dessen Zentrum eine von Säulen umgebene Wendeltreppe aufs Dach führte. Die Dachterrasse wiederum trug in der Mitte einen kleinen runden Turmaufbau, der sich über eine außen herum führende weitere Wendeltreppe besteigen ließ. Und hatte man es bis ganz nach oben geschafft, erwartete einem ein liebevoll gestaltetes Sitzensemble aus kunstvoll geformtem Schmiedeeisen. Dort, in der Höhe, lag einem die Welt zu Füßen, man war von herrlichen Blumenbänken umgeben und aller Sorgen der Erde ledig.
Maria war nach oben gestiegen und wandelte im Rondell. Sie erinnerte sich an Gesellschaften, bei denen dieser Raum zum Aufenthalt ausgeschmückt worden war. Im Bereich der Säulen war das Büffet auf weiß eingedeckten Tischen aufgebaut gewesen, die geöffnete große Doppeltür des Salons vergrößerte den Bereich zusätzlich. Musik von Piano und Violine sorgte für Unterhaltung. Damals war sie noch ein Kind gewesen, das musste um 1960 gewesen sein.
Die Witwe hatte eine Strickjacke angezogen und einen Schal mitgenommen. Sie hatte etwas vor, was sie schon lange nicht mehr getan hatte – sie wollte hinauf auf den Turm. Zielstrebig erklomm sie die Wendeltreppe zur Dachterrasse. Im Sommer hielt sich die Familie oft dort auf, genoss schöne Tage unter freiem Himmel. Doch jetzt, im Winter, blies häufig ein kalter Wind über die Freifläche. Manchmal fiel die Polarluft aus Norden auch einfach den Hügel herab und ließ die Natur frieren. Dann war es ganz still, und in der Morgensonne glitzerte der reifbedeckte Garten.
Zum Glück gab es heute weder Eiswind noch Polarluft, dennoch lag die Temperatur um den Nullpunkt. Maria wickelte den Schal fest um den Hals und zog ihn übers Kinn nach oben. Sie schaute zum Turm empor, der sich altehrwürdig und grau über die Terrasse erhob. Er war gerade so hoch, dass er das Dach des Haupthauses um vielleicht zwei Meter überragte.
Noch einmal atmete die alte Dame tief durch, ehe sie die Hand aufs Geländer legte. Sofort wurde sie sich einer Unterlassung bewusst – sie hätte auch an Handschuhe denken sollen. Das eiserne Gitter war frostig kalt.
»Egal, es wird schon gehen.«
Sie sagte diesen Satz laut vor sich hin, entweder, um sich selbst Mut zu machen oder als Kampfansage an den Winter. Stufe für Stufe kämpfte sich die Siebzigjährige in die Höhe, dabei immer die Erinnerung vor Augen, wie sie früher mit ihrem Schorsch häufig da oben gesessen und Kaffee getrunken hatte. Alles, was sie brauchten, hatten sie in einem Korb mitgenommen, und dann waren sie manchmal bis zum Sonnenuntergang nicht wieder heruntergekommen. Sie waren jung und verliebt und an diesem Platz ganz unter sich.
Endlich hatte sie die letzte Stufe erreicht, zog sich mit klammer Hand am Geländer nach oben. Vom Aufstieg außer Atem, sah sie sich um. Der Anblick war enttäuschend. Die Sitzgarnitur war rostig, die fehlenden Blumen ließen die alte, verwitterte Mauerkrone überdeutlich hervortreten. Weder Sonne noch blauer Himmel machten das Bild freundlicher – graue Wolken, in denen Schnee lag, sorgten für eine triste Stimmung.
War das der gleiche Ort, den sie eben noch vor Augen hatte? Langsam umrundete sie den Tisch. Da, auf dem Stuhl, der direkt zum Dach zeigte, hatte er immer gesessen. Er hatte es geliebt, wenn die Sonne sein Gesicht wärmte. Und sie saß ihm gegenüber, den Blick auf den Garten und den grünen Hügel, der sich anschloss, gewandt. Sie hatte den Arm auf dem Tisch liegen, er legte seine Hand auf ihre, umfasste ihre Finger – einfach so, nichts weiter. Und sie hatten sich dabei angeschaut, waren mit sich und der Welt zufrieden.
Maria wurde jäh aus ihren Träumen gerissen. Sie fror, die Kälte kroch in den ganzen Körper. Sie musste jetzt schleunigst ins Warme. Eilig stieg sie die Stufen hinab, hielt sich nur flüchtig am Geländer fest. Und dann … Gerade setzte sie den linken Fuß auf die Terrasse, da rutschte sie weg und knickte um. Sie konnte einen Fall eben noch vermeiden, doch als sie weitergehen wollte, spürte sie einen stechenden Schmerz im Gelenk.
»Das hat mir gerade noch gefehlt«, schalt sie sich selbst. Ihre Eile hatte sie unvorsichtig werden, ein wenig Eis am Fuße der Treppe sie ihren Ausflug teuer zu stehen kommen lassen.
Mühsam hinkte sie zur Tür, die den Aufgang vom Obergeschoss verschloss. Jeder Schritt verursachte heftige Schmerzen, doch auf einem Bein zu hüpfen, war in ihrem Alter keine Option.
Irgendwie schaffte Maria es schließlich, wieder ganz nach unten zu gelangen. Noch einmal biss sie die Zähne zusammen, um die Küche zu erreichen. Über einer Stuhllehne hing ein Geschirrtuch, welches sie unter dem kalten Wasserstrahl der Spüle anfeuchtete. Dann setzte sie sich hin, legte das verletzte Bein hoch und wickelte das nasse Tuch um den schmerzenden Knöchel.
»Maria, Maria! Was werden die anderen sagen?«
»Na, Anna – schickst du heute niemanden in den Ehestand?«
Lars Ritter, amtierender Bürgermeister von Sternbach, hielt die Schwenktür am Ende des Korridors auf, um der mit Akten bepackten Standesbeamtin das Weitergehen zu erleichtern.
»Nein, heute gibt’s nur Büroarbeit. Aber in drei Wochen, da ist was los. Ich hab vier Anmeldungen für den 22. Februar. Bloß weil es so eine schöne symmetrische Zahl aus Zweien und Nullen ist.«
»Glauben die Paare wirklich, dass ihnen so ein spezieller Tag Glück bringt?« Der Bürgermeister runzelte die Stirn unter dem dunklen Lockenkopf.
Anna winkte ab: »Glück sollte es immer bringen, wenn man sich zu mir traut. Da sollte das Datum keine Rolle spielen. Ich denke, es ist eher die Bequemlichkeit des Nicht-Vergessens.«
Sie wollte schon zur Treppe gehen, da drehte sie sich noch einmal um.
»Wie ist es denn bei dir, Lars? Welches Datum war’s da?«
Der Gefragte blickte verschämt zur Treppe.
»8. März.«
»Ach, schau an! Hochzeitstag und Frauentag in einem Aufwasch. Wie bequem.«
Lachend stieg Anna die breiten Steinstufen hinab.
»Paula, gibst du mir deine Aufzeichnungen von gestern! Ich muss den Stoff nacharbeiten.«
Das angesprochene Mädchen, ein blonder Strubbelkopf, griff in ihre Tasche.
»Da, bitte! Mathe, Deutsch, Bio und Physik. Es war eh nicht viel los, meist Wiederholung.«
Während sie Sophie die Schnellhefter reichte, sagte Paula zaghaft: »Das mit deinem Opa tut mir leid.«
Eine kleine Pause entstand, in der Sophie das Material in ihrer Tasche verstaute. Sie nahm einen Apfel heraus, bot ihn der Klassenkameradin an, die jedoch dankend ablehnte.
»Es ging so schnell. Weißt du, Paula, dass einem manchmal die Zeit einfach davonrennt?«
Die Freundin blickte sie fragend an.
»Wie ›davonrennt‹? Du hast doch hoffentlich noch jede Menge davon.«
»Nein, ich meine die Zeit, von den Alten zu lernen. Ich wollte Großvater noch so vieles fragen, wie es früher hier gewesen ist. Und ich wollte etwas von seinem Vater erfahren, der hier Ortskommandant war.«
Paula nickte besonnen.
»Ich verstehe. Aber da gibt es doch noch andere, die die Zeit erlebt haben. Und alte Aufzeichnungen sind vielleicht auch noch vorhanden, in Archiven.«
»Sicher, die Fakten könnte ich aus verschiedenen Quellen erfahren. Aber in so einer persönlichen Erzählung, da schwingen auch Gefühle mit. War alles richtig, was man getan hat? Waren die Menschen mit dem Erreichten zufrieden? Über was haben sie sich geärgert? Das alles erfährst du nur sehr unzureichend aus Archiven.«
Die Mitschülerin hatte Sophies Fragen angehört und ein nachdenkliches Gesicht aufgelegt.
»Das stimmt. Auf dem Papier steht: ›Ein Laib Brot hat soundsoviel gekostet.‹ Ob es den Leuten damals schwer gefallen ist, ihn zu kaufen, und ob das Brot gut gewesen ist – das erfährt man nur von ihnen selbst.«
Sophie nickte zustimmend. Leise raunte sie Paula zu: »Und da ist noch etwas. Ich möchte wissen, wo ich herkomme. Wer ich bin, verstehst du?«
»Nicht wirklich. Du sprichst heute in Rätseln.«
»Das ist doch ganz einfach. Mein Uropa war Amerikaner, hat hier geheiratet. Also hab ich auch Wurzeln auf der anderen Seite des Ozeans. Und selbst hier im Lande – durch den Krieg haben so viele Menschen ihre Heimat verlassen, sind unter Umständen durch halb Europa gezogen. Ich will das wissen. Sternbach ist meine Heimat, doch was gehört zu meinem kulturellen und gesellschaftlichen Erbe?«
Paula zeigte sich beeindruckt.
»Wow! Das klingt wie eine richtige Historikerin. Du, das ist wirklich eine gute Idee, nach seinen eigenen Wurzeln zu forschen. Vielleicht kann ich dir dabei helfen.«
»Danke. Ich werd auch nochmal mit Toni reden. Die hat als Geschichtslehrerin sicher ein paar gute Tipps, wie man an so etwas herangeht.«
Sophie stellte ihre Schultasche am Treppenaufgang im Foyer ab und schaute in Marias Wohnzimmer nach – der Ort, wo sie ihre Großmutter am ehesten vermutete.
»Oma, bist du hier?«
Nichts. Das Zimmer war leer.
Sophie lief einmal längs durch die Villa in Richtung Küche.
»Oma …«
Maria saß auf einem Stuhl, den Kopf vornüber, die Augen geschlossen.
»Oma! Ist was mit dir?«
Sophie spürte Angst in sich aufsteigen. Zu deutlich waren noch die Umstände von Großvaters Tod in ihrem Gedächtnis. Maria hatte ihren Mann vor reichlich einer Woche in der Bibliothek gefunden, im Sessel.
Das Mädchen lief zum Tisch, um zu helfen. Da schlug ihre Oma die Augen auf und gähnte herzlich.
»Sophie, mein Schatz – ist die Schule schon aus?« Sie schaute zur Uhr über der Tür, konnte jedoch nichts erkennen. Umständlich nahm sie die Brille ab und rieb sich die Augen.
»Ich muss wohl etwas eingenickt sein.«
Ein erneuter Blick zur Uhr gab ihr Gewissheit. Es war fast halb zwei; als sie sich hingesetzt hatte, war es noch nicht mal zwölf Uhr gewesen.
»Ach je, so spät …«
Sophie hatte das hochgelegte Bein gesehen und unterbrach sie.
»Oma, was ist hier passiert?«
Sie nahm das feuchte Tuch weg und schaute auf den Knöchel, der sich etwas verfärbt hatte. »Das sieht irgendwie kaputt aus.«
Maria winkte ab: »Ach wo. Ich bin ein wenig umgeknickt, das ist nur verstaucht. Mach mir doch bitte noch einen kalten Umschlag, dann gibt sich das schnell wieder!«
Die Enkelin ließ das Wasser eine Weile über das Geschirrtuch laufen, drückte es ein wenig aus und wickelte das Gelenk wieder ein.
»Vielleicht sollte sich das Dr. Zimmermann trotzdem mal anschauen. Du weißt schon, dass deine Knochen nicht mehr so elastisch wie früher sind.«
»Jetzt kühlen wir erst einmal, und dann sehen wir, wie ich mich bewegen kann.«
Sophie wusste, dass sie gegen den Willen ihrer Oma nichts ausrichten konnte.
»Willst du nicht wenigstens ins Wohnzimmer, in deinen bequemen Sessel? Da kannst du auch etwas im Fernsehen anschauen, wenn du möchtest.«
Die alte Frau deutete auf den eingewickelten Fuß.
»Wenn du mir ein wenig dabei hilfst.«
Nachdem Sophie ihre Oma auf dem Weg ins Wohnzimmer unterstützt und ihr den Sessel und einen Hocker mit Kissen zurecht gerückt hatte, war sie selbst erst einmal in ihr Zimmer gegangen. Sie holte ihr Smartphone hervor und rief die Mutter an.
»Ja, mein Schatz, was gibt es?«
»Hallo Mama.« Das Mädchen sprach hastig, sie war immer noch etwas aufgeregt. »Oma hat sich den Fuß verstaucht. Als ich nach Hause kam, saß sie in der Küche, mit einem nassen Tuch über dem Knöchel. Ich hab sie ins Wohnzimmer gebracht und den Fuß weich gelagert.«
Annas Überraschung war selbst am Telefon zu spüren.
»Ach, du Schreck! Geht es ihr gut? Hat sie große Schmerzen? Hast du Dr. Zimmermann angerufen?«
Die Fragen nahmen kein Ende.
»Auftreten kann sie mit dem Fuß nicht richtig, aber ich kann nicht sagen, ob es sehr weh tut. Oma wiegelt da immer ab, auch was Dr. Zimmermann betrifft. Sie will es erst einmal mit den Hausmitteln probieren. Das musst du dir schon selbst anschauen und sie dann überzeugen.«
Sophie hörte ihre Mutter seufzen.
»Na gut. Ich komme hier frühestens gegen drei Uhr weg. Hat Oma was zu trinken und zu essen? Nicht dass sie wieder aufsteht.«
»Ja, ich hab ihr erst einmal Gebäck und Mineralwasser hingestellt. Ich kann ihr auch Kaffee und Brote machen, hab ja keine Ahnung, was sie heute schon zu sich genommen hat.«
»Das wäre lieb, sei so nett! Bis später.«
Als Sophie das Smartphone auf den Schreibtisch legte, fiel ihr Blick auf das aufgeschlagene Ringbuch. Die Namen und Daten …
Mitten in der Nacht war sie aufgewacht, hatte sich zum Bett getastet und darauf fallen lassen. Mehr wusste sie nicht vom letzten Abend.
Sie musste unbedingt mit Oma über die Vergangenheit sprechen.
3
Nach einigem Zureden ihrer Schwiegertochter hatte sich Maria doch umstimmen lassen. Dr. Zimmermann konnte zu aller Erleichterung bestätigen, dass es sich nur um eine Verstauchung handelte. Er empfahl der Seniorin, den Fuß mindestens bis zum Wochenende zu schonen und eine Stützbandage zu tragen.
Sophie nutzte die Zeit, um ihre Recherchen bei der Großmutter zu beginnen. Vorn im Heft reservierte sie jeder Person genügend Platz für die herausgefundenen Fakten. Was sie selbst wusste, trug sie ein, was sie erfragen wollte, hielt sie in Stichworten fest. Am späten Nachmittag startete sie ihre Offensive.
»Oma, hast du etwas Zeit für mich?«
Maria deutete auf den bandagierten Fuß.
»Wenn ich von allem so viel wie augenblicklich Zeit hätte, wäre es kaum auszuhalten. Um was geht es denn, mein Schatz?«
Das Mädchen zeigte ihr die Namensliste.
»Ich möchte gern mehr über die Familie Hill wissen. Woher kommen meine Vorfahren, wer waren sie? Du weißt schon, so was Ähnliches wie eine Familienchronik.«
Interessiert schaute die alte Dame auf das Papier.
»Da hast du dir eine ganze Menge vorgenommen. So einen Stammbaum zu verfolgen, ist keine einfache Sache. Und du musst dir darüber im Klaren sein, dass die Informationen umso spärlicher werden, je weiter du in die Vergangenheit vordringst. Außer, du findest heraus, dass in unserer Ahnenlinie eine richtige Berühmtheit vorkommt.«
»Vielleicht kannst du mir etwas über Opa und Uropa erzählen.«
»Dann setz dich mal hin und schreibe mit!«
Sophie machte es sich auf dem Sofa bequem, legte sich das Ringbuch auf den Schoß und lauschte den Ausführungen der Großmutter.
»Die Familie Hill stammt ursprünglich aus Nebraska, also aus dem mittleren Bereich der Vereinigten Staaten. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts gehörten sie zu den Siedlertrecks, die das Land, von Osten kommend, erschlossen. Sie überschritten den Missouri und ließen sich auf dem Land westlich des Stroms nieder.
Die Hills waren Farmer, ernährten sich also vom Ackerbau. Als dann jedoch die Stadt Omaha heranwuchs und an Bedeutung gewann, siedelte einer von ihnen dahin über – in der Hoffnung, die industrielle Entwicklung würde auch für ihn den Wohlstand bringen. Nun, dem war wohl nicht so, und so sehen wir einen Hill um 1870 als Eisenbahner an der neu eröffneten transkontinentalen Linie, die von Omaha nach Kalifornien führte. Das war der Urgroßvater deines Urgroßvaters, Matthew Hill. Sein Sohn, Jonathan Hill, kam 1876 zur Welt, im hundertsten Jahr des Bestehens der Vereinigten Staaten. Wegen des Patriotismus seines Vaters hieß er mit zweitem Vornamen Washington.
Auch Jonathan war Eisenbahner, er befuhr als Schaffner die Strecke nach New York City. Dort lernte er seine spätere Frau Margaret Stewart kennen, die er 1898 heiratete. Sie blieben in New York, und ein Jahr später erblickte Walter Hill das Licht der Welt.
Walter erlernte den Beruf eines Schlossers und wechselte nach Springfield in Massachusetts, wo seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts die amerikanische Motorradproduktion aufblühte. Dort traf er auf Betty Thompson, die in der Waffenfabrik Springfield Armory arbeitete. Die beiden wurden bald ein Paar und heirateten. So wurde 1922 William Hill geboren, dein Uropa.«
Sophie hatte mit größtem Interesse zugehört und alles Wesentliche notiert. Und da Maria eine Pause einlegte, um einen Schluck zu trinken, packte sie Heft und Stift zur Seite und vollführte ein paar Lockerungsübungen für die Finger.
»Das ist so eine tolle Geschichte! Meine Vorfahren sind an so vielen Orten in Amerika gewesen. Das haben dir alles Opa und Uropa erzählt?«
»Nicht nur erzählt. In der Bibliothek muss es irgendwo auch Aufzeichnungen dazu geben. Leider war dein Opa der Einzige, der mit Bestimmtheit sagen konnte, wo sie da zu finden sind.«
Das Mädchen fieberte richtig vor Wissbegier.
»Ich möchte sie gern suchen. Das ist alles so aufregend. Und bis heute hab ich überhaupt nichts von diesem Teil unserer Geschichte gewusst. Darf ich, Oma?«
Über den Wissensdurst ihrer Enkelin freute sich die Großmutter natürlich. Wer wäre nicht stolz, wenn dem Nachwuchs die Familie so viel bedeutet.
»Sicher darfst du suchen. Ich komme eh kaum in Opas Zimmer. Vielleicht kann ich dich dann später fragen, wenn ich mal eines von seinen Büchern lesen möchte.«
Maria hatte ihrer Enkelin versprochen, am Abend mit dem zweiten Teil des Berichts fortzufahren, und Sophie war hochzufrieden gleich in die Bibliothek geeilt. Sie hatte die Andeutung ihrer Oma so verstanden, dass ihr jetzt die Verwaltung des literarischen Bestandes der Familie Hill übertragen worden war.
Da der Raum nur ein kleines Fenster in der rückwärtigen Wand hatte, befanden sich an beiden Seitenwänden Regale, jeweils etwa fünf Meter. Nur vorn links fehlte eines, dort stand ein kleiner Tisch mit zwei bequemen Stühlen. Vor dem Fenster jedoch breitete sich ein bulliger Schreibtisch mit einem hohen Sessel aus. Das war Opas Arbeitsplatz gewesen.
Das Mädchen ließ sich in den Sessel fallen, roch die leicht angestaubte Luft der alten Bücher. Ja, das war der Duft des Wissens. Eine Minute saß sie so da, in die weichen Polster gelehnt, den Blick über die vollen Regale schweifen lassend. Da befanden sich nicht nur Bücher – alte, sicher wertvolle und auch neuere – sondern auch Ordner und Schuber voller Zeitschriften. Sie sollte herausfinden, welchem Gebiet sich der Großvater besonders gewidmet hatte, um das alles zu verstehen.
Sophie setzte sich aufrecht und zog die rechte obere Schublade des Schreibtisches auf. Meist fanden sich in den oberen Fächern grundsätzliche Dinge, zum Beispiel Schlüssel für zugesperrte Kästen oder Zettel mit Informationen zu wichtigen Quellen.
Das Schubfach ging nicht auf. Es bewegte sich einen Millimeter, dann hemmte etwas das weitere Öffnen.
›Das Fach klemmt nicht, es ist eindeutig blockiert‹, kombinierte das Mädchen. ›Stellt sich die Frage, ob da nur etwas falsch drin liegt, oder ob es einen Verschluss gibt. Ein Schlüsselloch ist nicht zu sehen, also muss es ein versteckter Knopf oder Hebel sein.‹
Als nächstes probierte sie die linke obere Schublade, die sich ohne großen Widerstand öffnen ließ. In ihr befanden sich Schreibzeug, Büroklammern, ein Brieföffner, Ausweise und Mitgliedskarten sowie jede Menge Kleinkram. Sogar ein Ansteckbutton zur 575-Jahrfeier vor zweiundzwanzig Jahren lag darin.
An beiden Seitenteilen gab es zudem neben dem obersten Schubkasten ein Schloss, welches die anderen drei Fächer jeder Reihe mittels eines Mechanismus gleichzeitig zusperrte.
Bloß diese eine Schublade wollte nicht aufgehen. Sophie wettete, dass der Schlüssel für die restlichen Fächer da drin war.
Großvater hatte nie jemanden an seinen Schreibtisch gelassen; alles, was er daraus brauchte, hatte er immer selbst geholt. Deshalb kannte auch keiner den Verschluss und niemand wusste, was die Kästen enthielten.
Ein erneutes Rütteln brachte immer noch keinen Erfolg. Nein, da lag nichts quer und verklemmte sich beim Öffnen. Sophie versuchte, unter dem Tisch etwas zu erkennen, doch dort war es zu dunkel. Sie brauchte mehr Licht.