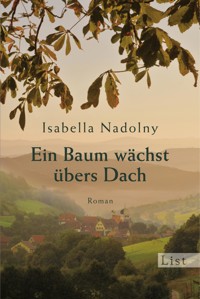3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In elf kleinen Erzählungen läßt Isabella Nadolny mehr als nur ein gutes Haar an den Männern. Die witzig und in feuilletonistischer Manier geschriebenen Geschichten erzählen u. a. von den »bleibenden Eindrücken«, die männliche Wesen schon bei den Kleinstfrauen im zarten Alter von drei Jahren hinterlassen, von späteren Eindrücken ganz zu schweigen. Sie wissen Erwähnenswertes über die »Natur« des Mannes von der grauen Vorzeit bis in die brisante Gegenwart zu berichten, und wie es in der »Höhle des Löwen« oder im Ehestandsgefängnis aussieht, auch das bleibt nicht verborgen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 109
Ähnliche
Isabella Nadolny
Soviel über ihn
Immer noch Liebenswertes an den Männern
FISCHER Digital
Inhalt
Immer noch …
Erfahrungen und Feuilletons haben eines gemeinsam: zwischen ihnen liegt oft viel Zeit. Nach Jahren überlese ich die Seiten des vorliegenden Bändchens. Ist das vor-geschriebene noch das Vorgeschriebene? Hat sich nicht einiges verändert? Nebensächliches? Hauptsächliches?
Rein äußerlich gesehen: Bärte sind kein Ereignis mehr. Die spät-studentenbewegten Revoluzzer haben sich mit der allgemeinen Nostalgie verbunden. Wenn ich einen jungen Mann mißtrauisch beäuge, weil ich nur Augen und Nase in seinem Gesicht sehe, ist er kein Terrorist, sondern der neue Pastor der Gemeinde. Die Sprache hat sich geändert. Wo eben noch der »ausgezeichnete Dr. Meier mit seiner reizenden Gattin sich die Ehre gaben«, tummeln sich heute Chauvies, Softies, Emanzen und Kindfrauen – und alle auf derselben Party.
Die Chauvies (ich hielt das anfänglich für einen neuen Brotaufstrich) ziehen ihre patriarchalische Rolle von anno dazumal durch und äußern zwischen zwei Schlucken lauthals: »Die Weiber wollen doch alle nur das gleiche.« Die Softies (keine Abart des Tempo-Taschentuchs) äußern: »Ich verstehe die Frauen ja sooo gut« und schämen sich der Tränen nicht, obwohl doch »ein tapferer Junge nicht weint«. Die Emanzen (keine Unterordnung der Kerbtiere, auch wenn es sich so anhört) wie auch die Kindfrauen werfen ihre Haare einmal ganz um sich herum, nehmen den Dauerlutscher aus dem Mund und lassen hören: »Schon 5000 Jahre dieses Theater, ich glaube, ich spinne!«
Aber das sind Nebensächlichkeiten. Wesentlicheres hat sich begeben. Viel seltener hört man den Aufschrei aus gepreßtem Frauenherzen: »Also wißt ihr, im nächsten Leben werde ich ein Mann!« So unvergleichlich besser scheint es nicht mehr zu sein. Aus dem »Mitleid mit den Frauen« beginnt allmählich – in ernsthaften Zeitschriften, in wissenschaftlichen Abhandlungen – das Mitleid mit den Männern zu werden. Die Ärmsten, die im ersten Tanz der Hormone eine unüberlegte Ehe geschlossen haben – bei den neuen Scheidungsgesetzen jetzt haben sie so gut wie lebenslang eine gewaltige Kette am Bein. Nun scheidet sie – wie in der düsteren Gotik – wirklich erst der Tod. Von der Frauenbewegung verunsichert, fragen sich auch die Glücklichen, ob sie ihre Rolle noch richtig spielen.
Viel Gutes ist geschehen. Beim Kampf der Geschlechter etwas zu erstreiten, ist nicht mehr so wesentlich, wie einander zu verstehen. Das patriarchalische »Ach, Unsinn!« ist zu einem »Vorsicht! Nicht drauftreten, hier liegt ein Problem!« geworden. Die vielgelästerte Emanzipation hat manch alten Zopf abgeschnitten. Wer die Oberhand behält und wer wen unterdrückt, wird zwischen einem einzelnen Mann und einer einzelnen Frau nur noch dann diskutiert, wenn sich ihre Beziehung der GmbH-Form schon bedrohlich angenähert hat.
Denn eines, ach, ist geblieben, wie es war: das psychodemokratische Modell fällt in sich zusammen wie ein Omelette soufflé, wenn die Liebe sich einstellt.
Die bleibenden Eindrücke
Irgendwann im Leben, meist schon sehr früh, fällt es einem zum erstenmal auf, daß es Männer gibt. Auf diesen kindlichen ersten Blick werden eigentlich nur zwei Sorten erkennbar. Die erste Sorte ist über zwanzig Jahre alt und wird deshalb zu den Greisen gerechnet. Solche Greise haben jedoch durchaus ihre Qualitäten. Sie können Tiere nachmachen oder den bösen Buh-Mann, sie können mit den Ohren wackeln, sich die Nase abreißen oder den Daumen. Sie sind zur Hand, wenn man sich das Knie aufschlägt und Trost braucht oder zehn Pfennige für eine Kokosstange, und man gewinnt, auf ihren Schultern reitend, neue lohnende Ausblicke auf gewohnte Dinge.
Die zweite Sorte sind die Mit-Kinder. In Gestalt von Brüdern, Vettern und Nachbarssöhnen sind sie schwere Prüfungen des Himmels, besonders wenn sie sich johlend und in Rudeln nähern. Sie sind borstig, unliebenswürdig, voller Schrammen, riechen nach Lederhose und haben lebende Frösche in der Tasche. Läßt man sich je dazu herbei, einer ihrer Aufforderungen zu folgen, wie »Spring mal da ’runter!« oder »Faß mal hierher!«, so fällt man bestimmt in die Brennesseln, oder man bekommt einen elektrischen Schlag. Stets ahmen sie einen quäkend nach, auch dann, wenn man gar nichts Dummes gesagt hat, und biegen sich vor Lachen, wenn man sein neues Sommerkleid zeigen will. Da sie einen außerdem an den Haaren ziehen, wann immer sie Gelegenheit dazu haben, findet man sie einfach fürchterlich.
So gräßlich man sie auch finden mag, insgeheim beneidet man sie, beneidet sie um ihre rohe Kraft, ihre Erfindungsgabe, ihr überlegenes Getue und ihr Talent beim Zielspucken und Bäumeklettern. Man möchte so sein wie sie und hadert mit dem lieben Gott – daran hat sich bis heute wenig geändert.
Auch heute noch kommt unweigerlich der Tag, wo ein Angehöriger dieses Chors der Rache, womöglich ein rothaariger, sommersprossiger, dem der eine Schneidezahn fehlt, einem im zugigen Torweg nach einer kurzen Verlegenheitspause im Gespräch ein Geldstück in die Faust drückt. »Da«, sagt er barsch, »kauf dir was!«, und dann macht er sich rasch davon.
Dies ist der Wendepunkt! Man steht da und ahnt erschauernd, daß dies nicht hätte geschehen können, wenn man ein Junge wäre. Es scheint, daß die Knaben einen nur so lange verachten, als sie zu mehreren sind. Es ist nur eine Ahnung, aber die erste jener Erfahrungen, die eine Frau zwischen zwei und zweiundachtzig Jahren nie wieder vergißt. Man bindet sich die Haarschleife fester, zieht die verrutschten Ringelsöckchen hoch und verläßt den zugigen Torweg als angehendes Weib. Von Stund an gefallen sie einem, die kleinen Männer, weil man ihre schwache Stelle entdeckt hat, auch wenn sie weiterhin johlend um die Ecke sausen.
Solange die Welt gleich hinter der eigenen Nasenspitze aufhört, sind es nur Äußerlichkeiten, die man an ihnen liebt. Um den Gesamteindruck eines männlichen Wesens zu erfassen, muß man aber beträchtlich älter sein.
Ich sehe mich noch, achtjährig, mit eiskalten Füßen auf meinem Schlitten an einem Rodelhang sitzen und, anstatt abzufahren, einen großen Jungen anschmachten, weil er eine himmelblaue Skihose trug. Dafür, daß er außerdem bildhübsch war, hatte ich gar keinen Blick. Mich faszinierten die himmelblauen Beinkleider, ja sie gaukelten sogar durch meine Träume, und die strenge Großtante, die mich erzog und vor der ich den Gegenstand meiner Schwärmerei leichthin erwähnte, sah schon schlimme Veranlagungen in mir keimen.
Der zweite Mann, der mir gefiel, trug keine bemerkenswerte Hose. Er war zwölf Jahre alt, häßlich und langweilig, aber er hatte einen gänzlich unerwarteten Reiz: Er hieß Ettore di Tomasi und war der Sohn des italienischen Grünkramhändlers am Markt. Ich schrieb seinen wundervoll klingenden Namen auf jede freie Fläche, im Winter mit langsam tauenden Eiszapfen an sonnenbeschienene Fensterläden und Scheunentore und, als es Frühling wurde, mit dem Blut aus einer Kniewunde in mein Poesiealbum. Die Schrift wurde mit den Jahren grünlich, und wie der Knabe ausgesehen hatte, wußte ich bald nicht mehr. Aber es besteht kein Zweifel, daß das Poesiealbum der richtige Ort für sein Überleben war.
Danach kam eine Zeit, in der mir kein Mann richtig gefiel, es seien denn jene flüchtigen Schemen, die man manchmal durch die beschlagene Scheibe einer Straßenbahn sieht oder die am offenen Fenster des D-Zuges stehen, der in entgegengesetzter Richtung vorüberbraust.
Später dann mußte das in jedem Frauenleben obligate Stadium der Schwärmerei für den Deutschlehrer oder Biologieprofessor überwunden werden, den nichts auszeichnete als eine bestimmte Art, am Fensterkreuz zu lehnen. Da standen wir dann, von unserem Herzklopfen fast zersprengt, in einem Treppenhaus, durch das der Angebetete gelegentlich emporstieg, und nahmen uns vor, edel, hilfreich und gut zu werden, nur weil er auf der Welt war. Heute ist man darin bedeutend sachlicher.
Die Tanzstundenjünglinge, die dann auftauchten, hatten es schwer. Sie mußten gegen die Traumgestalten und die Helden der Kinoplakate antreten, vornehmlich solcher Filme, in die mich Mama noch nicht gehen ließ. So hatten sie nicht nur von vorneherein eine schier unüberwindliche Konkurrenz – sie waren außerdem mangelhaft mit Reizen ausgestattet. Ihre Nickelbrillen, ihre unförmigen Knickerbockerhosen, dunklen Pullover mit eingestricktem Hirsch und ihre gebüschweise angepflanzten ersten Barthaare ließen mich die Braue verächtlich heben. Auch fühlte ich mich durch ihr Auftreten in Horden in die Zeit der Sandspielkästen und Rollerwettfahrten zurückversetzt. Ging man mit einem von ihnen sonntags in den Stadtpark, so war der schönste Augenblick derjenige, in dem er anrief und einen dazu aufforderte. Nachher wußte man nicht recht, was man zu ihm sagen sollte, und genierte sich. Da war es besser, gemeinsam ein Kino zu besuchen. Ging man aber mit mehreren von ihnen in einen Film, so litt man unter dem Benehmen der ganzen Bande. Sie schienen unfähig, ruhig und gerade auf ihrem Platz zu sitzen, streckten ihre langen Beine überallhin, stützten sich auf die Lehne des Vordermannes und hielten bei komischen Stellen nicht bis zur Pointe durch, ehe sie losprusteten. Während der Kußszenen schmatzten und blökten sie, und wenn das Licht wieder anging, machten sie zu laute und zu kesse Bemerkungen über den Film, damit ja keiner glaubte, sie seien ergriffen.
In der Tanzstunde selbst – die Gesichter voller Pusteln waren zwar die gleichen, aber der dunkle Anzug und die besseren Manieren wirkten sehr versöhnend – gefielen sie einem etwas besser. Sie waren hier gezwungen, die Gesten der wirklichen Männer nachzuahmen. Es gelang nicht allen gleich gut, aber einigen doch immerhin so, daß man ins Träumen geriet. Natürlich gaben sie selbst keine Traumhelden ab, aber die Tatsache, daß man im Arm eines männlichen Wesens tanzte, ließ einen an die berühmten Gardeleutnants denken, die auf Bällen zu finden gewesen sein mußten, an die Mütter und Tanten sich noch nach dreißig Jahren erinnerten und zu denen unsere Tanzstundenfeste sich verhielten wie etwa die Schönheitskönigin von Kötzschenbroda zur Königin von England. Ach, diese Bälle mußten herrlich gewesen sein, nicht nur wegen des Tanzens, nein, auch wegen des Rahmens, den sie für das etwaige erste Auftreten eines Märchenprinzen abgegeben hätten – eines Märchenprinzen, wie auch wir ihn wider besseres Wissen noch immer erwarteten.
Wir waren noch grün und überschätzten alle »ersten« Dinge gewaltig: den ersten Eindruck, das erste Kennenlernen, den ersten Kuß. Die Ernüchterung folgte mitunter auf dem Fuße. Mein erster Kuß fand auf dem Lande, bei einem Versteckspiel auf dem Heuboden statt, und ich hätte ihn gewiß genossen, wenn nicht das geladene Schweigen des jungen Mannes und die Tatsache, daß er sichtlich litt, ehe es endlich soweit war, mir einen so peinlichen Eindruck hinterlassen hätten. Wir gingen noch am selben Abend bei Mondschein engumschlungen im Park spazieren, und es war furchtbar unbequem, weil man nicht richtig ausschreiten konnte und sich bei jedem Schritt an der Hüfte des anderen stieß.
Auch was den ersten Blick betrifft, waren wir durch heimlich gelesene Romane verdorben. Es dauerte Jahre, bis wir erkannten, wie sehr es auf den »zweiten« Blick ankommt, die wenigen Ausnahmen abgerechnet, wo der erste Blick tatsächlich zur Liebe auf den ersten Blick führt und sozusagen von Pauken und Trompeten begleitet ist. Aber das geschieht verteufelt selten. Sogar so selten, daß noch nach Jahrtausenden darüber berichtet wird.
Im ersten Buch Mose steht ein solcher Bericht über den berühmten ersten Eindruck. Da schlenderte Isaak ganz harmlos auf dem Felde, er tat nichts, er sagte nichts, er sah einfach nur aus. Aber er sah so aus, daß Rebekka bei seinem Anblick vom Kamel fiel. Erst als sie unten war, fragte sie den Knecht, wer der Herr sei, erschauerte und verhüllte sich. Sie hatte Glück, das Happy-End folgte noch am selben Tage. Auch das ist selten.
Es kann auch schlecht ausgehen: Von Romeo ist nicht bekannt, ob er fabelhaft gut aussah, nur, daß er sich Julia mit der ausgefallenen Bemerkung näherte:
»Entweihet meine Hand verwegen dich,
O Heiligenbild, so will ich’s lieblich büßen …«
Auch dieser erste Eindruck saß. Er ging weit über all das hinaus, was einem an einem Mann gefallen kann. Julia hätte ein Urteil über die Erscheinung Romeos wahrscheinlich ebenso empört zurückgewiesen wie der junge Werther, der die Frage: »Wie gefällt Ihnen Lotte?« als Entheiligung bezeichnete. Es gibt auch ebenso berühmte Beispiele dafür, daß der erste Blick ein völliger Fehlschlag war. Die Priesterin Hero fand zunächst gar keinen Gefallen an dem jungen Leander. Er tat ihr nur leid, weil er so naß war, sie hatte Angst um ihn, weil jeden Augenblick jemand Mörderisches hereinstürzen konnte, und außerdem war er sehr frech und ließ sich nicht hinauswerfen. So kam denn eines zum anderen.
Nicht hinauswerfen ließ sich auch der junge Bonaparte bei Josefine Beauharnais. Er gefiel ihr gar nicht. Er war schlampig angezogen, hatte Schuppen auf dem Kragen, und sein Benehmen war stieselig. Der zweite Eindruck war dann besser, und den Rest wissen wir.
Ja, der zweite Eindruck, der sich gewöhnlich an den ersten anschließt, wendet die Sache manchmal zum Guten. Vielleicht darum, weil der erste Blick der Erscheinung, der zweite aber dem Wesen des Mannes gilt? Die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Blick gibt dem Mann eine Chance. Und wenn er sich unserer Beachtung wert zeigt …