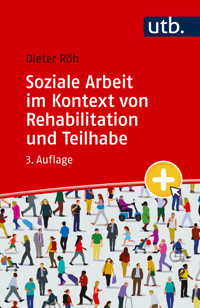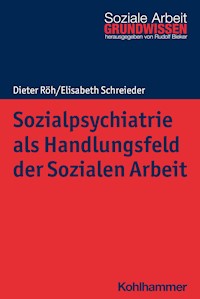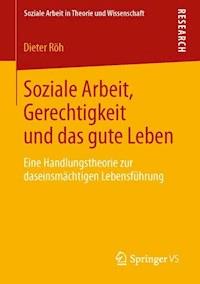27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sozialraumorientierung ist eine unverzichtbare konzeptionelle Anforderung in der Eingliederungshilfe geworden. Dieses Buch erklärt, wie sich diese Entwicklung verstehen und umsetzen lässt. Methodische Beschreibungen und praktische Hinweise zu personenbezogenen und personenübergreifenden Arbeitsweisen verdeutlichen die Prinzipien der Sozialraumorientierung. Das Spektrum der Praxisbeispiele reicht von Sozialraumbegehungen und subjektiven Landkarten über Netzwerkförderung, Sozialraumanalysen, projektbezogene Netzwerkarbeit bis hin zur Sozialplanung. Ausgehend von einem ressourcenorientierten, personzentrierten und partizipativen Ansatz wird verdeutlicht, wie betroffene Menschen sich ihr Umfeld noch stärker erschließen und für die eigene Lebensführung nutzen können und wie dies durch Fach- und Leitungskräfte professionell unterstützt werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dr. Dieter Röh ist Professor für Soziale Arbeit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg). Seine Lehr- und Forschungsbereiche sind die Eingliederungshilfe (Behindertenhilfe / Sozialpsychiatrie) sowie Theorien, Methoden und Geschichte der Sozialen Arbeit.
Anna Meins ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der HAW Hamburg und Promovendin der Universität Hamburg in Kooperation mit der HAW Hamburg. Darüber hinaus ist sie als Fachberaterin für Projekte bei der BHH Sozialkontor gGmbH tätig.
Im Ernst Reinhardt Verlag ebenfalls erschienen:
Röh, D.: Soziale Arbeit in der Behindertenhilfe (2. Aufl. 2018; ISBN 978-3-8252-4876-5)
Hinweis: Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abruf bar.
ISBN 978-3-497-03022-4 (Print)
ISBN 978-3-497-61437-0 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61438-7 (EPUB)
© 2021 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und straf bar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in EU
Cover unter Verwendung eines Fotos von iStock.com/JamesBrey
Abb. 9 unter Verwendung einer Graphik der BHH Sozialkontor gGmbH
Satz: Katharina Ehle
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
1 Einleitung
2 Theoretische Begründungslinien
2.1 Sozialraumorientierung als Fachkonzept Sozialer Arbeit
2.2 Gesellschaftstheoretische Reflexion
2.3 Aktuelle Positionen zur Begründung und Konzeptionierung
2.4 Handlungsprinzipien
2.4.1 Ressourcenorientierung
2.4.2 (Welt-)Aneignung
2.4.3 Empowerment
2.4.4 Partizipation
2.4.5 Netzwerkorientierung
2.5 Sozialraumverständnis
2.6 Personale Orientierung und Sozialraumorientierung
2.7 Ethische Legitimation und Problematik
3 Teilhabe behinderter Menschen
3.1 Begriffs- und Zielklärung: Inklusion oder Teilhabe
3.2 Lebenslagen behinderter Menschen in Deutschland
3.3 Rechtliche Rahmenbedingungen der Eingliederungshilfe
3.4 Zur Entwicklung der Teilhabeförderung
3.4.1 Normalisierungsprinzip
3.4.2 Psychiatrie-Enquete, Ambulantisierung und Gemeindepsychiatrie
3.4.3 Selbstbestimmung und Empowerment
3.4.4 Community Care, Community Living und die Zukunft der Teilhabe
4 Von der Theorie zur Praxis – ein Zwischenresümee
5 Methoden und Techniken sozialraumorientierter Praxis
5.1 Erweiterung des persönlichen Möglichkeitsraums: Analyse und Gestaltung des Sozialraums auf personenbezogener Ebene
5.1.1 Lebensweltorientierte Sozialraumbegehung
5.1.2 Autofoto- und Autovideografie
5.1.3 Nadelmethode
5.1.4 Subjektive Landkarten
5.1.5 Soziale Netzwerkanalyse und -intervention
5.2 Erweiterung des gesellschaftlichen Möglichkeitsraums: Analyse und Gestaltung des Sozialraums auf personenübergreifender Ebene
5.2.1 Personenübergreifende Sozialraumanalyse
5.2.2 One-to-Ones
5.2.3 Aktivierende Befragung
5.2.4 Fremdbilderkundungen
5.2.5 Projektbezogene Netzwerkarbeit von Organisationen
5.2.6 Freiwilliges Engagement
5.2.7 Interessenvertretung und politische Partizipation
5.3 Kommunale Teilhabeplanung und Angebotssteuerung
5.3.1 Teilhabeplanung als kommunale Sozialplanung
5.3.2 Sozialraumbudgets
5.3.3 Deinstitutionalisierung und Regionalisierung
6 Fazit und Ausblick
Literatur
Sachregister
1 Einleitung
Die Eingliederungshilfe befindet sich seit den 1980er Jahren in einem stetigen Wandel bzw. Reformprozess. Diese Entwicklung reicht von der stark institutionalisierten Form der „Anstaltsversorgung“ (auch in Großheimen) über die zunehmende Deinstitutionalisierung und Ambulantisierung und den Aufbau gemeindepsychiatrischer Dienste bis hin zum derzeitigen Versuch einer (noch stärker) personenzentrierten Ausgestaltung der Unterstützungsangebote. Etwa seit 2005 tritt mit der Sozialraumorientierung ein weiteres Element hinzu – verbunden mit weiteren fachlichen Anforderungen.
Die insgesamt festzustellende (erneute) Konjunktur einer „Communityorientierung in der Sozialen Arbeit“ (Landhäußer 2009) lässt sich verschiedentlich sowohl für die Eingliederungshilfe (Becker et al. 2013) bzw. die Behindertenhilfe (Franz / Beck 2007, Schablon 2009, Meins 2011, Leuchte / Theunissen 2012, Alisch / May 2015, Wansing / Windisch 2017, May et al. 2018, Dederich 2019) als auch die Sozialpsychiatrie (Dörner 2007, Görres / Zechert 2009, Kessl 2009, Röh 2013, Rohrmann 2013, Flemming 2014) nachzeichnen. Im Vergleich dazu realisierte die Behindertenhilfe institutionell und rechtlich die sozialräumlichen Anforderungen allerdings erst später. Dederich (2019, 501) führt das „noch relativ neue behindertenpädagogische Interesse für sozialräumliche Aspekte des Lebens mit einer Behinderung und der Organisation von Hilfesystemen und -strukturen“ auf die Kritik der Institutionalisierung und Defizitorientierung, die Forderungen der politischen Behindertenbewegung und die Hoffnung einer Umsetzung der Inklusion und Teilhabe zurück. Zudem kann für die Eingliederungshilfe ein deutliches sozialpolitisches und fiskalisches Interesse an der Umsteuerung der Leistungen zur Teilhabe festgestellt werden, wie die frühe Beschäftigung der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK 2009) mit dem Thema und die letztendliche Realisierung durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) verdeutlichen.
Schließlich gewinnt das Thema und die inhaltliche Stoßrichtung der Sozialraumorientierung auch durch das sozialwissenschaftliche und menschenrechtliche Verständnis von Behinderung als Problem der gesellschaftlichen Teilhabe an Bedeutung, insbesondere wenn man das biopsychosoziale Modell der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) sowie das Behinderungsverständnis des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) hinzuzieht. Mit Krüger kann man insgesamt festhalten, dass „Sozialraumorientierung und ein gezielt gestalteter Welfare-Mix als dieser Neuausrichtung fachlogisch zwingend innewohnend begriffen“ (Krüger 2010, 81) werden müssen. Hiermit kann dann auch das Programm dieser Publikation beschrieben werden, die zeigen will, warum Sozialraumorientierung unweigerlich verknüpft ist mit einer Personenzentrierung und wie die methodischen Möglichkeiten der sozialraumorientierten Arbeit in der Eingliederungshilfe helfen, diese zu transformieren und selbstbestimmtes Leben, basierend auf sozialer Teilhabe am Leben der Gesellschaft, zu unterstützen. Kahl (2019, 39) konstatiert, dass die „umfassende Antwort zur Förderung von Teilhabe […] derzeit sozialraumorientierte Konzepte“ zu sein scheinen und als Voraussetzung für diesen Anspruch einerseits eine „besondere professionelle Methodenkompetenz“ und andererseits eine „besondere Form professioneller Haltung“ notwendig seien. Beiden Anforderungen wollen wir in diesem Buch durch Begründung der Sozialraumorientierung als notwendiger Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe sowie durch Aufzeigen entsprechender Methoden und Techniken gerecht werden. Sozialraumorientierung ist, wie die Personenzentrierung, jedoch nicht nur ein fachliches Konzept, sondern muss immer auch ethisch reflektiert werden.
Zunächst gilt es, die Sozialraumorientierung als Konzept (in) der Eingliederungshilfe theoretisch zu begründen. Dies soll v. a. in den ersten Kapiteln erfolgen, um sodann schwerpunktmäßig die praktisch-methodischen Möglichkeiten einer sozialräumlich ausgerichteten Unterstützung behinderter Menschen darzustellen. Dabei liegt der Fokus auf sozialer Teilhabe, da der gesamte Bereich der Teilhabe an Arbeitsleben, Bildung und medizinischer Rehabilitation zwar auch sozialraumorientiert weiterentwickelt werden muss, dies aber jeweils anderen Logiken folgt bzw. hier andere Mechanismen greifen.
In diesem Buch werden folgende Aspekte dargestellt: Im zweiten Kapitel werden zunächst theoretische Begründungslinien der Sozialraumorientierung als Fachkonzept Sozialer Arbeit aufgezeigt. Zudem reflektieren wir gesellschaftstheoretisch die Folgen einer zunehmend auf lebensweltliche Unterstützung ausgerichteten Eingliederungshilfe und den in diesem Zusammenhang geforderten Wohlfahrtsmix aus professionellen, sozialstaatlichen Angeboten und „laienhaft-freiwilliger“, nachbarschaftlich-gemeinschaftlicher oder zivilgesellschaftlicher Unterstützung. Wir diskutieren aktuelle Perspektiven zur Begründung und Konzeptionierung der Sozialraumorientierung und positionieren uns mit einem eigenen handlungstheoretischen Zugang. Daran anschließend werden zentrale Handlungsprinzipien dargestellt und schließlich Sozialraumverständnisse aufgezeigt und wiederum unser eigenes Verständnis verdeutlicht. Die Bestimmung des Zusammenhangs von Personen- und Sozialraumorientierung sowie eine ethische Reflexion beschließen dieses erste Grundlagenkapitel.
Im dritten Kapitel wird dann die Teilhabesituation behinderter Menschen beleuchtet, indem zunächst die Begriffe Inklusion und Teilhabe diskutiert werden und für die Nutzung des Teilhabebegriffs votiert wird. Danach stellen wir einige zentrale Daten zur Lebenslage behinderter Menschen in Deutschland vor, um zu zeigen, von welcher gesellschaftlichen Ausgangslage wir auf die sozialräumlich gestaltete Verbesserung der Teilhabe schauen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Eingliederungshilfe, insbesondere die sozialräumliche Ausrichtung des neuen SGB IX, werden im Anschluss skizziert, um den Handlungsrahmen zu verdeutlichen. Dass Sozialraumorientierung unseres Erachtens eine konsequente Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe darstellt, soll der Durchgang durch die Reformideen der letzten Jahrzehnte – beginnend mit dem Normalisierungsprinzip über die Entwicklung der Gemeindepsychiatrie und die Deinstitutionalisierung bis zum Selbstbestimmungs- und Empowermentdiskurs und zu den Ideen „Community Care“ bzw. „Community Living“ – zeigen.
Das vierte Kapitel stellt den Übergang von der Theorie in die Praxis dar, indem dort die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst werden. Es kann von eiligen LeserInnen als Abkürzung zum fünften, dem Praxiskapitel genutzt werden.
Das fünfte Kapitel ist in drei Teile untergliedert. Im ersten Teil werden die eher personenbezogenen Methoden beschrieben und im zweiten Teil die personenübergreifenden Methoden. Wir greifen hier vielfach auf methodische Überlegungen aus der Praxis der Jugendhilfe oder anderen Arbeitsfeldern zurück und ergänzen diese aus eigener Praxis bzw. uns zur Verfügung gestelltem Material. Zuletzt gehen wir auf die Ebene der kommunalen Sozialpolitik ein, die viele der methodischen Facetten sozialräumlichen Handelns erst ermöglicht (oder erschwert). Da wir die Sozialraumorientierung insgesamt auf der Idee der daseinsmächtigen Lebensführung auf bauen, werden die methodischen Ansätze jeweils auch dem persönlichen oder gesellschaftlichen Möglichkeitsraum zugeordnet. Sie sind aber in einem integrativen Sinne zu verwenden und ergänzen sich vielfach bzw. greifen ineinander.
Zum Schluss noch ein paar Hinweise:
Dieses Buch adressiert vor allem Fachkräfte der Sozialen Arbeit sowie verwandter Professionen. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass in der Eingliederungshilfe faktisch mit einem hohen Anteil von Nicht-Fachkräften gearbeitet wird. Auch wenn wir die Umsetzung des Fachkonzepts vor allem als Aufgabe der Fachkräfte verstehen, ist die Qualifikation weiterer MitarbeiterInnen im Zuge der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe natürlich notwendig. Besser wäre jedoch eine höhere Fachkraftquote angesichts des hohen ethischen und fachlichen Anspruchs an eine moderne Teilhabeförderung.
Leider konnten wir nicht alle Aspekte, die uns derzeit wichtig erschienen, unterbringen. So haben wir u. a. auf eine ausführliche Beschreibung der Organisationsentwicklung auf Basis sozialräumlicher Prinzipien verzichten müssen. Diese und weitere Ergänzungen hinsichtlich der Umsetzung von Methoden und Techniken sozialraumorientierter Praxis hoffen wir, in weiteren Auflagen berücksichtigen zu können.
Wir sprechen im Folgenden, dem modernen Verständnis von Behinderung folgend, dann von „behinderten Menschen“, wenn wir damit das vorläufige Ergebnis des „Be-Hinderungs-Prozesses“ anzeigen wollen. Von geistig, psychisch oder körperlich beeinträchtigten Menschen ist dann die Rede, wenn Individuen mit ihren Funktionsbeeinträchtigungen im Sinne der ICF gemeint sind. Falls wir nur von „beeinträchtigten Menschen“ schreiben, sind damit prinzipiell alle der genannten Beeinträchtigungsarten gemeint. Wir wissen darum, dass sich die Rede von „Menschen mit Behinderungen“ gerade vor dem Hintergrund, dem stigmatisierenden Element der Zuschreibung entgegenzuwirken, zwar etabliert hat, haben uns aber doch für eine andere sprachliche Wendung entscheiden. Denn ist es nicht viel stigmatisierender, wenn man Menschen die Eigenschaft zuschreibt, sie hätten eine Behinderung, als zu sagen, sie würden behindert? Wenn wir also von behinderten Menschen schreiben, dann kennzeichnen wir damit Behinderung als aktiven Prozess im Sinne eines Ausschlusses aus der Gesellschaft bzw. der mehr oder weniger starken „Ver-hinderung“ von gesellschaftlicher Teilhabe. Diese neue Sprech- und Schreibweise sollte sich u.E. etablieren, um den sozialen Prozess der Behinderung stärker ins Bewusstsein zu rücken (Röh 2019, 10 f.).
Und noch ein Dank: Für die fachliche Einschätzung der Ausführungen des Kapitels 5.3 danken wir Sandra Ullrich-Rahner. Dabei sind selbstverständlich, wie im gesamten Buch, alle Ungenauigkeiten und Unzulänglichkeiten allein uns anzulasten.
2 Theoretische Begründungslinien
In diesem Kapitel sollen die theoretischen Grundlagen dargestellt werden, die eine sozialraumorientierte Perspektive in der Eingliederungshilfe unbedingt benötigt.
Dabei ist zunächst zu beachten, dass es in der Literatur zur Sozialraumorientierung im Vergleich zu anderen fachlichen Konzepten der Sozialen Arbeit bislang relativ wenige Hinweise auf erkenntnistheoretische, ethische oder gerechtigkeitstheoretische, objekt- oder gegenstands- bzw. funktionsbezogene sowie handlungstheoretische Grundlagen oder Begründungen gibt. Dafür sind bereits einige methodische Hinweise und Beispiele zu finden.
Noch stärker drückt sich dieser Mangel in der Anwendung des sozialraumorientierten Zugangs in der Eingliederungshilfe aus. Es wird daher im Folgenden darauf ankommen, die relevanten Zugänge und Bezüge der Sozialraumorientierung in und für diesen sozialrechtlichen Leistungsbereich darzustellen. Dabei wollen wir sie als eine kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Prinzipien, Orientierungen und Konzepte verstehen.
2.1 Sozialraumorientierung als Fachkonzept Sozialer Arbeit
Die Sozialraumorientierung hat sich als Fachkonzept der Sozialen Arbeit aus dem ursprünglichen Zusammenhang der Gemeinwesenarbeit (GWA) herausgelöst, was von einigen durchaus kritisch gesehen wird (Stövesand / Stoik 2013, 28). Unabhängig davon, ob diese Entwicklung gutgeheißen wird oder nicht, ist aber insgesamt festzustellen, dass sich eine sozialprofessionelle Ausrichtung auf den Sozialraum in den verschiedensten Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit (Fürst / Hinte 2014, Alisch / May 2015, Kessl / Reutlinger 2019) ergeben hat, die mit der Gemeinwesenarbeit bzw. bestimmten Varianten derselben (Stövesand / Stoik 2013) nur noch wenig zu tun hat. Gleichwohl finden wesentliche Elemente, wie ein relationales (Sozial-)Raumverständnis, Partizipation, Ressourcenorientierung, Netzwerkarbeit, Kooperation u. a. m. ihren Platz sowohl in der Gemeinwesenarbeit wie auch in der Sozialraumorientierung. Beide eint, dass die Gemeinwesenarbeit zwar als eines der drei zentralen Handlungskonzepte (bzw. Methoden, vgl. zur Unterscheidung: Kreft / Müller 2019a) der Sozialen Arbeit verstanden wird, in der Praxis und qua Prinzip aber multiprofessionell und interdisziplinär agiert. Ebenso wird Sozialraumorientierung von der Sozialen Arbeit zwar im Wesentlichen diskutiert und umgesetzt, sie kooperiert dabei aber genauso mit anderen professionellen AkteurInnen (und BürgerInnen als „Laien“) und wird in ihrer Begrifflichkeit zum Teil von diesen auch eigenständig verwendet.
Einen wesentlichen und originären Beitrag zur Trennung von Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung hat Wolfgang Hinte geleistet. Er kritisierte u. a. die weitgehende Marginalität der Gemeinwesenarbeit und eine geringe Entwicklungs- und Anpassungsfähigkeit in methodischer Hinsicht (Hinte 2007c) und propagierte daher den „relativ unverbrauchten Begriff“ (Hinte 2007a, 9) der „Stadtteil- bzw. Sozialraumorientierung“. So konstatiert Stoik, dieser Wechsel werde damit begründet, dass aus „pragmatisch-taktische[ r] Orientierung“ (Stoik 2013, 81) eine „möglichst breite Verankerung und Akzeptanz des Arbeitsprinzips GWA (u. a. durch Geldgeber und Politik) im Vordergrund steht. Mit dieser pragmatischen Orientierung wird aber (logischerweise) ein nie enden wollender Begriffswechsel eingeleitet – aktuell wird ‚Sozialraumorientierung‘ verwendet“ (Stoik 2013, 81). Gleichzeitig – und dem ist empirisch eindeutig so – „gelingt es durch Hintes pragmatischen Zugang, viele Elemente und professionelle Haltungen von GWA […] in die Handlungspraxis der Sozialen Arbeit einzuführen“ (Stoik 2013, 81), wovon die Berücksichtigung in der Eingliederungshilfe, wie bereits erwähnt, nur eine ist. Auf die entsprechenden Erfolge und Problematiken dieser ‚Etablierungspolitik‘ wird später (Kap. 2.3 und 2.4) noch einzugehen sein.
Hinte (2014, 17) selbst definiert Sozialraumorientierung einerseits ex negativo: Sie sei kein „‚großer‘, theoretischer, disziplinärer Entwurf“, keine „disziplinenübergreifende Theorie“, keine „sozialarbeiterische Methode“ und nicht auf „ein bestimmtes Arbeitsfeld“ begrenzt. Andererseits fasst er sie positiv als „Fachkonzept“, das eine „Brückenfunktion“ einnimmt „zwischen großen Entwürfen und kleinteiligen, in unterschiedlichen Kontexten entwickelten Methoden“.
Bei aller Differenz in weiteren Aspekten (vgl. vertiefend Röh 2019) kann diesem – handlungstheoretisch gesprochen – intermediären Verständnis gefolgt werden, weshalb wir hier bereits folgende Definition anbieten wollen:
DEFINITION
Sozialraumorientierung ist ein Konzept, mit demov einerseits der Einbezug der natürlichen, kulturellen, strukturellen und sozialen Umgebung des Menschen in die personenzentrierte Unterstützung zur Erweiterung seiner Handlungsoptionen im Sinne einer selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe an gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Prozessen und Strukturen und andererseits die Gestaltung des Sozialraums (inkl. sozialer Beziehungen, organisationaler und lokaler Prozesse und Strukturen) gekennzeichnet werden kann.
Daraus ergeben sich mehrere Perspektiven, die im Sinne der sozialstaatlichen Triangulation auch aufeinander einwirken:
1Sozialraumorientierung kann von der (leistungsberechtigten) Person und ihrer Lebenswelt her gedacht werden, d. h. im Sinne eines Verständnisses der subjektiven Welterfahrung. Dies führt zu einer an dieser Welterfahrung orientierten, auf Selbstbestimmung abzielenden personenzentrierten Hilfe, mit Bezug zu den Möglichkeiten der Aneignung sozialer Räume und dies unter Beachtung des Spannungsfeldes von Freiheit (Selbstbestimmung) und Sicherheit (Für-Sorge).
2Sozialraumorientierung kann von den Leistungsträgern her gedacht werden, d. h. als sozialbürokratisches Modell zur Gestaltung der Bedingungen der Leistungserbringung, (neuen) Verteilung von Kosten und Aufgaben, was u. a. auch die Einrichtung von Sozialraumbudgets nach sich ziehen kann, oder der mehr oder weniger starken Einflussnahme auf das Leistungsgeschehen, z. B. über die Gesamtplanung oder das Vertragsrecht.
3Sozialraumorientierung kann von den Leistungserbringern her gedacht werden, d. h. die bisherige, ggf. auf der Personenzentrierung beruhende Unterstützungslogik wird durch die Sozialraumorientierung erweitert. Sozialräumliche Ressourcen könnten so als Erweiterung der persönlichen Möglichkeiten der NutzerInnen verstärkt bzw. konsequent in die professionelle, personenzentrierte Unterstützung einbezogen werden.
Eine Sozialraumorientierung im gesamten Sinne müsste diese drei Perspektiven nun zusammenführen und in der Lage sein, zwischen diesen Ebenen zu vermitteln. Sozialraumorientierung in der Eingliederungshilfe erweitert und führt konsequent fort, was an Reformen bereits umgesetzt wurde, also eine Normalisierung der Lebensumstände, eine möglichst in der Gemeinde angesiedelte umfassende Unterstützung, die weitestgehende Förderung von Selbstbestimmung und eine insgesamt auf Teilhabe an allen gesellschaftlichen Lebensbereichen ausgerichtete Praxis. Sozialraumorientierung nutzt daher konsequent das vorhandene Repertoire an Möglichkeiten der Sozialraum- und Netzwerkanalysen, der Kooperation, Vernetzung und Erschließung von sozialräumlichen, insbesondere zivilgesellschaftlichen Ressourcen, und befähigt die AdressatInnen in der Nutzung dieser Ressourcen, um teilhaben und teilnehmen zu können (Röh 2019).
Im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit von personenzentrierter und sozialräumlich ausgerichteter Unterstützung, die für die Praxis der Eingliederungshilfe als zentral angesehen werden kann, kann man Sozialraumorientierung (wie Gemeinwesenarbeit) von einer „generellen Grundorientierung der Sozialen Arbeit, die am Individuum ansetzt und dabei seine gesellschaftliche Gewordenheit, sowie deren strukturelle Bedingungen analytisch-reflexiv in den Blick nimmt“ (Stövesand / Stoik 2013, 16) trennen. Eine solche Trennung mündet dann allerdings in einem antagonistischen Verhältnis von Personenzentrierung und Sozialraumorientierung bzw. Gemeinwesenarbeit, in dem letztere wiederum als „ein eigenes Konzept Sozialer Arbeit“ angenommen wird, „das, von dieser allgemeinen Grundorientierung ausgehend, nicht (primär) individuelles Bewältigungshandeln und Empowerment unterstützt, sondern die Entwicklung gemeinsamer Handlungsfähigkeit und kollektives Empowerment bezüglich der Gestaltung bzw. Veränderung von infrastrukturellen, politischen und sozialen Lebensbedingungen fördert“ (Stövesand / Stoik 2013, 16).
Diesem Antagonismus wollen wir nicht folgen und vielmehr für ein integratives Verständnis fachlichen Handelns plädieren, das die Sozialraumarbeit mit der personenzentrierten und auf das Individuum bezogenen Arbeit verbindet.
2.2 Gesellschaftstheoretische Reflexion
Mit der Sozialraumorientierung geht tendenziell der Auf- und Ausbau einer wahlweise ersetzenden oder komplementär wirkenden Aktivierung zivilgesellschaftlicher bzw. informeller-lebensweltlicher Ressourcen einher, etwa im Rahmen von bürgerschaftlichen Initiativen, Netzwerken oder, im Falle der Eingliederungshilfe bzw. Rehabilitation und Pflege, einer gemeinwesenbasierten Sorgekultur. Diese kommunitaristische, auf das Gemeinwesen und seine positiven Aspekte abzielende Ausrichtung ist zumeist mit der Vorstellung eines aktivierenden Sozialstaates verbunden, eine Bürgergesellschaft zu nutzen, um Verschiebungen von staatlicher hin zu privater Hilfe zu organisieren. Einerlei, in welche Richtung sich das Verhältnis BürgerInnen-Gemeinwesen-Staat als Welfare-Mix bewegt, wird es immer auch um eine Bestimmung des Verhältnisses von privatem, bürgerschaftlichem Engagement zu wohlfahrtsstaatlicher Versorgung mit sozialer Sicherheit und Schutz gehen. Dieses Verhältnis soll im Folgenden kurz erläutert werden, auch unter Einbezug eines weiteren Arguments, nämlich der Frage, ob die Sozialraumorientierung nur ein „Fachkonzept“ oder auch ein „Sparprogramm“ sei (Fehren / Hinte 2013).
Der Kommunitarismus ist nicht nur ein sozialphilosophisch seit längerem vertretenes Konzept (Etzioni 1995), sondern findet in jüngerer Zeit auch interdisziplinäre AnhängerInnen. Der Neurobiologe Gerald Hüther spricht beispielsweise von „Kommunaler Intelligenz“ (Hüther 2013) und votiert dafür, den Kommunen mehr Spielraum bei der Lösung von Problemen zu ermöglichen, da dort eine „Beziehungskultur“ vorhanden sei bzw. zu entfalten wäre, die Nationalstaaten und individualisierte Gesellschaften nicht (mehr) hervorbringen könnten:
„Was Kommunen also brauchen, um zukunftsfähig zu sein, wäre eine andere, eine für die Entfaltung der in ihren Bürgern angelegten Potenziale und der in der Kommune vorhandenen Möglichkeiten günstigere Beziehungskultur. Eine Kultur, in der jeder einzelne spürt, dass er gebraucht wird, dass alle miteinander verbunden sind, voneinander lernen und miteinander wachsen können.“ (Hüther 2013, 9)
Diese Sichtweise wird auch implizit ausgedrückt im Konzept des Community Care bzw. Community Living (vgl. zu Letzterem Knust-Potter 1998, Stein 2007):
„Der Begriff Community Care steht für ein konkretes Sozialraumkonzept, das professionellen Fachkräften eine Orientierung der Gemeinweseneinbindung von Menschen in marginalisierten Positionen bietet. Das Konzept steht für eine gesellschaftliche Bewegung, die sich mit dem gleichberechtigten Zusammenleben von Menschen innerhalb einer festgelegten geografischen Größe befasst und deren uneingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben anstrebt.“ (Schablon 2016, 539)
Auch wenn diese Vorstellung einer sorgenden Gemeinde in Deutschland bislang eher Wunsch denn gesellschaftliche Realität ist, wird sie vermehrt diskutiert, etwa im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel (Dörner 2007, 2012), aber auch durchaus kritisch reflektiert (Clausen 2008a, Dahme / Wohlfahrt 2010, Wunder 2009). Abgesehen von informell funktionierenden Sorgenetzwerken in lebensweltlichen Zusammenhängen der Familie und der Nachbarschaft sind diese „Sorgegemeinschaften“ in Europa noch nicht bzw. nur vereinzelt verwirklicht, wie Beispiele in den Niederlanden (Kal 2010) oder auch in Großbritannien (Knust-Potter 1998) zeigen (siehe für einen internationalen Vergleich Aselmeier 2008, Fietkau 2017). Gleichwohl ist diese Hinwendung auf das Gemeinschaftliche bzw. Lokale durchaus als Gegenbewegung zu den Individualisierungstendenzen der Gesellschaft in Zeiten zunehmender Globalisierung zu sehen (Schnur 2016). Interessant ist überdies, dass sich zwar einerseits Bottom-up oder Graswurzelbewegungen der Gemeinschaftsorientierung feststellen lassen, diese aber Top-down auch gefordert bzw. gefördert werden.
Alles in allem lässt sich feststellen, dass sich neben theoretischen und programmatischen Konstruktionen einer möglichen sorgenden Gemeinschaft bzw. Gemeinde in Deutschland nur sehr vereinzelte, eher projektbezogene Initiativen finden lassen (vgl. beispielhaft Dörner 2012). Ob und inwieweit sich hieran im Zuge der durch das BTHG vorgesehenen, stärker sozialräumlich auszurichtenden Eingliederungshilfe etwas ändert, bleibt abzuwarten. Spätestens dann, wenn sich die nicht nur gemeinwesenorientierte sondern auch gemeinwesenbasierte Sorge und Unterstützung der in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe behinderten Menschen zu einem strukturell wirkenden Prinzip auswächst, wären auch die sozioökonomischen Effekte und die Auswirkungen auf die Lebens- und Versorgungsqualität bei den Betroffenen zu erforschen und in der Praxis zu beachten. Schon jetzt ist zu diskutieren, ob mit einer sozialräumlich ausgerichteten Praxis, die vermehrt auf zivilgesellschaftliches Potenzial setzt, etwa durch den Einbezug von Freiwilligen (Kap. 5.2.6) oder auch durch den Ausbau der Idee von Unterstützerkreisen (Kap. 5.1.5, Knust-Potter / Windisch 2011, Doose 2015, Fietkau 2017), eine Reduktion sozialstaatlicher Ausgaben für die personenbezogenen sozialen Dienstleistungen erfolgen wird. Sollte das so sein, wäre sehr genau zu prüfen, inwieweit der Einbezug informeller UnterstützerInnen aus der Familie, der Nachbarschaft und generell aus der Gemeinde, die Lebens- und Versorgungsqualität negativ tangiert und inwieweit professionelle Fachkräfte hier die Qualität absichern müssten, etwa durch eine Art Supervisions- oder Kontrollkompetenz, in jeden Fall aber durch eine stärkere Netzwerkkompetenz.
2.3 Aktuelle Positionen zur Begründung und Konzeptionierung
Wie bereits festgehalten, existiert keine kohärente, spezifische (Handlungs-) Theorie, die Aussagen darüber trifft, von welchen Grundannahmen eine sozialraumorientierte Konzeptionierung auszugehen hätte, wie diese systematisch zusammenhängen oder welche handlungsleitenden Prämissen und ggf. sogar methodischen Leitlinien aus ihnen folgen würden. Dabei gilt allerdings:
„Eine Handlungstheorie (…) sollte also das handelnde Subjekt [z. B. eine / n professionelle / n Sozialarbeiter / in] insofern mit Handlungsgru¨nden [Werten, Normen, Symbolen, Deutungen etc.] ausstatten, als dieses ohne solche Gründe nicht intentional handeln könnte. Gleichfalls sollte eine Handlungstheorie (…) auch bereits vollzogene professionelle Handlungen interpretieren und in ein methodologisches Muster einordnen können.“ (Röh 2013, 20)
Aus diesem Grund wird hier, bevor bestimmte, allerdings nicht derart hergeleitete Handlungsprinzipien in Kapitel 2.4 dargestellt und kritisch reflektiert werden, der Versuch unternommen, auf Basis der Theorie der daseinsmächtigen Lebensführung einige handlungstheoretische Eckpunkte einer zukünftig noch weiter auszuführenden Theorie der Sozialraumorientierung zu skizzieren.
Die Theorie der daseinsmächtigen Lebensführung nutzt den Capabilities Approach, einen gerechtigkeitstheoretischen Ansatz, der hauptsächlich durch Amartya Sen und Martha Nussbaum entwickelt wurde und seit den 1990er Jahren intensiv auch außerhalb seiner ökonomischen wie philosophischen Herkunft diskutiert wird, um eine Handlungstheorie Sozialer Arbeit zu formulieren (vgl. Sen 2010, Nussbaum 2010). Es geht darum, das Person-in-Umwelt-Modell der Sozialen Arbeit so zu spezifizieren, dass es die komplexen Wechselwirkungen beider Sphären erfasst. Dabei wird auf der erkenntnistheoretischen Basis eines kritischen Realismus davon ausgegangen, dass sich die gesellschaftliche Wirklichkeit, so wie sie sich aktuell zeigt, bezüglich bestimmter sozialer Wirklichkeiten, die reale Konsequenzen haben, untersuchen und bis zu einem gewissen Grad auch verändern lässt. Hierzu werden jene Wechselwirkungen beleuchtet, die dazu führen, dass Menschen kein gutes Leben verwirklichen können – was konkret bezogen auf die Lebenslage behinderter Menschen eine Beschränkung der Teilhabe und Teilnahme am Leben der Gesellschaft bedeutet. Die Wechselwirkungen zwischen Person(en) und Umwelt(en) können auch als „persönlicher Möglichkeitsraum“ einerseits und „gesellschaftlicher Möglichkeitsraum“ andererseits konzipiert werden, wobei in beiden je getrennte, in der Interaktion sich jedoch gegenseitig beeinflussende Verwirklichungschancen entstehen. Möglichkeitsräume oder auch Verwirklichungschancen stehen dabei synonym für die von Sen und Nussbaum verwendete Begriffe der Capability bzw. der Capabilities. Dieses Verständnis korreliert mit dem durch die BRK beeinflussten, neuen Verständnis von Behinderung (§ 2 Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX), da Behinderung nun wie folgt gekennzeichnet ist:
„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“ (Art. 1 S. 2 BRK; vgl. Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 2017, 8)
Behinderung entsteht also erst aus der negativen Wechselwirkung von individueller Beeinträchtigung (persönlichem Möglichkeitsraum) und gesellschaftlicher Realität (gesellschaftlichem Möglichkeitsraum), die die volle und effektive Partizipation an der Gesellschaft behindert. Positiv und mit den Begriffen der Theorie daseinsmächtiger Lebensführung formuliert bedeutet dies, dass Teilhabe verstanden werden kann als die Chance zur Verwirklichung eines guten Lebens auf der Basis der gesellschaftlich garantierten Verfügbarkeit von Ressourcen und Partizipationsmöglichkeiten (gesellschaftlicher Möglichkeitsraum) und der subjektiven Handlungskompetenz, diese Ressourcen und Partizipationsmöglichkeit zu nutzen (persönlicher Möglichkeitsraum).
In der Praxis würde das bedeuten, dass zentrales Ziel der Sozialen Arbeit zum einen die Handlungsbefähigung der Subjekte ist und zum anderen die Kritik und Beeinflussung derjenigen Lebensbedingungen, die den Subjekten tatsächlich zur Verwirklichung ihrer Ziele zu Verfügung stehen müssen und aus denen sie dann wählen können. Daraus folgt eine ebenso fundamentale wie auch detaillierte Kritik der Ressourcenlage sowie des Zugangs zur Ressourcennutzung im Sinne einer Transformation dieser Ressourcen (Röh 2013).
(Behinderte) Menschen sollen also sowohl hinsichtlich ihres persönlichen Möglichkeitsraums als auch hinsichtlich des sie beeinflussenden gesellschaftlichen Möglichkeitsraums darin unterstützt werden, eine daseinsmächtige Lebensführung realisieren zu können. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie
„a ausreichend ökonomische und ökologische Mittel zur Verfügung […] haben, um den eigenen „oikos“ (griechisch für Haushalt) besorgen zu können (soziomaterielle Lage; sozioökologische Ressourcen),
b anstehende Entwicklungsaufgaben mithilfe relevanter Anderer und Gemeinschaften meistern können (Entwicklung / Bildung, soziale Unterstützung), um damit
c innerhalb relevanter Lebensbereiche entsprechende Rollen ausüben zu können (Inklusion / Integration).“ (Röh 2018b, 164)
Als handlungstheoretische Formulierung einer sozialraumorientierten Arbeit in der Eingliederungshilfe bedeutet dies Folgendes:
„So kann Sozialraumorientierung vereinfacht gesagt als eine Möglichkeit verstanden werden, die ‚gesellschaftlichen Möglichkeitsräume‘ aufzuschließen, um Menschen die Chance zu eröffnen, ihren ‚persönlichen Möglichkeitsraum‘ zu erweitern, also teilhaben und teilnehmen zu können an notwendigen wie selbstgewählten Systemen und Lebenswelten. Entscheidend wird also sein, sowohl Subjekte oder Gruppen zu befähigen als auch soziale Räume, Prozesse und Strukturen so zu gestalten, dass sie Ressourcen enthalten und diese erschlossen werden können.“ (Röh 2019, o.S.)
2.4 Handlungsprinzipien
Die Sozialraumorientierung wird in der Literatur mehr als ein Handlungs- oder Fachkonzept, denn als (Handlungs-)Theorie besprochen (Hinte 2014, 2018, Schönig 2011), auch wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie schon handlungstheoretische Bezüge enthält. Früchtel et al. (2013a, 25) schreiben zur „Theorie der Sozialraumorientierung“, sie sei „maßgeblich von der Theorie der Lebensweltorientierung beeinflusst“ bzw. kennzeichnen sie als „reflexive Theorie“ (Früchtel et al. 2013a, 23), in der „alte Konzepte wirkungsvoll kombiniert werden“ (Früchtel et al. 2013a, 23). Diese wären: Gemeinwesenarbeit, Empowerment, Theorie des sozialen Kapitals, das Konzept der lernenden Organisation, Aspekte der Neuen Steuerung und die Theorie der Lebensweltorientierung. Diesbezüglich stünde ein genauerer Vergleich theoretischer Annahmen an. Auch wenn dies hier nicht ausführlich erfolgen kann, sei Folgendes festgehalten: Die Lebensweltorientierung interessiert sich v. a. für den Alltag bzw. die Lebenswelt, die in Zeit, Raum und Beziehungen erlebt wird, und
„meint den Bezug auf die gegebenen Lebensverhältnisse der Adressaten, in denen Hilfe zur Lebensbewältigung praktiziert wird, meint den Bezug auf individuelle, soziale und politische Ressourcen, meint den Bezug auf soziale Netze und lokale / regionale Strukturen.“ (Thiersch 1995 / 2012, 5)
Hier bestehen also zumindest hinsichtlich eines relationalen Sozialraumverständnisses (Kap. 2.5) Parallelen zwischen beiden theoretischen Modellen. Auch die der Lebensweltorientierung zu Grunde liegenden Struktur- und Handlungsmaximen (Prävention, Alltagsnähe, Integration, Partizipation, Dezentralisierung sowie Vernetzen / Planen, Einmischen, Aushandeln, Reflektieren) weisen eine Ähnlichkeit mit den Prinzipien der Sozialraumorientierung bzw. den von Früchtel et al. (2013a, 2013b) vorgeschlagenen Handlungsfeldern (Sozialstruktur, Organisation, Netzwerk, Individuum) auf.
Franz und Beck (2007) fassen die wesentlichen Prinzipien von Sozialraumorientierung wie folgt zusammen:
Interdisziplinäres Arbeiten: Beiträge zu adäquaten Lösungen können aus verschiedenen Disziplinen stammen (Soziale Arbeit, Gemeindepsychologie, Städtebau, Architektur etc.)
Dopplung der Handlungsebenen: Hilfeleistungen sollen individuell und auf das Gemeinwesen bezogen sein
Lebensweltorientierung: Hilfen sollen an den Interessen und Bedürfnissen der Betroffenen ansetzen
Orientierung an Ressourcen: Statt ausschließlicher Problemschau werden vor allem die Ressourcen des Sozialraums in den Blick genommen
Aktivierung und Beteiligung: Kern der Gemeinwesenarbeit ist der partizipatorische Einbezug der Bevölkerung
Zielgruppenu¨bergreifende Arbeit: Ziel ist es, möglichst breiten Nutzen für verschiedene Personengruppen zu erzeugen
Kooperative Arbeitsformen: Vernetzung mit im Sozialraum aktiven Gruppen und Organisationen und gemeinsames Handeln
Wolfgang Hinte hat diese Prinzipen zu fünf wesentlichen Merkmalen reduziert und damit den seines Erachtens bedeutsamen Kern und das Alleinstellungsmerkmal der Sozialraumorientierung beschrieben; er benennt sie in der jüngsten Publikation zu diesem Thema wie folgt:
– „Im Zentrum stehen immer die Interessen und der Wille der leistungsberechtigten Menschen – egal, ob sie uns gefallen oder nicht.
– Wir vermeiden Betreuung und setzen auf Aktivierung.
– In einem sozialräumlichen Konzept schauen wir konsequent auf die Ressourcen sowohl der einzelnen Menschen als auch der Quartiere.
– Sozialräumliche Arbeit muss zielgruppen- und bereichsübergreifend angelegt sein.
– Vernetzung und Abstimmung der zahlreichen sozialen Dienste sind Grundlage für funktionierende Einzelhilfen.“ (Hinte 2018, 14 ff.)
An diesen Prinzipien, die in Variationen (u. a. Hinte 2007b, Fehren / Hinte 2013, Hinte 2014) seit langem von ihm vorgetragen werden, kann durchaus Kritik geübt werden (Stoik 2013, Scheu / Autrata 2013, Beck 2016a, Röh 2019). So brauchen nach Beck (2016a) behinderte Menschen
„nicht nur eine Stärkung ihres Willens und ihrer Kompetenzen, um ihre Anliegen, auch und vor allem über die Organisation in sozialen Gruppen und Vernetzungsstrukturen vor Ort, zu vertreten. […] Handlungsfähigkeit bzw. ihre Einschränkungen müssen hier […] genauso erweitert gedacht werden wie die Voraussetzungen der politischen Beteiligung.“ (Beck 2016a, 65)
Denn Ressourcen zur Bewältigung der Beeinträchtigung sind nur bedingt gegeben, so dass Selbsthilfe und soziale Hilfe, etwa in Form von Stadtteilinitiativen, nur eingeschränkt möglich sind und wirksam werden können. Vielmehr müssen die Komplexität und die Problematik der Frage des Zugangs zu und des Erhalts von Ressourcen im Feld von Behinderung stärker thematisiert werden (Beck 2016a). Entsprechend muss eine Adaption von Sozialraumorientierung auf das Feld der Behindertenhilfe die besondere Lebenslage von Menschen mit Beeinträchtigung sowie die alltäglichen Herausforderungen in der Bewältigung von Behinderungen berücksichtigen und darf sich nicht nur auf ein Verständnis sozialstruktureller Marginalisierung beziehen. Gleichermaßen gilt es, die Spezifik des Hilfesystems, die jeweilige historische Entwicklung mit der entsprechenden leistungsrechtlichen Steuerung in den Blick zu nehmen.
Im Allgemeinen kann daher Folgendes festgehalten werden:
„dass seine [W. Hintes, Anm. d. Verf.] Positionen, zumindest in der vorgetragenen Absolutheit, keine hinreichenden Argumente für eine reflexive Prüfung bisheriger Primate oder Leitideen, wie z. B. der Lebensweltorientierung […], bieten. […] Als Hypothese soll dienen, die Eingliederungshilfe als ein System an Hilfen für besonders vulnerable Gruppen zu verstehen, das daher einer eigenen, ethisch sensiblen Programmatik bedarf, die es schafft, Prinzipien wie Freiheit und Sicherheit in der Unterstützung der eigenen Lebensführung gut miteinander zu vereinen.“ (Röh 2019, o. S.)
Zudem ist anzumerken, dass es sich im engeren Sinne erst bei den letzten drei von Hinte genannten Prinzipien (siehe oben) um solche der Sozialraumorientierung handelt. Gerade die ersten beiden sind grundsätzliche ethische Prinzipien, die es, wenn auch reflexiv angelegt, in der Sozialen Arbeit zu beachten gilt, die aber in ein Spannungsverhältnis von Schutz und Freiheit, von Fremd- und Selbstbestimmung gesetzt werden müssen (Kap. 2.7).
Uns erscheint es daher ratsamer, den o. a. Beschreibungen von Franz und Beck oder auch der Rezeption von Herrmann (2019) bzw. Spatscheck / Wolf-Ostermann (2016, 15) bzgl. der Sozialraumorientierung und zuletzt Deinet (2009c) zu folgen. Auch der von Kessl / Reutlinger (2010, 44) vorgenommenen Einteilung kann zugestimmt werden:
Ressourcenerschließung in lokalen sozialen Netzwerken
(Re-)Aktivierung kleinräumiger Unterstützungssysteme und Beziehungsstrukturen
Zentrierung der Nutzerperspektive
Veränderung institutioneller Strukturen, insofern sie nicht zielführend sind
sozialpolitische Mitgestaltung und Verwaltungsmodernisierung
In Hinblick auf die besondere Lebenslage von Menschen mit einer Beeinträchtigung schlagen wir als Orientierung für die Umsetzung von Sozialraumorientierung in der Eingliederungshilfe damit zusammenfassend folgende Grundsätze vor:
Jede sozialräumliche Handlung, sei sie personenzentriert oder personenübergreifend, orientiert sich stärker an den individuellen, gruppenbezogenen, einrichtungsbezogenen und zivilgesellschaftlichen Ressourcen als an den Defiziten, Schwächen, Limitationen resp. Restriktionen oder Problemen.
In enger Verbindung damit kommt in der sozialraumorientierten Arbeit dem Modell der Aneignung eine große Bedeutung zu. Wenn, wie noch ausführlich dargestellt werden wird (Kap. 2.5), der soziale Raum bzw. Sozialraum ein relationales Gebilde ist, das wesentlich durch menschliche Aktivität gestaltet wird, dann sollte sozialräumlich ausgerichtetes Handeln Chancen zur Aneignung dieses Raumes eröffnen. Dazu gehört auch die Möglichkeit und Befähigung Betroffener zur Partizipation an der Ressourcenerschließung bzw. -nutzung.
Fachkräfte, ebenso wie Freiwillige oder Angehörige, befördern und achten das Selbstbestimmungsrecht Betroffener und unterstützen diese im Finden und Beschreiben eigener Ziele. Sie nutzen das Konzept des Empowerments auf allen Ebenen. Dabei sind sie sich gleichzeitig bewusst, dass Menschen nicht immer die richtige Entscheidung zu treffen, da sie nicht immer klar genug sehen, welche Möglichkeiten ihnen zu Verfügung stehen oder welche Konsequenzen ihre Entscheidungen zur Folge haben. Sie erkennen auch, ob und inwieweit erlernte Hilflosigkeit, adaptive Präferenzen oder andere Verfremdungen auf die eigene Willensbildung und Entscheidungs- und Handlungsfreiheit einwirken. Es geht also auch um die pädagogische oder therapeutische Qualität der fachlichen Unterstützung.
Sozialräumlich arbeitende Fachkräfte und Organisationen streben nach Vernetzung und setzen sowohl im informellen wie formellen Bereich sozialer Unterstützung auf eine gute Qualität derselben – im Interesse der Betroffenen und unter Wahrung ihrer Lebensqualität und Selbstbestimmung. Neben der Vernetzung mit professionellen sozialen Diensten und Institutionen setzen sie dabei auch auf zivilgesellschaftliche Ressourcen und erschließen diese, soweit nicht vorhanden, in Kooperation mit Verwaltung, Politik und anderen professionellen wie non-professionellen AkteurInnen.
Sozialraumorientierung nimmt Einfluss auf lokale und regionale (ggf. auch nationale und globale) Entscheidungen und Entwicklungen, auch indem sie stellvertretend für oder gemeinsam mit Betroffenen an deren politischer Partizipation arbeitet. Sie gestaltet (sozial-)räumliche Strukturen und Angebote mit.
Die diesen Grundsätzen innewohnenden Handlungsprinzipien gilt es nun im Weiteren sowohl theoretisch als auch methodisch (Kap. 5) genauer darzulegen, um Sozialraumorientierung für die Eingliederungshilfe als Fachkonzept entsprechend einordnen und begründen zu können.
2.4.1 Ressourcenorientierung
Ressourcenorientierung spielt innerhalb der Theorie und Praxis Sozialer Arbeit eine herausragende Rolle (Röh 2012, Möbius / Friedrich 2010), da sie weitere Prinzipien, wie etwa Empowerment oder auch eine sozialökologische oder systemische Sichtweise, konzeptionell unterstützt. Wie bereits deutlich wurde, stellt die Orientierung nicht nur an personalen, sondern vor allem an sozialen Ressourcen – und hier besonders an Umwelt- oder Umfeldressourcen – ein Merkmal einer sozialraumorientierten Sozialen Arbeit mit behinderten Menschen dar. Die Bedeutung dieser Ressourcen bzw. der Folgen ihres Fehlens kann theoretisch bereits an der ICF, an der BRK und aus dem neuen Behinderungsverständnis gemäß § 2 SGB IX abgelesen werden. „Be-Hinderung“ entsteht (Kap. 1) eben erst dadurch, dass es eine negative Wechselwirkung zwischen individuellen Beeinträchtigungen körperlicher, geistiger oder psychischer Art bzw. Sinnesbeeinträchtigungen und einer Umwelt gibt. Geht man von einer positiven Wechselwirkung aus, so wird deutlich, dass statt nach „Be-Hinderungsfaktoren“ – in der Sprache der ICF als Barrieren bezeichnet – nach „Ent-Hinderungsfaktoren“ (Knust-Potter 1998) gesucht und diese – in der Sprache der ICF als Förderfaktoren bezeichneten – Möglichkeitsräume erschlossen werden müssen. Im Diskurs um die Sozialraumorientierung wird dies häufig im Zusammenhang mit der fallunspezifischen (Früchtel / Budde 2006) oder auch fallübergreifenden Arbeit (Lüttringhaus 2011) assoziiert. Das ist jedoch nicht zwangsläufig, denn auch die fallspezifische Arbeit erfordert einen ressourcenorientierten Einbezug aller Potenziale. Früchtel, Cyprian und Budde ordnen dies im Kapitel „Individuum“ dem Stärkenmodell zu (Kap. 2.4.3) und stellen fest, dass, entgegen dem Defizitblickwinkel, der „die Normaleinstellung unseres Alltagsverstandes“ (Früchtel et al. 2013a, 55) darstellt, das Stärkenmodell eher „ein künstlicher Blick“ (Früchtel et al. 2013a, 55) sei. Dabei geht es eher um eine „Schatzsuche statt Fehlerfahndung“ (Schiffer 2013). Denn Fehler eröffnen sich leichter dem professionellen Auge, das durch eine Problembetroffenheit als häufigem Ausgangspunkt sozialer Hilfen angesprochen wird und zudem sozialstaatlich geschult nach notwendigerweise defizitären Leistungsbegründungen sucht. Stärken und Ressourcen müssen hingegen häufig erst aktiv erschlossen werden.
Doch was sind überhaupt Ressourcen? Wortursprünglich geht der Begriff auf „Quelle“ (im Englischen source) zurück und bezeichnet damit ein wichtiges Überlebensmittel, wenn man z. B. an Wasserquellen oder Nahrungsquellen denkt. Pantucek bezeichnet Quellen bzw. Ressourcen daher auch als „Lebens-Mittel“ (Pantucek 2008, 4). Der Ressourcenansatz spielt auch in der Stadtentwicklung eine Rolle. So wurden beispielsweise Anfang des 20. Jahrhunderts städtische Ressourcen geschaffen, um der durch die Urbanisierung der Städte entstehenden Verdichtung des bebauten (Wohn-)Raums zumindest teilweise Erholungsräume zuzufügen (siehe z. B. die sog. Therbusch’sche Ressource in der Oranienburger Straße 18 in Berlin oder auch die Gartenstadtbewegung; Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft 2015). Mit Wendt können wir den Ressourcengebrauch sowohl als einen die Ressourcen erschöpfenden Verbrauch derselben als auch als deren regenerativen Wiederauf bau bzw. ihrer Pflege verstehen: „In der Natur wie im Sozialen dienen sie der Herstellung und Wiederherstellung lebendigen Daseins, und in ihm hat auch die Pflege dieser Quellen zu erfolgen“ (Wendt 2010, 25).
Knecht (2012, 21 ff.) gliedert Ressourcen in persönliche Ressourcen einerseits und Umweltressourcen andererseits und konkretisiert diese auf verschiedenen Ebenen (siehe Tabelle 1).
Von besonderer Bedeutung ist neben dem Vorhandensein der Umweltressourcen auch deren Transformationsfähigkeit, die sich in dem Vorhandensein, der Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit selbst zeigt, aber auch in der mit den personalen Ressourcen verbundenen subjektiven Ressourcentransformationsfähigkeit. Gemäß der Theorie der Ressourcenerhaltung und des multiaxialen Copingmodells nach Hobfall und Buchwald (2004) kann es hierbei zu einer Verlust- oder Gewinnspirale kommen, je nachdem, wie Ressourcen faktisch genutzt werden.
Tab. 1: Ressourcentabelle (gekürzt und sprachlich modifiziert nach Knecht 2012, 21 ff.)
Persönliche RessourcenUmweltressourcenPhysische Ressourcen, u. a. Gesundheit, Leistungsfähigkeit, stabile Konstitution, physische Attraktivität
Sozial-emotionale Beziehungsressourcen, z. B. sozial-emotionale Zugehörigkeit
Psychische Ressourcen, u. a.
– kognitive Ressourcen (intellektuelle Fähigkeiten, Kreativität, Problemlösefähigkeit etc.), günstige kognitive Überzeugungen (z. B. Selbstwirksamkeitsüberzeugung)
– emotionale Ressourcen (emotionale Stabilität, Verlässlichkeit, emotionale Regulationsfähigkeit, Genussfähigkeit etc.)
– Innehaben von anerkannten, identitätsfördernden Rollen (z. B. Ämter, Positionen in Familie, Beruf oder sozialen Gemeinschaften)
Soziale Ressourcen, z. B. ein soziales Netzwerk, Erfahrung von sozialer Integration und Zugehörigkeit, soziale Unterstützung
Interaktionelle psychische Ressourcen, z. B. Beziehungs-, Konflikt- und Kritikfähigkeit, Ambiguitätstoleranz, Integrationsfähigkeit etc.
Sozialökologische Ressourcen, z. B. Wohn- und Wohnumfeldqualität inkl. Infrastruktur oder Arbeitsplatzqualität
Ökonomische Ressourcen, wie Geldund Kapitalbesitz, (stabiles) Einkommen
Sozialstaatliche oder soziokulturelle Ressourcen, z. B.
– das Vorhandensein, die Erreichbarkeit und der Zugang zu Bildungsund Gesundheits- oder Kulturangeboten und psychosozialen Unterstützungsleistungen
– monetäre Transferleistungen oder Dienstleistungen der sozialstaatlichen Sicherungssysteme
– Teilhabemöglichkeiten am religiösen oder gesellschaftlich-kulturellen Leben
– Durchschaubarkeit und Beeinflussbarkeit von gesellschaftlichen Strukturen
– Rechtsstaatlichkeit
Sozialraumorientierung kann einerseits zur Erschließung oder zum Aufbau von Umweltressourcen beitragen und andererseits die aktive Umwandlung vorhandener Ressourcen im Rahmen der Lebensführung in Quellen eigener Handlungsfähigkeit unterstützen, was wiederum als (Welt-)Aneignung und (Welt-)Gestaltung verstanden werden kann. Im Sinne des oben skizzierten handlungstheoretischen Rahmens ginge es also sowohl darum, die Ressourcen im Bereich des persönlichen wie auch im Bereich des gesellschaftlichen Möglichkeitsraums zu verbessern.
2.4.2 (Welt-)Aneignung
Aneignung spielt als Prinzip der Sozialraumorientierung eine ebenfalls bedeutende Rolle, da mit ihr das gestalterische, die Umwelt interaktiv formende Element deutlich hervortritt. Hüllemann, Reutlinger und Deinet diagnostizieren eine interdisziplinäre und „vielschichtige, facettenreiche und selten terminologische Verwendung im Sinne eines einheitlich-systematischen Fachbegriffs“ (Hüllemann et al. 2017, 2), die jedoch in den allermeisten Fällen werkursprünglich auf die kulturhistorische Schule der sowjetischen Psychologie nach Lev Vygotskji und Alexej Leontjew und die kritische, subjektwissenschaftliche Psychologie Klaus Holzkamps verweist. Hervorzuheben sind die dominanten Nutzungsformen in der Stadtplanung bzw. Architektur und im Bildungssektor. Einmal geht es also um die Frage, wie Menschen sich die bebaute Umwelt aneignen können bzw. wie die architektonische Planung eine möglichst menschenfreundliche Wohn- und Lebensqualität in Städten garantieren kann (Raumaneignungsvariante), zum anderen darum, wie Menschen sich verschiedenste Bildungsmaterialien, Themen und Wissen aneignen können. Letzteres spiegelt sich in einer möglichst guten methodisch-didaktischen Lehrplanung wider, aber auch in der Gestaltung einer förderlichen Lernumgebung (Kap. 2.5).
May (2018, 145) argumentiert, Lefèbvre folgend, dafür, den Raum als Repräsentationsraum verschiedener und durchaus divergierender Lebenserfahrungen und Interesse zu konzipieren. Dies bedeutet, dafür zu sorgen,
„dass alle an diesen Aushandlungsprozessen Beteiligten […] die gleichen Chancen haben, ihre Bedürfnisse und Interessen zur Geltung zu bringen. Bei Menschen, die bisher gerade darin behindert wurden, erfordert dies, ihnen immer wieder über Sozialraumentwicklung Gelegenheiten zu eröffnen, sich räumlich wie sozial einen ihnen angemessenen Rahmen zu einer Selbstvergewisserung zu schaffen“ (May 2018, 149; Hervorheb. i. O.).
Darüber hinaus ist es nötig, sie so zu stärken, dass sie ihre Stimme einbringen können.
Aneignung kann zudem philosophisch verstanden werden als der Kern der Vita Activa (Arendt 1960), der exzentrischen Positionalität des Menschen (Plessner 1965) bzw. dem Kant’schen Verständnis des vernunftbegabten Wesens oder auch der Aristotelischen Idee des ‚zoon politicon‘ folgend. In all diesen Menschenbildern drückt sich aus, dass Menschen aktive Wesen sind, die nicht nur in direkter, nicht-bewusster Interaktion mit ihrer Umwelt leben, sondern diese seit frühester Zeit prägen und gestalten. So kommt dann neben die Raumaneignung und die Bildung (verstanden als Lernprozess) auch die Arbeit ins Spiel. Im Prozess der Arbeit, hier verstanden als produktiver Auseinandersetzung mit der Welt und nicht nur im funktionalen Sinne als Erwerbs- oder Carearbeit, wird der Mensch in höchstem Maße aktiv und verändert seine Welt, indem er „Dinge“ (materiell wie immateriell) herstellt, sie anwendet, damit handelt usw. Arbeit ist damit, so Marx,
„zunächst ein Prozeß zwischen Mensch und Natur, ein Prozeß, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigne Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für sein eignes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigne Natur.“ (Marx 1972, 192)
Dabei ist grundsätzlich von einer Wechselwirkung von Akkommodation und Assimilation, um einmal die Piaget’schen Begriffe zu benutzen, auszugehen. D. h. Menschen werden kognitiv, emotional, sozial und kulturell von einer Umgebung beeinflusst, die sie immer auch schon selbst gestaltet haben, oder – um es mit Pestalozzi zu sagen:
„Soviel sahe ich bald, die Umstände machen den Menschen, aber ich sahe eben sobald, der Mensch macht die Umstände, er hat eine Kraft in sich selbst, selbige vielfältig nach seinem Willen zu lenken. So wie er dies tut, nimmt er selbst Anteil an der Bildung seiner selbst und an dem Einfluss der Umstände, die auf ihn wirken.“ (Pestalozzi 1797 / 2002, 50)
Hüllemann, Reutlinger und Deinet diskutieren dieses Verhältnis bzw. die Aneignungsprozesse noch entweder als „einseitigen Einschreibeprozess“ (Hüllemann et al. 2017, 4) oder als „wechselseitigen Vermittlungsprozess zwischen Aneignungssubjekt und Aneignungsobjekt“ (Hüllemann et al. 2017, 5). Wir sehen Aneignung im Anschluss an die letztere Bestimmung als einen bipolaren Prozess der wechselseitigen Anpassung des Menschen an die Umwelt und die Anpassung der Umwelt an den Menschen, von ihm so geformt, dass sie seine Bedürfnisse befriedigen kann. Im Sinne des Capabilities Approachs bzw. der daraus abgeleiteten Theorie daseinsmächtiger Lebensführung (übrigens auch des sozialökologischen Ansatzes, vgl. hierzu Germain / Gitterman 1999, Gitterman / Germain 2008, Wendt 2010, 2018) kann dies als Gegenstand Sozialer Arbeit gedeutet werden: Einerseits die Unterstützung von Menschen, handlungsfähiger zu werden, und andererseits die Gestaltung der Umwelt(en), damit sie handlungsfähig sein können (Röh 2013, insb. 177 ff. und 225 ff.; siehe auch Kap. 2.3).
Für die Sozialraumorientierung in der Eingliederungshilfe lassen sich eine Raumaneigungsvariante und eine Bildungsvariante sowie die vermittelnde Position der wechselseitigen Einflussnahme von Menschen und Umwelten unterscheiden. Die Teilhabe an Bildung ist also über funktionale oder formale Prozesse des Erwerbs von Bildungsabschlüssen hinaus für die Weltaneignung von Bedeutung. Zudem haben die Möglichkeit und Notwendigkeit der Raumaneignung sehr direkte Auswirkungen auf die Mobilität behinderter Menschen bzw. die Zugänglichkeit von Gebäuden, die – jenseits digitaler bzw. virtueller Teilhabe – weitere Möglichkeiten oder Begrenzungen von Teilhabe erzeugen. Neben diesen Aneignungssphären werden die damit im Zusammenhang stehenden Bedingungen, in soziale Beziehungsformen einzutreten, behindert. Die Aneignung eines Raumes, sei er privat oder öffentlich, hängt immer auch davon ab, welche soziale Position ich innehabe, d. h. über welche Macht ich zur Gestaltung von Beziehungssituationen und den Regeln des sozialen Zusammenlebens verfüge. In ähnlicher Weise verweist die zentrale Funktion der Arbeit als Aneignung auf die hohe Bedeutung derselben für behinderte Menschen, die häufig von dieser Aneignungssphäre ausgeschlossen oder in ihren Wahlmöglichkeiten, was, wo und wie sie arbeiten wollen, eingeschränkt sind.
2.4.3 Empowerment
Mit dem Empowermentprinzip, wahlweise zu übersetzen mit Selbstbemächtigung oder Selbstbefähigung („power“ als Ausdruck von Macht oder „power“ als Ausdruck von Fähigkeit), liegt ein weiteres wichtiges Merkmal der Sozialraumorientierung vor, das in der Praxis wie auch in der Literatur der Sozialen Arbeit hinlänglich fest verankert ist (Herriger 2014, Knuf 2016, Schwalb / Theunissen 2018). Doch was ist Empowerment? Julian Rappaport, der es als einer der ersten aus gemeindepsychologischer Sicht betrachtete, hält fest: „You have trouble defining it, but you know it, when you see it“ (Rappaport 1985a, 17). Mit Stark würde man es sehen, wenn man sich folgende Frage vor Augen führt:
„Unter welchen Bedingungen gelingt es Menschen, sich aus einer machtlosen und demoralisierenden Situation heraus zu entwickeln, die eigene Stärke zusammen mit anderen zu erkennen und durch ihr Handeln ihre soziale Umgebung und Lebensbedingungen zumindest teilweise nach ihren Vorstellungen zu gestalten?“ (Stark 1993, 41)