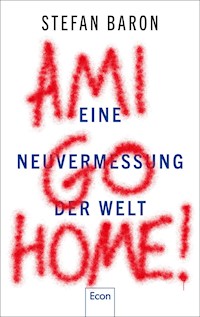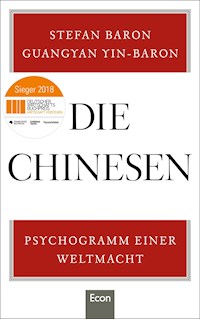19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Er stand im Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik wie kein zweiter Topmanager in diesem Lande. Josef Ackermann, bis 2012 Vorstandschef der Deutschen Bank, hat turbulente Jahre hinter sich: Sein Victory-Zeichen und das Renditeziel von 25 Prozent machten ihn für viele zum Buhmann der Nation. Auch seine Rolle bei der Finanzkrise ist umstritten: Hat er die Misere mit verursacht oder das Schlimmste verhindern können und bei der Überwindung entscheidend mitgeholfen? Stefan Baron, Kommunikationschef der Deutschen Bank während der Krisenjahre, liefert eine bestechend scharfe Nahaufnahme Ackermanns. Kaum einer kennt seine Überzeugungen, seine Stärken und Schwächen so gut wie er. Aus nächster Nähe schildert Baron, wie Ackermann sich und seine Haltung unter dem Eindruck des Jahrhundertereignisses verändert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
STEFAN BARON
SPÄTE REUE
JOSEF ACKERMANN
EINE NAHAUFNAHME
Econ
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Econ ist ein Verlagder Ullstein Buchverlage GmbH
ISBN: 978-3-8437-0592-9
© der deutschsprachigen AusgabeUllstein Buchverlage GmbH, Berlin 2013Redaktionsschluss: 15. Juli 2013
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden
Für Guangyan und Lea Bowen
Inhalt
Einführung Wie alles begann
Kapitel 1 Tanzen solange die Musik spielt
Kapitel 2Biedermänner und Brandstifter
Kapitel 3Zerstörerische Schöpfung
Kapitel 4Der Kompass fürs Leben
Kapitel 5Erkenntnis und Interesse
Kapitel 6Blick in den Abgrund
Kapitel 7Zwischen Triumph und Demut
Kapitel 8Der schlimmste Tag
Kapitel 9Spitzel und Streubomben
Kapitel 10Kampf ums Erbe
Kapitel 11Vom Banker zum Staatsmann
Kapitel 12Was bleibt
NachwortBilanz eines Seitenwechsels
Tafelteil
Literatur
Abbildungsnachweis
Anzeigen
Einführung Wie alles begann
Josef Ackermann lächelte sein berühmtes Joe-Lächeln, erhob sich, gab mir die Hand und sagte: »Dann auf Wiedersehen in Frankfurt.« Bevor der Mann, der mich gerade als neuen Kommunikationschef eingestellt hatte, die Cafébar im Parkhotel am Ende der Düsseldorfer Königsallee verließ, fragte er mich noch, ob ich die Rechnung übernehmen könne, er habe leider kein Bargeld dabei.
Glück gehabt, dachte ich, denn ich führe selbst auch nur selten Bares mit mir. Doch an diesem Morgen hatte mir eine innere Stimme geraten, ein paar Scheine einzustecken. Genug für die zwei Cappuccini und Croissants, die wir verzehrt hatten. »Ich erledige das«, erwiderte ich, und so konnte der Chef der Deutschen Bank ohne weitere Umstände die gepanzerte schwarze S-Klasse-Limousine ansteuern, die vor dem Eingang auf ihn wartete, um ihn zum nächsten Termin zu bringen.
Auf dem Weg in die WirtschaftsWoche-Redaktion über die schon leicht frühlingshafte »Kö« wurde mir langsam bewusst, was an diesem Morgen im März 2007 geschehen war: Mit 59 Jahren, einem Alter, in dem viele schon in den Vorruhestand wechseln, hatte ich mich auf das größte Abenteuer meines Berufslebens eingelassen. Fast drei Jahrzehnte war ich, mit Leib und Seele Journalist, gegenüber allen Lockrufen, die Seiten zu wechseln, standhaft geblieben. Und nun hatte ich mich binnen einer knappen Stunde anders entschieden und bereit erklärt, die Kommunikation für Deutschlands am meisten angefeindetes Unternehmen und umstrittensten Manager zu übernehmen.
Alles war rasend schnell gegangen. Nur zwei Tage zuvor war ich von einem alten Bekannten überraschend mit der Anfrage konfrontiert worden und hatte aus Neugier, ob das wirklich ernst gemeint war, grundsätzliches Interesse signalisiert. Wie ernst das Ganze war, merkte ich, als mich schon tags darauf die Bitte erreichte, am folgenden Morgen Josef Ackermann zum Frühstück zu treffen. Nun musste ich mir wirklich Gedanken machen.
Journalist zu sein war für mich (und ist es bis heute) der schönste Beruf der Welt. Aber nach 16 Jahren als Chefredakteur der WirtschaftsWoche war manches zur Routine geworden. Die strukturelle Krise der Printmedien ließ meine Arbeit überdies mehr und mehr zu einem Rückzugsgefecht werden – keine erfreuliche Aussicht für jemanden, der bisher immer nur die Offensive gekannt hatte. Schon vor diesem Hintergrund entfaltete die Perspektive eines Wechsels ihren Charme.
Dieser wurde durch die spezifische Anziehungskraft der Deutschen Bank noch beträchtlich verstärkt. Kein anderes Unternehmen zwischen Flensburg und Garmisch erfährt auch nur annähernd so viel öffentliche Aufmerksamkeit. Das Institut, 1870 auf »allerhöchsten Erlass Seiner Majestät des Königs von Preußen« in Berlin gegründet, ist nicht nur Deutschlands Geldhaus Nummer eins und dazu das einzige von Weltformat, sondern das wichtigste und mächtigste Unternehmen des Landes, eine nationale Institution, mehr noch: ein Mythos. Und sein Chef gilt als eine Art Schattenkanzler der Republik.
Als langjähriger Kunde und vor allem durch meine Zeit als Finanzkorrespondent des Spiegel in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre fühlte ich mich der Bank zudem besonders verbunden. Trotz aller kritischen Distanz hatte ich einen kurzen Draht zu dem seinerzeitigen Vorstandssprecher, Alfred Herrhausen, gepflegt und wenige Wochen vor seiner Ermordung durch die linksterroristische Rote Armee Fraktion (RAF) noch eine Titelgeschichte (»Der Herr des Geldes«) über ihn verfasst. Nicht zuletzt auch deswegen war mir sein Tod sehr nahegegangen.
Mit der sich beschleunigenden Globalisierung sowie der forcierten Marktliberalisierung durch die britische Premierministerin Maggie Thatcher im Verein mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan hatten damals die goldene Ära für die Finanzbranche und der Aufstieg der Investmentbanker zu den »Masters of the Universe« begonnen. Es waren spannende Jahre für einen jungen Wirtschaftsjournalisten, an die ich gerne zurückdachte. An sie anknüpfen zu können, machte einen Wechsel ebenfalls verlockend.
Dann war da natürlich die hervorragende Bezahlung und – Josef Ackermann. Seit seinem unseligen Victory-Zeichen zur Eröffnung des Mannesmann-Prozesses galt er vielen als »Buhmann der Nation« (Stern).
Im Frühjahr 2000 hatte der britische Telefonriese Vodafone die Mehrheit an dem Konkurrenten Mannesmann übernommen. Der Abwehrkampf war heftig, der Börsenwert des Düsseldorfer Unternehmens dadurch deutlich gestiegen. Zur Belohnung hatte der Deutsche-Bank-Chef als Mitglied des Aufsichtsratspräsidiums gemeinsam mit dem Vorsitzenden Joachim Funk und dessen Stellvertreter, dem IG-Metall-Funktionär Klaus Zwickel, Sonderprämien für Vorstandschef Klaus Esser, Funk selbst und andere Mitarbeiter in Höhe von insgesamt 57 Millionen Mark bewilligt.
Die drei Millionen davon für Funk kamen einer glatten Selbstbegünstigung gleich. Der Schweizer verspürte dabei offenbar selbst ein ungutes Gefühl, wie er mir später sagte, verdrängte es jedoch. Um einen »Affront« zu vermeiden, habe er der Bitte Funks nachgegeben. Er hätte sie abschlagen müssen.
Für Ackermann waren solche Zahlungen allerdings nichts Ungewöhnliches und auch die Beträge, um die es ging, eher klein. Allein Frank Newman, dem ehemaligen Chef der New Yorker Investmentbank Bankers Trust, hatte die Deutsche Bank nach der Übernahme des Geldhauses 1999 zuerst fürs Bleiben und später fürs Gehen insgesamt rund 100 Millionen Dollar bezahlt.
Die Staatsanwälte beeindruckten derartige internationale Gepflogenheiten jedoch nicht. Sie warfen dem Deutsche-Bank-Chef und den anderen Beteiligten »Untreue in besonders schwerem Fall« vor. Ein Delikt, auf das eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren steht.
Am 21. Januar 2004, dem Eröffnungstag des Prozesses vor dem Düsseldorfer Landgericht, entstand das dem beteiligten Strafrechtsanwalt Rainer Hamm zufolge »wohl am meisten missdeutete Pressefoto« der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Beim Warten auf die verspäteten Richter im Saal L111 des Gerichts vertrieben sich die Angeklagten mit Smalltalk die Zeit und kamen dabei auf den amerikanischen Popstar Michael Jackson zu sprechen. Nur fünf Tage zuvor hatte der bei der Eröffnung seines Prozesses wegen des Vorwurfs der Kindesmisshandlung das Gericht warten lassen und beim Verlassen des Gerichts auch noch das Victory-Zeichen gemacht. Josef Ackermann ahmte das im Spaß nach und wurde dabei von dem dpa-Fotografen Oliver Berg abgelichtet.
Der Schnappschuss ging um die Welt. Da der Hintergrund nicht bekannt war, wurde Ackermanns V-Zeichen von der deutschen Öffentlichkeit auf sein eigenes Verfahren bezogen. Ein Sturm der Entrüstung brach los. »Obszön«, kommentierte die Süddeutsche Zeitung. »Ackermann hat verloren, selbst wenn er den Prozess gewinnt«, schrieb der Spiegel in einer Titelgeschichte. Überschrift: »Die Arroganz der Mächtigen«.
Das fatale Missverständnis hätte sich mit einer raschen persönlichen Erklärung vielleicht noch aus der Welt schaffen lassen. Die Äußerung des Schweizers beim Verlassen des Gerichtssaals, wonach Deutschland »das einzige Land« sei, »in dem diejenigen, die Werte schaffen, bestraft« würden, machte das jedoch unmöglich. Damit habe der Chef der Deutschen Bank, so die Süddeutsche, seine »Verachtung« auch gegenüber denen zum Ausdruck gebracht, »die für kleines Geld schuften und Werte schaffen«.
Von einem Tag auf den anderen war Josef Ackermann in Deutschland als Bösewicht abgestempelt und zum hässlichen Gesicht des Kapitalismus geworden. Daran hatte auch sein Freispruch gegen eine Geldauflage in Höhe von 3,2 Millionen Euro fast drei Jahre später nichts geändert.
Schlimmer konnte es kaum mehr kommen, dachte ich. Die Popularitätskurve des Schweizers besaß viel Aufwärtspotential.
Ein Artikel der WirtschaftsWoche im August 2000 war der Auslöser dafür, dass Josef Ackermann fast zwei Jahre vor dem planmäßigen Ausscheiden von Rolf-Ernst Breuer zu dessen Nachfolger gekürt worden war. Mein damaliger Kollege Dirk Schütz, heute Chefredakteur des Zürcher Wirtschaftsmagazins Bilanz, hatte darin beschrieben, dass im Vorstand der Bank auch Thomas Fischer Ambitionen auf den Spitzenplatz hegte.
Ackermann muss bei der Lektüre ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt haben. Schon einmal, bei seinem vorherigen Arbeitgeber, der Schweizerischen Kreditanstalt, heute Credit Suisse, waren seine Hoffnungen kurz vor dem Ziel geplatzt. Er hatte seine Vorstellungen für eine Universal-Bank aus Privatkundengeschäft, Vermögensverwaltung und Investmentbanking nicht durchsetzen können und die Bank verlassen, in der er in wenigen Jahren vom Assistenten zum Präsidenten der Generaldirektion aufgestiegen war.
Der WirtschaftsWoche-Artikel ließ auch seine Londoner Deutsche-Bank-Kollegen um Edson Mitchell, den damaligen Leiter des wichtigen Wertpapierhandelsgeschäfts, unruhig werden. Sie wollten an der Spitze des Instituts jemanden haben, der sie verstand und unterstützte. Die Gewähr dafür bot in ihren Augen nur der Schweizer.
Nach dem Sommerurlaub forcierten sie die Diskussion über die Nachfolge Breuers und machten dabei keinen Hehl daraus, wo ihre Sympathien lagen. Die meisten im Führungsgremium der Bank seien der Meinung gewesen, dass das Haus jetzt »nicht zwei Jahre lang eine Nachfolgediskussion führen könne«, erinnert sich Ackermann. Auf Vorschlag seines dienstältesten Mitglieds, Tessen von Heydebreck, stimmte der Vorstand, einschließlich Fischer, für den Schweizer als nächsten Deutsche-Bank-Chef. Fischer übernahm später die Führung der WestLB.
Bis zu unserem gemeinsamen Frühstück in Düsseldorf waren Josef Ackermann und ich uns nur einige wenige Male begegnet: Ich erinnere mich an ein eher flüchtiges Zusammentreffen im November 2003, als sich Jean-Claude Trichet im Schlosshotel in Kronberg der deutschen Finanzelite als neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) vorstellte. Etwas Smalltalk nach dem Abendessen – das war’s.
Das nächste Mal sahen wir uns im Rahmen des jährlichen Führungstreffens der Verlagsgruppe Holtzbrinck, zu der die Wirtschaftswoche damals gehörte, an einem Wochenende im März 2005 im noch tiefverschneiten Kitzbühel. Der Deutsche-Bank-Chef war als Promi-Gast eingeladen. Ich weiß noch, wie verblüfft wir alle registrierten, dass er ohne jede Begleitung kam, am Abend in Rosi’s Sonnbergstuben kräftig mitbecherte und sich – es ging schon gegen Morgen – ohne Berührungsängste zu »Anton aus Tirol« in die Abschluss-Polonaise einreihte.
Am intensivsten habe ich die Begegnung im September des gleichen Jahres bei einem Interview im A-Turm der Bank in Frankfurt in Erinnerung. Ackermann fand im Verlaufe des Gesprächs spontan Gefallen an dem Etikett »Let the good times roll«, das ich damals seiner opportunistischen Fokussierung auf die hochprofitable Investmentbank aufgeklebt hatte. Als das Mikrofon abgestellt war, unterhielten wir uns noch eine Weile über mein Ökonomie-Studium in Köln und die Jahre als Wirtschaftsforscher am Kieler Institut für Weltwirtschaft.
Josef Ackermann und ich haben vieles gemeinsam: Wir sind fast auf den Tag gleich alt (ich bin einen Tag älter), wuchsen beide in kleinen, einst prosperierenden Landgemeinden auf, in denen wir schon in unserer Jugend erleben konnten, wie die zunehmende Globalisierung einen tiefgreifenden Strukturwandel erzwang. Wir wurden von streng-fürsorglichen Eltern aus der katholischen Mittelschicht zu Leistungsbereitschaft, Selbstverantwortung und Weltoffenheit erzogen; auf dem humanistischen Gymnasium und im Studium der Volkswirtschaft haben wir schließlich auch dieselbe Ausbildung erfahren. Kurz: Wir verstanden uns ohne viele Worte. Das gab schließlich den Ausschlag für meine Bereitschaft, mit fast 60 beruflich noch einmal neu durchzustarten, die Seiten zu wechseln und aus der ersten Reihe wieder zurück ins Glied zu treten.
Als der Schweizer 2002 die Chefposition in Frankfurt übernahm, wollte er nur Banker sein. Sein Ziel: das Haus, das damals operativ kaum Geld verdiente und als Übernahmekandidat galt, auf Vordermann bringen und in die globale Spitzengruppe der Investmentbanken führen. Die weltweit wohl einmalige politische Rolle der Bank als Anführer der nationalen Wirtschaft und ihrer Chefs als Kanzlerberater sowie das damit verbundene besondere Medieninteresse auf ihrem Heimatmarkt waren ihm als erstem Ausländer an der Spitze des Geldhauses fremd. Zudem glaubte er, der erst mit fast 50 Jahren nach Deutschland gekommen war und dort über keinerlei persönliches Beziehungsnetzwerk verfügte, öffentlich besondere Zurückhaltung an den Tag legen zu müssen. Dies war ihm auch von Beratern empfohlen worden.
Im Verlauf des Mannesmann-Prozesses wurde dem Schweizer jedoch bewusst: Wenn er Erfolg haben und auch von den Deutschen geschätzt werden wollte, musste er die besondere politische und gesellschaftspolitische Rolle annehmen, die dem Chef der Deutschen Bank nun einmal zugeschrieben wurde. Er musste sein Netzwerk im Lande enger knüpfen sowie seine Kommunikation intensivieren und neu ausrichten. Auf dieser Basis fanden wir zusammen.
Einmal zum Wechsel entschlossen, wollte ich die neue Position möglichst schnell antreten. Mein Verleger, Stefan von Holtzbrinck, war jedoch alles andere als erfreut über die Abwanderungsabsicht und pochte zunächst vehement darauf, dass ich meinen noch über ein Jahr laufenden Vertrag einhielt. Das hätte das Aus für meine Zukunftspläne bedeutet. Erst einige Telefonate zwischen den Chefetagen in Frankfurt und Stuttgart, der Zentrale der Holtzbrinck-Gruppe, machten schließlich den Weg frei.
Und so nahm am 1. Juni 2007 das Abenteuer seinen Lauf, das dann noch viel größer werden sollte, als ich es mir selbst in den wildesten Träumen je hätte vorstellen können. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich nämlich noch nichts von dem Jahrhundert-Beben, das die Finanzbranche schon bald bis auf die Grundfesten erschüttern würde.
Wieder einmal erwies sich dabei aber, dass Krise immer auch Chance bedeutet. Josef Ackermann sah sich vor die Herausforderung seines Lebens gestellt – und er zeigte sich ihr gewachsen. Es war sein Rendezvous mit der Geschichte. Der Schweizer, der die Deutsche Bank mit ehrgeizigen Renditevorgaben in die Spitzengruppe der globalen Investmentbanken geboxt hatte, erkannte lange vor den meisten seiner Kollegen das Ausmaß der drohenden Gefahr, brachte sein Institut vergleichsweise unbeschadet durch die Krise und richtete es anschließend für die Zukunft neu aus.
Darüber hinaus zeigte er als erster Topbanker Reue über die Fehlentwicklungen in seiner Branche und auch in seinem Hause, übte öffentlich Selbstkritik und drängte als Präsident des Welt-Bankenverbands IIF auf umfassende Reformen. Er trat für eine konsequente Rückbesinnung auf den Kunden und auf die gesellschaftliche Verantwortung der Banken ein und wirkte selbst an vorderster Stelle bei der Bewältigung sowohl der großen Finanz- wie der anschließenden Staatsschuldenkrise in Europa mit.
Gewiss, Josef Ackermanns Reue kam erst, als der Schaden größtenteils bereits angerichtet war. Aber werden wir nicht alle meist erst aus Schaden klug? Was aus Sicht der Gesellschaft im Nachhinein als spät, vielleicht zu spät erscheinen mag – für einen führenden Banker war es sehr früh. Und: Die Umkehr war ehrlich gemeint, auch wenn sie dem Schweizer die Möglichkeit bot, sein arg ramponiertes Ansehen aufzupolieren, also nicht allein auf uneigennützige Motive zurückging.
Auf der Hauptversammlung am 31. Mai 2012 wurde Josef Ackermann trotz des absolut unbefriedigenden Aktienkurses, des Hickhacks um seine Nachfolge und zahlreicher hässlicher Rechtsstreitigkeiten von 7000 Aktionären mit stehendem Beifall verabschiedet. Er war im Verlaufe der Krise »vom Buhmann zum Popstar der Finanzbranche« (Handelsblatt) geworden.
Das vorliegende Buch soll diese bemerkenswerte Wandlung, ihre Hintergründe und Voraussetzungen, Begleitumstände und Folgen beschreiben. Es ist eine Geschichte von Kampf und Wettbewerb, Triumph und Enttäuschung, Ruhm und Schmach, Rampenlicht und Einsamkeit. Es ist das Porträt eines Menschen in seinen Zeitverhältnissen, einer ebenso vielschichtigen wie herausragenden Persönlichkeit, deren Ausstrahlung selbst seine Gegner immer wieder in ihren Bann zieht. Es ist ein Stück Finanzgeschichte. Und ein Stück Sittengeschichte der Geldbranche.
Ich bin Josef Ackermann nach wie vor eng verbunden und berate ihn weiter in Kommunikationsfragen. Dieses Buch ist gleichwohl keine autorisierte Biographie, sondern ein subjektiver Erfahrungsbericht aus meiner Zeit an seiner Seite, eine Nahaufnahme der bestimmenden Jahre seines beruflichen Lebens.
Als langjähriger Journalist weiß ich, wie wichtig es ist, bei aller Nähe zum und Sympathie für das Objekt der Beschreibung, kritische Distanz zu wahren. Diese habe ich auch in meiner Zeit bei der Deutschen Bank gehalten. Und es ist beiden Seiten, so denke ich, gut bekommen.
Inwieweit es mir in diesem Buch geglückt ist, den richtigen Abstand zu finden, bleibt dem Urteil des Lesers überlassen. »Jede Wirklichkeit besteht aus zwei Hälften, dem Subjekt und dem Objekt«, so der Philosoph Arthur Schopenhauer in seinen »Aphorismen zur Lebensweisheit«. »Bei völlig gleicher objektiver Hälfte, aber verschiedener subjektiver, ist daher die gegenwärtige Wirklichkeit eine ganz andere.«
Dieses Buch ist meine Wirklichkeit von Josef Ackermann.
Köln, im Sommer 2013
Kapitel 1 Tanzen solange die Musik spielt
Meine Taufe als Kommunikationschef der Deutschen Bank gerät zur Feuertaufe. Ich bin gerade einige Wochen in den blauen Doppeltürmen in Frankfurt, als die größte Finanzkrise seit den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts ausbricht. Später zieht sie die Staatsschuldenkrise in Europa nach sich. Unter beiden leidet die Welt noch heute.
Der Ausbruch der Krise verbindet sich in Deutschland mit dem Beinahe-Zusammenbruch der Industriekreditbank (IKB) Ende Juli 2007, die bis dahin als grundsolider, ja geradezu langweiliger Mittelstandsfinanzier betrachtet worden war. Die Zentrale des Instituts, das 1924 zur Abwicklung deutscher Reparationsleistungen aus dem Ersten Weltkrieg gegründet worden war, befand sich bis zur Mitte des vergangenen Jahrzehnts in der Kasernenstraße in Düsseldorf, genau gegenüber dem Verlagshaus der Handelsblatt-Gruppe, zu der auch die WirtschaftsWoche gehört. Die Bankmitarbeiter, die wir dort ein- und ausgehen sahen und denen wir in der Mittagszeit in den umliegenden Lokalen begegneten, wirkten auf uns Journalisten so bieder, dass niemand auf die Idee kam, in diesem Hause könnte ein großes Rad gedreht werden.
Dennoch war genau dies der Fall. Direkt vor unsere Nase. Zwar hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Bonn auch nichts gemerkt, aber das macht die Sache nicht besser. Ich gräme mich noch heute darüber, dass wir nicht entdeckten, was in dem Rundbau auf der anderen Straßenseite vor sich ging und wie wir uns von Äußerlichkeiten und Klischees täuschen ließen.
Schon im Februar 2004 hatte das Fachmagazin Risk in einem dreiseitigen Artikel mit der Überschrift »The Great German Structured Credit Experiment« die Warnflagge gehisst: »Der konservative Mittelstandsfinanzier IKB«, so die Zeitschrift, »hat sich in Deutschlands größten Anleger für strukturierte Kreditprodukte verwandelt – mit einer Neigung zu riskanteren Geschäften«. Das hätte eigentlich genügen müssen, um hellhörig zu werden, unsere Nachbarn mit anderen Augen zu betrachten, sie und die ganze Branche stärker zu hinterfragen.
Auch dem Jahresabschluss und Lagebericht 2006/ 2007 der Bank selbst war zu entnehmen, welches Risiko sie eingegangen war. Man musste nur genau hinschauen. »In dem Posten ›Andere Verpflichtungen‹ sind Kreditzusagen über insgesamt 8,1 Milliarden Euro Gegenwert an Spezialgesellschaften enthalten«, heißt es dort auf Seite 57. Das Eigenkapital der Düsseldorfer dagegen: ganze 1,2 Milliarden Euro.
Als langjähriger Wirtschaftsjournalist habe ich mich später in der Krise, als ein Erdbeben nach dem anderen das Finanzsystem erschüttert und es fast zum Einstürzen bringt, immer wieder gefragt, wie so vielen Wirtschaftsmedien rund um die Welt die größte Geschichte des Jahrhunderts durchgehen konnte. Wie wir, von wenigen Ausnahmen abgesehen, als Profession kollektiv so versagen, ja für die gigantische Finanzblase, die sich vor unseren Augen aufblähte, insgesamt »mehr als Cheerleader denn als Bremser« agieren konnten. So sieht es jedenfalls Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph E. Stiglitz in einem Beitrag zu dem Sammelband »Bad News – How America’s Business Press Missed the Story of the Century«, den Anya Schiffrin von der New Yorker Columbia University herausgegeben hat.
Lag es vielleicht auch daran, dass die Branche schon seit Jahren in einem tiefgreifenden Strukturwandel steckt und viele Medien in einem teilweise ruinösen Wettbewerb ums nackte Überleben kämpfen müssen? Für gründliche Recherche und entsprechende Urteilsbildung daher vielfach keine Zeit mehr bleibt?
Wo die Ressourcen fehlen, selbständig Fakten herbeizuschaffen, liegt die Flucht in die schnelle Meinung nahe, die leicht und billig zu produzieren ist, aber ebenso schnell auch wieder vergessen wird. Oder die Verlockung, sich vom Objekt seiner Beobachtung »einbetten« zu lassen, die aber Glaubwürdigkeit kostet. Beides hat schwerwiegende Folgen für die Rationalität und Effizienz unserer Gesellschaft. Demokratie und Marktwirtschaft, Wahlfreiheit und Konsumentenhoheit basieren darauf, dass sich Staatsbürger und Marktteilnehmer ein einigermaßen zutreffendes Bild von der Wirklichkeit machen können.
Das war in den Jahren vor der Finanzkrise nicht der Fall. Dabei hatte es an Warnzeichen keineswegs gefehlt. Da waren die zunehmenden Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen, allen voran das Riesendefizit der USA und der gigantische Überschuss Chinas; die enormen Kapitalzuflüsse nach Amerika und das billige Geld; das explosive Wachstum des Finanzsektors, speziell von neuartigen, weitgehend intransparenten Kreditinstrumenten und Schattenbanken; die durch Schulden aufgeblähten Bankbilanzen und Staatshaushalte; das schwindende Risikobewusstsein infolge der Verbriefung von Krediten; die Immobilienblase, hohe private Verschuldung und dürftige Qualitätsstandards für Hypothekenkredite in den USA und manches mehr.
Aber alle Warnsignale wurden in den Wind geschlagen. Von Bankmanagern, aber auch von denen, die sie kontrollieren sollen: von Aufsichtsräten und Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfern und Ratingagenturen – und eben auch, bis auf wenige Ausnahmen, von den Medien.
Anfang Februar 2007 fragt Maria Bartiromo (Spitzname: »Money Honey«), Starmoderatorin des US-Börsensenders CNBC, auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Bergstädtchen Davos prominente Unternehmenschefs wie immer nach dem wichtigsten Thema für das gerade begonnene Jahr. Nur ein einziger von ihnen, so berichtet sie später in ihrem Buch über die Finanzkrise (»The Weekend That Changed Wall Street«), nennt die zu hohe Verschuldung auf dem US-Immobilienmarkt: Josef Ackermann.
Aber nicht etwa, weil er das drohende Unheil ahnt. Als Bartiromo später nach Ausbruch der Krise von dem Deutsche-Bank-Chef wissen will, ob er das Unglück damals schon herannahen sah, gibt er ehrlich zu: »Wir wussten etwas, aber nicht viel. Ich habe die Finanzkrise nicht vorausgesehen.« In einer boomenden Wirtschaft seien Immobilienblasen und zu hohe Verschuldung immer ein Problem. »Blasen sind besonders gefährlich, wenn sie mit einer hohen Verschuldung verbunden sind«, so lautet auch eine der zentralen Schlussfolgerungen von Carmen M. Reinhart und Kenneth S. Rogoff aus ihrer Analyse von Finanzkrisen in den letzten 800 Jahren (»This Time is Different – Eight Centuries of Financial Folly«).
Nach dem traumatischen Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 war es den Amerikanern so leicht wie nie gemacht geworden, auf Pump ein Haus zu kaufen. Ohne Sicherheiten, vielfach auch ohne Einkommen. Die Darlehen hießen dann Ninja-Kredite für »No income, no job, no assets«.
Präsident George W. Bush hatte die »Ownership Society«, eine Gesellschaft von Eigentümern, ausgerufen, um das Volk trotz Terrorattacken und Irak-Kriegs bei Laune zu halten. Solange die Immobilienpreise stiegen und die Zinsen bei einem Prozent blieben, waren die laxen Standards kein Problem, die Häuser bezahlten sich quasi von selbst. 2006 aber hörten die Preise wegen des wachsenden Überangebots auf zu steigen. Dann begannen sie, vor allem im sogenannten Subprime-Segment finanzschwacher Käufer, hier und da zu fallen, die Zinsen zogen dagegen an. Zwangsversteigerungen häuften sich, die Blase drohte zu platzen.
Noch aber ist es nicht so weit, als ich bei der Deutschen Bank anfange. Und auch für meinen Chef gilt, was sein damaliger Citibank-Kollege Chuck Prince so trefflich auf den Punkt gebracht hatte: »Solange die Musik spielt, muss man aufstehen und tanzen.« Anders ausgedrückt: Wer sich zu früh aus einem gut laufenden Geschäft zurückzieht, verzichtet auf Profit, riskiert den Verlust von Marktanteilen und womöglich sogar die Eigenständigkeit.
Die Musik spielt im Juni 2007 noch. Im ersten Vierteljahr hatte die Deutsche Bank mit 3,2 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern gerade einen neuen Rekord in ihrer langen Geschichte aufgestellt. Ein Detail war dabei allerdings weithin unbeachtet geblieben: 200 Millionen Euro des Ergebnisses gingen allein auf Greg Lippmann zurück, den in New York tätigen Chefhändler für sogenannte forderungsunterlegte Wertpapiere, im Fachjargon Asset-Backed Securities (ABS). Dessen Kollege Eugene Xu, ein promovierter Mathematiker aus Schanghai, hatte als Analyst schon im September 2005 einen rapiden Anstieg der Pleiten von Hauskäufern im Subprime-Segment vorausgesagt. Damit verbunden, so seine Prognose, käme es zu einem Preisverfall der mit Hypothekenkrediten an Schuldner minderer Qualität unterlegten Papiere. Seitdem war Lippmann zur »Kassandra der Finanzkrise« (New York Times) geworden und hatte auf das Platzen der Blase gewettet, während Kollegen diese immer noch weiter aufpusteten.
Bankchef Josef Ackermann ist beim Blick auf den US-Subprime-Markt zwar schon eine Weile unwohl, er rechnet aber nicht mit dessen Kollaps und schon gar nicht mit einer Krise des weltweiten Finanzsystems. Auf Baisse will sein Haus insgesamt deswegen nicht setzen.
Es läuft ja auch alles so blendend. Am Freitag, dem 3. Juni 2007, erreicht der deutsche Aktienindex Dax 8000 Punkte und damit fast seine historische Bestmarke bis dahin. Der Kurs der Deutschen Bank klettert auf das Rekordniveau von 118 Euro.
In den ersten beiden Wochen in Frankfurt bekomme ich meinen Chef überhaupt nicht zu Gesicht: Er ist unterwegs. Von Athen, wo der Weltbankenverband International Institute of Finance (IIF), dessen Präsident er ist, seine Frühjahrstagung abgehalten hatte, geht es um die halbe Welt. Zuerst nach Kapstadt, von da nach Paris und St. Petersburg, weiter nach New York und Washington bis an die US-Westküste.
Josef Ackermann ist im Flugzeug zu Hause. Morgens Chicago, mittags Houston, gegen Abend Las Vegas und am späten Abend Los Angeles. Zum Abendessen im Restaurant Borchardt in Berlin mit Journalisten ein Wiener Schnitzel oder Rindertartar essen, danach ins Flugzeug und am nächsten Morgen Frühstück mit einem Notenbanker in New York, Regierungsmitglied in Mexiko City oder Großkunden in São Paulo – das ist Alltag für den Deutsche-Bank-Chef, wie ich später erleben sollte. Auf einer Südamerika-Reise etwa sieht er in einer Woche en suite die Regierungschefs von Peru, Argentinien und Brasilien.
Auch am Wochenende ist der Schweizer sehr oft auf Reisen. Einmal fliegt er für eine Sitzung des internationalen Beirats der Stadt Shanghai Freitagnacht von Frankfurt nach China und ist Montagmorgen wieder pünktlich im Büro zurück. Ein anderes Mal geht es am Wochenende nach Seoul und zurück, um vor Ort im Gespräch mit südkoreanischen Behörden ein größeres Problem für die Bank wieder einzurenken. »Manchmal weiß ich, wenn ich morgens im Hotel aufwache, nicht mehr, wo ich gerade bin«, bekennt Ackermann selbst. Der Chef der Deutschen Bank ist »rastlos im Auftrag des Kapitals unterwegs«, so der preisgekrönte Filmemacher Hubert Seipel in seinem vielbeachteten Porträt »Die Welt des Josef Ackermann« für die ARD. Kein Wunder: Das Geschäft des Geldhauses, früher einmal zu 80 Prozent im Inland, findet längst weit überwiegend im Ausland statt.
Vor allem in der Boom-Region Asien ist das Institut in den zurückliegenden Jahren schnell gewachsen und wie zuvor schon in Europa und den USA zu einem der führenden Geldhäuser aufgestiegen. In 17 asiatischen Ländern unterhält es eigene Niederlassungen. Kamen 2008 noch zwei Milliarden Euro Erträge aus Fernost (ohne Japan), sind es inzwischen schon mehr als doppelt so viel. Die Bank ist an vielen der größten Börsengänge in der Region beteiligt. Das setzt Präsenz des Chefs vor Ort voraus.
Der vielreisende Vorstandsvorsitzende wohnt denn auch nicht wie die meisten Topmanager der Frankfurter Finanzszene in einer eigenen Villa am Taunushang, sondern zur Miete in einer Vierzimmer-Wohnung nahe dem Palmengarten im Westend. Ackermann ziehe »den Kosmos einer multinationalen Stadtgesellschaft« einem abgeschirmten Leben hinter hohen Hecken und Mauern vor, schreibt Hilmar Hoffmann, langjähriger Kulturdezernent der Mainmetropole, in der Neuauflage seines Buches »Die großen Frankfurter«, das auch ein Kapitel über den Schweizer enthält.
Die Entscheidung hatte jedoch vor allem praktische Gründe. Was soll Josef Ackermann mit einer Villa in Kronberg? Schon wer ihn in seiner Stadtwohnung besucht, stellt fest: Hier lebt niemand. Hier hat jemand eine Bleibe, ein pied-à-terre, wie es die Franzosen so treffend nennen. Die Einrichtung ist unauffällig, quadratisch-praktisch-gut. Das Einzige, was irgendwie heraussticht, ist ein Schweizer Landschaftsgemälde von Ernst-Ludwig Kirchner im Flur.
Der Bewohner hält sich an seiner Frankfurter Privatadresse in der Siesmayerstraße ebenso selten auf wie in seinem Büro auf der 32. Etage im A-Turm der Bank an der Taunusanlage. Dort ist der Schreibtisch immer aufgeräumt und bis auf ein paar Unterschriftenmappen leer. Das Null-acht-fünfzehn-Mobiliar, Glastische und schwarze Ledersessel, könnte auch zu einem Sparkassendirektor passen. Im Wandregal steht allerhand Krimskrams: Ein Dreimast-Schoner in der Flasche zur Erinnerung an einen Besuch beim Übersee-Club in Hamburg, eine Statuette der griechischen Göttin Nike als Andenken an die Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Universität von Thrakien und weitere Reise-Mitbringsel. Außer den Fotos von seiner finnischen Ehefrau Pirkko, mit der er seit über 35 Jahren verheiratet ist, sowie seiner Tochter Catherine, einer studierten Schauspielerin und Filmproduzentin, ist in dem Raum nichts wirklich Persönliches zu finden.
Ins Auge springen dem Besucher allein eine lackierte Zigarrenbox aus feinem Wurzelholz und ein schwerer kristallener Aschenbecher. Eigentlich gilt in den Türmen überall striktes Rauchverbot. Die einzige Ausnahme ist das Büro des Chefs. Um zu verhindern, dass er beim Rauchen einer Zigarre die Sprinkleranlage auslöst, ist dort die Empfindlichkeit des Rauchdetektors deutlich reduziert.
Josef Ackermann hat sich in der Zentrale seiner Bank nie wohnlich oder repräsentativ eingerichtet. Warum auch, er ist ja sowieso kaum da und legt auf Äußerlichkeiten ohnehin keinen großen Wert. Von dem Imponiergehabe und der Gockelei so vieler Banker hat er jedenfalls nichts an sich. Seine Dienstuniform besteht aus gut geschnittenen, aber unauffälligen dunkelblauen Einreihern ohne Einstecktuch. Dazu ein uni-farbiges oder fein gestreiftes hellblaues oder weißes Hemd mit Manschettenärmeln und konventionellem Kragen. Uhr (Marke: Omega), Krawatte und Manschettenknöpfe sind edel, aber ebenfalls dezent.
Das Auftreten des Deutsche-Bank-Chefs ist unprätentiös. Seine schwarze Kalbsledertasche trägt er selbst, er reist ohne Schleppe von Assistenten, zahlt nicht mit schwarzer oder platinfarbiger Kreditkarte, die goldene Mastercard tut’s auch. Plagt ihn nach getaner Arbeit spätabends noch eine Hungerattacke, weil er den ganzen Tag nicht richtig zum Essen gekommen ist, bestellt er in der Hotelbar am liebsten ein Glas offenen Rotwein und eine Currywurst mit Pommes frites. Im Büro sorgt sein Sekretariat dafür, dass für Notstände genügend Toblerone-Schokolade in der Schublade liegt.
Josef Ackermanns Interesse, Ehrgeiz und Eitelkeit richten sich auf anderes. Sein hervorstechendstes Merkmal: Er will immer mehr wissen als die anderen, ihnen stets voraus und überlegen sein. Und er will alles ganz genau wissen.
Sosehr dies die unmittelbar Betroffenen zu nerven vermag, so sehr sorgt es zugleich dafür, dass der Schweizer, anders als so viele in solchen Positionen, das Zuhören nicht verlernt hat. Für meine Entscheidung, zur Deutschen Bank zu wechseln, war diese Eigenschaft jedenfalls von zentraler Bedeutung. Wie sich schon bald herausstellen sollte, hatte ich mich darin nicht getäuscht.
Wenige Wochen nach meinem Dienstantritt in Frankfurt nimmt Ackermann an einer Podiumsdiskussion des Schweizer Industrieverbands in Zürich teil. Dabei fährt er einer Mitdiskutantin für meinen Geschmack wiederholt etwas zu ungeduldig und prononciert in die Parade. Als ich ihm dies hinterher sage und empfehle, seine intellektuelle Überlegenheit weniger deutlich zu zeigen, wischt er die Kritik nicht einfach unwirsch beiseite, sondern beginnt eine Diskussion mit mir. Dabei stellt sich heraus: Die Argumentation der Frau hat ihn gelangweilt. Mit Langeweile kann er schlecht umgehen. Dann lassen Konzentration und Disziplin nach – und er macht Fehler.
Die Gier des Bankers Josef Ackermann heißt Neugier. Sie zielt vor allem auf Menschen. Je bedeutender sie sind, desto besser. Die Treffen mit ihnen schmeicheln seinem Ego, hier kann er sich mit den Erfolgreichsten messen und erfahren, wie gut er selbst ist, das Terrain für große Geschäfte und Mandate vorbereiten und sich mit Informationen vollsaugen, die sich zum Nutzen der Bank verwerten lassen. Josef Ackermann setzt darauf, durch die Vielfalt der Perspektiven, die sich aus seinen zahlreichen Begegnungen mit Aktionären, Kunden und Regulierern, aber auch mit vielen Mitarbeitern auf seinen Reisen um die Welt ergeben, zu höherer Erkenntnis zu gelangen. Kein Weg ist dem Schweizer dafür zu weit, nichts zu viel oder zu anstrengend. Nirgends, so stelle ich auf vielen gemeinsamen Reisen mit ihm später fest, ist er mehr bei sich als »on the road«, im Gespräch mit Kunden und Kollegen, Aktionären und Anlegern, Regierenden und Regulierern. Der Oberst der Reserve der eidgenössischen Armee zieht die Front der Etappe vor.
Unter seiner Führung erst ist die Deutsche Bank ein wahrhaft globales, multikulturelles Institut geworden, vertreten in über 70 Staaten und mit Mitarbeitern aus fast 150 Ländern, zusammengehalten durch die englische Sprache und das Motto »Passion to Perform«, zu Deutsch: »Leistung aus Leidenschaft«. Als er in Frankfurt angefangen habe, erzählt er mir zu meinem Einstieg, sei auf der jährlichen Konferenz der Führungskräfte nur Deutsch gesprochen worden, die Schauspielerin Hannelore Elsner habe deutsche Gedichte vorgetragen.
Ackermanns internationales Netzwerk sucht seinesgleichen. Er gehört dem Stiftungsrat des Davoser Weltwirtschaftsforums und dem Lenkungsausschuss der Bilderberg-Konferenz an und sitzt dem Wirtschaftsbeirat des Goethe-Instituts vor. In der Wirtschaft kennt er rund um den Globus alle, die Rang und Namen haben. Auch in der Politik ist er bestens vernetzt. Von diversen US-Präsidenten bis zu den Staats- und Regierungschefs Russlands und Chinas, von den Ölscheichs Arabiens bis zu den Herrschern der Königshäuser Europas.
Er diskutiert mit George W. Bush im Oval Office über das Rechtssystem der USA und mit Wladimir Putin in seiner Residenz in Nowo-Ogarjowo vor den Toren Moskaus über das bestmögliche Finanzsystem für Russland. Dem spanischen König Juan Carlos erläutert er im Königspalast in Madrid die Gefahren, die von der europäischen Staatsschuldenkrise ausgehen. Auf der Farm des steinreichen Prinzen und Großinvestors Al-Walid ibn Talal al Saud in der Wüste Saudi-Arabiens kickert der begeisterte Tischfußballspieler so lange mit dessen Frau, bis er mit Blasen an den Händen aufgeben und sich von einem Arzt verbinden lassen muss. Der ehemalige Pekinger Oberbürgermeister und heutige Vize-Premier Wang Qishan macht auf seiner Europareise in Frankfurt Station. Josef Ackermann lässt ihm in der Villa Sander, dem Gästehaus der Deutschen Bank, sein westliches Lieblingsgericht Ossobuco servieren.
Als ich den Schweizer einmal frage, wer ihn von den vielen Promis, die er kennt, am meisten beeindruckt hat, nennt er nach kurzem Nachdenken den ehemaligen chinesischen Staatschef Jiang Zemin. Dessen profunde Kenntnis der abendländischen Kultur habe ihn regelrecht beschämt: »Welcher westliche Staats- oder Regierungschef oder Unternehmensführer kann ein chinesisches Gedicht rezitieren oder Volkslied singen?« Westliche Politiker und Wirtschaftsvertreter müssten viel mehr über die Kultur des Riesenreichs lernen, um den Chinesen auf Augenhöhe begegnen zu können. »Die Chinesen kennen uns viel besser als wir sie«, so Josef Ackermann.
Wo immer in der Welt die Kanzlerin oder der Außenminister hinkommen – der Deutsche-Bank-Chef war schon da. Und nicht selten geben ihm seine Gesprächspartner eine Botschaft für die Regierung in Berlin mit auf den Weg. Für sein Haus sind dieses Netzwerk und die Wahrnehmung als Vertreter Deutschlands ein unschätzbarer Vorteil – sein Ansehen in der Welt ist dadurch weit größer als sein Gewicht an der Börse. Auch für die Bewältigung der Finanzkrise und ihre Aufarbeitung sollte es sich als großes Plus erweisen.
Spätestens nach der Rückkehr von seinen Reisen speist der Deutsche-Bank-Chef seine Beobachtungen und Anregungen systematisch in die Organisation ein. Meistens tut er dies jedoch schon von unterwegs. Sein Büro aus zwei Sekretärinnen und zwei Assistenten bleibt immer auf Trab, auch wenn der Chef nicht da ist. Umgekehrt taktet es ihn Tag für Tag meist auf Monate voraus so eng durch, dass für den Hausherrn in Frankfurt routinemäßig ein Aufzug in die Tiefgarage blockiert wird, sobald er sich auf den Weg zum nächsten Termin macht. Zurück gilt dasselbe. Es soll nur ja keine Minute verlorengehen. Mathias Fluck, Ackermanns Fahrer in den letzten drei Jahren, bewundert an seinem Chef dessen »absolute Verlässlichkeit«. Er sei »immer pünktlich – wie ein Schweizer Uhrwerk«.
Josef Ackermann kommuniziert nahezu ausschließlich mündlich, entweder im persönlichen Gespräch oder per Telefon. Schriftliches von ihm gibt es so gut wie gar nicht. E-Mail ist tabu. Ein kurzes »o. k.«, »pls discuss!« oder »pls call!« auf Papier oder als SMS, das ist alles.
Die Bank führt der Schweizer über Zahlen. Stets ist er bestens im Bilde, wie die Geschäfte laufen. Jeden Tag gegen 16 Uhr Mitteleuropäischer Zeit bekommt er den sogenannten Flash, eine Seite mit den wichtigsten aktuellen Kennziffern aus den einzelnen Geschäftsbereichen. Nichts Wesentliches entgeht seinem Röntgenblick. Entdeckt er eine Schwachstelle, greift er sofort zum Telefon, um direkt und notfalls auch hart gegenzusteuern.
Läuft dagegen alles, lässt Josef Ackermann lange Leine. Er ist kein Mikromanager, aber ein Perfektionist, der sich nur mit dem Besten zufriedengibt, gleichgültig wie viele Runden dafür zu drehen sind. Er ist kein Workaholic, aber jemand, der seine Rolle voll auslebt. Hinzu kommen ein messerscharfer Verstand, ein Elefantengedächtnis und eine Bärenkonstitution.
Freizeit ist für den Deutsche-Bank-Chef ein Fremdwort. Drei Wochen Sommerurlaub im August. Hin und wieder mal ein Besuch in der Oper, einem Kunstmuseum oder dem Frankfurter Fußballstadion, seit die Eintracht wieder erstklassig geworden ist. Am Wochenende zu Hause in Zürich eine stramme Wanderung durch den Wald oder unterwegs in fernen Ländern ein schneller Marsch um den Block müssen als Ausgleich reichen für nahezu pausenlose 80- bis 100-Stunden-Wochen, unregelmäßiges Essen, wenig Schlaf und den ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Zeitzonen. Private Abstecher, wie der Wochenend-Ausflug zum Kap der Guten Hoffnung Ende Juni 2010, sind die absolute Ausnahme.
Der Deutsche-Bank-Chef ist für eine Stippvisite bei der Fußballweltmeisterschaft nach Südafrika gereist, um gemeinsam mit Kunden das Vorrunden-Spiel Brasilien gegen Portugal im Moses-Mabhida-Stadion in Durban zu besuchen. Anschließend nimmt er an dem Fortune 500 Global Forum teil, bei dem sich jedes Jahr zahlreiche CEOs der größten Unternehmen der Welt treffen. Aufgrund des Fußballturniers haben die Organisatoren dieses Mal Kapstadt als Veranstaltungsort gewählt.
Am Freitagnachmittag bei einem gemeinsamen Cappuccino auf der lauschigen Park-Terrasse des traditionsreichen Mount Nelson Hotels am Fuße des Tafelbergs schlägt Ackermann spontan vor, am nächsten Tag einen privaten Ausflug zu machen. Zuerst will er ein Wildtierreservat besuchen, um die Big Five zu sehen, von Großwildjägern so genannt, weil es besonders schwierig und gefährlich ist, sie zu erlegen. Anschließend soll es noch kurz zum Kap der Guten Hoffnung gehen. Am Samstagabend steht schon wieder die Abschlussveranstaltung der Konferenz auf dem Programm.
Mitten in der Nacht fahren wir im Hotel los, um den Wildpark einige Autostunden von Kapstadt entfernt im Morgengrauen zu erreichen, wenn die Chancen am größten sind, die Tiere in freier Wildbahn zu erleben. Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt, und das Glück ist uns hold: Wir bekommen Büffel, Elefant, Löwe und Nashorn aus nächster Nähe zu Gesicht. Nur ein Leopard ist weit und breit nicht zu entdecken. Dafür lassen sich zwei Giraffen beim Frühstück zuschauen.
Anschließend geht es weiter zum Kap der Guten Hoffnung. An den Felsklippen, die über die Jahrhunderte so manchem Segelschiff auf dem Weg nach Indien zum Verhängnis wurden, können wir die Folgen der Piraterie am Horn von Afrika beobachten: Am Horizont ziehen wie auf einer Perlenkette aufgereiht die Containerschiffe vorbei. Der weite Weg um Afrika herum, der jahrelang nahezu verwaist war, macht sich ganz offensichtlich wieder bezahlt.
In Südafrika ist stets ein Bodyguard an Ackermanns Seite, ansonsten reist er im Ausland meist ohne Personenschutz. Im Inland dagegen begleiten ihn auf Schritt und Tritt immer zwei Leibwächter. Seit dem Mannesmann-Prozess zählt er zu den am stärksten gefährdeten Personen der Republik. Seine Dienstlimousine, ein Mercedes der S-Klasse, ist gepanzert. So dick und schwer, dass ich immer beide Arme brauche, um beim Ein- und Aussteigen die linke hintere Tür zu öffnen.