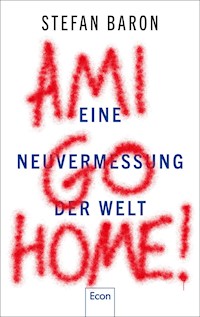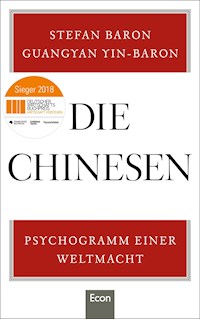
22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Ein spannendes und außerordentlich lehrreiches Buch." Sigmar Gabriel; ehemaliger Außenminister Auf der Bestenliste "Sachbücher des Monats Mai" von DIE WELT, NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, WDR 5, ÖSTERREICH 1 und TELEPOLIS Mit seinem ebenso tiefschürfenden wie hochaktuellen Porträt des Volkes, das wie kein anderes die Welt von morgen prägen wird, legt das deutsch-chinesische Autorenpaar ein unverzichtbares Standardwerk zum Verständnis der Chinesen vor. "Ein mutiges Buch. Ein Psychogramm einer ganzen Nation von 1,4 Milliarden Menschen zu erstellen, ist keine leichte Aufgabe. Die Autoren meistern sie mit beeindruckender Kenntnis und dem Mut, auch sicher geglaubte Einschätzungen kräftig gegen den Strich zu bürsten". Eberhard Sandschneider; Professor für Politik Chinas und internationale Beziehungen, FU Berlin "Dieses Buch ist für alle, die in China Geschäfte machen wollen, eine lehrreiche, aber auch spannende Lektüre und die umfassendste Darstellung von Land und Leuten, die ich kenne." Heinrich von Pierer; langjähriger Vorstandsvorsitzender von Siemens "Ein Buch, das für kontroverse und fruchtbare Diskussionen sorgen kann." Jörg Wuttke; langjähriger Präsident der Europäischen Handelskammer in China
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
China bestimmt immer stärker die Geschicke der Welt – mit weitreichenden Folgen auch für unser ganz persönliches Wohlergehen. Dennoch sind die Chinesen den meisten von uns ein Rätsel geblieben. Dieser gefährlichen Unkenntnis machen Stefan Baron und Guangyan Yin-Baron ein Ende. Ihr auf jahrzehntelangen eigenen Erfahrungen sowie einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen basierendes Buch bietet einen einzigartigen Einblick nicht nur in das Denken und Fühlen der Chinesen, sondern auch in deren ökonomische und geopolitische Ambitionen. Dadurch wird es dem Leser möglich, sowohl die gesamte Tragweite der Herausforderung zu erfassen, die Chinas Aufstieg an die Weltspitze für uns mit sich bringt, als auch die richtigen Antworten darauf zu finden. Das deutschchinesische Autorenpaar sieht dabei nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Mit einer klugen Fernostpolitik nach dem Vorbild der einstigen Ostpolitik könnte gerade auch Deutschland zu einer gerechteren und friedlicheren Weltordnung beitragen.
Die Autoren
Stefan Baron, geboren 1948, hat sich als mehrfach preisgekrönter Journalist einen Namen gemacht. Er arbeitete beim Spiegel und danach viele Jahre als Chefredakteur bei der Wirtschafts-Woche. Der studierte Volkswirt, der vor seiner Journalistenlaufbahn am Kieler Institut für Weltwirtschaft über Entwicklungsländer forschte, beschäftigt sich seit fast drei Jahrzehnten intensiv mit China. Heute ist er als Autor und Kommunikationsberater tätig.
Guangyan Yin-Baron, geboren 1967, ist in China aufgewachsen, hat dort an der Jinan Universität in Kanton Kommunikation und Journalismus studiert und anschließend bei der Kanton-Tageszeitung gearbeitet, einer der größten Zeitungen des Landes. 1993 ging sie nach Witten-Herdecke, um an der dortigen Privatuniversität Ökonomie zu studieren. Seitdem lebt sie in Deutschland und arbeitet heute als Beraterin für Unternehmen und Institutionen aus beiden Ländern.
Stefan Baron Guangyan Yin-Baron
Die Chinesen
Psychogramm einer Weltmacht
Econ
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweise zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-17366
© 2018 © der deutschsprachigen Ausgabe by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018 Karten: © Peter Palm, Berlin Covergestaltung: Brain Barth, Berlin
E-Book: L42 AG, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Für Lea Bowen
»Lies nicht um zu widersprechen und zu widerlegen, auch nicht um zu glauben und für selbstverständlich zu halten, noch um Stoff für Gespräche und Diskurse zu finden,
Inhalt
Schreibweise chinesischer Namen und Wörter
Einführung
Die chinesische Herausforderung
TEIL I
Zur Psychologie eines Volkes
Vielfalt und kollektives (Unter-)Bewusstsein
Das westliche China-Bild im Wandel der Zeiten
Zwischen Faszination, Furcht und Verachtung
Geistes- und kulturgeschichtliche Grundlagen
Von Konfuzius und Laotse bis Mao und Deng
TEIL II
Erziehung und Sozialisation
Familie, Hierarchie, Bildung
Denken und Wahrnehmung
Praktisch, ganzheitlich, dialektisch
Sprache und Kommunikation
Vieldeutig, indirekt, distanziert
Moral und Gesellschaft
Nächstenliebe, Netzwerk, Gesicht
Mann und Frau
Sachlich, nüchtern, partnerschaftlich
Lebenseinstellung und Temperament
Vital, gewieft, gleichmütig
TEIL III
Wirtschaft und Arbeitswelt
Paternalismus, Merkantilismus, Modernisierung
Staat und Herrschaft
Zwischen Meta-Konfuzianismus und Sino-Marxismus
China und die Welt
Frieden, Stärke, Multipolarität
Ausblick
Konvergenz, Koexistenz oder Kampf der Kulturen?
Karten
Dank
In dieses Buch eingeflossene und weiterführende Literatur
Schreibweise chinesischer Namen und Wörter
Um chinesische Namen und Wörter in unser Alphabet zu transkribieren, haben wir die in der Volkrepublik China übliche Pinyin-Umschrift benutzt. Ausnahmen wurden bei Namen gemacht, die in der zuvor lange Zeit gebräuchlichen Umschrift nach Wade-Giles dem Leser geläufiger sein dürften.
Einführung
Die chinesische Herausforderung
Weltgeschichte ist nicht zuletzt, vielleicht sogar vor allem, die Geschichte großer Kulturen. Die vergangenen beiden Jahrhunderte und besonders die zurückliegenden Jahrzehnte der Globalisierung wurden entscheidend von der westlichen, christlich-abendländischen Kultur geprägt.
Im 21. Jahrhundert wird diese jedoch nicht mehr die Richtschnur sein, an der sich alle mehr oder weniger orientieren. Die Welt wird zunehmend multipolar. Vor 20 Jahren stellten die in der Gruppe der G-7 zusammengeschlossenen großen westlichen Industriestaaten plus Japan noch 44 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung (in Kaufkraft gemessen). Heute sind es nur noch etwa 30 Prozent. Gleichzeitig hat der Anteil der sogenannten BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) von 18 auf über 30 Prozent zugenommen.
Die ökonomischen und politischen Gewichte haben sich von Nord nach Süd und mehr noch von West nach Ost verschoben und verschieben sich weiter. Die Globalisierung frisst ihre Kinder. Der Schwerpunkt der Weltpolitik verlagert sich vom Abendland (zurück) nach Eurasien und vom atlantischen in den pazifischen Raum.
Eine zentrale Rolle spielt dabei China, das volkreichste Land der Erde. In den vergangenen vier Jahrzehnten ist das »Reich der Mitte« (Zhongguo), wie es sich selbst nennt, von einem der ärmsten Entwicklungsländer zur größten Handelsnation und nach Kaufkraft gemessen bereits auch größten Volkswirtschaft der Erde aufgestiegen, zu einer Weltmacht, die an Bedeutung nur noch von den USA übertroffen wird. Trotz zuletzt deutlich geringerer Dynamik entfallen auf das Land rund 40 Prozent des Wachstums der globalen Wirtschaft. Somit ist bereits jetzt das Wohlergehen der gesamten Menschheit eng mit dem des fernöstlichen Riesenreichs verknüpft. Und in der Zukunft wird dies noch mehr der Fall sein.
China ist in seiner Entwicklung an einer entscheidenden Schwelle angekommen: Gelingt es ihm, über sie hinwegzukommen, seine Wirtschaft tiefgreifend umzustrukturieren und auf das Niveau führender Industriestaaten anzuheben? Oder scheitert es daran, wie schon so viele andere Länder vor ihm, bricht die einzigartige Erfolgsgeschichte ab und die Wirtschaft stagniert bzw. verfällt oder kollabiert sogar?
Eng verbunden damit ist auch die Frage, welchen politischen Weg China künftig gehen wird. Bleibt es bei dem autoritären Herrschaftssystem, verhärtet sich dieses vielleicht sogar, oder nimmt es allmählich weichere Formen an und ist eines nicht allzu fernen Tages womöglich eine demokratische Verfassung denkbar? Und nicht zuletzt: Welche geopolitischen Ambitionen hegt die Führung in Peking? Strebt sie für das Land die Vorherrschaft in Asien an oder will sie sogar den Platz der USA als Welt-Hegemon einnehmen und eine eigene Weltordnung etablieren?
Wegen Chinas schon heute enormen wirtschaftlichen und politischen Gewichts und seiner tiefen Verflechtung in die internationale Arbeitsteilung sind diese Fragen für die gesamte Welt und nicht zuletzt für Deutschland von größter Bedeutung. David Shambaugh, renommierter Politik-Professor an der George Washington Universität, betrachtet die künftige Entwicklung Chinas als »die wichtigste Frage der Weltpolitik«. Auf dem Spiel steht dabei nicht nur unser Wohlstand, sondern auch unsere Identität – und der Weltfrieden. Hierzulande bisher weithin unbeachtet ist zwischen den USA und China seit Jahren ein geopolitischer Wettbewerb im Gange, den Liu Mingfu, ehemals Dozent an der Nationalen Verteidigungsuniversität in Peking, als das »größte globale Machtspiel der Menschheitsgeschichte« bezeichnet.
Historisch betrachtet hat die Rivalität zwischen einer alten Führungsmacht und einer aufstrebenden Macht immer wieder zu Kriegen geführt. Graham Allison, Politik-Professor an der Harvard-Universität, hat 16 Fälle untersucht, in denen eine aufsteigende Nation eine etablierte Macht herausforderte. In zwölf davon kam es zum Krieg.
Bekanntestes Beispiel für diese brisante Konstellation ist die Rivalität zwischen dem vorwärtsdrängenden Athen und dem um seine Vormachtstellung fürchtenden Sparta im Altertum. Sie endete im Peloponnesischen Krieg. Dieser führte nicht nur zur Zerstörung Athens, sondern ruinierte am Ende ganz Griechenland. »Was den Krieg unvermeidlich machte, war der Aufstieg Athens und die Angst, die das in Sparta hervorrief«, so der griechische Geschichtsschreiber Thukydides. Die Konstellation wird daher allgemein als »Thukydides-Falle« bezeichnet.
Heute beunruhigt das aufsteigende China die dominierende Weltmacht USA. Im Weißen Haus in Washington wird Thukydides’ Werk über den Peloponnesischen Krieg als eine Art Menetekel betrachtet. Nicht nur Stephen Bannon, der Donald Trump als Wahlkampfmanager zuerst zum Präsidenten machte und ihm in den ersten Monaten im Amt dann als oberster strategischer Berater diente, auch Sicherheitsberater H.R. McMaster sowie Verteidigungsminister James Mattis zählen es zu ihren Lieblingsbüchern. Bannon sieht die USA schon seit längerem in einem »Wirtschaftskrieg« mit China, auf Sicht von fünf bis zehn Jahren hält er sogar einen Schießkrieg zwischen beiden Ländern im Südchinesischen Meer für »unvermeidlich«.
Wenige Wochen nach Trumps Amtsantritt ließ McMaster zwei Dutzend Exemplare von Allisons Buch über die Thukydides-Falle bestellen und empfahl sie seinen Mitarbeitern zur Lektüre. Wenig später wurde der Autor selbst eingeladen, den Nationalen Sicherheitsrat zu dem Thema zu briefen, ob es auch zwischen den USA und China zum Krieg kommen werde wie zwischen Sparta und Athen.
Allisons Antwort: Ein solcher Krieg sei zwar »nicht unvermeidlich«, aber »sehr viel wahrscheinlicher als derzeit wahrgenommen«. Aus »übersteigerten Gefühlen der eigenen Bedeutung« werde auf der Seite der aufsteigenden Macht leicht »Hybris«; aus »unvernünftiger Furcht« entwickle sich auf Seiten der vorherrschenden Macht schnell »Paranoia«. Gerade in Zeiten moderner Cybertechnologie, die es ermöglicht, den Kontrahenten blind zu machen und seine Befehlsstrukturen lahmzulegen, ergibt sich aus einer solchen Gemütsverfassung ein besonders hohes Eskalations- und Kriegsrisiko.
Auch der Politikwissenschaftler Aaron Friedberg von der Princeton-Universität sieht die Zukunft der amerikanisch-chinesischen Beziehungen düster: »Wenn China immer reicher und stärker wird, ohne sich zu einer liberalen Demokratie zu entwickeln, wird die gegenwärtig noch zurückgenommene Rivalität offener zutage treten und zu etwas Gefährlichem aufblühen.«
Für Professor John Mearsheimer von der Universität Chicago, der sich ebenso wie Allison intensiv mit dem Problem der Thukydides-Falle beschäftigt hat, gibt es gar kein Wenn mehr. Die Frage, ob China »friedlich aufsteigen« kann, beantwortet der einflussreiche Politikwissenschaftler mit einem klaren »Nein«.
Derselben Meinung ist offensichtlich auch Shinzo Abe, Regierungschef von Chinas Nachbar Japan. Schon 2014 verglich er auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos Pekings zunehmendes Selbstbewusstsein und seine territorialen Besitzansprüche im Süd- und Ostchinesischen Meer mit der Situation vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Damals sah sich die etablierte Seemacht England durch das große Flottenbauprogramm des deutschen Kaiserreichs herausgefordert.
Eine Studie der RAND-Corporation im Auftrag der US-Armee (Titel: »War with China: Thinking Through the Unthinkable«) kam 2016 zu dem Ergebnis, ein Krieg zwischen den USA und China sei schon in den kommenden zehn Jahren »nicht unvorstellbar« und jedenfalls »realistisch genug, um eine umsichtige Politik zu verfolgen und effektive Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen«. Das Pentagon hat seine strategische Planung für Asien bereits entsprechend angepasst, spielt seit längerem mögliche Eskalationsszenarien durch und veranstaltet regelmäßig dazu passende Kriegsspiele. Genauso wie das Verteidigungsministerium in Peking.
Mit Donald Trumps Einzug ins Weiße Haus hat sich die Lage zwischen den beiden Großmächten weiter zugespitzt. Trump beklagt schon seit vielen Jahren, die USA würden von China »ausgeplündert«. Der Präsident denkt ähnlich wie sein ehemaliger Berater Bannon, der das christlich-jüdische Amerika in einem »globalen Existenzkampf« mit dem islamistischen Terrorismus einerseits und dem gottlosen Kommunismus in Gestalt von China andererseits sieht. »Die fundamentale Frage unserer Zeit«, so Trump in einer Grundsatzrede bei seinem Staatsbesuch in Polen im Juli 2017, sei die Frage, »ob der Westen den Willen hat zu überleben«.
Auch nach Bannons Ausscheiden aus dem Präsidententeam gibt es im Weißen Haus eine Reihe führender Mitarbeiter, die ihren Chef in seiner Haltung zu China bestärken. Zu ihnen zählen vor allem der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sowie Peter Navarro, Chef des Büros für Handel und Industrie.
Lighthizer, ein erklärter Wirtschaftsnationalist, macht China für »die Krise der US-Industrie« verantwortlich. Der Wirtschaftsprofessor Navarro hat in Büchern wie »The Coming China Wars«, »Death by China« und zuletzt »Crouching Tiger – What Chinas Militarism Means for the World« seit Jahren einen konfrontativen Kurs gegen den fernöstlichen Rivalen vertreten. Peking ist für ihn »das neue Herz der Finsternis«.
Wenngleich ein heißer Krieg zwischen den USA und China zumindest in absehbarer Zukunft eher unwahrscheinlich ist – ein neuer Kalter Krieg wie einst zwischen Washington und Moskau, zumindest aber ein Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt steht ernsthaft zu befürchten. Trotz intensiver ökonomischer Verbindungen, so der Buchautor und China-Kenner James Bradley, führe über den Pazifik »nur eine schmale und wacklige Brücke der Gemeinschaft«.
Die Landbrücke der Gemeinschaft von Europa nach China ist leider kaum breiter und stabiler. Das bilaterale Klima hat sich hier zuletzt ebenfalls deutlich eingetrübt. Die chinakritischen Stimmen nehmen auch auf diesem Kontinent ständig zu. Wegen heftiger Meinungsverschiedenheiten über Handels- und Investitionsfragen endete der jährliche EU-China-Gipfel im Juni 2017 schon zum zweiten Mal in Folge ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung.
Obwohl China nun seit über anderthalb Jahrzehnten der Welthandelsorganisation WTO angehört, verweigern ihm EU und USA nach wie vor den einst versprochenen Status einer Marktwirtschaft und damit verbundene Handelserleichterungen. China hat bei der WTO dagegen Klage erhoben und wird wohl auch recht bekommen.
Die Europäische Kommission wirft China vor, Kosten und Preise einzelner Güter durch staatliche Eingriffe zu verzerren, und hat ein neues Anti-Dumping-Regelwerk beschlossen, das an diesem Verdacht ansetzt. Daneben will sie ähnlich wie die USA chinesischen Investoren, die sie als staatsnah betrachtet, die Übernahme von Hightech- und sicherheitsrelevanten Unternehmen in Europa verwehren.
Die Aversion gegenüber China beschränkt sich auch in Europa nicht nur auf Fragen des wirtschaftlichen Wettbewerbs, sondern reicht tiefer. Eine Bemerkung des deutschen EU-Kommissars und ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger hat dies 2016 schlaglichtartig sichtbar gemacht. Oettinger bezeichnete Chinesen öffentlich als »Schlitzaugen« und spottete über Gesprächspartner aus Peking, alle hätten »die Haare mit schwarzer Schuhcreme von links nach rechts gekämmt«.
Oettingers Chinesenbild ist, bewusst oder unbewusst, offenbar durch die Gestalt des Dr. Fu Manchu aus der vielfach verfilmten gleichnamigen Romanserie geprägt, in der der chinesische Finsterling mit teuflischen Methoden versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und wie Oettinger geht es vielen im Westen.
Bahnt sich zwischen dem in die Defensive geratenen Westen und dem vorwärtsstürmenden China also ein »Zusammenprall der Kulturen« an, vor dem der Politikwissenschaftler Samuel Huntington in seinem gleichnamigen Bestseller schon 1996 gewarnt hat und den wir in anderer Form mit Teilen der islamischen Kultur bereits heute erleben?
In den vergangenen Jahren, so Stephen Schwarzman, Eigentümer der amerikanischen Investmentgesellschaft Blackstone Group, seien ihm »die großen Kulturunterschiede« zwischen dem Westen und China immer »bewusster geworden« und hätten ihn zunehmend »beunruhigt«. Es gelte »eine Kluft des Verstehens zu überbrücken, um die Welt sicherer zu machen«, so Schwarzman – und spendete Hunderte Millionen seines Vermögens für ein hochkarätiges Stipendiaten-Programm, bei dem künftige Führungskräfte aus aller Welt China besser kennenlernen sollen.
Auch wenn der Zusammenprall des Westens mit dem fernöstlichen Riesenreich anders als der mit dem islamistischen Terrorismus – bisher zumindest – vor allem auf dem Feld der Wirtschaft ausgetragen wird, stellt er für die bestehende Weltordnung doch die weitaus größere Herausforderung dar. »Der Westen hat keine Ahnung, was ihn mit Chinas Aufstieg erwartet«, so Kevin Rudd, ehemals Regierungschef von Australien und einer der besten China-Kenner in der internationalen Politik. Die USA, als globaler Hegemon und Hüter der Pax Americana an erster Stelle von diesem Aufstieg betroffen, werden sich der Herausforderung zunehmend bewusst. Hierzulande lassen die Aufmerksamkeit für und Beschäftigung mit dem »Reich der Mitte« und dem epochalen Zeitenwandel, den es erfährt, dagegen weiter sehr zu wünschen übrig. Gerade heute, da China den Westen »zum ersten Mal real bedrängt«, konstatiert Mark Siemons, langjähriger Feuilleton-Korrespondent der »F.A.Z.« in dem Lande, wirke sich »dieser blinde Fleck besonders fatal aus«.
Deutschland kann es jedoch nicht gleichgültig sein, wenn die zunehmende Rivalität zwischen den USA und China um Platz eins in der Hierachie der Weltmächte auf einen Handelskrieg oder gar eine militärische Auseinandersetzung zutreibt. Unser Wohlstand hängt in besonderem Maße von Frieden, freiem Handel und einer florierenden Weltwirtschaft ab.
Mehr noch als der islamistische Terror droht ein Fernost-West-Konflikt die gesamte Welt ins Chaos zu stürzen. Ein Krieg, selbst wenn nur regional und auf konventionelle Waffen begrenzt, würde einer Studie der RAND-Corporation zufolge eine globale wirtschaftliche Depression wie in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts auslösen. Schon ein Handelskrieg der USA mit China zöge eine schwere Rezession nach sich.
Nach Jahrzehnten der Globalisierung ist die Weltwirtschaft bereits viel zu stark verflochten, als dass ein Konflikt zwischen zwei so großen Ländern sich auf diese begrenzen ließe. China und die USA stellen zusammen rund 40 Prozent des globalen Sozialprodukts, fast ein Drittel aller Auslandsinvestitionen und ein Viertel aller Exporte.
25 Prozent der gesamten amerikanischen Importe kommen aus China. Höhere Zölle, Steuern oder Abgaben darauf würden die Inflation in den USA anfachen, die Notenbank müsste die Zinsen erhöhen, der Dollar stiege auf neue Höhen, die Ausfuhr des Landes ginge – nicht zuletzt durch entsprechende Vergeltungsmaßnahmen Pekings – spürbar zurück. Und mit ihm das Wachstum der amerikanischen Wirtschaft. Das wiederum ließe auch die US-Einfuhr aus anderen Ländern einbrechen, allen voran aus Deutschland.
Auch China käme ins Schlingern. 15 Prozent seiner wirtschaftlichen Wertschöpfung entfallen auf den Export. Das größte Abnehmerland sind die Vereinigten Staaten, die größte Abnehmerregion ist Südostasien. Diese ist zum Teil stark in US-Dollar verschuldet. Ein hoher Dollarkurs würde ihre Wirtschaft und mit ihr den chinesischen Export dorthin schwächen.
Ein Rückgang des Wachstums in den beiden größten Volkswirtschaften und der wachstumstärksten Region der Welt ließe zudem die Rohstoffpreise verfallen und brächte damit auch die rohstoffproduzierenden Länder in Bedrängnis. Die Schleifspur zöge sich so immer weiter durch die Weltwirtschaft und würde nicht zuletzt den Exportweltmeister Deutschland hart treffen.
Nie zuvor war unsere Zukunft daher mehr mit der von China verbunden als heute. In den Augen des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping sind Deutschland und China ökonomisch sogar bereits »unverzichtbar« füreinander geworden.
Zumindest sind sie füreinander die größten Handelspartner in ihrer jeweiligen Weltregion. Tag für Tag tauschen sie Waren im Wert von fast einer halben Milliarde Euro aus. Im Hamburger Hafen werden sieben Mal so viele Container aus China umgeschlagen wie aus den USA. Für Deutschlands Unternehmen ist das fernöstliche Riesenreich inzwischen der wichtigste Absatzmarkt überhaupt. Der VW-Konzern etwa verkauft dort allein 40 Prozent seiner gesamten Automobile.
Mehr als 8000 deutsche Unternehmen mit über 30 000 deutschen Experten sind in China tätig. Umgekehrt sind es bereits über 1000 chinesische Unternehmen bei uns, und ihre Zahl nimmt rapide zu.
In Deutschland leben inzwischen rund 150 000 Chinesen. Ihre Zahl wächst von Jahr zu Jahr. 2016 schnellte allein in Frankfurt die Zahl der beim Einwohnermeldeamt mit Erstwohnsitz registrierten Chinesen von zehn- auf vierzehntausend in die Höhe.
Über 8000 Deutsche studieren in China. Fast 50 000 Chinesen studieren bei uns – die größte Gruppe unter den ausländischen Hochschülern. Hinzu kommen Tausende Internatsschüler. Ihre Zahl steigt so schnell, dass immer mehr Schulen sich gezwungen sehen, eine Obergrenze einzuführen.
Pro Jahr besuchen gut anderthalb Millionen Chinesen Deutschland als Touristen und umgekehrt über eine Million Bundesbürger das »Reich der Mitte«. Allein die Lufthansa fliegt mehr als 70 Mal in der Woche chinesische Metropolen an. Die meisten Flüge sind ausgebucht.
Regierungsvertreter und Abgeordnete aus Berlin und Peking reisen regelmäßig zu Konsultationen hin und her. Über 90 deutsche Städte und Bundesländer unterhalten Partnerschaften mit chinesischen Kommunen und Provinzen. Inzwischen gibt es hierzulande bereits 19 Konfuzius-Institute.
Die Deutschen haben – ob als Politiker oder Geschäftsleute, Kunden oder Touristen, Kommilitonen oder Kollegen, Freunde oder Nachbarn – mit Chinesen heute also mehr zu tun als je zuvor. Nie zuvor war es daher für sie so wichtig zu wissen, wie diese denken und fühlen, salopp ausgedrückt: wie sie ticken. Denn nur so lassen sich die politischen, ökonomischen und menschlichen Chancen der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens optimal nutzen und schädliche, ja womöglich zerstörerische Irrtümer und Missverständnisse vermeiden.
Chinas Geschichte und Kultur sind den meisten Menschen hierzulande jedoch nach wie vor unbekannt, das Denken, Fühlen und Handeln seiner Bürger ein Rätsel: irgendwie faszinierend, aber fremd, undurchsichtig und unbegreiflich. Der Ausdruck »Fachchinesisch« spricht für sich.
Im Geschichtsunterricht und in anderen Fächern spielt China an deutschen Schulen so gut wie keine Rolle. Selbst rudimentäre Kenntnisse über das älteste und volkreichste Land der Welt fehlen – bis in die Spitzen der Gesellschaft. Chinesisch als Fremdsprache wird immer noch viel zu selten angeboten. Im Vergleich etwa zu den USA fristet Sinologie an unseren Universitäten nur ein Schattendasein. Während sich amerikanische China-Forscher auf praktische Probleme der Gegenwart und Zukunft konzentrieren, vertiefen sich ihre deutschen Kollegen vielfach in esoterische Themen aus oft ferner Vergangenheit.
Wenn der renommierte amerikanische Geschichtsprofessor und China-Kenner Arthur Waldron angesichts der aktuellen Diskussion in außenpolitischen Zirkeln seines Landes einen »tiefgreifenden Mangel an Wissen über China« beklagt, ja von einem »schwarzen Loch« spricht, müsste er Deutschland einen schwarzen Krater bescheinigen.
In unserem öffentlichen Diskurs nimmt China immer noch kaum mehr Platz ein als ein Dritte-Welt-Land. Während sich in den USA ein gutes Dutzend angesehener Forschungsinstitute und Denkfabriken intensiv mit dem zeitgenössischen China beschäftigen, tut dies hierzulande nur das Mercator Institut für China-Studien (Merics). Erst 2017 hat das Auswärtige Amt in Berlin eine eigene Asien-Abteilung eingerichtet. Die China-Wahrnehmung und -Expertise in unseren Medien ist zum großen Teil atemberaubend mangelhaft.
Sprecher und Moderatoren der Hauptnachrichtensendungen im deutschen Fernsehen können meist nicht einmal chinesische Vor- und Nachnamen auseinanderhalten. Anders als bei anderen Sprachen geben sie sich auch kaum Mühe, sie richtig auszusprechen.
Der angesehene britische »Economist« hat 2012 für China eine eigene Rubrik eingeführt, die erste und einzige feste Länderrubrik neben der für die USA seit 1942. Die »New York Times« und das »Wall Street Journal« beschäftigen rund ein Dutzend, die Nachrichtenagentur »Bloomberg« sogar an die 50 Mitarbeiter vor Ort; deutsche Medien sind – wenn überhaupt – höchstens mit zwei bis drei Journalisten in China vertreten.
Mit ganz wenigen Ausnahmen ist ihre Berichterstattung aus dem »Reich der Mitte« gemessen an dessen wirtschaftlicher und geopolitischer Relevanz denn auch spärlich und dünn. Während jeder Tweet von US-Präsident Donald Trump seit dessen Amtsantritt hin und her gewendet wird, fand etwa die fast dreieinhalbstündige Rede des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping auf dem 19. Parteitag der KP Chinas im Oktober 2017 in deutschen Medien weithin nur oberflächliche Beachtung. Dabei stellt sie das wichtigste politische Dokument von Xis erster fünfjähriger Amtsperiode dar und gibt detailliert Aufschluss darüber, was das Land, das die Zukunft der Welt bereits heute wesentlich mitbestimmt, in den kommenden fünf Jahren und darüber hinaus vorhat. Nur der »Spiegel« hat in einer Titelgeschichte (»Xing lai – Aufwachen!«) einige Wochen danach prominent auf die chinesische Herausforderung aufmerksam gemacht und dies selbst als »Weckruf für den Westen« bezeichnet.
Meist bleibt die Berichterstattung der deutschen Medien über China aber nicht nur seicht – in der Regel ist sie auch einseitig und stereotyp. Die Themen sind immer wieder dieselben: Demokratie, Menschenrechte, Umweltverschmutzung, Technologieklau und neuerdings auch Aufrüstung. Und natürlich: Absonderliches. Oder besser, was man dafür hält.
Im Umfeld der Olympischen Spiele 2008 in Peking ließ die Heinrich-Böll-Stiftung rund 4000 Artikel deutscher Medien über China auswerten. Fazit: Die Journalisten hätten weithin »Klischees über China unreflektiert kolportiert«. Daran hat sich seitdem nichts geändert.
So kann es kaum verwundern, wenn das Bild, das die Deutschen insgesamt von China haben, große Lücken aufweist und mehrheitlich negativ ist. Konfuzius, der wichtigste Denker des Landes und einer der bedeutendsten der Weltgeschichte, gilt den meisten, wenn sie denn überhaupt je von ihm gehört haben, als eine Art Spruchbeutel.
Kaum ein Bundesbürger weiß auch, dass China die längste Zeit der Geschichte die Weltmacht Nummer eins war. So gut wie niemandem sagt der Name Zheng He etwas, ein kaiserlicher Eunuch muslimischen Glaubens und Admiral, der in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, also lange vor Kolumbus und Vasco da Gama, die halbe Welt umsegelte; mit einer Flotte von über 300 Schiffen, darunter über 60 Riesenschiffe mit neun Masten, 135 Metern Länge, über 55 Metern Breite. Mit seinen 25 Metern Länge nahm sich dagegen der Dreimaster Santa Maria, in dem Kolumbus über 100 Jahre später Amerika entdeckte, wie eine Schaluppe aus.
In seinem 1620 erschienenen wissenschaftshistorischen Werk »Novum organum« schrieb der Philosoph Francis Bacon, »kein Reich, keine Religion oder Philosophie, kein Stern« habe »größeren Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit ausgeübt als die drei Erfindungen Buchdruck, Schießpulver und Magnet«. Bacon wusste damals nicht, dass alle drei in China erfunden worden waren (siehe Tafel, S. 24). Die meisten Deutschen wissen es bis heute nicht. Sie denken, China verstehe sich nur aufs Kopieren.
In der Schule lernen unsere Kinder immer noch, dass Johannes Gensfleisch aus Mainz, allgemein als Johannes Gutenberg bekannt, um das Jahr 1440 herum den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden habe, obwohl dies in Wahrheit der chinesische Druckarbeiter Bi Sheng bereits vier Jahrhunderte zuvor getan hatte. Nur blieb der schon 200 Jahre früher erfundene Blockdruck wegen der vielen Zeichen in der chinesischen Sprache lange Zeit effizienter und deshalb überwiegend weiter in Gebrauch. Fest steht: In China erschienen bereits Bücher in Millionenauflage, als in Europa Manuskripte noch per Hand kopiert wurden.
Große Kreativität
Die wichtigsten chinesischen Erfindungen
Papier (inkl. Tapeten,Toiletten- und Fensterpapier) 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Europa im 13. Jahrhundert.
Buchdruck 11. Jahrhundert. Europa im 15. Jahrhundert.
Schwarzpulver Um 250 nach unserer Zeitrechnung. Kanonen erst um 1250. In Europa Schwarzpulver erstmals 1285. Kanonen dagegen keine 100 Jahre später.
Kompass In seiner Grundform bereits im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. In verbesserter Form als Sextant im 11. Jahrhundert. In Europa erstmals 1190 erwähnt.
Mechanische Uhr Im Jahr 1086. Allerdings nur in Form großer Turmuhren. Die erste tragbare Uhr, die auf dem Schwingungsprinzip beruht, stammt aus Europa und wurde von den Jesuiten Ende des 16. Jahrhunderts nach China gebracht.
Papiergeld Kam zuerst 1024 in Umlauf. Seit dem 14. Jahrhundert bereits in ungedeckter Form. Erste Geldscheine in Europa 1483.
Seide 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. In Europa etwa im Jahr 550 unserer Zeitrechnung.
Porzellan 620 unserer Zeitrechnung. In Europa 1708.
Spinnrad Im 13. Jahrhundert. Im 15. Jahrhundert nach Europa importiert.
(Eiserner) Pflug 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. In Europa fast 2000 Jahre später. Die landwirtschaftliche Revolution im 18. Jahrhundert in Europa wurde durch Übernahme chinesischer Agrartechniken ausgelöst. Den Entwicklungsstand, auf dem China in der Agrartechnik auch im Hinblick auf Saatgut und chemische Insektizide bereits im 12. Jahrhundert angekommen war, erreichte Europa erst im 20. Jahrhundert.
Hochofen (für Eisenschmelze) 200 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Erste eiserne Hängebrücke im Jahr 65 unserer Zeitrechnung. Seit dem 5. Jahrhundert Verfahren zur Stahlproduktion, welches das Siemens-Martin-Verfahren vom 19. Jahrhundert vorwegnahm. Stahlproduktion in China zu Beginn des 11. Jahrhunderts schon so hoch wie in England zu Beginn der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert.
Wasserbau Erste Flussumleitung ohne Stauwehr 256 vor unserer Zeitrechnung in Dujiangyan bei Chengdu.
Dezimalsystem Bereits 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung in China im Gebrauch, bevor es über Indien und Arabien im 15. Jahrhundert nach Europa kam.
Viele Deutsche halten China auch nach wie vor für eine Art große DDR und die Chinesen für ein konformistisches Ameisenvolk. Die Bilder von uniformen Volksmassen im sogenannten Mao-Look haben bei ihnen offenbar einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Dabei macht der Staatssektor in dem Land heute nur noch gut ein Viertel der Wirtschaft aus, der Sozialstaat ist erheblich kleiner als der deutsche, die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen um vieles größer, der Wettbewerb wesentlich härter. Dass inzwischen Millionen Deutsche China auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen besucht haben, konnte an dem schiefen Bild über das Land seltsamerweise kaum etwas ändern. Reisen sei »fatal für Vorurteile«, sagte einst Mark Twain. In Bezug auf China trifft dies bisher nicht zu.
Selbst die meisten sogenannten Expats, die für ein deutsches Unternehmen im »Reich der Mitte« gearbeitet haben, legen oft ein erstaunliches Unverständnis darüber an den Tag, wie Chinesen denken, fühlen und handeln. Ihre Zeit verbringen sie meist in Mega-Städten wie Schanghai, die für das Riesenland so wenig typisch sind, wie Berlin es für Deutschland ist. Zudem verlassen sie China in der Regel schon nach wenigen Jahren wieder – wenn sie gerade beginnen, es ein bisschen zu verstehen. Die wenigsten dieser Gastarbeiter sprechen, geschweige denn lesen oder schreiben Chinesisch.
Wie einst die imperialistischen Eindringlinge in ihren Konzessionsgebieten leben sie meist abgesondert von der einheimischen Bevölkerung in Ausländerghettos. Am öffentlichen Leben des Landes nehmen sie kaum teil. Einheimische lernen sie oft nur als Chauffeur oder Dienstmädchen persönlich kennen. In einer Befragung von Expats in 67 Ländern rund um die Welt, wie sie sich in ihrem jeweiligen Gastland »akklimatisiert« hätten, kam China auf Platz 60. Soll heißen: Das Land bleibt ihnen fremd, ein Einleben findet kaum statt. Auch viele sogenannte »Old China Hands«, die länger in China gelebt haben und deshalb die Chinesen in- und auswendig zu kennen glauben, wissen in Wirklichkeit verblüffend wenig über sie, weil sie China nur nach ihren eigenen Maßstäben beurteilen.
Für einen Mann mit einem Hammer, so Mark Twain, sei »jedes Problem ein Nagel«. Die Maßstäbe zur Beurteilung anderer Gesellschaften liefere uns »stets die eigene Gesellschaft«. Unser Gehirn sucht bevorzugt nach einer Bestätigung der eigenen Weltsicht, weil so Botenstoffe ausgeschüttet werden, die uns glücklich machen. Was dem eigenen Vorurteil widerspricht, wird dagegen gern in Zweifel gezogen oder gleich abgelehnt.
Wo es aber an Wissen und Verständnis fehlt, blühen nicht nur Vorurteile und Stereotype, sondern auch Unsicherheit und Ängste. Chinas wirtschaftlicher Erfolg ist den meisten Deutschen unheimlich, ihre Einstellung zu dem Land schwankt seltsam hin und her: Einmal bestaunen sie die imposanten Skylines der Großstädte, die hochmodernen Einkaufszentren, Flughäfen, Eisenbahnlinien, Autobahnen, Brücken und Staudämme, bewundern den rapiden Fortschritt und die ungeheure Dynamik des Landes und fürchten sich vor der »gelben Gefahr«.
Dann wieder betrachten sie China als Scheinriesen, verweisen auf das gesunkene Wirtschaftswachstum, die hohe Verschuldung und sagen den baldigen Kollaps der chinesischen Wirtschaft samt politischem Regime voraus. Wobei oft nicht klar ist, was überwiegt: die Furcht vor den Folgen für den eigenen Wohlstand oder die Genugtuung, weil einfach nicht sein kann, was nicht sein darf.
Meine Frau Guangyan, gebürtige Chinesin, aber schon seit über 20 Jahren in Deutschland zu Hause und längst deutsche Staatsbürgerin, hat dieser Zustand ebenso wie mich schon lange beschäftigt. Immer wieder fiel uns auf, wie fremd den Deutschen die Chinesen trotz der zunehmenden gegenseitigen Kontakte und wachsenden Bedeutung füreinander geblieben sind; wie sie abwechselnd einmal verächtlich auf sie herabschauen und dann wieder angstvoll vor ihnen zurückschrecken, sie einmal idealisieren und ein anderes Mal dämonisieren.
So sprechen etwa deutsche Mitbürger meine Frau meist wie selbstverständlich auf Englisch an. Was in der wohlmeinenden Absicht geschehen mag, ihr entgegenzukommen, ist zugleich doch auch verräterisch, denn es zeigt, dass man zuerst und vor allem das Fremde an ihr sieht. Dazu bleibt die Konversation fast immer kurz und nichtssagend, weil ihre Gesprächspartner nicht wissen, was sie interessiert oder langweilt, erfreut oder verärgert.
Unsere Tochter Lea Bowen musste sich die gesamte Schulzeit hindurch mit verächtlichen, beleidigenden und diskriminierenden Bemerkungen von Mitschülerinnen und Mitschülern über Chinesen auseinandersetzen. Neben der großen und bisher weithin unverstandenen Herausforderung, die China für Deutschland und den Westen darstellt, haben solche Alltagserfahrungen den Anstoß für dieses Buch gegeben.
Zwar gibt es bereits eine Vielzahl von China-Büchern auf dem deutschsprachigen Markt: Reiseberichte, Erfahrungen von Expats und Journalisten, Benimm- und Geschäftsratgeber für den Umgang mit Chinesen, Fibeln über Tai Chi und Feng Shui, Kochbücher usw. Hinzu kommen Übersetzungen chinesischer Belletristik sowie eine beachtliche, aber für den Laien meist schwer verdauliche wissenschaftliche Literatur zu Einzelaspekten der chinesischen Kultur.
Ein Buch über die geistesgeschichtlichen, kulturellen und (sozial-)psychologischen Voraussetzungen zum Verständnis der Chinesen, eine zugleich fundierte und doch leicht verständliche Erklärung, wie diese denken und fühlen, fehlt jedoch bisher.
Eine Ausnahme davon ist lediglich Lin Yutangs Charakterstudie »Mein Land und mein Volk«. Die China-Kennerin und Literaturnobelpreisträgerin Pearl S. Buck nannte es das »echteste, tiefste, umfassendste und bedeutendste Buch, das bis jetzt über China geschrieben wurde«. Allerdings liegt das nun schon fast ein Jahrhundert zurück.
Vor 50 Jahren veröffentlichte der französische Publizist Jean-Jacques Servan-Schreiber ein Buch mit dem Titel »Die amerikanische Herausforderung«. Es hat viel dazu beigetragen, Europa wachzurütteln und zu erkennen, dass es gegen Amerika nur eigenständig bestehen kann, wenn es sich zusammenschließt.
Mit dem vorliegenden Buch, das meine Frau und ich gemeinsam verfasst haben, wollen wir die chinesische Herausforderung beschreiben. Diese besteht, gerade für uns Deutsche, vor allem anderen zunächst einmal darin zu verstehen, wie die Chinesen denken und fühlen. Denn erst dann können wir ermessen, wie sehr wir politisch, ökonomisch und kulturell tatsächlich gefordert sind und darauf angemessen reagieren. »Die Chinesen zu verstehen«, so der China-Kenner Evan Osnos, »verlangt nicht nur, das Licht und die Hitze zu ermessen, die von seiner hellleuchtenden neuen Macht ausgehen, sondern auch die Quelle seiner Energie – die Männer und Frauen im Zentrum von Chinas Werden«.
Interkulturelle Kompetenz ist in einer globalisierten und multipolaren Welt so wichtig wie nie zuvor. Denn erst in der Begegnung mit dem Fremden erleben wir die volle Wucht kultureller Differenz. Fremdes, das unverstanden bleibt, verunsichert, führt zu Abwehr und dysfunktionalem Verhalten. Nicht nur unser Wohlstand, sondern auch der Frieden auf diesem Globus hängen mehr denn je von dem Willen und der Fähigkeit ab, den psychischen Code anderer Völker zu entschlüsseln, sich in andere Kulturen hineinzudenken und hineinzufühlen. Dabei spielt das Verständnis der chinesischen Kultur eine herausragende Rolle.
Seit rund 30 Jahren beschäftige ich mich selbst intensiv mit China. Als Chefredakteur des Magazins »WirtschaftsWoche« habe ich schon in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen Schwerpunkt auf die Berichterstattung über das Land und seinen Wiederaufstieg zur Weltmacht gelegt, zahlreiche Interviews mit führenden chinesischen Politikern und Unternehmenschefs geführt, bilinguale Sonderausgaben produziert sowie deutsch-chinesische Wirtschaftskongresse und Manager-Reisen veranstaltet.
Nicht nur beruflich, auch privat bin ich seitdem mit einer Vielzahl von Chinesen aus allen Bereichen der Gesellschaft zusammengekommen. Daraus ist eine Reihe enger Beziehungen und Freundschaften hervorgegangen. Zusammen mit meiner Frau Guangyan habe ich im Laufe der Jahre das gesamte Land bereist. Von der Insel Hainan im Südosten bis Xinjiang im Nordwesten, von der Mandschurei im Nordosten bis Tibet im Südwesten.
Guangyan, eine Chinesin aus einer alten Familie von Gelehrten und Staatsdienern, hat an der Jinan-Universität im südchinesischen Kanton Journalismus und Kommunikation studiert und danach einige Jahre als Redakteurin bei der »Kanton-Tageszeitung« gearbeitet, einer der größten Zeitungen des Landes. In den 1990er Jahren kam sie zum Studium der Ökonomie an die private Hochschule in Witten-Herdecke. Seidem lebt sie in Deutschland und arbeitet als Beraterin für Unternehmen aus beiden Ländern, reist ständig zwischen diesen hin und her, wirkt bei der Umsetzung zahlreicher deutsch-chinesischer Projekte mit und ist dabei nahezu täglich mit Verständnisproblemen zwischen beiden Kulturen konfrontiert.
Im Zusammenleben mit ihr, in zahllosen gemeinsamen Gesprächen, auf unseren vielen Reisen durch das Land, durch die regelmäßigen ausgedehnten Besuche bei ihrer Familie und Treffen mit Verwandten und Freunden habe ich einen tiefen Einblick in das Denken und Fühlen der Chinesen, ihre Kultur und Mentalität gewonnen.
So wertvoll persönliche Erfahrungen sind, so können sie doch keine Allgemeingültigkeit beanspruchen. »Jede Wirklichkeit besteht aus zwei Hälften, dem Subjekt und dem Objekt«, so der Philosoph Arthur Schopenhauer in seinen »Aphorismen zur Lebensweisheit«. »Bei völlig gleicher objektiver Hälfte, aber verschiedener subjektiver ist daher die gegenwärtige Wirklichkeit eine ganz andere.«
Dieses Problem und mit ihm das des Ethnozentrismus wollen Guangyan und ich zum einen durch die Doppel-Autorenschaft überwinden. Um unser beider Wirklichkeiten aber auf eine noch breitere Grundlage zu stellen, haben wir zusätzlich die für das Thema relevante Literatur und dabei besonders das vorhandene empirische Wissen zur Psychologie der Chinesen aufgearbeitet.
Meine Frau hat dabei die einschlägige chinesischsprachige Fachliteratur ausgewertet. Als deutscher Muttersprachler habe ich es übernommen, die gemeinsamen Erkenntnisse nach intensiver Diskussion mit ihr niederzuschreiben.
Indem wir uns darum bemühen, andere Kulturen kennenzulernen und zu verstehen, lernen wir nicht nur, besser mit ihnen umzugehen und Missverständnisse mit möglicherweise gravierenden Folgen zu vermeiden – wir lernen auch viel über uns selbst. Denn meist wissen wir erst richtig, wer wir sind, wenn wir wissen, wer wir n i c h t sind. Das Fremde hilft uns, das Vertraute zu verstehen. So gesehen ist dieses Buch über die Chinesen zugleich ein Buch über uns.
Anders als wir haben die Chinesen längst verstanden, wie wichtig es für sie ist, uns – und sich selbst – zu verstehen. Sie schicken viel mehr Schüler und Studenten in den Westen als wir umgekehrt zu ihnen. Ihre Diplomaten und Wirtschaftsvertreter bleiben hier deutlich länger auf Posten als ihre deutschen Kollegen in China. Ihre Eliten kennen unsere Kultur wesentlich besser als unsere die chinesische. Sie halten sich an den Ratschlag ihres großen strategischen Denkers Sunzi: »Wenn Du Dich selbst kennst und den anderen, gewinnst Du jede Schlacht.«
Dass sie diesen Rat einst missachteten, hat für sie zu über einem Jahrhundert der Demütigung geführt, die sie nun ein für alle Mal wieder abschütteln wollen. Dagegen sind wir heute drauf und dran, denselben Fehler zu begehen. Mit unabsehbaren Folgen nicht nur für Deutschland, sondern für Europa und die gesamte Welt.
Auch dafür, dass es dazu nicht kommt, will dieses Buch einen bescheidenen Beitrag leisten.
Köln, im November 2017
Stefan Baron
TEIL I
Zur Psychologie eines Volkes
Vielfalt und kollektives (Unter-)Bewusstsein
Ein Buch über die Psychologie des größten Volkes der Erde kommt nicht ohne Verallgemeinerungen aus. Das chinesische Volk, mit an die 1,4 Milliarden Menschen, fast doppelt so viele wie ganz Europa, ist zwangsläufig komplex, hybrid und pluralistisch. »China ist ein so großes Land und sein Leben hat so viele Facetten«, schickte bereits Lin Yutang dem Porträt seiner Landsleute voraus, »dass es sich notwendig die verschiedenartigsten und wohl auch einander widersprechende Deutungen gefallen lassen muss.«
Allein die geographische Ausdehnung ihres Landes legt nahe, dass die Chinesen nicht aus einem Guss sein können. China ist eigentlich schon kein Land mehr, sondern ein Kontinent. Der Kaiser herrsche über »alle unter dem Himmel« (Tianxia), sagten die alten Chinesen. Mao Zedong berühmte sich, sein Land könne aufgrund seiner großen Ausdehnung und Bevölkerung als Einziges ein nukleares Armageddon überleben.
China hat eine 22 000 Kilometer lange Grenze. Von Norden nach Süden erstreckt sich das chinesische Territorium vom 54. bis zum 18. Breitengrad – insgesamt über 4000 Kilometer. Das entspricht einer Entfernung von Deutschland bis in den Sudan. In ost-westlicher Richtung sind es fast 4500 Kilometer, eine Strecke vom Atlantik bis zum Ural.
Zwar gilt in ganz China (einschließlich Taiwan) eine einheitliche Uhrzeit (Greenwich Mean Time plus acht Stunden); zwischen dem Osten und dem Westen liegen jedoch fünf Zeitzonen. In dem riesigen Land sind alle Landschafts- und Klimazonen vertreten. Vom eisigen Hochgebirge des Himalaya bis zur Tropeninsel Hainan. Von der Sandwüste Taklamakan bis zu den fruchtbaren Ufern des Jangtse-Flusses.
Wenn in diesem Buch von den Chinesen die Rede ist, sind vor allem die Han gemeint. Zwar machen diese mehr als 90 Prozent der Bevölkerung aus. Daneben gibt es aber 56 offiziell anerkannte ethnische Minderheiten, die zusammen deutlich über 100 Millionen Menschen zählen. Ihr Anteil ist in den zurückliegenden Jahrzehnten noch gestiegen, weil Minderheiten nicht dem lange gültigen staatlichen Gebot der Ein-Kind-Politik unterlagen.
Mit den verschiedenen Ethnien verbinden sich unterschiedliche Glaubensbekenntnisse. Die große Mehrzahl der Han gehört keiner Religion an. Ganze 50 bis 60 Millionen von ihnen bekennen sich zum Christentum. Die weitaus meisten davon sind Mitglieder verschiedener protestantischer Gemeinden, etwa zwölf Millionen sind Katholiken. Diese teilen sich in eine inoffizielle papsttreue Kirche und eine offiziell anerkannte chinesische katholische Kirche, die ihre Bischöfe nicht vom Vatikan bestimmen lässt.
Weit über 100 Millionen Chinesen sind Anhänger des Buddhismus. Dazu zählt besonders die Minderheit der Tibeter. Etwa 20 Millionen Chinesen sind (sunnitische) Moslems. Mindestens zehn Millionen davon stellt die über das ganze Land verteilte Hui-Nationalität, die sich ansonsten jedoch kulturell stark der Mehrheitsbevölkerung der Han angenähert hat. Die andere Hälfte kommt von der regionalen Minderheit der Uiguren, eines Turk-Volkes in der Provinz Xinjiang im äußersten Nordwesten des Landes.
Alle Han haben eine Reihe genetisch bedingter Merkmale gemeinsam: Mandelform und dunkle Farbe der Augen, schwarze Haare und eine bestimmte Haarstruktur, spärliche Körperbehaarung, feine Hautporen und schwache Schweißabsonderung, ausgeprägter Geruchssinn und eine relativ hohe Stimmlage. Aber es gibt auch Unterschiede: So haben Südchinesen im Schnitt eine dunklere Hautfarbe, sind kleiner, schlanker und feingliedriger als ihre Landsleute im Norden.
Die Grenze zwischen Nord- und Südchina verläuft ungefähr auf Höhe des Jangtse-Flusses. Sie trennt den Teil des Landes mit (Fern-)Heizung von dem ohne und vor allem den mit Getreide- von dem mit Reisanbau.
Südchinesen unterscheiden sich von Nordchinesen in punkto Temperament und Lebenseinstellung. Eine 2014 im Wissenschaftsmagazin »Science« veröffentlichte empirische Studie der Universität von Virginia, bei der über 1000 Studenten aus dem Norden und Süden Chinas befragt wurden, kam zu dem Ergebnis, dass die Nordchinesen aggressiver und individualistischer sind als ihre Landsleute im Süden.
Als Begründung führten die Forscher vor allem an, dass im Süden Reis und im Norden Getreide angebaut wird. Der Anbau von Reis erfordere gemeinsame Deiche und Bewässerungskanäle, Reisbauern müssten daher stärker zusammenarbeiten als Getreidebauern. Vielleicht sind Nordchinesen deshalb auch die besseren Krieger, Südchinesen dagegen die gewitzteren Händler und regsameren Kaufleute.
In der langen chinesischen Geschichte hat jedenfalls kein einziger »Reisesser« aus dem Süden eine kaiserliche Dynastie begründen können. Dies haben ausschließlich »Nudelesser« aus dem Norden geschafft. Die Republik hingegen wurde 1912 von dem Kantonesen Sun Yatsen begründet. Auch dessen Nachfolger Tschiang Kaishek und der Begründer der Volksrepublik, Mao Zedong, stammten aus dem Süden.
Während den Menschen im Norden nachgesagt wird, nach Macht zu streben, um dadurch zu Reichtum zu gelangen, ist es bei ihren Landsleuten im Süden eher umgekehrt. Vor allem entlang der Küste sind sie stets wohlhabender gewesen als Nordchinesen – und wurden von diesen in der Geschichte oft ausgeplündert.
Zum einen erfreut sich der Süden eines günstigeren Klimas und seine Böden sind fruchtbarer; zum anderen wurde er stets weniger von Überschwemmungen und Missernten geplagt. Hinzu kommt eine lange Tradition im Überseehandel.
Das alles hat die Menschen dort weltoffener und liberaler, dem Wandel gegenüber aufgeschlossener und leichtlebiger werden lassen als die im Norden. Und auch experimentierfreudiger und abenteuerlustiger. Der große Reformer Deng Xiaoping wusste schon, warum er die Öffnung des Landes und seine marktwirtschaftlichen Pläne in der südlichen Provinz Guangdong und nicht im nördlichen Peking verkündete.
Während die Einwohner der Hauptstadt sich besonders für Politik interessieren und sich vergleichsweise wenig aus Äußerlichkeiten machen (an warmen Sommerabenden sind in der 20-Millionen-Stadt heute noch Menschen im Schlafanzug auf der Straße anzutreffen), erwärmen sich die Schanghaier vor allem für Wirtschaft und legen viel Wert auf Äußeres. Zudem gelten sie als besonders trickreich und auf ihren Vorteil bedacht und sind bei ihren Landsleuten deshalb nicht sonderlich beliebt. Allerdings stellen sie einen Großteil der Unternehmerelite des Landes.
Die Kantonesen, wie die Bewohner der Provinz Guangdong mit deren Hauptstadt Kanton (Guangzhou) genannt werden, machen sich von allen Chinesen am wenigsten aus Politik. Die Hauptstadt ist weit weg. Für Kantonesen zählt vor allem ein angenehmes Leben, und das heißt in ihren Augen in erster Linie gutes Essen. Während die Schanghaier gute Unternehmer sind, denken sie kurzfristiger und sind besonders geschickte Händler. Schon im Jahr 880 unserer Zeitrechnung zählte Kanton 120 000 ausländische Einwohner – die meisten von ihnen arabische, persische und indische Kaufleute.
Zwischen Schanghaiern und Kantonesen sind die Einwohner der Provinz Zhejiang angesiedelt – und das nicht nur geographisch. Sie sind extrem fleißig und Kleinstunternehmer par excellence. Neben den Provinzen Guangdong und der benachbarten Provinz Fujian stammt der größte Teil der Überseechinesen von dort.
Auch sprachlich unterscheiden sich die Einwohner Chinas deutlich voneinander. Neben den nichtchinesischen Sprachen Tibetanisch, Uigurisch, Mongolisch und Mandschurisch gibt es in dem Land acht größere chinesische Sprachgruppen mit jeweils Dutzenden von Untergruppen. Das im Südosten des Landes gesprochene Kantonesisch etwa ist von Mandarin mindestens so weit entfernt wie Holländisch von Deutsch.
Alle Sprachgruppen haben mit der Hochsprache Mandarin (Putonghua) jedoch die Schrift gemeinsam. Deren Zeichen bedeuten stets dasselbe wie etwa in Hongkong (Kantonesisch) und Xianggang (Mandarin) die Zeichen für »Duft« und »Hafen«. In Taiwan und Hongkong gilt allerdings noch die traditionelle Langschrift, in der Volksrepublik und in Singapur seit 1956 dagegen eine vereinfachte Schrift, die weniger Striche enthält und deshalb leichter zu schreiben, aber schwerer zu lesen ist, weil sich die Zeichen schlechter auseinanderhalten lassen. In Taiwan und Hongkong werden Bücher auch traditionell von hinten nach vorne und von oben nach unten geschrieben, in der Volksrepublik dagegen wie im Westen von vorne nach hinten und links nach rechts.
Im Hinblick auf die Sprache und auch sonst ist China in den zurückliegenden Jahrzehnten wesentlich einheitlicher geworden. Wenn in den achtziger und neunziger Jahren der damalige Parteichef Deng Xiaoping im Fernsehen auftrat, mussten wegen seines starken Sichuan-Dialekts Untertitel eingeblendet werden. Heute beherrschen außer alten Leuten nahezu alle Chinesen die Hochsprache Mandarin.
Auch der rapide Ausbau der Infrastruktur (Straßen, Flughäfen, Eisenbahnen, Telekommunikation und Internet), die Millionen Wanderarbeiter sowie die zunehmende Verstädterung haben die Einheitlichkeit (und Einheit) des Landes beträchtlich gestärkt – inklusive ursprünglich einmal kulturfremder Gebiete wie der Inneren Mongolei, der Mandschurei, Xinjiangs und Tibets. Dauerte eine Fahrt mit der Eisenbahn von Peking nach Kanton 1957 noch rund 50 Stunden, braucht der Schnellzug für die über 2100 Kilometer lange Strecke heute keine zehn Stunden mehr.
Gleichwohl bestehen zwischen Stadt und Land sowie den entwickelten Küstenregionen im Osten und dem weniger entwickelten Landesinneren immer noch enorme Unterschiede. Die Durchschnittseinkommen in den Metropolen an der Ostküste sind etwa dreimal so hoch wie in den ländlichen Regionen des Westens. Hier sind auch die traditionellen Werte der chinesischen Kultur wie Familiensinn oder Paternalismus stärker ausgeprägt. Hinzu kommen die üblichen Unterschiede zwischen Jung und Alt sowie Bildungs- und Herkunftsunterschiede. Und nicht zuletzt die Unterschiede zwischen Festlands- und Auslandschinesen, Zhonguoren und Huaren.
Denn neben den Einwohnern der Volksrepublik gibt es rund um die Welt weitere gut 60 Millionen Chinesen. Zehn Millionen davon haben einen volksrepublikanischen Pass. Allein Taiwan zählt 24 Millionen Einwohner; in Indonesien leben weitere über acht Millionen ethnische Chinesen; über sieben Millionen sind es in Thailand, weitere fast sieben Millionen in Malaysia, über vier Millionen in Singapur, weit über drei Millionen in den USA (vor allem in Kalifornien), fast zwei in Kanada (vor allem an der Westküste um Vancouver), über eine Million in der EU (fast die Hälfte davon in Großbritannien), und rund eine weitere Million in Australien.
Taiwan wurde schon vor Jahrhunderten von Bewohnern der gegenüberliegenden Küstenprovinz Fujian besiedelt. 1945 kamen Millionen Anhänger der im Bürgerkrieg gegen die Kommunisten unterlegenen Guomindang-Partei und ihres Anführers Tschiang Kaishek aus ganz China hinzu.
Seit der Zeit des ersten Kaisers, also dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, trieben die Einwohner der Küstenorte Südchinas Handel mit Südostasien. Viele von ihnen ließen sich dort irgendwann nieder und wurden in ihrer neuen Heimat nach und nach zur dominierenden wirtschaftlichen Kraft. Das Seegebiet zwischen Südostasien und der alten Heimat wurde für sie zu einer Art Binnenmeer. Daher auch der Name »Südchinesisches Meer«.
Im agrarisch geprägten kaiserlichen China rangierten Geschäftsleute im Ansehen meist weit unter Bauern und Handwerkern. Regierende und Mandarine entledigten sich ihrer Schulden oder der Verantwortung für Misswirtschaft oft kurzerhand dadurch, dass sie Kaufleute aus dem Kernland im Norden in die Gebiete südlich des Jangtse-Flusses vertrieben. So entwickelte sich Südchina im Laufe der Zeit zu einer Hochburg von Kaufleuten und zur Heimatbasis der heutigen Auslandschinesen.
Deren sogenanntes »Bambus-Netzwerk« wächst von Jahr zu Jahr beständig weiter. Heute kommen viele seiner Mitglieder auch aus dem Norden. Nahezu die Hälfte der reichen Chinesen (mit Vermögen über zwölf Millionen Euro) schließen es laut einer Umfrage der China Merchants Bank nicht aus zu emigrieren. Mehr als ein Viertel von ihnen hat bereits ein Domizil im Ausland. Oft leben dort schon Frau und Kinder. Viele wohlhabende Chinesen zeugen sogar mit Hilfe amerikanischer Leihmütter Kinder, um diesen einen amerikanischen Pass zu sichern.
Da Einstellungen und Verhalten nicht nur von gemeinsamer Geschichte und gemeinsamen Werten geprägt werden, sondern auch vom politischen und sozialen System mit seinen spezifischen Belohnungs- bzw. Sanktionsmechanismen, unterscheiden sich die Chinesen in unterschiedlichen sozio-kulturellen Umgebungen voneinander. Chinesen aus Taiwan, Hongkong oder Macau und mehr noch Auslandschinesen in Südostasien oder Einwanderer in westlichen Ländern wie den USA, Kanada, Australien oder Deutschland sind in mancherlei Hinsicht anders als sogenannte »Festlandschinesen« aus der Volksrepublik.
D i e Chinesen gibt es so gesehen also noch viel weniger als d i e Deutschen. Menschen sind ohnedies keine homogenen Wesen, sie werden von einer Vielzahl von Zugehörigkeiten geprägt und unterscheiden sich schon deshalb von ihren Mitmenschen – auch solchen derselben Volksgruppe, Kultur und Nationalität. Das gilt zumal für das größte Volk auf Erden. Dennoch ist Chinesen insgesamt gesehen ein Fundus an Gemeinsamkeiten im Denken, Fühlen und Handeln eigen, der sie von Nicht-Chinesen deutlich abhebt.
Erleben und Verhalten des Menschen ist mehr ein Produkt der Kultur als der Natur. Unterschiede in Psyche, Mentalität und Charakter zwischen den einzelnen Völkern sind nicht genetisch zu erklären. In den vergangenen Jahrzehnten haben Wissenschaftler zwar mehr und mehr genetische Prädispositionen entdeckt, die den Einzelnen etwa hinsichtlich Intelligenz, Emotionalität oder sogar moralischer Aspekte prägen. Diese führen sie jedoch wiederum auf kulturelle Prägung zurück.
Wie die Genomforschung zeigt, ist die Variabilität zwischen Ethnien geringer als innerhalb derselben. Das heißt, ein Chinese kann einem Deutschen genetisch ähnlicher sein als dieser seinem deutschen Nachbarn. Die Varianz des Erbguts innerhalb einer Ethnie erklärt zu über 80 Prozent auch die gesamte genetische Varianz unter Menschen.
Genetisch bedingt sind die Unterschiede beim Haar, bei Form und Farbe der Augen, bei der Gestalt der Nase, der Pigmentierung der Haut oder auch beim Auftreten bestimmter Krankheiten. Auch lässt sich offenbar ein Zusammenhang zwischen dem Vorkommen eines bestimmten Gens und tonalen Sprachen wie etwa Mandarin nachweisen.
Die Analyse von DNA-Sequenzen hat zudem starke Indizien dafür ergeben, dass der Homo sapiens auch in China aus dem ursprünglich in Ostafrika beheimateten Homo erectus hervorgegangen ist und nicht unabhängig davon, wie zuvor auf der Basis von Schädelfunden angenommen worden war. Und dass die Chinesen im Norden des Landes, der Wiege der chinesischen Tradition und Kultur, ursprünglich von Südchinesen abstammen, deren Erbgut wiederum sehr viel mit anderen Bewohnern Südostasiens gemeinsam hat.
Insgesamt konnte die Genetik bisher keinen starken Zusammenhang zwischen Genotyp und Phänotyp feststellen. Menschen eines bestimmten Kulturkreises weisen dagegen über das allgemein Menschliche hinaus eine Reihe typischer Eigenschaften auf. So hat der Philosoph Arthur Schopenhauer zwar recht, wenn er sagt, die »Individualität eines Menschen« überwiege »bei weitem die Nationalität«. Allerdings überwiegt die Kultur meist die Individualität.
Jeder Mensch wird zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort in eine bestimmte Gesellschaft mit gemeinsamer Geschichte, Philosophie, Tradition, Sitten und Gebräuchen, Werten und Symbolen hineingeboren. Diese Faktoren prägen ihn psychisch ebenso wie die Physis seiner Vorfahren. Die Menschen sind »zugleich Produkte einer biologischen und einer kulturellen Evolution«, so der Hirnforscher Wolf Singer. Die genetische Ausstattung eines Menschen aus der Steinzeit sei von unserer heutigen »nicht sehr verschieden. Sein Verhalten, sein Denken, seine Vorstellungen von Raum und Zeit dürften jedoch ganz anders gewesen sein.« Daran könne man »den dominanten Einfluss der Kultur« ablesen. Das Wesen des Menschen wird also weniger von seinen Genen als durch Umwelteinflüsse, vornehmlich Erziehung, Sozialisation und Bildung, geformt, die wiederum selbst kulturabhängig sind.
Nach Gustave LeBon, dem Begründer der Massenpsychologie, ist unser Verhalten, auch wenn es aus eigenem Antrieb zu kommen scheint, vom »Geist der Toten« mitbestimmt. Der berühmte Soziologe Emile Durkheim sprach von einem »kollektiven Bewusstsein, das unabhängig vom individuellen Bewusstsein existiert«; der Kulturwissenschaftler Geert Hofstede von Kultur als »kollektiver geistiger Programmierung«. Für den Orientalisten Edward Said sind Nationen »Narrative«. Um eine Nation zu verstehen, so der Philosoph Bertrand Russell, »müssen wir seine Philosophie verstehen«. Und der bekannte Wirtschaftshistoriker David Landes kam zu dem Schluss, dass Kultur »fast den ganzen Unterschied« bei der wirtschaftlichen Entwicklung von Völkern erklärt. In der modernen Psychologie werden Denken, Fühlen und Handeln eines Volkes, sein kollektives Bewusstsein und Unterbewusstsein, denn auch als Teil seiner Kultur betrachtet.
Durch die über Jahrtausende ungebrochene gemeinsame Kultur ist die kollektive seelisch-geistige Prägung wohl in kaum einem anderen Land der Erde so stark wie in China. Zugleich ist sie jedoch wissenschaftlich vergleichsweise wenig untersucht. Dies liegt zum einen an den methodischen Schwierigkeiten der Völkerpsychologie. Forscher sind hier der Gefahr ausgesetzt, fremde Verhaltensweisen durch die eigene kulturelle Brille zu beurteilen, also einem »Perspektivismus« zu erliegen, wie der Psychologe Heinz Remplein es nannte. So ist es mehr als fraglich, ob die vornehmlich in den USA entwickelten Methoden der Psychologie geeignet sind, die Psyche von Menschen aus völlig andersartigen Kulturen wie der chinesischen zu ergründen.
Die psychologische Erforschung fremder Völker setzt zudem intimste Kenntnis von deren Kultur und Philosophie, Sprache und Lebensformen voraus. Um das innerste Wesen eines fremden Volkes zu erfassen, sind daher viele Jahre umfassenden Studiums und Zusammenlebens vor Ort unerlässlich – Bedingungen, die nicht leicht zu erfüllen sind.
Die Völkerpsychologie ist so in besonderem Maße auf die sogenannte indigene Erforschung durch einheimische Wissenschaftler angewiesen. Doch daran hapert es im Falle Chinas bis heute. Die psychologische Wissenschaft ist ein Produkt der westlichen Kultur und fand – wie andere Diziplinen der Sozialwissenschaften – erst spät Eingang in das Land. Dort konnte sie sich dann überdies nur schwer entwickeln.
Schon als 1899 das erste Psychologie-Buch in chinesischer Übersetzung erschien, Joseph Havens »Mental Philosophy«, traten die Probleme offen zutage: Für die Begriffe und Konzepte der westlichen Disziplin gab es kein chinesisches Äquivalent. So wurde der Titel des Buches mit »Untersuchung des G e i s t e s« übersetzt. Als dann 1907 eine Übersetzung von Harold Hoffdings »Outline of Psychology« erschien, hieß Psychologie auf Chinesisch auf einmal »Wissen des H e r z e n s«.
Mit Gründung der Republik im Jahr 1912 erlebte die Disziplin eine kurze Blüte. In der ersten Ausgabe von »Xin Li«, der Zeitschrift der 1921 gegründeten Chinesischen Psychologischen Gesellschaft, bezeichnete ihr Herausgeber die Psychologie als »die nützlichste aller Wissenschaften«. Der Bürgerkrieg setzte dem Aufschwung jedoch schon bald wieder ein Ende.
Nach der Machtübernahme der Kommunisten im Jahr 1949 wurde Psychologie in Anlehnung an die Praxis in der damaligen Sowjetunion erneut anders definiert – jetzt galt sie als »Erforschung des B e w u s s t s e i n s«. Und getreu dem materialistischen Grundsatz »Das Sein bestimmt das Bewusstsein« wurden psychische Phänomene fortan als klassenbedingt und bloße Reflexion des Gehirns auf äußere Realitäten und Aktivitäten betrachtet. Die chinesischen Lehrbücher waren jetzt Übersetzungen aus dem Russischen, nicht mehr aus dem Amerikanischen.
Die Disziplin hatte es weiter schwer. Für Mao Zedong war sie »zu 90 Prozent nutzlos«. Mit Beginn der Kulturrevolution 1966 kamen alle einschlägigen Bücher und Zeitschriften auf den Index und die Lehrtätigkeit zum Erliegen. Erst 1978, nach Maos Tod, regte sich wieder neues Leben. Bis heute genießt das Fach in China vergleichsweise wenig Ansehen. In dem riesigen Land studieren es nur gut 10 000 junge Menschen. Die Chinesische Psychologische Gesellschaft zählt nur einige Tausend Mitglieder mit Diplomexamen oder Doktortitel.
Die Disziplin ist zudem weiterhin politischer Einflussnahme ausgesetzt und beschränkt sich vornehmlich auf Bereiche mit direkter Verwertbarkeit: Erziehungs- und Entwicklungspsychologie; Testen und Messen von bestimmten Eigenschaften zu Rekrutierungs- und Ausbildungszwecken und für die Anwendung im Gesundheitssektor. In den angesehenen internationalen Wissenschaftsjournalen sind nur wenige Beiträge chinesischer Psychologen aus der Volksrepublik zu finden.
Mit dem Thema Nationalcharakter haben sich in China daher bis heute fast mehr Politiker und Schriftsteller als Psychologen befasst. Als die letzte kaiserliche Dynastie sich als unfähig erwies, dem Vordringen westlicher Kolonialisten und Japans Einhalt zu gebieten, suchten viele die Schuld in der konfuzianischen Kultur. Der prominenteste Vertreter der Bewegung, der Schriftsteller Lu Xun (1881-1936), bezeichnete den Konfuzianismus damals als »Menschenfresserreligion«, die den Charakter der Menschen schwäche. China müsse sie über Bord werfen, wenn es seine Rückständigkeit überwinden, die westlichen Kolonialisten abschütteln und in der modernen Welt bestehen wolle.
Mit der Kunstfigur des Ah Q in seinem wohl bekanntesten Werk »Die wahre Geschichte des Ah Q« schuf der Schriftsteller eine Symbolfigur, die alle Defizite des chinesischen Nationalcharakters aus seiner Sicht verkörpert, allen voran die materialistische Selbstsucht und das Desinteresse am Wohl der Allgemeinheit, den Gehorsam gegenüber Autoritäten, das Streben nach »Gesicht«, also Ansehen, und die Neigung zum Selbsttrost.
Von einem Ausländer getreten zu werden, so verspottete Lu etwa seine Landsleute, sei für diese zwar nicht gerade ein Gesichtsgewinn, aber auch kein großer Gesichtsverlust, da der Übeltäter ja ein »Barbar« sei. Ein besonders böser seiner Witze handelt von einem Obdachlosen, der prahlt, mit einem allseits hochverehrten Meister gesprochen zu haben. Als man ihn fragt, was dieser denn gesagt habe, habe der Bettler erwidert: »Ich stand vor seinem Tor, er kam heraus und sagte: ›Hau ab!‹«
Neben Lu Xun hat sich vor allem der Schriftsteller Lin Yutang (1895-1976) mit dem chinesischen Nationalcharakter beschäftigt. Er tat dies ebenfalls kritisch, aber deutlich sachlicher.
Systematische wissenschaftliche Forschung zur Psychologie der Chinesen, zu ihrem Denken, Fühlen und Handeln, gibt es in der Volksrepublik erst seit wenigen Jahrzehnten. Die indigene Kulturpsychologie des Landes, vor allem empirischer und nicht nur deskriptiver Art, steckt immer noch in den Kinderschuhen. Mit chinesischem Denken ist es schwer vereinbar, Menschen unter experimentellen Laborbedingungen in mentale Einzelteile zu zerlegen und daraus abstrakte Schlussfolgerungen zu ziehen.
Die wichtigsten Studien zur Psychologie der Chinesen ebenso wie interkulturelle Vergleiche mit China stammen daher bis heute meist entweder aus den USA und Australien oder aus Taiwan, Hongkong und Singapur, die stärker von den westlichen empirischen Wissenschaften durchdrungen wurden. In der Regel werden Chinesen in interkulturellen Vergleichen daher mit US-Amerikanern verglichen, von denen sie sich besonders stark unterscheiden. Inwieweit sie anderen (westlichen) Völkern vielleicht ähnlicher sind – im Hinblick auf Familiensinn, Esskultur und Lebensfreude etwa den Italienern –, darauf gibt es bisher nur wenige gesicherte Antworten.
Michael Harris Bond, einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der chinesischen Psychologie und Herausgeber des »Oxford Handbook of Chinese Psychology«, der umfassendsten Darstellung der theoretischen wie vor allem auch empirischen Forschungen in dem Feld, zeigt sich bezüglich des gesicherten Wissensstandes seines Fachgebiets denn auch eher bescheiden. Es sei »prekär«, so Bond, bei »unserem gegenwärtigen Wissen« abschließende Urteile über »d i e Chinesen« zu fällen.
Allen methodischen Schwächen zum Trotz lassen die bisher vorliegenden empirischen Studien zu dem Thema aber auch für Bond den Befund zu, dass die Chinesen sich von westlichen Völkern in vielem grundsätzlich unterscheiden. Es gibt also etwas, was für »d i e Chinesen« typisch ist.
Obwohl in ihrem Mutterland gelegentlich als »Bananen« verspottet (außen gelb, innen weiß) sind auch die Überseechinesen ihrer Heimat stets eng verbunden geblieben. Viele gehören Namens- und Herkunftsortsvereinigungen, Wohltätigkeitsvereinen oder Gilden an, reisen oft nach China, um Familie und Freunde zu besuchen, verbringen dort ihren Ruhestand und haben sich Grabstätten in der Heimaterde reserviert. Ob Bewohner der Volksrepublik, Taiwans oder Überseechinesen – alle eint das starke Bewusstsein einer gemeinsamen Identität als »Kinder des Gelben Kaisers«, des mystischen Urvaters Chinas, alle fühlen sich durch eine gemeinsame Kultur verbunden, bilden also im wahrsten Sinne des Wortes eine Kulturnation.
Als China 1964 in der Wüste von Xinjiang seine erste Atombombe zündete, freuten sich darüber Chinesen in aller Welt – auch wenn sie das Regime in Peking ablehnten. Genauso war es beim Einzug des Landes als festes Mitglied in den UN-Sicherheitsrat, beim ersten Weltraumflug eines Chinesen, bei der Wiedervereinigung mit Hongkong und Macau oder den Olympischen Spielen 2008 in Peking.
Viele Chinesen in Übersee wissen um die Defizite ihres Mutterlands und können zwischen dem Land und seiner Regierung sehr wohl unterscheiden. Deshalb haben sie bei der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas in den vergangenen Jahrzehnten gerne geholfen. Und zugleich, auch das lässt sich als typisch bezeichnen, sahen sie vielfach auch die Chance, dabei selbst etwas zu verdienen. Das Startkapital für den fulminanten Aufstieg des Landes, der in der Menschheitsgeschichte seinesgleichen sucht, kam hauptsächlich aus ihrem weltumspannenden Netzwerk.
Bis heute bilden Überseechinesen die größte Investorengruppe in China. Seit der Öffnung des Landes unter Deng Xiaoping waren alle Regierungen in Peking stets klug genug, dieses Netzwerk zu nutzen. Und das zunehmend nicht nur wirtschaftlich.
Seit dem vergangenen Jahr sind etwa chinesischstämmige Spitzensportler in aller Welt auch ohne Pass der Volksrepublik eingeladen, an den Nationalen Spielen des Landes teilzunehmen. Und um bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking und Zhangjiakou besser abzuschneiden, hat das Eishockey-Entwicklungsland China im kanadischen Vancouver ein Team mit Überseechinesen zusammengestellt, von dem es schneller lernen kann.
Volks- oder Nationalcharakter sind Geschichte und Kultur unterworfen und ändern sich mit den Lebensumständen. Außerhalb Chinas und in der städtisch-industriell dominierten Gesellschaft des Landes, das Teil einer globalisierten Welt geworden ist, wirken andere Kräfte als in der ländlich-agrarischen, auf sich selbst fixierten Gesellschaft, die das Wesen der Chinesen über Jahrtausende geprägt hat.
Jahrtausendealte Prägungen sind jedoch sehr langlebig. Kulturelle Veränderungen vollziehen sich nur langsam. Wer zur Psyche der Chinesen vordringen will, kommt daher nicht umhin, zunächst ihr historisches Erbe zu studieren. Dazu gehören auch die Beziehungen und Einstellungen des Westens zu dem Land.
Das westliche China-Bild im Wandel der Zeiten
Zwischen Faszination, Furcht und Verachtung
Seit der Antike hat China die Phantasie des Westens beschäftigt. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot bezeichnete es als »Land der Seide«. Erzählungen von seinen fabelhaften Reichtümern machten die Runde und weckten den Wunsch, daran teilzuhaben.
Der Seeweg nach China jedoch war unbekannt, der Landweg über Zentralasien lang, beschwerlich und gefährlich. Zudem wurde er von den Arabern kontrolliert, deren Expansion nach Westen abzuwehren das christliche Abendland lange voll in Anspruch nahm. Danach waren die zahlreichen Staaten des europäischen Kontinents über Jahrhunderte vornehmlich mit Streitigkeiten untereinander beschäftigt.
Erst im 13. Jahrhundert kamen Kaufleute aus Europa nach China. Einer von ihnen war Marco Polo aus Venedig, der mit rund 50 000 Einwohnern damals größten und prächtigsten Stadt des alten Kontinents. Sein Reisebericht prägte das China-Bild des Westens bis in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts hinein.
Marco Polo