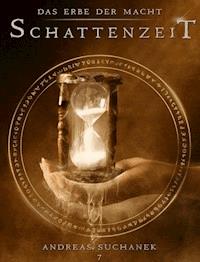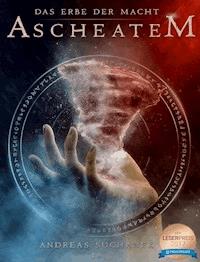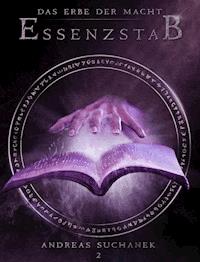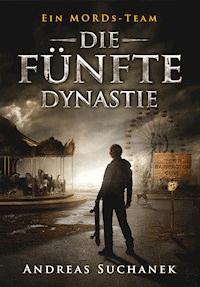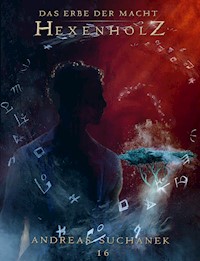12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Spiegelstadt
- Sprache: Deutsch
Magisch, romantisch, geheimnisvoll: »Spiegelstadt 2. Gefangen in Purpur und Schatten« ist der Abschluss der romantisch-queeren Urban-Fantasy-Dilogie der preisgekrönten Own-Voice-Autoren Nach seiner Flucht aus der Spiegelstadt findet sich Max in einer dritten Version von Berlin wieder: Statt Prunk und Glamour der 20er-Jahre herrschen hier Verfall und Zerstörung. Um in dieser Gefängniswelt zu überleben, muss Max mit einem neuen Feind zusammenarbeiten. Denn die Portale zwischen den Welten lassen sich nicht mehr öffnen, es gibt kein Entkommen. Für den rebellischen Lenyo sieht es indes nicht weniger düster aus: Nicht nur konnte er Max nicht beschützen – er ist auch der grausamen Feen-Herrscherin Tamyra in die Hände gefallen. Bald müssen alle Parteien erkennen, dass das magische Gewebe zwischen den Welten zu zerreißen droht. Falls das geschieht, sind alle drei Versionen von Berlin dem Untergang geweiht. Können Max und Lenyo noch einmal zueinander finden? Und ist ihre Liebe stark genug, um drei Welten zu retten? Die Own-Voice-Autoren Andreas Suchanek und Christian Handel haben mit »Spiegelstadt« eine magisch-mitreißende, hochspannende und anrührend romantische Urban Fantasy geschaffen: »Dass sich Christian Handel und Andreas Suchanek zusammengetan haben, um SPIEGELSTADT gemeinsam zu erschaffen, ist ein Glücksfall für alle Fans deutscher Fantasy! [E]ine spannende Geschichte mit liebenswerten und skurrilen Charakteren, einer wunderschönen Liebesgeschichte, vielen phantastischen sowie magischen Elementen und überraschenden Wendungen, die den Leserinnen und Lesern den Atem stocken lassen werden.« Dana Rotter, Nautilus – Fantasymagazin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Andreas Suchanek / Christian Handel
Spiegelstadt 2
Gefangen in Purpur und Schatten
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Das Schicksal der Spiegelstadt steht auf dem Spiel!
Nach seiner Flucht aus der Spiegelstadt findet sich Max in einer dritten Version von Berlin wieder: Statt des Glamours der 20er-Jahre herrschen hier Verfall und Zerstörung. Und es gibt kein Entkommen, denn die Portale zwischen den Welten lassen sich nicht mehr öffnen. Wenn es Max nicht gelingt, noch einmal auf seine magischen Fähigkeiten zuzugreifen, wird er weder seine große Liebe Lenyo retten können – noch die drei miteinander verbundenen Städte …
Das Finale der queeren Urban-Fantasy-Dilogie der preisgekrönten Autoren Andreas Suchanek und Christian Handel
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Vor langer Zeit
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
Epilog
Vor langer Zeit
Die Luft roch nach Asche, Blut und Verwesung. Trockene Erde knirschte unter seinen Stiefelsohlen, Kiesel kullerten davon, wenn er sie mit der Spitze traf.
»Eure Majestät, es ist nicht sicher«, erklang die Stimme von Haralm, dem Hauptmann der Wache.
Ludvin schenkte ihm lediglich einen Blick.
Sein Gegenüber schaute zu Boden, blieb aber angespannt. Am Firmament zuckten Blitze, der Wind frischte auf. Ein Sturm war auf dem Weg.
Doch Ludvin war sicher, dass er noch etwas anderes gehört hatte. Konnte das sein? Die Gefängniswelt war noch leer, würde sich aber bald füllen. Das zersetzende Gerede in den Städten nahm zu, sie mussten die Aufständischen entfernen. Und das auf eine Art, die sie aus den Erinnerungen ihrer Helfer auslöschte.
Ludvin stoppte und lauschte erneut. Es war mehr als ein Geräusch, es war ein Gefühl. Es glich jenem, das er spürte, wenn er den Purpurschleier benutzte. Ein Ziehen, ein Echo, der Hauch uralter Magie.
Nicht auszudenken, was geschah, sollte ein Gefangener hier über irgendeine Magie stolpern, die er nutzen konnte.
»Eure Majestät«, erklang erneut Haralms Stimme. »Der Sturm ist fast hier. Ihr wisst, was er uns kosten könnte.«
Ludvin wusste es. Ebenso wusste er, dass diese Worte seinen Hauptmann Überwindung gekostet hatten. Niemand sprach den König auf diese Art an, wenn es vermeidbar war. Seine breiten Schultern in der Uniform, die Orden an der Brust, der Hauch von Magie, der ihn durch die zahlreichen Schutzartefakte umgab – seine gesamte Präsenz war königlich.
Die Gedanken an seine Leibwache verebbten abrupt, als er eine Gestalt ausmachte. Sie saß im Matsch, den Körper von Krusten aus Blut übersät. Ein Mädchen, eindeutig, und das blonde Haar war trotz des Schmutzes auszumachen.
Ludvin eilte auf sie zu, ging neben ihr in die Hocke. Augen von unendlicher Tiefe erwiderten seinen Blick. »Wie kommst du hierher?«
Er trug seinen Purpurmantel nicht, winkte jedoch herrisch Haralm herbei, damit dieser seine Weste ablegte und die Blöße des Kindes bedeckte. Nicht, dass man unter all dem Dreck etwas hätte erkennen können.
Das Kind blinzelte nur, betrachtete ihn eingehend. Die Weste fand ihren Platz, und Ludvin nahm das Mädchen auf die Arme. Wie alt mochte es sein? Sieben? Magische Wirkungen konnten das Äußere natürlich verändern.
»Kannst du sprechen?«, fragte er.
Das Kind blickte ihn nur weiter aus jenen seltsam unergründlichen Augen an, in denen ein violetter Sturm zu toben schien.
»Eure Majestät, wir müssen hier weg«, sagte Haralm. In seiner Stimme klang jener Ton mit, den er nur anschlug, wenn Lebensgefahr bestand. Ab diesem Augenblick würde er sich über Befehle hinwegsetzen, um Ludvin zu schützen, wohl wissend, dass der Tod des Königs auch sein eigener wäre.
Mit dem Mädchen auf den Armen gingen sie schnellen Schrittes zurück Richtung Tor.
In der Ferne ragten heruntergekommene Gemäuer empor, der Sturm kam zügig näher. Purpurne Blitze zuckten vom Firmament herab, eine rötliche Wand schob sich auf sie zu.
In Sichtweite waberte das Portal.
»Ja«, sagte das Mädchen plötzlich mit glockenheller Stimme. »Dort will ich hin.«
Ludvin zuckte zusammen, wäre beinahe gestolpert. »Du kannst sprechen.«
»Eure Sprache ist nicht schwer«, erwiderte das Mädchen.
Der Sturm war fast heran.
Ludvin spürte die Gefahr. Sie war jetzt ganz nah.
»Ich bin Tamyra.«
Sie sprangen durch das Portal.
1. Kapitel
Max
Max wirbelte durch eine Welt aus Schatten, wurde hilflos hin und her geschleudert von unsichtbaren Kräften. Die Finsternis um ihn herum war zähflüssig und erdrückend, undurchdringlich – und sie stank. Der Geruch nach Verwesung drohte ihn zu überwältigen. Goldene Blitze zuckten durch das Nichts, beleuchteten für Sekunden Schemen, die ihn umgaben wie Schattenmonster in einem Albtraum, bevor sie wieder von der Schwärze verschluckt wurden. Max versuchte, sich gegen die unsichtbaren Kräfte zu stemmen, die ihn in alle Richtungen schleuderten, aber seine Hände griffen ein ums andere Mal ins Leere, und seine Panik wuchs.
Plötzlich stoppte das Wirbeln. Die Schatten um ihn herum verdichteten sich und hielten ihn fest.
Die Welt erstarrte.
Ich …
Bevor sich der Gedanke klar in seinem Kopf formen konnte, platzte die Dunkelheit auf wie die Haut einer überreifen Frucht und ließ ihn fallen, spuckte ihn aus.
Gerade noch rechtzeitig zog er die Beine an und riss die Arme vor das Gesicht. Dann prallte er hart auf unebenem Boden auf. Ein schreckliches Glühen schoss durch seinen Unterarm, und er brüllte vor Schmerz und Überraschung auf.
Am Ende des Schreis sog er die Luft gierig ein – und hätte beinahe gewürgt, so faulig roch es. Doch alles war besser als das blutige Chaos, dem er gerade entkommen war. Wo jeder gegen jeden gekämpft hatte: Lenyo gegen Tamyra. Kalinda gegen sie alle. Der Schuss, der die Jägerin niedergestreckt hatte. Janus und dieses Loch, das er, Max, in das Gewebe der Welt gerissen hatte und das nicht geschlossen werden konnte, es sei denn, jemand ging hindurch.
Hatte sein Opfer genügt? Hatte er mit seinem Sprung in das Portal Lenyo gerettet? Oder hatte Tamyra …
»Geht es dir gut?«, erklang Robins Stimme neben ihm.
Nein, nicht Robin.
Max ignorierte den brennenden Schmerz in seinem Arm, griff nach einem faustgroßen Stein, der vor ihm auf dem Boden lag, und stürzte sich auf die Kreatur.
Robin riss überrascht die Augen auf.
Das ist nicht Robin!
»Es gibt keine Robin«, hatte das Monster zu ihm gesagt.
Max holte aus, um mit dem Stein auf den Kopf des Wesens einzuschlagen. Dieses riss in letzter Sekunde den Arm nach oben, fing seinen Schlag ab.
Max sah rot. Er ließ den Stein fallen und stürzte mit dem Ungeheuer zu Boden. Es mochte aussehen wie seine beste Freundin, war es aber nicht.
Verzweifelt versuchte er, das Monster an den Ohren zu packen. Es hatte Imgard kaltblütig ermordet, Robin vernichtet, es war ihm egal, was hier mit ihm geschah, dieses Biest musste leiden. Es muss …!
Die Verzweiflung gab ihm Kraft. Mit beiden Händen riss er den Kopf des Wesens erst in die Höhe, dann donnerte er ihn auf den harten Boden.
Sein Gegner brüllte auf, holte selbst mit der Faust aus und versetzte ihm einen Kinnhaken.
Reflexartig ließ Max los und stolperte zurück.
»Maximus –«
»Nenn mich nicht so!«, unterbrach er das Monster. Seine Hände tasteten nach einem weiteren Stein.
»Ich weiß, ich hab dir was vorgemacht. Ich bin ein Gestaltwandler.«
Max erinnerte sich daran, wie Robins Gesichtszüge zerronnen waren wie Schmelzwasser und sich neu zusammengesetzt hatten, zunächst zu denen eines arrogant wirkenden Mannes, dann zu denen einer spindeldürren Kreatur, die mehr Ähnlichkeit mit einem Alien als mit einem Menschen besaß. Diese Kreatur jetzt Robins vertrautes Gesicht tragen zu sehen, eingerahmt von ihren roten Haaren, ließ in Max’ Kehle Galle aufsteigen.
»Du bist der Erlkönig«, sagte er stumpf. So hatte Lenyo den Anführer des Widerstands genannt, der gegen Tamyra und ihresgleichen ins Feld zog.
Sie starrten sich an.
Warum hatte dieser Fremde all das getan? Warum hatte er ihm etwas vorgespielt? Warum sie alle verraten, wenn sie doch angeblich auf der gleichen Seite standen?
»Ja«, bekräftigte die Kreatur mit der Stimme seiner besten Freundin. »Ich bin aber auch Robin.«
Beinahe hätte Max den Stein fallen gelassen. Erinnerungen drängten sich ihm auf, an Versteckspiele in Imgards Garten, an Spaziergänge um den Schlachtensee, an Ausflüge in den Tierpark, gemeinsame Nachmittage in seinem Zimmer mit Chips und Gummibärchen. Seite an Seite hatten Robin und er auf dem Bett gelegen und für One Direction geschwärmt, sie für Harry, er für Zayn.
War das alles eine Lüge gewesen?
»Seit wann?«, presste er hervor. Sein Inneres schmerzte jetzt genauso sehr wie der verdammte Arm. »Mein ganzes Leben schon?«
Robin – der Gestaltwandler, der Erlkönig – machte Anstalten, sich ihm zu nähern.
»Stopp!«
Das Wesen verharrte, schaute sich dann nach links und rechts um.
»Hör auf, ihr Gesicht zu tragen«, verlangte Max und stand auf.
Die Worte prallten am Erlkönig ab. »Ich erkläre dir alles, versprochen. Aber vorher müssen wir von hier weg.«
»Weg?« Max ließ den Blick schweifen. Erst jetzt nahm er seine Umgebung richtig wahr.
Sie befanden sich nicht mehr in dem geheimnisvollen Raum mit der seltsamen Uhr und der Steintribüne, natürlich nicht. Stattdessen war er an einem Ort, der ihm wie ein postapokalyptischer Fiebertraum erschien. Um ihn herum breitete sich eine trostlose Landschaft aus Gestrüpp und Geröll aus. Dornige Ranken kletterten über geborstenen Stein. In der Ferne sah er hohe Gebäude, die ausgebombt und verlassen wirkten. Zu seiner Rechten machte er durch wirbelnde Staubmassen kahle Bäume aus. Ihre Silhouetten zeichneten sich trostlos vor einem seltsam gelbstichigen Himmel ab. Sein Blick ging nach links und huschte über die Fassaden rußgeschwärzter Ruinen: stumme Zeugen einer schrecklichen Zeit, in der Verfall und Zerstörung ihre Spuren hinterlassen hatten.
Max’ Blick blieb an etwas seltsam Vertrautem hängen, an den Überresten eines majestätischen Monuments, das nur aus Trümmern bestand. Bruchstücke gewaltiger Säulen ragten wie abgebrochene Zahnstümpfe in den Himmel, umgeben von Bergen aus Geröll und dornigem Astwerk. Es kletterte über die Steine, eine wilde und unnatürliche Präsenz, die in Max eine seltsame Unruhe auslöste. Die Dornen schienen gierig darauf zu sein, das Bauwerk zu verschlingen, und Max meinte, ein leises Rascheln zu hören, so als ob sie dabei wären, ihren Griff noch fester um das einst stolze Monument zu schließen.
In einer Lücke zwischen den Ranken entdeckte er endlich etwas, das wie der Teil einer Statue aussah: die Überreste eines Kupferengels, der einen Speer in der Hand hielt. Nein, kein Speer. Auch kein Engel. Die Erkenntnis schlug wie ein Hammer auf ihn ein. Er blickte auf die Siegesgöttin Victoria, die eigentlich auf ihrem Streitwagen auf dem Brandenburger Tor hätte thronen müssen. Nun lag sie in den zerbrochenen Überresten des Wahrzeichens.
Victoria war gefallen. Verloren.
So wie er selbst.
Max blinzelte Tränen weg.
»Von hier weg?«, fragte er den Erlkönig. »Wohin denn? Wo sind wir überhaupt?«
Nicht mehr in der Spiegelstadt, so viel war klar. Der Riss, den er geöffnet hatte, war eine Passage gewesen. Aber keine, die ihn nach Hause führte, zurück in sein Berlin.
»Max«, drängte der Erlkönig ihn mit Robins Stimme. »Ich schwöre dir, ich werde dir alles erklären. Wenn wir in Sicherheit sind.«
Wieder versuchte das Monster, einen Schritt auf ihn zuzumachen, und erneut wich Max zurück. Etwas zerbrach knirschend unter seinem Gewicht. Er hob den Fuß und blickte hinab. Knochen lagen dort. Ein ganzes Skelett, klein, wie das eines Tieres, vielleicht eines Hasen. Er konnte es nicht genau erkennen, die Überreste lagen verstreut zwischen den Ranken. Es waren zu viele, als dass sie nur von einem einzelnen Tier stammen konnten.
Etwas Dunkles tropfte von seinem Arm in den Staub und auf die bleichen Knochen.
Verwirrt schaute er auf die Wunde am Arm, ein gezackter, hässlicher Schnitt, aus dem Blut quoll. Den Schmerz vom Aufprall hatte er ganz vergessen. Ihm war fast, als ob das Brennen zu ihm gehörte. Hatte er sich die Verletzung an einer Dornenranke zugezogen?
»Wir kümmern uns gleich darum«, versprach sein Gegenüber. »Deine Wunde muss verbunden werden.«
»Wieso? Was macht es schon, ob ich blute? Wir kommen hier ohnehin nicht weg. Oder hast du goldene Tränen dabei?«
Robin – nein, nein, nein: Der Erlkönig! Der Erlkönig schüttelte den Kopf. »Aber dich.«
Beinahe hätte Max laut gelacht. »Mich? Erinnerst du dich daran, was passiert ist, als ich diesen Riss vorhin geöffnet habe?«
Sein Portal aus Schwärze und Verfall hatte angefangen, die Welt aufzufressen. Welten. Verdammt, er hatte sich geopfert, um genau das zu verhindern.
Aber waren die anderen in Sicherheit? Was war mit Lenyo?
»Das war keine Pforte, die du geöffnet hast«, entgegnete der Gestaltwandler. »Das war ein Riss. Unkontrolliert. Aber das muss nicht so sein, Max. Du kannst ein Portal auch anders öffnen, besser. Deine Mutter hätte es dir sagen müssen, dich unterrichten sollen: Du bist der Schlüssel!«
Max’ Finger lösten sich vom Stein, als hätten sie jegliche Kraft verloren, und die Beine sackten unter seinem Körper weg. Blitzschnell bewegte sich der Erlkönig auf ihn zu und fing ihn auf, ehe er stürzen konnte. Langsam führte er ihn weg von dem zerstörten Wahrzeichen, zu den Überresten einer Säule, damit er sich daran lehnen konnte. Max fühlte sich sogar zu schwach, um seinen Griff abzuschütteln.
»Deine Mutter hätte es dir sagen müssen«, hallten die Worte in seinem Kopf wider. Prinzessin Imgard hatte ihm ja nicht einmal mitgeteilt, dass sie seine Mutter war! Trauer und Wut kämpften in ihm um die Vorherrschaft, während das Bild der Frau in ihm aufstieg, die ihn aufgezogen hatte. Und selbst dieses Bild, diese Gestalt, war eine Lüge gewesen – eine Illusion, hervorgerufen durch einen Trank, der ihr Aussehen für immer verändert hatte. Sein Leben lang hatte Max sie für seine Großmutter gehalten. Seine Kuschelfreundin. Offensichtlich war alles an seinem Leben eine Lüge! Hatte ihm überhaupt jemals jemand die Wahrheit erzählt?
Taub ließ Max es zu, dass der Erlkönig den Schnitt an seinem Arm betrachtete. Den brennenden Schmerz nahm er nur dumpf wahr.
»Das sieht nicht gut aus«, sagte der Erlkönig, während er ein Stück Stoff aus seiner Hosentasche fischte und damit die Wunde betupfte. »Wir brauchen einen Heilkristall. Ich weiß, wo es welche gibt.«
Max’ Kopf ruckte hoch. »Du weißt, wo?« In den unterirdischen Katakomben hatte das Wesen ihn bedrängt, ein Portal zu öffnen. Angeblich, um Kalinda hineinzustoßen. Max’ Augen verengten sich. »Du wolltest, dass ich den Spalt öffne, und bist mir gefolgt, obwohl du wusstest, was dich erwartet. Warum?«
Der Erlkönig antwortete nicht.
Konzentriert verband er die Wunde. Max starrte auf den wippenden roten Pferdeschwanz. Robins Pferdeschwanz.
Mit der freien Hand tastete er über den staubigen Boden. Wie einfach es wäre, jetzt einen Gesteinsbrocken in die Hand zu nehmen und diesem Monster den Schädel einzuschlagen. Seine Finger zuckten, so sehr sehnte er sich danach. Er hasste den Erlkönig, hasste dieses Monster, das ihm Robin gestohlen hatte, das seine Großmutter … seine Mutter umgebracht hatte. Max wusste, er sollte blanken Hass fühlen. Zorn. Sich auf den Mörder stürzen wollen, ihn vernichten … Aber alles, was er fühlte, war … dumpf. Als betrachtete er sich selbst und die Situation um sich herum durch eine Milchglasscheibe.
Auch die Erkenntnis, wo sie sich befanden, sickerte nur langsam in ihn ein. »Wir sind in der Gefängniswelt, die mein Urgroßvater geschaffen hat.«
»Großvater«, korrigierte der Erlkönig.
»Urgroßvater«, widersprach Max.
»Nein. Es war Imgards eigener Vater, nicht ihr Großvater, glaub mir.«
Nun zupfte doch so etwas wie Unruhe in ihm. »Aber ich habe es in der Erinnerung aus der Silberträne gesehen: Mein Großvater kam auf die Idee, unser Berlin erneut zu spiegeln, hat sie gesagt.«
Sie. Prinzessin Imgard. Seine Mutter.
In seiner Hosentasche befand sich eine Silberträne. Tamyra hatte sie ihm zugeworfen. Angeblich enthielt sie die letzte Erinnerung Imgards: der Moment, in dem sie umgebracht worden war. Vom Erlkönig. Seine Hand schloss sich um einen weiteren spitzen Stein, und er spannte die Muskeln an.
»Das würde ich nicht tun«, sagte der Erlkönig so beiläufig, als riete er ihm davon ab, ein bestimmtes Essen im Restaurant zu bestellen. Er blickte nicht einmal zu ihm auf, fummelte nur weiter an dem provisorischen Verband. »Ohne mich überlebst du hier keinen Tag.«
Max schluckte, ließ den Stein jedoch nicht los. Er konnte immer noch zuschlagen. »Wir kommen sowieso nie mehr von hier weg«, sagte er dann.
Das brachte den Erlkönig doch dazu, aufzuschauen. Seine Lippen verzogen sich zu Robins spöttischem Lächeln. »Es gibt drei Gründe, warum du mit mir Frieden schließen solltest.«
Wut kochte in ihm auf. »Frieden?« Wie sollte das möglich sein?
»Oder einen Waffenstillstand, wenn dir das lieber ist.«
Schlag ihn, beschwor Max sich selbst. Schlag ihm den Stein mitten ins Gesicht.
»Ich höre«, sagte er stattdessen.
»Ich weiß, wie wir von hier wieder nach Hause kommen«, begann der Erlkönig.
Lüge, war das Erste, was Max durch den Kopf schoss. Doch wenn der Erlkönig schon einmal hier gewesen war, und die Reaktion seiner Tante hatte das bestätigt, dann bedeutete das, dass er auch schon einmal von hier entkommen war.
»Zweitens?«, fragte er deshalb.
»Ich kann dir erzählen, was wirklich vor sich geht. Welche Schuld deine Familie auf sich geladen hat. Und wie wir die, die sie unterdrückt und gefangen gesetzt haben, retten können.«
»Das genügt nicht.«
Der Gestaltwandler richtete sich auf. »Robin ist nicht tot.«
Max’ Herz begann, schneller zu klopfen.
»Sie ist ein Teil von mir«, teilte ihm der Erlkönig mit. »Und wenn du mir hilfst, gebe ich sie dir zurück.«
2. Kapitel
Lenyo
Für eine Sekunde verlor sich Lenyo in der Melange aus Kampfgeräuschen, Magie und dem immensen Gefühl von Orientierungsverlust. Schmerz tobte durch seinen Magen, wo Tamyra ihm das Knie hineingerammt hatte. Er keuchte, spuckte und atmete schwer.
Aus tränenverschleierten Augen sah er Kalinda am Boden liegen. Der Schuss aus Tamyras Waffe hatte die Jägerin niedergestreckt. Eine Blutlache breitete sich unter ihr aus. Max war gerade in den Riss gesprungen, Robin direkt hinterher. Mit einem seltsamen nassen Geräusch, als würde eine eitrige Wunde sich abrupt schließen, verschwand der Durchgang.
Obwohl Tamyra eindeutig die Oberhand gewonnen hatte, kümmerte sie sich nicht länger um ihn, Janus oder Kalinda; sie eilte zur Uhr. Das seltsame Objekt hatte sein Geheimnis bisher nicht preisgegeben, doch irgendwie schien es die Magie zu stabilisieren, die ihr gespiegeltes Berlin mit jenem der Menschen auf der einen und dem Gefängnis auf der anderen Seite verknüpfte.
Die Ziffernblätter bestanden aus schwarzem Metall, der Hintergrund der Uhr war alt und rissig. Es gab Zylinder und Zahnräder, doch obgleich es sich eindeutig um eine Apparatur handelte, verströmte sie eine Art von … Gehässigkeit. Boshaftigkeit, gebunden in Metall und Glas. Für einen Augenblick fühlte Lenyo sich angestarrt von einer uralten Entität. Im nächsten war alles wieder wie zuvor. Beben erschütterten den Raum, in der Luft lag der Geruch von Kalindas Blut.
Lenyo erhob sich und taumelte auf Tamyra zu. Sie hantierte an der Apparatur, war abgelenkt.
Janus setzte sich in Bewegung, um ihm zu folgen. Lenyo schüttelte den Kopf, nickte in Richtung Kalinda und formte die Worte: Bring sie weg.
Der Dschinn zögerte, kam der Aufforderung schlussendlich aber nach. Tamyra gehörte Lenyo ganz allein. Sie hatte Albiert getötet, seine Schwester umgebracht und hielt die Spiegelstadt in einem eisernen Klammergriff. Niemand hier war frei. Selbst die Liebe stand unter dem Bann der im Blutkompass festgelegten Unvereinbarkeit.
Doch heute konnte er das ändern.
»Ihr Idioten!«, brüllte Tamyra. »Ist euch eigentlich klar, was ihr angerichtet habt!«
Sie hatte ihn also bemerkt.
Lenyo rammte ihr die Schulter in die Seite. Vermutlich schmerzte ihn das mehr als sie, doch das war ihm egal. Von der Wucht wurde sie zu Boden geschleudert. Das seltsame Bedienpult aus Hebeln und Drehreglern war frei. Nicht, dass ihm diese Anzeigen etwas sagten.
»Ich befreie die Spiegelstadt von dir!«, brüllte Lenyo zurück.
Der angestaute Hass kam über ihn wie eine Welle. Er sah all die toten Freunde, das Gesicht seiner Schwester, das ihn aus leeren Augen anstarrte. Ihr Körper hinter der Bar, der Kopf … Er brüllte und sprang auf ihre Mörderin zu.
Tamyra konnte seinen ersten Schlag blocken, doch der zweite und dritte trafen. Wieder und wieder schlug er zu. Blut spritzte, Haut platzte auf, ihre Nase brach. Längst rannen Tränen über seine Wangen. Er wollte nicht alle verloren haben, die ihm etwas bedeuteten, wollte das Schicksal zwingen, sie ihm zurückzugeben. Durch einen Trick, Magie oder sonst etwas.
In diesem Augenblick hätte er jedes Leben geopfert, nur um jene zurückzubekommen, die er liebte.
Der Gedanke ließ seine Wut verrauchen. Durch den Schleier aus Tränen blickte er auf das blutige Gesicht von Tamyra.
»Sind wir dann fertig?«, fragte diese.
Ihr Blut floss zurück, die Wunden schlossen sich wie von Geisterhand, Knochen knackten. Lenyo sprang auf, brachte Abstand zwischen sich und sie.
Mit einer eleganten Bewegung kam Tamyra wieder in die Höhe. »Du kannst mich nicht töten, dummer kleiner Lenyo. Und sei froh darüber. Momentan bin ich die Einzige, die zwischen der Zerstörung der Welt und dem Bewahren von allem steht, was dir lieb ist.«
»Es gibt nichts mehr, was mir lieb ist«, brachte er krächzend hervor. »Du hast mir alles genommen.«
»Und dafür soll der Rest der Welt zahlen? Wie egoistisch von dir.« Tamyra lächelte. »In dir steckt ja doch etwas Pep. Hätte ich gar nicht gedacht.« Sie ging einfach an ihm vorbei, stellte sich wieder an die Konsole und begann zu hantieren. Sie drehte an einem Rad, wodurch das Abfließen des violetten Sirenenblutes gestoppt wurde. Nur durch die ihm innewohnende Macht, die durch die Uhr kanalisiert wurde, blieben die Welten stabil. »Der Riss ist endlich geschlossen, ich kann also Gegenmaßnahmen einleiten. Aber das war knapp. Eine Minute länger, und es wäre das Ende gewesen.«
Es klackte und ratterte, Skalen verschoben sich. Das Beben ließ nach. Auch das durchdringende Ticken verstummte. Lenyo sah nach oben zu dem riesigen Zifferblatt der Uhr. Der Sekundenzeiger war wieder erstarrt, wie eingefroren in der Zeit.
Schnell wandte er sich um. Janus und Kalinda waren fort. Falls die Jägerin es bis nach draußen schaffte, konnte Janus ihr helfen. Noch vor wenigen Tagen hätte er ganz anders darüber gedacht, Kalinda niemals vertraut. Doch im Kampf gegen Tamyra hatte sie sich positioniert; und zwar eindeutig gegen ihre ehemalige Chefin.
»Wie viel Böses kann in einem einzigen Wesen stecken?« Lenyo fühlte sich leer und ausgebrannt. Er wollte Tamyra anspucken, sie packen und mit eigenen Händen ihr Genick brechen. Doch sein Körper stand nur da.
»Mehr, als du denkst.« Tamyra lächelte.
Sie wirkte wie ein Raubtier, das sich der eigenen Überlegenheit bewusst war. Natürlich konnte Lenyo sie jederzeit angreifen, doch was für ein Zauber ihre Wunden auch immer geschlossen hatte, er würde erneut wirken. Ob dieser sie am Leben hielt? Wenn sie verbrannte, setzte sich dann die Asche wieder zusammen? Oder … »Bist du ein Wechselbalg?«
Tamyra fuhr zu ihm herum. »Wage es nie wieder, mich mit diesen Alles-und-nichts-Wesen zu vergleichen! Es hat einen Grund, warum wir sie ausgerottet haben.« Beiläufig nahm sie die Waffe auf, die dort lag, wo Robin verschwunden war. »Zumindest dachten wir das.«
Es wirkte geradezu unwirklich, dass er neben ihr stand und sie nicht angriff. Konnte er ihr die Waffe entreißen und in den Kopf schießen? Würde sie dann sterben?
Oder war es vorbei?
Vorsichtig machte Lenyo einen Schritt zurück. Er würde diese Frau töten, jedoch an einem anderen Tag. Hier und heute hatte er verloren.
Er warf sich herum und rannte hinter Janus und Kalinda zum Ausgang.
Ein Schuss hallte.
Die Kugel drang in seine rechte Wade ein, ließ ihn stolpern und der Länge nach zu Boden gehen. Die Wucht des Aufpralls trieb ihm erneut die Luft aus den Lungen.
»Nur weil ich beschäftigt bin, hast du noch lange nicht die Erlaubnis, zu gehen.« Tamyra trat zurück an die Konsole, als wäre nichts geschehen.
Ihre Angst über den Riss war fort, genau wie der Riss selbst. Sie hatte die Oberhand zurückgewonnen.
Sie war kein Wechselbalg oder, wie es in den Geschichtspapieren auch genannt wurde, ein Alles-und-nichts-Wesen. Der Öffentlichkeit mochte das nicht mehr bekannt sein, doch durch Infiltration hatte der Widerstand sorgfältig zusammengetragen, wo Attacken auf die Königsfamilie in der Vergangenheit am erfolgreichsten gewesen waren. Die Wechselbälger waren bis zu einem gewissen Punkt sehr beliebt bei der Königsfamilie gewesen. Aus ihnen hatten sie einen effektiven Spionagering geformt und sie auf subversive Elemente angesetzt. Hierfür wurde ein Zielsubjekt erst tage- oder gar wochenlang observiert, dann nahm ein Wechselbalg deren Gestalt an, tauchte in das fremde Leben ein und infiltrierte so die entsprechenden Kreise. Niemand war sicher.
Was die Königsfamilie dabei nicht bedacht hatte, war, dass es auch subversive Wechselbälger gab. Diese hatten die Königsfamilie observiert, und eines Tages war es zu dem Versuch gekommen, den König zu töten und durch ein solches Wesen zu ersetzen. Der Anschlag war fehlgegangen, hatte jedoch Auswirkungen gezeigt.
Denn daraufhin begann die große Säuberung. Es spielte keine Rolle, ob der jeweilige Wechselbalg sich jahrzehntelang in der Armee hervorgetan hatte oder eben erst neugeboren war. Sie alle wurden geholt und verschwanden. Bisher war der Widerstand davon ausgegangen, dass sie getötet worden waren. Andererseits war das bei Wechselbälgern schwer, ihr ganzer Körper war formbar.
»Ihr habt sie in das Gefängnis geworfen«, flüsterte Lenyo.
Plötzlich ergab es Sinn. Wenn Robin in Wahrheit der Erlkönig war, hatte der gesamte Widerstand den Zweck, das zu beenden, was damals begonnen worden war. Die Königsfamilie sollte gestürzt werden. Und natürlich wollte der Wechselbalg sein Volk befreien, das im Gefängnis festsaß.
Unweigerlich fragte sich Lenyo, warum der Erlkönig nicht einfach mit offenen Karten gespielt hatte. Sie hatten schließlich alle das gleiche Ziel: den Sturz der Königsfamilie. Oder?
»So schweigsam?« Tamyra blickte kurz zu ihm herüber. »Das bin ich gar nicht von dir gewohnt. Du sollst mich doch unterhalten.«
»Es interessiert mich nicht, was du willst«, erwiderte er keuchend.
»Da ist aber jemand trotzig.«
Die Apparatur begann zu summen.
»Du hast dich also nach oben schlafen wollen?«, fragte Tamyra.
Lenyo blinzelte. »W…Was?«
»Du und mein Neffe. Max.«
Der Gedanke, dass sein Andersseiter mit dieser Frau verwandt war, war so fremd, so grundlegend falsch. »Macht dir das Spaß?«
»Dich zu provozieren?«
»Ständig mit dieser Pseudo-Ironie durch die Welt zu gehen, wo doch jeder weiß, wie du bist. Wer du bist. Glaubst du, ich finde deine Worte witzig? Oder irgendwer sonst? Wäre dein Innerstes sichtbar, du wärst ein schwarzer Klumpen Bosheit.«
»Wenn das Innere sichtbar wäre, Lenyo, dann wären wir das alle. Es gibt nichts Gutes in Menschen und Feenwesen. Sieh es dir doch an.« Sie deutete in die Höhe. »Zuerst haben wir die Teilung eingeleitet, um sicher zu sein. Prompt herrschte Chaos. Die Gefängniswelt musste erschaffen werden.« Bei diesen Worten taumelte Tamyra und stützte sich auf die Apparatur. Doch der Schwindel verschwand sofort wieder. »Und jetzt brennen die Straßen, der Mob will die Ordnung zerstören. Sie werden natürlich scheitern, wir sind auf solche Situationen vorbereitet, aber erklär mir eines: Was wäre, wenn der Widerstand siegt?«
»Wir wären endlich von eurer Knechtschaft befreit!«
»Gewiss.« Tamyra wedelte mit der Hand. »Das Urböse ist besiegt, und all die Probleme gehören der Vergangenheit an. Aber: Was dann? Bis vor wenigen Minuten wusstest du nicht, dass euer Anführer ein Wechselbalg ist. Er hätte die Tore der Gefängniswelt geöffnet und auch sein Volk zurückgeholt. Was, denkst du, hätte das für Folgen? Auf Rache sinnende Wesen, die eingesperrt waren, kehren zurück. Ihr hättet die Knute, die euch zu Boden schlägt, lediglich ausgetauscht. So ist es immer.«
»Wir hätten sie mit offenen Armen begrüßt und eine Ordnung erschaffen, die auf Demokratie –«
Tamyra brach in schallendes Gelächter aus. Es war nicht gespielt, das sah er ihr an. »Ich bitte dich, Lenyo.« Nur langsam kam sie wieder zu Atem. »Du bist ja unterhaltsamer, als ich dachte. Demokratie! Dieses Konzept beruht darauf, dass alle Menschen von einer gewählten Gruppe geführt werden, die Kompromisse schließt.« Sie schüttelte den Kopf. »Weder Feenwesen noch Menschen wollen Kompromisse. Sie wollen, dass gefälligst ihr Weg der richtige ist. Schließ genug Kompromisse, und Wesen wie Menschen wählen in ihrer Wut jene, die einfache Antworten auf komplexe Fragen geben. Die einen festen Standpunkt vertreten. Und die holen sich die Macht dann. Demokratie ist immer nur ein Zwischenspiel zwischen zwei Extremen, die abwechselnd an die Macht gelangen.«
»Damit rechtfertigst du deine Taten?«
»Die Mehrheit lebt hier in Ruhe vor sich hin und genießt ihre gewöhnliche bürgerliche Existenz«, erwiderte Tamyra. »Schau doch auf die andere Seite, Lenyo. Sie zerstören sich selbst, ihren Planeten, bringen sich um, stecken einander in den Kerker … und wofür?«
»Sie köpfen sich aber nicht gegenseitig!«
»Nun, was das betrifft, solltest du dringend dein Wissen über die Französische Revolution aufbessern. Doch falls es dich beruhigt, das mit Yelna war ein Unfall.«
»Ein … Unfall?« Lenyos Magen zog sich zusammen. Trotz der Schmerzen richtete er sich auf, kam wacklig auf die Beine. »Ein Unfall?«
»Richtig. Weißt du, ich war schon zur Tür raus. Es war quasi ein Schnippen zu viel.«
»Ein Schnippen zu viel?!« Die Wut kehrte zurück. Einem Orkan gleich peitschte sie durch sein Innerstes.
»Es war letztlich deine Schuld. Hättest du mich nicht provoziert … aber Schwamm drüber.«
Blut rauschte in seinen Ohren, er nahm nicht mehr wahr, was Tamyra noch für sinnloses Geschwätz von sich gab. Lenyo sprang auf sie zu und griff nach ihrem Hals. Seine Hände schlossen sich um ihre Kehle. Es gab keinen Menschen, kein Wesen in diesem Universum, das er mehr hasste. Mochte die Spiegelstadt in Chaos und Feuer versinken, mochte er verbluten durch die Wunde an seiner Wade, in diesem Augenblick war ihm alles egal. Es gab nur ihn und Tamyra. Und er wollte sehen, wie sie starb.
Sie blickte ihn aus unergründlichen Augen an. Dann wurde sie aktiv. Zuerst rammte sie ihm das Knie in den Magen, dann zertrümmerte sie mit dem Ellbogen seine Nase. Blut spritzte, als Lenyo nach hinten kippte. Tamyra ragte neben ihm auf, holte aus und trat ihm ins Gesicht.
Lenyo lag am Boden und spürte, wie Blut und Kraft ihn verließen. Sein Körper war eine einzige große Wunde. Er wimmerte. Wieso konnte das Leben nicht schön sein? Er wollte mit Max und Yelna auf einer Terrasse sitzen, den neuen Tag begrüßen und gemeinsam lachen.
Doch nichts davon würde geschehen. Nie mehr. Am Ende war es stets Tamyra, die gewann.
Sie ging neben ihm in die Hocke, kümmerte sich nicht um das Blut auf ihrer Kleidung. Geradezu sanft strich sie eine Strähne aus seinem Gesicht.
»Keine Sorge, du stirbst heute nicht.« Ein diabolisches Lächeln legte sich auf ihre Züge. »Ich brauche ein paar Antworten, und du wirst sie mir geben. Wir werden eine Menge Spaß haben.«
3. Kapitel
Janus
Janus war elend zumute. Und das lag nicht an Kalinda, die er über seine Schulter geworfen hatte. Dschinn waren stärker, als es den Anschein machte, zumindest was ihre Körper betraf.
Ein ähnliches Gefühl hatte er gerade vor vier Wochen gehabt, als ein Twink nach einem One-Night-Stand ihn mit großen Augen angeblickt, allen Mut zusammengenommen und verkündet hatte, sich verliebt zu haben. Janus hatte ihm das Herz brechen müssen, es aber mit einem Vergessenszauber abgemildert. Schließlich wollte er nicht, dass es dem armen Tropf schlecht ging.
»He!«, brüllte es neben ihm.
Janus warf Kalinda im Reflex von der Schulter.
Die Jägerin landete unsanft auf dem Boden.
»Schrei mich gefälligst nicht so an!«, blaffte er.
»Wirf du mich nicht wie einen Kadaver über die Schulter«, schnauzte Kalinda zurück.
»Ich hatte eben keinen Schwebezauber parat!«
Sie funkelten einander an.
Janus seufzte. »Wir sind auf der Flucht und haben uns Tamyra zum Feind gemacht. Wir sollten später streiten. Du bist außerdem schwer verletzt. Ich konnte die Blutung stoppen, aber der Zauber wird nicht lange halten, und die inneren Verletzungen sind nach wie vor vorhanden.«
»Jedes Gespräch mit dir löst bei mir innere Verletzungen aus.«
Diesen einen Spruch gönnte ihr Janus, weil sie ein alter, kaputter Kadaver war. Den nächsten würde er wieder kontern. Doch Kalinda räusperte sich, nickte zufrieden und reckte sich. Es folgte ein schmerzhafter Ausruf, gefolgt von einem Fluch.
»Verletzt bedeutet, dass du nicht im Vollbesitz deiner körperlichen Kräfte bist«, sagte er liebenswürdig.
Was ihre geistigen Kräfte betraf, darüber schwieg er lieber.
Dann wandte er sich ab und ging davon. Kalinda humpelte hinterher. Er hatte ihr nicht die ganze Wahrheit gesagt. Der Zauber, der ihre Wunde verschlossen hatte, war hochkomplex und flüchtig. Sollte er zu früh verschwinden, würde sie innerhalb von Minuten verbluten. Sie benötigte Hilfe, und das schnell.
Sie erreichten die Treppenstufen, die in einen stillgelegten U-Bahn-Schacht mündeten.
»Wo gehen wir hin?«, fragte Kalinda.
Janus erschrak, als er sich ihr zuwandte. Ihr Gesicht war kreidebleich, ein Schweißfilm stand auf ihrer Stirn, ihre Muskeln zitterten. »Ich bringe dich zu … Freunden.«
Wobei er sich nicht sicher war, ob er diese Leute tatsächlich so nennen konnte. Wie nannte man Einzelgänger, die sich ab und an über den Weg liefen, aber zum gleichen Volk gehörten?
»Deine Freunde sind vermutlich meine Feinde.« Kalinda stützte sich an der Wand ab. Ihr Atem ging stoßweise. »Ich habe für Tamyra zahlreiche Aufgaben übernommen, dabei habe ich mir nicht viele Freunde gemacht.«
»Da sind wir einer Meinung. Aber das kriege ich schon hin. Im schlimmsten Fall stirbst du eben kurz und schmerzlos.«
Der Witz kam nicht gut an. Kalinda warf ihm böse Blicke zu, die – hätte sie die entsprechende magische Kraft besessen – locker hätten töten können.
Die Wohnung, die sie aufsuchen mussten, lag in Friedrichshain. Natürlich konnte er mit einer blutenden Jägerin nicht einfach so durch die Stadt gehen. Dachte er. Ein Trugschluss, wie sich kurz darauf am nächstgelegenen Bahnhof herausstellte. Überall hingen Revolutionsplakate, auf denen krakelig neue Grenzen innerhalb der Stadt eingezeichnet waren. »Da oben scheint einiges zu passieren. Niedergeschlagen ist der Aufstand auf jeden Fall nicht.«
Mittlerweile musste Kalinda sich auf ihn stützen. Sie traten an die Oberfläche, und Janus blieb geschockt stehen. Rauchsäulen stiegen über der Häuserfront auf, der Lärm von Menschenmassen erklang, von Kampfgeräuschen unterlegt.
»Eines muss man dem Widerstand lassen, das hier ist hervorragend geplant«, sagte Janus. »Auch wenn ihr Chef offensichtlich nicht der war, der er zu sein vorgab.«
»Tamyra wird sie alle umbringen.«
»Unser Sonnenschein hat gesprochen.« Janus tätschelte Kalindas Arm. »Aber wir leben noch.«
»Noch.«
»Jetzt ist aber gut.«
Sie gingen durch die Straßen, und letztlich wagte es Janus, mit Kalinda eine kurze Strecke mit der U-Bahn zu fahren. Niemand nahm von ihnen Notiz. Offenbar war jeder mit sich selbst beschäftigt. Tamyras Helfer würden in dieser Situation kaum nach einem Dschinn und einer Jägerin suchen, sie mussten den Palast schützen. Fairerweise – auch wenn es schmerzte – musste Janus sich eingestehen, dass sie in all dem Chaos schlicht unbedeutend waren. Was konnten sie beide schon tun, was dem Königshaus oder Tamyra gefährlich werden mochte?
Irgendwann erreichten sie Friedrichshain. Janus sah das Haus von Weitem und atmete auf. Es war ein renovierter Altbau, dessen Außenseite in Klinkerbauweise auf alt getrimmt war. Hohe Fenster ragten vom Boden bis zur Decke, das Innere war loftartig gestaltet.
Janus zeichnete hastig ein magisches Symbol auf die Tür, die sich daraufhin öffnete. Mit dem Fuß schob er sie hinter Kalinda wieder zu und brachte die Jägerin zu dem edlen Designersofa, das gleich voller Blut sein würde. Sie sank auf die Fläche und atmete mit geschlossenen Augen langsam ein und aus.
Das Problem bei einem Volk aus Einzelgängern, die alle freiheitsliebend waren, war die Kommunikation. Es gab nun einmal Dinge, die die Dschinn als ganzes Volk betrafen. Und genau dafür existierte dieses Loft.
Janus eilte zu einer Truhe, die an der Seite stand und für gewöhnliche Besucher unsichtbar war. Er öffnete sie und nahm die Gegenstände heraus. Ein einzelner Schuh (Stiletto), ein Schal und ein Slip.
Schnell legte er die drei Gegenstände in der Wohnung ab. Gedanklich manifestierte er die mit Stiletto, Schal und Slip verbundenen Personen.
Über dem Schuh erschien eine Silhouette, die rasch Konturen annahm. Ein(e) Dschinn manifestierte sich, einen Fuß im Stiletto. »Ach verdammt, ich hätte einen anderen Anker nutzen sollen. Wenigstens war ich dieses Mal barfuß.« Sier blickte auf. »Ich hoffe, es ist wichtig.« Jaris(a) verschränkte die Arme, als sei es ein Sakrileg, dass der Ruf ausgelöst worden war.
Der Schal erhob sich in die Luft, und kurz darauf manifestierte sich eine elegante ältere Dame mit grauem Haar und Saphirohrringen. Sie zog sich den Schal vom Hals. »Ich hatte ganz vergessen, dass es Zeit für den Sommeranker wird. Der Schal ist viel zu warm.« Sie warf ihn beiseite. »Ich hoffe, es ist wichtig. Gerade war ich in der Hamburger Elbphilharmonie und konnte knapp die Toilette aufsuchen, dann wurde ich in meinen diesseitigen Körper und hierhergezogen. Die anderen Frauen werden mich hassen, weil ich eine Kabine besetzt halte. Es wird Zeit, dass dieser Ratsdienst endet.«
Abschließend stieg der Slip in die Höhe. Im Inneren erschien ein blondhaariger, breitschultriger Kerl mit verwuschelten Haaren und einem frechen Grinsen. Außer dem Slip trug er nichts. »Jo?«
»Finius.« Janus nickte ihm begrüßend zu.
Er war der einzige Twink des aktuellen und letzten Rates, mit dem Janus noch keine Nacht verbracht hatte. Finius besaß eine leidenschaftliche Ausstrahlung, die ihresgleichen suchte.
»Da liegt eine Jägerin auf unserer Couch«, sagte Jaris(a). »Und sie blutet den Stoff voll.«
Nora wurde sofort ernst. »Erkläre uns alles, Janus. Ich kümmere mich darum.«
Finius trat ans Fenster. »Brennt es da irgendwo?« Sein knackiger Hintern war dem Raum zugewandt.
Janus schüttelte den Kopf, vertrieb alle sonstigen Gedanken und gab eine Zusammenfassung der Ereignisse. Nora behandelte in der Zwischenzeit Kalinda. Diese hatte das Bewusstsein verloren, und der Zauber hing nur noch an einem seidenen Faden.
»Ein Aufstand«, echote Finius. »Hoffentlich passiert Martyn nichts, mit dem habe ich morgen ein Date.«
»Wenn sie weiter so langsam heilt, verpasse ich das gesamte Stück in der Elbphilharmonie.«
Jaris(a) saß an der Seite, stützte das Kinn auf die Handfläche und zuckte mit den Schultern. »Wenigstens passiert hier mal was.«
»Das ist ein ganz schöner Schlamassel, in den du dich da hineinmanövriert hast, Janus«, sagte Nora. »Du weißt, wir sind neutral. Damit ist unser Volk bisher gut gefahren. Wenn es brennt, ziehen wir uns auf die andere Seite zurück und sitzen es aus.«
»Was ich auch direkt wieder tun werde«, verkündete Finius.
»Tja, das würde ich ja gerne ebenfalls tun.« Janus breitete die Arme aus. »Aber Tamyra hat meinen Anderskörper geschnappt. Ich kann nicht mehr wechseln.«
Die anderen drei starrten ihn entgeistert an. Der Gedanke, die so hoch geschätzte Freiheit zu verlieren, musste entsetzlich sein.
»Das tut mir leid.« Finius kam zu Janus und zog ihn in eine Umarmung.
»Dem kann ich nur zustimmen«, sagte Nora. »Eine inakzeptable Tat. Es steht völlig außer Frage, dass wir dir helfen werden.«
»Jo«, sagte Finius mit einem bezaubernden Lächeln auf dem Gesicht.
»Endlich passiert mal was.« Jaris(a) warf Janus einen bedauernden Blick zu. »Und es tut mir natürlich leid. Retten wir die Jägerin deshalb?«
»Ich mag sie«, entfuhr es Janus, und er hoffte sehr, dass Kalinda wirklich bewusstlos war und nicht heimlich lauschte. »Sie ist ein wenig ruppig, gemein, hinterhältig, tendenziell bösartig, und sie hat eine harte Rechte.«
»Ohhh.« Jaris(a) tätschelte Janus’ Arm. »Das ist deine masochistische Ader. Jeder hat eine.«
»Jo«, kam es von Finius. »Ich kannte mal ’nen heißen Daddy, der hat sich gerne auspeitschen lassen. Und der konnte Blowjobs geben, phänomenal.«
»Jahrelang gelernt«, kommentierte Nora. »Alter zahlt sich eben aus.« Sie tätschelte Kalindas Schulter. »Deine Jägerin ist jetzt außer Lebensgefahr. Den Rest erledigt die Zeit. Ich gehe davon aus, dass sie morgen wieder bei Bewusstsein sein wird.«
Kalinda atmete scharf ein und fuhr ruckartig auf. »Wo sind sie?!«
Jaris(a), Nora und Finius schrien auf.
»Du bist in Sicherheit, niemand ist uns gefolgt«, beruhigte Janus die Jägerin.
»Ich habe sie gesehen, sie waren da. Überall. Sie kommen.« Kalinda wandte sich Janus zu, die Augen wie in Trance. »Die Hasen kommen.« Dann sackte sie wieder auf die Couch und begann zu schnarchen.
»Hat sie gerade gesagt: ›Die Hasen kommen‹?«, fragte Jaris(a).
»Jo.« Finius verschränkte die Arme. »Bist du sicher, dass dein Zauber im Oberstübchen der Jägerin nicht ein paar Neuronen falsch verdrahtet hat?«
»Das kann in einem solchen Fall tatsächlich passieren«, sagte Nora. »Du solltest sie im Auge behalten. Ich hatte mal einen, der bekam nach einer Heilung eine Phobie gegen Gänseblümchen.«
Oh, es würde Janus eine Freude sein, Kalinda im Auge zu behalten und den ein oder anderen Hasen zu manifestieren. Es ging nichts über einen Stresstest.
»Kommen wir also zurück zum Thema«, sagte Nora. »Tamyra hat deinen Andersseiter-Körper geschnappt. Hat sie die Verbindung bisher irgendwie genutzt?«
»Das nicht, aber ich kann nicht mehr wechseln. Es ist vollkommen blockiert. Falls diesem Körper hier etwas passiert, werde ich sterben.«
Jetzt wirkten die andern wütend. So was konnte einen Dschinn durchaus in den Wahnsinn treiben. Janus war glücklicherweise daran gewöhnt, über längere Zeiträume in einem der beiden Körper zu verweilen, doch irgendwann würde unweigerlich die Degeneration des nicht genutzten Körpers einsetzen.
»Du weißt also auch nicht, wo dein anderer Körper ist?«, fragte Jaris(a).
»Zuletzt drüben, in meinem Domizil«, erklärte er. »Aber nein, aktuell bin ich ratlos.«
»Das finde ich heraus.« Jaris(a) streifte sich den Stiletto wieder über. »Auf der anderen Seite habe ich Kontakte, die setze ich darauf an.«
Jaris(a)s Konturen wurden unscharf, zur Silhouette, und schließlich war sier fort. Nur der Stiletto blieb an Ort und Stelle.
Finius bückte sich und hob ihn hoch. »Wie kann man seinen Fuß nur in diese Dinger pressen?«
Nora nickte in Richtung seines Slips. »Das frage ich mich in deinem Fall auch immer.«
Finius zwinkerte ihr zu. »Ist ziemlich eng bei der Größe.«
»Können wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren?«, bat Janus. »Mein Körper, Kalinda, der gefangene Lenyo und der Aufstand. Und Max. Und Tamyra.« Er kratzte sich an der Stirn. »Es ist tatsächlich ein ziemliches Chaos.«
»Darin bist du doch Spezialist.« Finius zuckte mit den Schultern. »Sind wir irgendwie alle.«
Und Selbsterkenntnis war hier sicher nicht der Weg zur Besserung, wie Janus wusste. Sie waren nun einmal ein Volk aus magisch langlebigen Wesen. Das sorgte irgendwann für Langeweile, was zur Erweiterung der eigenen Grenzen führte. Spaß, das Erkunden des eigenen Körpers, das Erlernen neuer Sprachen und Magie, das Reisen an ferne Orte … Im Gegensatz zu vielen anderen Wesen, die Berlin nicht verlassen konnten, war es den Dschinn möglich, jederzeit die andere Seite aufzusuchen. Dort gab es ferne Länder, Meer und Sonnenschein. Schnee und Berghütten. Janus bedauerte all diejenigen, die in ihren kleinen Leben vor sich hinvegetierten und nicht einmal wussten, was dort draußen auf sie wartete. Andererseits war genau das vielleicht auch besser so.
»Es tut mir leid, aber unsere einzige Sorge ist dein Andersseiter-Körper«, erklärte Nora. »Da sind wir drei uns einig. Wenn es um den Aufstand oder Lenyo geht, wirst du alleine entscheiden müssen, ob du dich involvierst oder zurückziehst. Normalerweise würden wir dich mit einem Rechtsspruch davon abhalten, dich weiter in die Machtspiele der Königsfamilie zu verstricken, das weißt du. Es könnte eine Gefahr für uns alle werden. Doch da Tamyra deinen Körper gefangen genommen hat, hast du das Recht auf Vergeltung.«
Janus schnaubte. Die Dschinn waren wie die Schweiz. Nun ja, eine sehr freie Schweiz. Jeder durfte im Grunde alles, solange es nicht das Volk in Gefahr brachte. Heilung von Verletzten war sogar gern gesehen. Doch niemals durfte man sich in die großen Dinge einmischen, die möglicherweise das Volk gefährdeten. Was daraus erwachsen konnte, hatten alle durch die Attacke und die darauffolgende Auslöschung der Wechselbälger erfahren.
Dass das Triumvirat ihm erlaubte, weiterzumachen, war tatsächlich lediglich Tamyras Sakrileg geschuldet. Er musste ihr wohl sogar noch dankbar sein. Sobald sein Körper wieder frei wäre, würden die drei verschwinden und alles Weitere ihm überlassen. Im Falle seines Todes oder einer Anklage folgte unweigerlich die Distanzierung.
Nora ging in die Küche und brühte sich einen Tee. Im Schrank befanden sich erlesene Kräuter der anderen Seite – aus aller Welt. Dazu nahm sie sich ein paar Trüffel-Pralinen. Die schnelle Rückkehr zu ihrem Konzert hatte sie nach den Enthüllungen wohl aufgegeben. Blieb nur zu hoffen, dass niemand so bald ihren bewusstlosen Körper auf der Toilette fand, sonst würde sie in einem Krankenhaus aufwachen.
Finius zog sein Smartphone hervor. Er hatte die Verbindung magisch auf die andere Seite gelegt und war damit auch hier online.