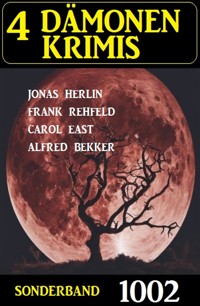von Jonas Herlin
In dem kleinen Ort Ravenhude bei Hamburg ereignen sich
seltsame Dinge. Menschen werden vom Blitz erschlagen und es kommt
zu eigenartigen, allen meteorologischen Erkenntnissen zuwider
laufenden Stürmen. Als dort der Fotograf Jim Rönckendorff unter
mysteriösen Umständen verschwindet, lässt das der Hamburger
Reporterin Sandra Düpree keine Ruhe. Sie will dem Geheimnis auf den
Grund gehen.
Wer ist die geheimnisvolle Frau, die immer wieder schemenhaft
auftaucht? Welche Rolle spielt eine uralte Hexenlegende? Und
welches Geheimnis umgibt das alte Landhaus von Wilfried Doorn, das
Jim Rönckendorff als Kulisse für seine Fotos verwenden
wollte?
Sandra Düpree und ihr Kollege Tom Broland setzen alles daran,
Licht ins Dunkel zu bringen.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books,
Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press,
Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition,
Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints
von
Alfred Bekker
© Roman by Author
Jonas Herlin ist ein Pseudonym von Alfred Bekker.
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress,
Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich
lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und
nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Ravenhude bei Hamburg…
Der See war grau wie Spinnweben. Mit einem leeren, in sich
gekehrten Blick stand Birte am Ufer, während der leichte Wind, der
über die Hügel strich, ihr durch das Haar wehte. Sie
fröstelte.
Eine leichte Gänsehaut überzog ihre Unterarme. Ihre Lippen
flüsterten einen Namen.
„Alina.“
Immer wieder zog es sie an diesen trostlosen Ort. Die
Vegetation schien sich von den umliegenden Hügeln aus irgendeinem
Grund zurückgezogen zu haben. Es war kaum Gras auf dem steinigen
Boden zu sehen. Die knorrigen Bäume wirkten morsch und tot. Wie
Ruinen einstigen Lebens. Der Geruch von Moder und Fäulnis stieg aus
dem trüben See empor, an dessen Rändern sich eine grauweiße
Salzschicht abgelagert hatte. Ein Ort des Todes!
Ein Ort, von dem sich das Leben zurückgezogen und einer Aura
des Verfalls Platz gemacht hatte.
Ein leichtes Donnergrollen ließ Birte zusammenzucken. Aus den
Augenwinkel heraus glaubte sie, eine Gestalt zu sehen. Eine
Bewegung …
Sie wirbelte herum und erstarrte.
Eine junge Frau mit goldblondem, schulterlangem Haar stand auf
dem nahen Hügel. Und obwohl der Wind jetzt kräftiger wurde, bewegte
sich ihr Haar nicht einen einzigen Millimeter. Die junge Frau kam
näher. Birte blickte ihr entgegen, während ihr die Furcht wie eine
kalte glitschige Hand den Rücken hinaufkroch.
„Alina“, flüsterte sie.
Alina war schön. So schön wie damals, an jenem Tag, als das
Unglück geschehen war.
Es ist schon so lange her, und doch kommt es mir vor, als wäre
es erst gestern gewesen.
Auf Alinas Gesicht stand ein teuflisches Lächeln, das einem
das Blut in den Adern gefrieren lassen konnte. Ihre Augen
leuchteten vor Hass. Ihre Bewegungen waren katzenhaft und
geschmeidig und hatten beinahe etwas Tierhaftes an sich. Ihr
Lächeln wurde breiter. Zwei Reihen makellos weißer Zähne entblößte
sie. Ein Zischen ging über die vollen, aber etwas blassen Lippen.
Ihre Züge waren feingeschnitten und von fast überirdischer
Schönheit. Aber in diesem Moment schienen sie auf groteske Weise
durch den Hass entstellt zu sein. Birte atmete tief durch.
Wie angewurzelt stand sie da, unfähig auch nur einen einzigen
Schritt zu machen.
Das Herz schlug ihr bis zum Hals.
Das Donnergrollen wurde stärker.
Birte blickte kurz hinauf in den grauen Himmel. Der Wind riss
jetzt heftig an Birtes Kleidern und Haaren. Ein wütender Sturm
schien wie aus dem Nichts heraus ausgebrochen zu sein. Die wenigen,
verkümmert wirkenden Sträucher und Bäume wurden heftig hin und her
gebogen. Lediglich Alina schien von diesem Sturm völlig unberührt
zu sein. Ihr Kleid hing schlaff an ihr herab. Das einzige, was den
Stoff ein wenig bewegte, waren die anmutigen, katzenhaften
Schritte, mit denen sie sich Birte näherte.
„Was willst du, Alina?“, rief Birte. Sie strich sich das Haar
aus dem Gesicht, das ihr der Wind in die Augen geweht hatte.
Sie schauderte, als sie in die Augen ihres Gegenübers sah.
Alinas Augen veränderten sich.
Zunächst waren sie leuchtend blau gewesen, aber nun begann
sich Schwärze auszubreiten. Innerhalb eines einzigen Augenblicks
waren ihre Augen nichts als dunkle Flecken, die aus purer
Finsternis zu bestehen schienen.
Wieder grollte indessen der Donner, während es in Alinas Augen
grell aufleuchtete. Blitze zuckten dort. Ein knallender Donner ließ
Birte zusammenzucken und bis ins Mark erschrecken.
Sie machte einen Schritt zurück.
Das Grauen schüttelte sie.
Sie öffnete halb den Mund, wollte schreien, aber kein Laut kam
über Birtes Lippen.
Der Wind wurde dermaßen stark, dass sich Birte nicht mehr auf
den Beinen halten konnte. Eine plötzliche Böe riss sie nach hinten.
Sie taumelte zu Boden.
Birte wirbelte am Boden herum und blickte Alina
entgegen.
„Nein“, flüsterte sie.
Alina lachte leise.
Und in der nächsten Sekunde blitzte es grell vom Himmel herab.
Ein Strahl so weiß wie Platin zischte nur Zentimeter von Birte
entfernt in den Boden hinein, ein weiterer dicht daneben. Der
Donner war ohrenbetäubend und glich nicht mehr einem langen,
dumpfen Grollen, sondern einem Kanonenschlag, der unmittelbar auf
den Blitz folgte. Ein halbes Dutzend solcher Einschläge folgte kurz
hintereinander. Sie alle brannten sich dicht neben der am Boden
kauernden Birte in den Boden, versengten die letzten Grashalme und
zerschmolzen das Erdreich zu etwas Formlosen.
Ein schwarzer Ring wurde um Birte herum sichtbar. Reglos
kauerte sie am Boden.
Sie hatte erwartet, dass die unvorstellbar großen Energien
dieser Entladung sie verbrennen würden.
Selbst in einer Entfernung von mehreren Metern konnte ein
Blitzeinschlag noch zu schweren Verletzungen oder dem Tod
führen.
Aber Birte war unversehrt.
Alina lachte schauderhaft.
Sie hob die Arme, öffnete die Hände …
Und dann fuhren die gewaltigen Energien, die gerade in den
Boden eingedrungen waren, wieder aus dem Erdreich heraus. Grelle
Strahlen schossen aus der schwarzen Linie hervor, die einen Kreis
um Birte gebildet hatte.
Diese Strahlen trafen auf Alinas Fingerkuppen, und es machte
den Eindruck, als würde die blonde Frau mit den abgrundtief dunklen
Augen, mit ihren Händen all das an Energie aufnehmen, was noch
Sekundenbruchteile zuvor in den Boden gefahren war.
Birte zitterte.
Sie kontrolliert alles!, ging es ihr fröstelnd durch den Kopf.
Gewaltige Kräfte, die niemand sonst zu beherrschen wusste.
Birte öffnete die Lippen, sah ihr Gegenüber mit einem Blick
an, der eine Mischung aus Hass und blanker Verzweiflung
zeigte.
Das Grauen schüttelte sie.
„Alina! Warum tötest du mich nicht?“, rief sie. „Warum
vollendest du es nicht?“
Alinas Blick ruhte auf ihr.
Die dunklen Augen verwandelten sich zurück. Sie schüttelte den
Kopf.
„Nein, Birte“, murmelte sie. „Nein.“ Ihr Lachen wirkte wie
irre. Alina drehte sich herum. Mit langsamen Schritten lief sie
zurück zu dem Hügel, auf dem Birte sie zuerst gesehen hatte.
„Alina!“, rief Birte.
Sie schrie es beinahe.
Das dumpfe Grollen des Donners war die Antwort. Birte erhob
sich.
Im selben Moment sah sie, wie Alina den Hügel erreichte. Ihre
Gestalt wurde transparent und wirkte im nächsten Augenblick wie
eine schwache, unscharfe Projektion. Aus dem Nichts heraus schoss
ein greller, blauweißer Blitz dicht vor Birtes Fußspitzen.
Alinas Gestalt verblasste zur Gänze.
Regen setzte ein, und innerhalb von wenigen Augenblicken
klebte Birte das Haar am Kopf.
Reglos stand sie da und blickte zu jener Stelle an der Alina
verschwunden war.
Es wird nie aufhören!, dachte sie voller Verzweiflung. Nie
…
2
Es war bereits Abend, als wir die Lichter Hamburgs in der
Dämmerung sahen. Wie ein Spiegelbild des Sternenmeeres. Tom saß am
Steuer des Volvo, und ich kämpfte mit meiner Müdigkeit. Ein
wunderbares Wochenende an der Ostsee lag hinter uns. Morgen früh
erwartete uns beide wieder unser Job als Reporter der HAMBURG
EXPRESS NACHRICHTEN. Ein paar Tage hatten wir in der Nähe von
Timmendorf ausgespannt, die unvergleichliche Landschaft und das
Meer genossen.
Und unsere Liebe.
Tom Broland war Mitte dreißig, hochgewachsen und dunkelhaarig.
Und der Blick seiner graugrünen Augen hatte immer etwas
Geheimnisvolles an sich. Ich verband diese Augenfarbe immer mit der
Weite des Meeres, mit dem Glitzern der Sonnenstrahlen auf der
Wasseroberfläche und dem Geruch von Seetang und Salz.
Tom war Reporter einer großen Nachrichtenagentur gewesen,
bevor er bei den NACHRICHTEN angeheuert hatte. Lange Jahre hatte er
als Korrespondent in Übersee verbracht – vor allem in Asien.
Für ihn war eine Stelle bei den HAMBURG EXPRESS NACHRICHTEN
einer Boulevardzeitung! – eigentlich ein beruflicher Abstieg. Ich
hatte mich lange gefragt, wie es dazu hatte kommen können.
Besonders redselig war Tom nicht, was seine Vergangenheit anging.
Aber inzwischen wusste ich, dass das Ende seiner
Korrespondenten-Karriere mit einem mehrmonatigem Aufenthalt im
Dschungel Südostasiens zusammenhing. In dem geheimnisvollen Tempel
von Pa Tam Ran – irgendwo im Dreiländereck Thailand-Kambodscha-Laos
gelegen, hatte er die besonderen Konzentrationstechniken der
dortigen Mönche kennengelernt. Seit frühester Jugend hatte er unter
seltsamen Träumen gelitten, die sich nun als Bilder aus früheren
Leben entpuppten, zu denen Tom einen bewussten Zugang gewann.
Erinnerungen an vergangene Leben waren für ihn mittlerweile
selbstverständlich.
Kein Wunder, dass er über eine besondere Sensibilität
verfügte, was übersinnliche Phänomene und dergleichen anging. Nie
wäre er bei aller Skepsis zu einem vorschnellen Urteil auf diesem
Gebiet gekommen.
Und so hatte ich ihm schließlich auch anvertraut, dass ich
über eine leichte seherische Gabe verfügte, die ich vermutlich von
meiner verstorbenen Mutter geerbt hatte. Außer meiner Großtante
Elisabeth Düpree, die mich auf diese Gabe aufmerksam gemacht hatte,
gab es niemanden sonst, der davon wusste.
Ein Beweis des unendlichen Vertrauens, das ich Tom Broland
gegenüber empfand.
Mein Name ist übrigens Sandra Düpree. Eins können Sie mir
jedenfalls glauben: Das Übernatürliche spielte bei uns schon immer
eine besondere Rolle. In meinem Fall war es Fluch und Gabe
zugleich.
„Ich liebe dich, Tom“, sagte ich plötzlich in die Stille
hinein, während wir über eine mehrspurige Stadtautobahn direkt in
das vor uns liegende Lichtermeer der Riesenstadt Hamburg
hineinfuhren.
Ich sah ihn an.
Er blickte kurz zu mir hinüber.
„Ich liebe dich auch“, sagte er und lächelte.
„Ich dachte gerade daran, wie vertraut du mir bereits bist.“
Ich zuckte die Achseln und seufzte. „Es ist geradezu
unheimlich.“
„Findest du?“
„Ja.“
„Sandra, wenn sich zwei verwandte Seelen finden, dann ist das
nicht immer eine Frage der Zeit.“
„Vielleicht hast du recht.“ Ich machte eine Pause. Ich war
hundemüde. Die Fahrt, bei der wir uns alle paar Stunden am Steuer
abgelöst hatten, war sehr anstrengend gewesen. Aber ich war auch
glücklich. Eine regelrechte Welle positiver Empfindungen
durchströmte mich.
Ich hätte die ganze Welt in diesem Augenblick umarmen
können.
„Wusstest du, dass ich außer mit meiner Großtante noch nie mit
jemandem über meine Gabe gesprochen habe?“, fragte ich dann.
„Ich glaube, du erwähntest es mal“, sagte er.
„Es ist ein Beweis meines Vertrauens“, sagte ich.
„Ich weiß.“
„Tom, ich fühle mich dir so nah.“
„Sandra!“
„Ich möchte nicht, dass es jemals anders wird zwischen uns,
Tom!“
„Das möchte ich auch nicht!“
Ich berührte ihn leicht am Ellbogen. Ich hätte ihn in dieser
Sekunde gerne umarmt, mich an ihn geschmiegt und ihn voller
Leidenschaft geküsst. Aber leider musste wir in diesem Moment den
Erfordernissen des Straßenverkehrs einen gewissen Tribut
zollen.
3
Tom brachte mich nach Hause. Zu Hause – das war die alte
viktorianische Villa meiner Großtante Elisabeth Düpree, die von mir
einfach nur Tante Elisabeth genannt wurde. Tom fuhr seinen Volvo in
die Einfahrt der am Stadtrand gelegenen Villa. Wir küssten uns
leidenschaftlich. Seine Hand strich mir über das Haar, und ich
spürte ein eigentümliches Kribbeln in der Bauchgegend.
„Es ist spät“, sagte ich dann. „Morgen werde ich an meinem
Schreibtisch einschlafen.“
„Wäre das so schlimm, Sandra?“
„Unglücklicherweise haben wir bei den NACHRICHTEN ja ein
Großraumbüro. Da kann man nie sicher sein, dass der Chefredakteur
nicht gerade zuschaut, wenn man sich eine Auszeit nimmt!“
Tom hob die Augenbrauen.
In seinen Augen blitzte es schelmisch.
„Hast du denn morgen nicht zufällig etwas im Archiv zu
tun?“
Wir mussten beide lachen.
Dann stiegen wir aus.
Tom ging zum Kofferraum und holte mir meine Reisetasche
heraus. Es war das erste Mal seit langem gewesen, dass ich
verreiste, ohne meinen Laptop mitgenommen zu haben, um einen
Artikel über meinen Aufenthalt zu schreiben. Ein ganz ungewohntes
Gefühl.
Ich nahm ihm die Tasche aus der Hand, setzte sie auf dem Boden
ab und schlang noch einmal meine Arme um seinen Hals.
„Bis morgen“, hauchte ich ihm ins Ohr.
„Bis morgen, Sandra!“
4
Ich steckte den Schlüssel in das Schloss der Haustür und
drehte ihn herum. Bevor ich die Tür öffnete, drehte ich mich kurz
herum und winkte Tom zu, dessen Volvo gerade die Straße
entlangfuhr. Ich hoffte, dass er mich noch gesehen hatte. Dann ging
ich in die Villa.
Es war bereits nach Mitternacht, und es war durchaus möglich,
dass Tante Elisabeth schon schlief. In dem Fall wollte ich sie nach
Möglichkeit nicht aufwecken, denn sie hatte ohnehin Schwierigkeiten
einzuschlafen.
Genauso gut war es allerdings möglich, dass sie noch immer
über dicken, von einer feinen Staubschicht bedeckten Folianten
gebeugt in der Bibliothek saß, völlig vertieft in ihre
okkultistischen Studien. Tante Elisabeth war nämlich eine Expertin
auf diesem Gebiet. Und ihre Villa glich einer Mischung aus Museum
und Bibliothek, in dem sich alle nur erdenklichen Bücher,
Geheimschriften und Presseartikel befanden, die sich mit
unerklärlichen Phänomenen beschäftigten. Tante Elisabeth war dabei
keine leichtgläubige alte Dame, die in ihren späten Jahren etwas
wunderlich geworden war. Ihr war wohl bewusst, dass sich im Bereich
des Okkultismus und der Parapsychologie überwiegend Scharlatane
tummelten, die nichts weiter im Sinn hatten, als Aufmerksamkeit zu
erregen und Ahnungslosen möglichst viel Geld aus der Tasche zu
ziehen. Aber es gab einen Rest an Geschehnissen, für die es mit den
Methoden der modernen Wissenschaft keine hinreichende Erklärung
gab. Bis heute zumindest. Tante Elisabeth hatte sich ganz der
Aufgabe gewidmet, diese Fälle zu dokumentieren. So war ihre
Sammlung zu einem der größten Privatarchive auf diesem Gebiet in
ganz Europa geworden.
Nächtelang saß sie oft in der Bibliothek, wo sich allerdings
nur der wichtigste Teil ihrer Sammlung befand. Überall in der Villa
gab es überfüllte Bücherregale, in denen sich die dicken, staubigen
Lederbände nur so drängelten. Sehr seltene, zum Teil uralte
Schriften waren darunter. Tante Elisabeth besuchte regelmäßig
Versteigerungen nach Haushaltsauflösungen und war auch schon auf
Flohmärkten fündig geworden. So manchen Schatz hatte sie da
gehoben, der ansonsten vielleicht unrettbar verloren gewesen
wäre.
Unterbrochen wurden die langen Reihen der Bücher hin und
wieder durch okkulte Gegenstände, Pendel, Glaskugeln, Geistermasken
und Ähnliches. Aber es waren auch archaische Kultgegenstände
darunter, die aus der Hinterlassenschaft ihres Mannes stammten.
Friedrich Düpree war ein berühmter Archäologe gewesen, bevor er von
einer Forschungsreise in den Regenwald Südamerikas nicht
zurückkehrte. Seitdem war er verschollen.
Ich schloss die Tür so leise hinter mir, wie es möglich war.
Aber sie knarrte ein wenig. Wie oft hatte ich sie schon eigenhändig
geölt, aber es schien zum Charakter dieses verwinkelten und für
Außenstehende vielleicht etwas unheimlich wirkenden Hauses zu
gehören, dass die Tür knarrte. Vorsichtig ging ich durch den
langgezogenen Flur. Die Tür zur Bibliothek stand einen Spalt offen.
Aber es brannte kein Licht.
Tante Elisabeth war also nicht mehr in ihre Archivarbeit
vertieft.
Ich machte kein Licht. Das Mondlicht fiel durch eines der
Fenster, und ich hätte den Weg vermutlich auch gefunden, wenn ich
gar nichts gesehen hätte. Eine etwa einen Meter durchmessende
afrikanische Geistermaske hing als unheimlicher Schatten an der
Wand. Tante Elisabeth hatte sie vor Kurzem aus dem Keller geholt.
Diese Maske gehörte auch zu Onkel Friedrichs Hinterlassenschaft,
und Tante Elisabeth brauchte sie für irgendeine ihrer Studien. Sie
hatte mir auch erläutert, worum es dabei ging, aber ich war wohl
gedanklich zu sehr mit dem bevorstehenden Wochenende beschäftigt
gewesen.
Dem unvergleichlich schönen Wochenende, das ich mit Tom
Broland in Cornwall verbracht hatte.
Allein bei dem Gedanken daran glaubte ich das Meeresrauschen
zu hören.
Ich ging die Treppe hinauf, die ins obere Stockwerk führte.
Dort befanden sich meine Räume – die einzigen im ganzen Haus, die
nicht von Tante Elisabeths Okkultismus-Archiv belegt waren. Ich
nannte meine Räume daher auch manchmal scherzhaft okkultfreie
Zone.
Ohne allzu viel Krach zu machen, brachte ich die Treppe hinter
mich. Ich machte Licht, durchquerte mein Wohnzimmer und ließ die
Reisetasche auf dem Fußboden liegen, bevor ich das Schlafzimmer
betrat. Ich zog die Schuhe aus. Ich wollte gerade nach dem
Lichtschalter fassen, da hielt ich plötzlich inne.
Ich weiß nicht, was es war, das mich auf einmal erstarren
ließ.
Eine eigenartige Empfindung, für die ich keine Worte hatte.
Ich blickte zum Fenster, sah, dass sich draußen im Garten die
Baumwipfel und Sträucher ziemlich heftig bewegten. Der Wind heulte
um die Villa. Ein eigenartiger, stöhnender Laut.
Im nächsten Moment zuckte ich zusammen.
Ein Blitz zuckte dicht vor meinen Augen durch die Dunkelheit.
Seine blauweiße Helligkeit war derart grell, dass ich einige
Augenblicke blind war. Namenlose Dunkelheit umgab mich. Der Donner
war wie ein Kanonenschlag. Bis ins Mark erschreckte mich dieser
furchtbare Knall.
Für den Bruchteil eines Augenblicks sah ich ein Gesicht vor
meinem inneren Auge.
Das Gesicht einer jungen Frau. Ihr Gesicht war von blondem,
schulterlangem Haar umrahmt. Die Züge waren feingeschnitten. Die
hohen Wangenknochen gaben ihnen einen Ausdruck, der irgendwo
zwischen Stolz und Hochmut zu liegen schien. Eine überirdisch
schöne Frau …
Ein Gesicht von beinahe perfektem Ebenmaß. Aber ihre
Augen!
Mit ihnen stimmte etwas nicht.
Sie waren dunkel wie die Nacht. Nur Schwärze schien in ihnen
zu sein. Keine Pupillen, keine Iris, nicht einmal ein einziger
weißer Fleck!
Blitze sah ich in diesen Augen. Grell zuckten sie durch die
Dunkelheit, die das gesamte Innere ihres hübschen Kopfes auf
geheimnisvolle Weise auszufüllen schien. Die vollen, aber etwas
blassen Lippen öffneten sich zu einem spöttischen Lächeln. Zwei
Reihen makellos weißer Zähne blitzen auf. Und das Lachen, das dann
erscholl, war schauderhaft. Es war dermaßen von Hass durchtränkt,
dass einem kalte Schauder den Rücken hinunterjagen konnten.
Das alles dauerte kaum länger als einen Augenaufschlag. Dann
war es vorbei.
Nur Schwärze war für mehrere Sekunden um mich herum. Ein
Gefühl der Panik stieg in mir auf. Schwindel erfasste mich, und ich
glaubte zu fallen. Ich tastete mit den Händen und berührte etwas
Glattes, Hölzernes. Die lackierte Oberkante einer Kommode aus
Kiefernholz. Ich hielt mich daran fest. Das Herz schlug mir bis zum
Hals.
Eine Vision!, schoss es mir durch den Kopf. Ich wusste
es.
Es musste sich um eine jener Traumvisionen handeln, für die
meine Gabe verantwortlich war.
Langsam begannen sich vor meinen Augen wieder Konturen zu
bilden. Ich griff nach dem Lichtschalter. Die Helligkeit
schmerzte.
Ich schauderte noch immer angesichts dessen, was ich gesehen
hatte. Es war eine Vision von schier unglaublicher Intensität
gewesen.
Ich war verwirrt.
Mit wenigen Schritten bewegte ich mich auf einen der Sessel
zu, die im Raum standen, und ließ mich hineinfallen. Ich atmete
tief durch.
Eine Vision – aber was hat sie zu bedeuten?, fragte ich
mich.
Verstört streifte ich die Schuhe ab.
Ich war hundemüde, noch vor wenigen Minuten wäre ich beinahe
im Stehen eingeschlafen. Aber ich wusste, dass ich dennoch in
dieser Nacht kaum Ruhe finden würde.
5
Immer wieder erwachte ich schweißgebadet und sah dann für
Bruchteile von Sekunden jenes Gesicht vor mir, das mir in meiner
Vision zum ersten Mal begegnet war. Immer dieselben pechschwarzen
Augen, die zuckenden, grellen Blitze, das Donnergrollen …
Und das Lachen.
Verzweifelt zermarterte ich mir das Hirn darüber, was diese
Traumbilder wohl bedeuten mochten. Sie standen in irgendeinem
Zusammenhang mit mir, mit der Zukunft, mit meinem Schicksal. Aber
es war so, als hätte mir jemand lediglich einen winzigen Ausschnitt
von einem gewaltigen Gemälde gezeigt. Es war beinahe unmöglich, von
diesem Ausschnitt auf die Szenerie zu schließen, die das gesamte
Gemälde darstellte.
Immer wieder schlief ich dann vor Erschöpfung ein, wälzte mich
dann erneut unruhig hin und her, um wieder schweißgebadet zu
erwachen.
Am Morgen fühlte ich mich wie gerädert.
Ich hatte das Gefühl, überhaupt nicht geschlafen zu haben. Wie
in Trance ging ich hinunter in die Küche. Tante Elisabeth war
bereits auf den Beinen und hatte den Tee aufgesetzt.
„Guten Morgen, mein Kind“, sagte sie lächelnd. Ich antwortete
ihr zunächst mit einem Gähnen. Dann versuchte ich das Lächeln zu
erwidern.
Seit dem frühen Tod meiner Eltern hatte Tante Elisabeth mich
wie ihre eigene Tochter erzogen. Sie hatte mir die Mutter ersetzt
und mich auf das hingewiesen, was sie meine Gabe genannt hatte.
Eine Fähigkeit, die ich nicht selten als Fluch empfunden hatte. Nur
langsam hatte ich mich damit arrangieren können.
„Du siehst nicht gerade glücklich aus“, stellte Tante
Elisabeth fest. „War dein Wochenende nicht schön?“
„Es war wunderschön“, erwiderte ich. „Einfach
wunderbar.“
„Dann verstehe ich nicht …“
„Es hat nichts damit zu tun!“
„Womit dann?“ Sie sah mich an.
Tante Elisabeth kannte mich einfach zu gut, als dass ich ihr
etwas vormachen konnte.
„Du hattest eine Vision“, sagte Tante Elisabeth, und ihre
Augen musterten mich dabei aufmerksam. Was sie gesagt hatte, war
keine Frage, sondern eine Feststellung.
Ich nickte.
„Ja“, flüsterte ich.
Und mich schauderte allein bei dem Gedanken an die Bilder, die
ich gesehen hatte.
Ich zuckte unwillkürlich zusammen, als ich das abgrundtief
schwarze Augenpaar dieser geheimnisvollen blonden Frau für einen
Sekundenbruchteil vor mir sah.
„Möchtest du darüber reden, Sandra?“
„Ja … Es war nicht viel, was ich sehen konnte. Das Gesicht
einer jungen Frau, deren Augen vollkommen schwarz waren. Blitze
zuckten darin. Und sie lachte … Es war schauderhaft. Sie wirkte
voller Hass.“
„Du hast diese Frau nie gesehen?“ Ich schüttelte den
Kopf.
„Nein, bislang nicht. Aber ich fürchte, dass ihr noch begegnen
werde.“
6
Als ich meinen roten Mercedes 190 auf den Parkplatz vor dem
Verlagsgebäude der HAMBURG EXPRESS NACHRICHTEN fuhr, war ich
ziemlich spät dran.
Ich parkte den Wagen – ein Geschenk von Tante Elisabeth – in
eine der wenigen Parklücken, die um diese Zeit noch zu finden
waren, stieg aus und beeilte mich, durch den aufkommenden
Nieselregen ins Gebäude zu kommen.
Die Redaktion der HAMBURG EXPRESS NACHRICHTEN nahm eine ganze
Etage in dem riesigen Betonklotz ein, in dem unser Verlag seinen
Sitz hatte.
Als ich das Großraumbüro unserer Redaktion betrat, erwartete
mich dort die übliche Hektik. Ein ständiges Kommen und Gehen
herrschte zwischen den Schreibtischen. Hin und wieder schrillte ein
Telefon.
Michael T. Schwanemeier, unser Chefredakteur, hatte
selbstverständlich ein separates Büro. Die Tür stand offen.
Schwanemeier stand davor, hatte die Ärmel seines Hemdes
hochgekrempelt und die Krawatte gelockert, so dass sie ihm wie ein
Strick um den Hals hing. Schwanemeier hatte sich ganz und gar der
Aufgabe gewidmet, die Auflage der HAMBURG EXPRESS NACHRICHTEN oben
zu halten. Oft war er der Erste in der Redaktion und abends nicht
selten der Letzte. So etwas wie ein Privatleben schien er nicht zu
kennen. Zum Leidwesen so manches Kollegen erwartete er diesen
Einsatz allerdings auch von seinen Mitarbeitern.
„Guten Morgen, Sandra!“, begrüßte er mich. „Auf Ihrem
Schreibtisch liegen ein paar Meldungen. Machen Sie doch bitte so
schnell wie möglich einen Artikel daraus. Fünfzig Zeilen. Und sehen
Sie im Archiv nach, ob wir nicht ein paar passende Bilder dazu in
den Katakomben schlummern haben.“
„Und wenn nicht?“, seufzte ich.
„Dann müssen Sie mehr schreiben.“ Ich sah Herr Schwanemeier
an, sah dessen hochroten Kopf und gab den Gedanken auf, ihn danach
zu fragen, ob es heute nicht auch eine größere Überschrift tun
würde.
Auf dem Weg zum Schreibtisch nahm ich mir einen Becher des
dünnen Redaktionskaffees aus der Maschine. Ich sah mich kurz um,
bevor ich mich setzte. Von Tom Broland war nirgends etwas zu
sehen.
Vielleicht war er bereits mit irgendeinem irrsinnig wichtigen
Auftrag unterwegs.
Ich nahm einen Schluck des Kaffees und schloss für einen
Moment die Augen.
„Hallo, Sandra“, sagte eine mir nur allzu vertraute
Stimme.
„Ich glaube nicht, dass das die Arbeitshaltung ist, die unser
geschätzter Herr Schwanemeier gerne sieht!“
Ich blickte auf und sah einen blonden Haarschopf, einen
Drei-Tage-Bart und ein ziemlich zerknittertes Jackett, dessen
Revers vom Riemen einer Kameratasche völlig ruiniert war.
„Hallo, Jim“, sagte ich.
Jim Rönckendorff war als Fotograf bei den HAMBURG EXPRESS
NACHRICHTEN angestellt. Wir hatten schon oft zusammengearbeitet und
so manche Story zusammen bearbeitet. Jim war mehr als nur ein guter
Kollege. Er war auch ein Freund.
„Ein schönes Wochenende gehabt?“, fragte er.
„Ich kann nicht klagen“, erwiderte ich. Ich wusste nicht
genau, worauf er eigentlich hinaus wollte. Aber irgendwie hatte ich
das Gefühl, dass er nicht nur einfach so um meinen Schreibtisch
herumstrich.
„Sandra, ich möchte dich um einen Gefallen bitten“, begann er
dann. Jim kratzte sich im Nacken. Sein Gesicht wirkte viel
nachdenklicher als sonst. Eigentlich war er eher der Typ des
Sonnyboys, der immer gutgelaunt und witzig war. Aber im Augenblick
schien ihn irgendetwas stark zu beschäftigen.
„Worum geht es?“, fragte ich.
„Um dein Spezialgebiet, Sandra.“
„Ach, ja …“
„Ich möchte dir etwas zeigen, Sandra.“ Er griff in die
Innentasche seines Jacketts. Einen Moment später hielt er einige
Fotoabzüge in der Hand.
„Worum geht es?“, fragte ich.
Er breitete die Fotos auf meinem Schreibtisch aus. Es waren
unverkennbar Modefotos. Hinreißend schöne Models posierten in
extravaganten Kleidern vor einem ebenso extravaganten Hintergrund,
der durch die grauen Mauern eines altehrwürdigen englischen
Landhauses gebildet wurde. Dahinter erstreckte sich eine
eigenartige, karge Landschaft, die in einem reizvollen Kontrast zu
den Models und ihren Kleidern stand.
„Wie ich sehe, warst du mal wieder ziemlich fleißig in deiner
freien Zeit“, meinte ich.
Er zuckte die Schultern.
„Man tut, was man kann.“
Ich wusste, dass sich Jim über seine Arbeit bei den HAMBURG
EXPRESS NACHRICHTEN hinaus hin und wieder ein paar Euro dazu
verdiente. Landschaftsaufnahmen für Bildkalender gehörten ebenso
dazu wie Modefotografien. Michael T. Schwanemeier, unser
allgewaltiger Chefredakteur, drückte beide Augen zu, solange Jims
Arbeit für die NACHRICHTEN nicht darunter litt. Außerdem wusste er
Jims außergewöhnliche Arbeit durchaus zu schätzen. Schwanemeier war
ein Profi.
Er konnte sich an fünf Fingern einer Hand abzählen, dass ein
Kamera-Ass wie Jim Rönckendorff nicht ewig bei den HAMBURG EXPRESS
NACHRICHTEN bleiben würde. Er war zu gut, um nicht den Ehrgeiz zu
haben, seine Bilder auf den Hochglanz-Seiten großer Magazine zu
sehen, statt in vergleichsweise bescheidener Bildauflösung auf
billigem Zeitungspapier. VOGUE, ELLE oder PLAYBOY – in eine dieser
Richtungen würde Jims Weg unweigerlich gehen. Und je später das
geschah, desto besser für die Qualität der Bilder, die in den
HAMBURG EXPRESS NACHRICHTEN erschienen.
Schwanemeier wusste das nur zu gut.
Und deshalb zeigte er in diesem Fall auch etwas, was ihn sonst
nicht unbedingt auszeichnete: Nachsicht mit jemandem, der
vielleicht nur 98 Prozent seiner Kraft in den Dienst unseres
Blattes stellte.
„Hervorragende Aufnahmen“, stellte ich fest, nachdem ich sie
oberflächlich angesehen hatte. „Ich hoffe, man hat dich gut genug
bezahlt, damit du dir endlich mal ein neues Jackett leisten
kannst.“
„Das ist keine Frage des Geldes, sondern des Stils“, erwiderte
er in einem leicht pikierten Tonfall und setzte dann hinzu.
„Außerdem ist es mir sehr ernst. Sieh mal genau hin.“
Ich stutzte, nahm eines der Bilder hoch und runzelte die
Stirn.
Im Vordergrund waren die posierenden Models in ihren
fließenden Gewändern zu sehen. Perfekt gestylt und inszeniert, wie
man es aus den teuren Magazinen kannte. Aber im Hintergrund,
verloren in der düsteren Landschaft war noch etwas anderes.
Ein Gesicht, eine Gestalt.
Oder vielmehr nur die Ahnung davon.
Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag vor den Kopf. Der Puls
schlug mir bis zum Hals.
Nein!, dachte ich. Das kann nicht wahr sein! Die transparente
Erscheinung im Hintergrund war jene blonde Frau, die ich in meiner
Vision gesehen hatte. Nur ihre Augen …
Sie waren nicht schwarz, so wie ich sie gesehen hatte.
Leuchtend blau waren sie, umgeben von reinstem Weiß.
Ausdrucksstarke Augen, die den Betrachter des Bildes intensiv
anzusehen schienen. Ein Blick, wie keines der Models ihn besser
hätte inszenieren können. Eine Mischung aus Geheimnis, Sehnsucht
und Melancholie schien darin zu liegen. Ich schluckte.
„Sieht aus wie eine Doppelbelichtung“, murmelte ich.
„Hältst du mich für einen Anfänger, Sandra?“
„Nein, so war das nicht gemeint!“
„Diese Frau ist auf all diesen Bildern zu sehen. Manchmal nur
ganz schwach, wie eine verblassende Projektion. Auf anderen wirkt
es so, als wäre sie wirklich dagewesen.“
Ich sah Jim an. „Wer ist sie?“
„Wenn ich das wüsste!“
„Jim, wie kommen diese Aufnahmen zu Stande?“
Jim atmete tief durch. Sein Blick wirkte sehr ernst. Er schien
wirklich ein wenig verstört zu sein. „Alles der Reihe nach“, sagte
er dann. „Ich habe das Wochenende mit Modeaufnahmen verbracht, die
auf dem Landsitz der Familie Doorn aufgenommen wurden. Das Anwesen
liegt eine halbe Stunde außerhalb von Hamburg. Vielleicht sind die
heutigen Besitzer etwas verarmt und auf solche zusätzlichen
Einnahmen angewiesen – ich weiß es nicht. Heute morgen habe ich
dann die Abzüge gemacht und auf allen ist diese Frau zu sehen … Ich
bin mir sicher, sie nicht gesehen zu haben, als die Aufnahmen
gemacht wurden.“
„Bist du dir sicher?“
„Völlig. Es ist mir ganz und gar unerklärlich, wie diese …“,
er suchte nach dem richtigen Wort, „… diese Erscheinung auf die
Bilder gekommen ist. Es kann keine Doppelbelichtung sein, denn
diese Frau war überhaupt nicht dort! Dass die Aufnahmen im Eimer
sind, ist eine Sache – die andere ist, dass ich gerne wüsste, was
hier geschehen ist. Sandra – du bist doch anerkanntermaßen eine
Spezialistin für das Übersinnliche!“
„Wie kommst du darauf, dass diese Aufnahmen einen
übersinnlichen Hintergrund haben könnten?“, fragte ich, in Gedanken
versunken. Ich nahm mir einige der anderen Abzüge, betrachtete sie
eingehend und fühlte wachsendes Unbehagen in mir. Das kann kein
Zufall sein!, ging es mir durch den Kopf. Diese Frau … Sie muss
einen Namen haben …
„Darf ich diese Abzüge behalten?“, fragte ich.