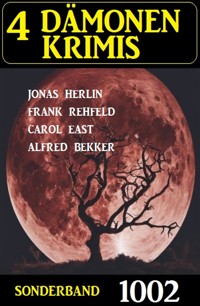Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Ebook beinhaltet folgende Romane: Ann Murdoch: Hexenvisionen Ann Murdoch: In Teufels Namen Ann Murdoch: Symphonie der Geister Ann Murdoch: Tödliche Schatzsuche Jonas Herlin: Verfluchter Steinkreis: Unheimlicher Thriller Die junge Anwältin Harry Beagle hat einen seltsamen Fall übernommen, bei dem der Angeklagte behauptet, sein Opfer sei vom Teufel besessen gewesen. Zusammen mit dem Journalisten Steve geht sie der Sache näher auf den Grund. Dabei ahnen die beiden aber noch nicht, dass sie schon bald dem Teufel höchstpersönlich gegenüberstehen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ann Murdoch, Jonas Herlin
5 Romantische Geheimnis Thriller Januar 2024
Inhaltsverzeichnis
5 Romantische Geheimnis Thriller Januar 2024
Copyright
Hexenvisionen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
In Teufels Namen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Symphonie der Geister
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tödliche Schatzsuche
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Verfluchter Steinkreis: Unheimlicher Thriller
5 Romantische Geheimnis Thriller Januar 2024
Ann Murdoch, Jonas Herlin
Das Ebook beinhaltet folgende Romane:
Ann Murdoch: Hexenvisionen
Ann Murdoch: In Teufels Namen
Ann Murdoch: Symphonie der Geister
Ann Murdoch: Tödliche Schatzsuche
Jonas Herlin: Verfluchter Steinkreis: Unheimlicher Thriller
Die junge Anwältin Harry Beagle hat einen seltsamen Fall übernommen, bei dem der Angeklagte behauptet, sein Opfer sei vom Teufel besessen gewesen. Zusammen mit dem Journalisten Steve geht sie der Sache näher auf den Grund. Dabei ahnen die beiden aber noch nicht, dass sie schon bald dem Teufel höchstpersönlich gegenüberstehen werden.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Hexenvisionen
Ann Murdoch
Helen Jefferson konnte sich ein amüsiertes Schmunzeln nicht verkneifen, als sie den Briefumschlag auf ihrem Schreibtisch öffnete und die Vorankündigung sah.
„Die Hexengilde lädt zum magischen Zirkel!“
Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Womöglich würde man ihr geheimnisvolle Kräutertränke aufschwatzen und sie in die Geheimnisse der Magie und Zaubersprüche einweisen wollen. Aber vielleicht würde es auch ganz lustig, schoss es ihr durch den Kopf. Es konnte ja sein, dass die Hexen auf ihren Besen tanzten und der Satan persönlich erschien.
Aber nein, also wirklich, sie schüttelte unbewusst den Kopf. Die modernen Hexen waren emanzipiert, sie beschworen den Teufel nicht mehr herauf, und sie tanzten auch nicht mehr auf Besen. Aber noch immer gab es Kräutertränke, geheimnisvolle Beschwörungen, Pulver, deren Zutaten besser im Verborgenen blieben und natürlich übersinnliche Kräfte.
„Ein gefundenes Fressen für Sir Thomas“, murmelte sie vor sich hin.
„Hast du einen Liebesbrief bekommen, Helen?“, fragte Dennis, ihr Kollege aus der Politikredaktion, der gerade vorbeiging.
Sie schüttelte den Kopf und lachte auf. „Nein, eine Einladung zum Hexentreffen.“
„Vergiss deine schwarze Katze nicht“, spöttelte er gutgelaunt und ging wieder an seine Arbeit.
„Ich kann mich bremsen“, rief sie ihm hinterher. „Hexen, pah!“
„Jefferson, in mein Büro!“, erklang die Stimme von Chefredakteur Raymond Brody.
Helen schnitt eine Grimasse. „Vielleicht sollte ich doch zu diesem Hexentreffen gehen. Unter Umständen haben sie ein paar schöne Flüche oder Beschwörungen, wie ich diesen Mann in eine Kröte verwandeln kann“, murmelte sie vor sich hin.
Sie stand auf, straffte die Schultern und machte sich auf den Weg in den abgetrennten Glaskasten, der das Büro des Chefredakteurs war.
Helen Jefferson mochte Raymond Brody nicht. Er wirkte in ihren Augen geradezu ölig, hatte ein falsches Lächeln und versuchte ständig sie anzubaggern. Kurzum, er war ein Heuchler. Doch sie musste ihm eines lassen, er hatte das richtige Gespür des Journalisten, das war jedoch das einzige, was für ihn sprach.
Noch bevor Helen sich jedoch dem Anliegen ihres Vorgesetzten zuwenden konnte, klingelte auf ihrem Schreibtisch das Telefon. Sie griff danach wie nach einem rettenden Strohhalm.
„Jefferson“, meldete sie sich fast atemlos.
„Du meine Güte, kommen Sie gerade vom Hundert-Meter-Sprint?“, erklang am anderen Ende die Stimme von Sir Thomas Harding, dem angesehenen Wissenschaftler. Mit ihm hatte Helen nun überhaupt nicht gerechnet, und etwas verblüfft hielt sie den Hörer in der Hand.
„Was wollen Sie denn?“, fragte sie fassungslos.
„Oh, tut mir leid“, erwiderte er leichthin. „Bin ich so unwillkommen? Dann lege ich gleich wieder auf.“
„Lassen Sie sich das ja nicht einfallen“, japste Helen. Sie spürte förmlich, wie sich ein feines Lächeln auf den Lippen des Wissenschaftlers malte.
„Brody?“, fragte er mitfühlend.
„Brody! Und ein Hexenkongress“, erwiderte sie seufzend.
„Wie gut Sie doch meine Gedanken lesen können“, meinte er scherzend. „Genau deswegen rufe ich an.“
„Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst.“
„Aber ja, liebste Helen, ich habe extra dafür gesorgt, dass Sie eine Einladung auf den Schreibtisch bekommen. Und wie ich höre, ist sie da.“
„Weiter haben Sie wohl keine Sorgen, was?“, spottete sie.
„Doch, eigentlich schon. Aber finden Sie es nicht auch ein faszinierendes Thema?“
In Helen überschlugen sich die Gedanken. Vor allen Dingen aber wehrte sie sich dagegen, wieder in eine mysteriöse Geschichte zusammen mit Parapsychologen hineingezogen zu werden. Bisher war es fast immer ein lebensgefährliches Abenteuer geworden, mit Sir Thomas Harding zusammenzuarbeiten. Die beiden kannten sich seit der Ernennung des Wissenschaftlers in den Adelsstand. Helen hatte ihn damals eigentlich nur interviewt - und war prompt in eine haarsträubende Geschichte hineingezogen worden. Und auch später hatten die zwei einige Abenteuer zusammen erlebt, die Helen zeitweise an ihrem Verstand zweifeln ließen. Und nun wollte sie nichts mehr mit mysteriösen Vorfällen zu tun haben. Sie schätzte Sir Thomas als Schachpartner und Freund, aber das war auch alles. Sie wollte gerade zu einer geharnischten Antwort ausholen, als erneut der Ruf ihres Chefredakteurs aufklang. Sie machte heftige Zeichen zu dem Glaskasten hin, in dem Brody saß und deutete auf ihr Telefon.
„Ich habe jetzt keine Zeit mehr, Sir Thomas“, sagte sie kurz angebunden. „Und im Übrigen können Sie meinetwegen mit dem Satan zum Hexenkongress gehen, aber nicht mit mir. Guten Tag!“
Wütend knallte sie den Hörer auf, dann ging sie noch immer zornig zu Brody hinein. Mit Erschrecken sah sie, dass er ebenfalls eine Einladung zu diesem Kongress in den Händen hielt.
„Werfen Sie diesen Müll ganz schnell in den Papierkorb“, empfahl sie.
Raymond Brody blickte auf, und ein zufriedenes Lächeln malte sich auf seinem gar nicht so unattraktiven Gesicht. Helen schwante Übles.
„Wenn Sie darauf anspielen, dass ich zu dieser - dieser Veranstaltung...“, begann sie mit zorniger Stimme, doch Brody unterbrach sie brüsk.
„Ich spiele auf gar nichts an, Jefferson. Ich schätze es ganz und gar nicht, wenn man mir vorschreiben will, wohin ich meine Reporter zu schicken habe. Ich schätze es vor allen Dingen dann nicht, wenn es ein Außenstehender ist, der mir etwas vorschreiben will.“
Helen erschrak. Hatte Sir Thomas etwa...? Doch Brody fuhr ungerührt fort.
„Die Vorsitzende dieses Hexenzirkels, oder was auch immer sie ist, hat mich angerufen und will auf keinen Fall, dass wir darüber berichten. Anscheinend wollen diese Hexen ihre Rituale geheim halten. Dem widerspricht natürlich diese Einladung. Und da ich mir nun nicht sicher war und von Ihnen vermutlich keine objektive Antwort bekommen hätte, habe ich mich mit Sir Thomas Harding in Verbindung gesetzt. Er empfiehlt dringend, dass ich Sie losschicke.“
Helen schnappte nach Luft. „Das ist eine Frechheit“, fuhr sie empört auf.
„Das finde ich eigentlich auch, denn ich wollte Dennis hinschicken, er scheint mir etwas objektiver. Aber Sir Thomas hat mich davon überzeugt, dass Sie auf diesem Gebiet schon fast Expertin sind. Machen Sie sich also fertig, und nehmen Sie eine Kamera sowie genügend Filme mit. Ich will einen farbigen Bericht sehen.“
„Ich will nicht!“, sagte Helen bestimmt.
Brody schaute sie erstaunt an. „Ich dachte, Sie wären so dick befreundet mit dem Professor.“
„Meine private Freundschaft hat nichts mit meiner Arbeit zu tun“, erwiderte sie. „Im Übrigen halte ich diesen sogenannten Kongress für Blödsinn. Es gibt keine Hexen. Schauen Sie sich doch die Inquisition des Mittelalters an. Verblendete Nichtswisser waren das, die harmlose Frauen umgebracht haben.“
„Ich möchte, dass Sie herausfinden, was heute noch daran ist“, erwiderte er gemütlich.
Sie starrte ihn wütend an. Im Grunde hatte es wenig Zweck sich zu weigern, das wusste sie genau. Es gab genügend Journalisten auf Londons Straßen, die sich darum reißen würden, in einer solchen Position beim angesehenen „Weekly Mirror“ zu arbeiten. Also, entweder übernahm sie diesen Auftrag, oder sie reichte gleich ihre Kündigung ein.
„Ich werde versuchen einen Zauberspruch zu finden, mit dem ich widerliche Chefredakteure loswerden kann“, sagte sie wütend.
„Gut. Und wenn Sie den haben, besorgen Sie mir einen, mit dem ich Sie zu einer Einladung überreden kann“, gab er trocken zurück.
„Eher gefriert die Hölle!“
Brody lächelte ihr hinterher, als sie sein Büro verließ und die Tür betont leise schloss.
1
Ein Hexenkongress! Helen war sich noch immer nicht sicher, ob sie lachen oder weinen sollte. Trotzdem begannen sich in ihr mittlerweile die Wut und die Neugier die Waage zu halten. Was sollte sie anziehen? Wie trat man dort überhaupt auf? Und war Fotografieren erlaubt? Vermutlich nicht, wenn die Oberhexe sich schon gegen eine Reporterin aussprach.
Ein Lichtblick fiel Helen ein. Wenn sie ohnehin nicht erwünscht war, würde man sie vielleicht schon an der Tür abweisen, dann konnte sie sich die Berichterstattung sparen.
Doch Sir Thomas, den sie an diesem Abend noch aufsuchte, nachdem er mehrfach telefonisch darum gebeten hatte, zerstörte diese kleine Hoffnung.
„Ich kenne Moira Winters“, erklärte er. „Sie kommt in regelmäßigen Abständen zu mir ins Institut, um sich testen zu lassen.“
Sir Thomas leitete das parapsychische Institut in London, das von einigen als Humbug verschrien, von anderen hochgelobt wurde. „Sie hofft immer noch, eines Tages übersinnliche Fähigkeiten zu erhalten. Vielleicht schafft sie es ja mit ein paar Zaubersprüchen.“
„O fein, und was soll ich da?“, fragte Helen wenig begeistert.
„Vielleicht reizt es Sie, anschließend festzustellen, dass Sie viel mehr übersinnliche Fähigkeiten besitzen, als die meisten dieser sogenannten Hexen“, stellte er trocken fest. „Helen, ich habe Ihnen immer wieder gesagt, dass Sie sehr sensibel sind. Sie sollten viel mehr auf Ihre Gefühle und Ahnungen geben. Und Sie sollten sich endlich testen lassen.“
„Wenn Sie mich damit wieder einmal nerven wollen, dann gehe ich gleich wieder“, erklärte sie, noch immer nicht besänftigt.
„Nein, verschieben wir das Thema lieber“, gab er nach. „Wie wäre es mit einer Partie Schach?“
Wenig später saßen sich die beiden gegenüber und maßen ihre Kräfte im fairen Wettstreit.
2
Die Frau sah eigentlich vollkommen normal und vor allen Dingen sehr hübsch aus. Pechschwarzes Haar fiel ihr in Locken auf die Schultern, in dem herzförmigen Gesicht leuchteten ein roter Mund und warme braune Augen, und ihr Lächeln war sympathisch und ansteckend. Trotzdem hatte sie sich als Dalrina, Hexe Ersten Grades vorgestellt. Helen war verblüfft, und Dalrina hatte ihr das angesehen.
„Ich sehe schon, Sie sind eine Skeptikerin“, hatte sie gemeint und Helen freundlich die Hand entgegengestreckt. „Aber wir Hexen sind nun mal keine verhutzelten Weiblein, die in Sack und Asche durch die Gegend laufen und ständig vor sich hinmurmeln. Die Hexen von heute sind Frauen, die mitten im Leben stehen, so wie ich. In meinem bürgerlichen Beruf bin ich Immobilienmaklerin.“
„Nun, dann hoffe ich, dass Sie wenigstens ein paar Hexenhäuser anzubieten haben“, murmelte Helen sarkastisch.
Dalrina lachte noch einmal auf. „Sie sind reizend. Wollen Sie nicht unserer Gilde beitreten?“
Helen streckte empört und abwehrend die Hände aus, und Sir Thomas lächelte.
„Kommen Sie, ich zeige Ihnen alles und stellte Sie den anderen vor“, sagte Dalrina offenherzig und zog Helen mit sich.
In einigen kleineren Räumen gab es regelrechte Diskussionsrunden vom kleinen Hexeneinmaleins bis hin zu handfesten Beschwörungen. Geheimnisvolle Mixturen wurden hergestellt, Kräutertees, Salben, wie auch Kerzen, deren Wachs einige Zutaten zugefügt wurden, die Helen nicht identifizieren konnte und wohl auch gar nicht wollte. Sir Thomas hatte einige Male geschnuppert, Pulver flüchtig untersucht und etwas mit der Zungenspitze geschmeckt. Er machte plötzlich ein besorgtes Gesicht.
„Was ist los?“, fragte Helen etwas spöttisch. „Reicht Ihnen die Dosis nicht?“
„Das ist nicht alles unbedenklich“, meinte er ernst.
„Dann rufen Sie doch das Gesundheitsamt“, empfahl sie zynisch.
Dalrina wandte sich dem Wissenschaftler zu. „Wir sind sehr sorgfältig in der Auswahl und Bemessung unserer Zutaten.“
„Aber scheinbar nicht sehr wählerisch, ob Sie damit Schaden anrichten können.“
„Ernsthafte Hexerei ist kein Sandkastenspiel.“
„Und Körperverletzung kein leichtfertiges Delikt.“
„Ich glaube nicht, dass Sie genau wissen, wovon Sie reden, Professor.“
„Ich bin nicht nur Parapsychologe, ich habe eine gründliche medizinische Ausbildung hinter mir. Ich weiß auf jeden Fall, was Sie mit den Drogen anrichten können, die Sie hier zusammenbrauen. Auch in Kerzen. Rhodanquecksilber kann tödlich wirken.“
„Nehmen Sie ernsthaft an, dass wir mit dem Tod experimentieren?“, fragte Dalrina ernst. „Wir sind eine Hexengilde und beschwören übersinnliche Mächte. Aber wir töten nicht.“
Harding schwieg zu diesen Worten, doch in Helen kroch langsam Angst hoch. Wo war sie hier nur wieder hineingeraten? Ihre linke Hand krallte sich fester um die Kamera, die sie vor die Brust gehängt hatte. Ein innerer Drang riet ihr wegzulaufen. Das alles hier konnte doch nicht real sein. Aber wenn es real war, dann war es gefährlich. Also raus hier!
Doch Dalrina hielt sie an der Hand fest, als habe sie ihre Gedanken gelesen. Und ein warnender Blick von Sir Thomas hinderte sie daran, sich einfach loszureißen. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen, dachte sie wehmütig.
Jetzt aber blickte sich Helen neugierig um. Dieser sogenannte Kongress fand in einem alten viktorianischen Haus statt, das sich als weitläufiger erwies, als es von außen schien. Die Räume waren hoch, die Wände teilweise holzgetäfelt oder mit reichlich Stuck ausgestattet, einige Wände waren mit Stofftapeten verziert, und die Bilder, die dort hingen, mochten ein Vermögen wert sein, wenn sie echt waren. Und sie sahen sehr echt aus. Die Möbel wirkten zerbrechlich und teuer, die Teppiche gut gepflegt und noch teurer.
Die Hexengilde schien zumindest nicht am Hungertuch zu nagen. Da das Haus so weitläufig war, und sich in jedem Raum höchstens drei oder vier Personen aufhielten, hatte Helen überhaupt keinen Überblick, wie groß dieser Kongress sein mochte. Doch sie fand es auf alle Fall erstaunlich, wie viele Leute hier zusammengekommen waren. Hexerei schien weiter verbreitet, als sie geahnt hatte. Und mittlerweile regte sich in ihr die gesunde Reporterneugier. Wenn es so viele Menschen gab, die sich dafür interessierten, dann gab es mit Sicherheit noch mehr, die darüber auch etwas lesen wollten. Und genau das war ja ihr Anliegen, ein Bericht in der Zeitung.
Helen Jefferson besann sich darauf, wer und was sie war und vor allen Dingen, warum sie hier war. Energisch nahm sie ihre Kamera hoch, schickte ein bezauberndes Lächeln zu Dalrina und fragte ganz arglos: „Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich ein paar Fotos mache? Von Ihnen meine ich, und vielleicht von dem Haus.“
„Aber nein“, lächelte die Hexe. „Meine Brüder und Schwestern müssen Sie aber auf jeden Fall erst fragen, ob sie nichts dagegen haben. Einige von uns sind da sehr empfindlich.“
„Selbstverständlich“, versprach Helen zuckersüß. „Ich finde das alles hier hochinteressant, und ich hoffe, ich werde noch einige Zaubersprüche und andere Dinge kennenlernen. Vielleicht darf ich auch Fragen stellen.“
Dalrina freute sich offensichtlich. „Nun, vielleicht kann ich Sie ja doch noch zu uns bekehren. Sie machen jedenfalls den Eindruck, als wären Sie sehr sensibel für unsere Kunst.“
Sir Thomas hüstelte unterdrückt, und Helen hätte ihm am liebsten einen bitterbösen Blick zugeschickt. Das war im Grunde das, was auch er schon mehrfach gesagt hatte. Aber sie beherrschte sich mustergültig.
„Ich glaube nicht, dass ich das könnte“, sagte Helen etwas kleinlaut und stellte sich absichtlich ein bisschen dumm. „Dafür muss man doch sicher lange studieren. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ich bin für so etwas völlig unbegabt.“
Sir Thomas verschluckte sich an den Worten, die er mühsam unterdrückte.
„Ich bin sicher, jeder von uns wird Ihnen gerne helfen, wenn Sie ernsthaft daran interessiert sind“, erwiderte Dalrina mit einem reizenden Lächeln und völlig arglos.
„Wir werden sehen“, wiegelte Helen ab.
3
Zwei Stunden später schwirrte Helen der Kopf. Dalrina hatte das vorgetäuschte Interesse für wahr genommen und Helen in alles Mögliche eingeführt. Schließlich bat die Reporterin dringend um eine Pause, sie wollte sich ein bisschen ausruhen. Sir Thomas begleitete sie. Und schließlich saßen die beiden in einer gemütlichen Sitzecke beieinander, mit Erfrischungen vor sich auf dem Tisch.
„Das war phantastisch, Helen. Ich bewundere Sie“, meinte Harding anerkennend.
Sie blickte ihn aber nur böse an. „Rein berufliches Interesse, Professor. Und im Übrigen wäre ich Ihnen sehr verbunden und dankbar, wenn Sie sich in Zukunft aus meinen Angelegenheiten heraushalten.“
„Ihren Angelegenheiten, Helen?“, fragte er vollkommen unschuldig. „Ich glaube, ich verstehe Sie nicht ganz.“
„Ich meine damit, dass Sie meine Aufträge nicht über Mr. Brody manipulieren sollten. Und schon gar nicht einen solch blödsinnigen Kongress wie diesen hier.“
„Oh, und ich dachte, es gefällt Ihnen“, erklärte er betrübt.
„Ich brauche diese Veranstaltung etwa so dringend wie Magenschmerzen“, fauchte sie ihn an.
„Sie sind sehr hart zu mir“, stellte er bedauernd fest. „Ich habe nur gedacht, ich tue Ihnen einen Gefallen.“
„Tun Sie mir einen einzigen Gefallen“, seufzte Helen. „Lassen Sie mich ganz einfach in Ruhe. Ich schätze Sie als Freund und Schachpartner. Aber bitte, mischen Sie sich nie wieder in meine Arbeit ein. Bitte!“
Thomas Harding wurde sehr ernst. „Verzeihen Sie mir, Helen, aber ich nehme diese Sache hier äußerst ernst. Diese Hexengilde steht in dem Ruf Schäden anrichten zu können, von denen Sie und ich sich keine Vorstellung machen können. Eine Frau aus meinem Bekanntenkreis hatte sich diesen Leuten angeschlossen. Und heute ist sie in einer psychiatrischen Anstalt, nicht mehr ansprechbar. Körperlich völlig gesund, aber geistig ein Wrack.“
Helen erschrak. „Entschuldigen Sie, das habe ich natürlich nicht gewusst. Aber das erklärt nicht, warum ich mitkommen sollte. Ich als außenstehende Reporterin werde daran sicher nichts ändern können.“
„Ehrlich gesagt, hatte ich gehofft, dass man Ihnen, um sich zu präsentieren, einiges zeigen würde. Einiges, was nicht unbedingt in der Öffentlichkeit bekannt ist. Ich möchte dieser Sache ganz einfach auf den Grund gehen. Vielleicht ist ja gar nichts daran an den Gerüchten. Dann hätte Jennys Krankheit doch eine andere Ursache. Aber nachdem ich gesehen habe, welche Mittel hier verwendet werden, hat sich mein Verdacht eher bestärkt.“
„Ja, Sie sprachen vorhin von Rhodanquecksilber. Was ist das?“
„Eine Art Salz, das bei der Verbrennung von Schwefelsäure, Quecksilber und anderen Zutaten entsteht. Es vereinigt in sich die giftige Wirkung der Blausäure und des Quecksilbers. Im Mittelalter war es sehr gebräuchlich, um andere Menschen zu töten, ohne Spuren zu hinterlassen. Man mischte es zum Beispiel in Kerzen.“
Helen schüttelte sich unwillkürlich. „Sie bringen mich hier mit potentiellen Mördern zusammen, Professor, finden Sie das richtig?“
Er lächelte maliziös. „Es gibt heute wahrhaft bessere Mittel, um Leute aus dem Weg zu räumen. Ich finde es eher bemerkenswert, dass hier noch mittelalterliche Methoden gepflegt werden.“
„Bemerkenswert vielleicht. Aber nicht besonders vertrauenerweckend.“
„Nun seien Sie doch nicht so empfindlich, Helen. Niemand bedroht Sie.“
„Bis jetzt nicht“, stellte sie trocken fest. „Aber wer bin ich denn schon? Nur eine kleine Journalistin, im Zweifelsfalle entbehrlich.“
Sir Thomas legte seine rechte Hand auf die von Helen. „Ich werde Sie auf jeden Fall beschützen“, versprach er großmütig.
„Da bin ich aber beruhigt. Die Frage ist nur, ob ich mir einen Bodyguard wie Sie leisten kann.“
„Seien Sie nicht so zynisch“, empfahl er lächelnd. „Wir bekommen Besuch, lächeln Sie.“
Dalrina tänzelte auf die beiden zu. „Es ist bald Zeit für das Abendessen“, verkündete sie. „Kommen Sie bitte.“
4
Ein großzügiger Speisesaal breitete sich vor Helens erstaunten Augen aus, als Dalrina eine schwere hölzerne Flügeltür öffnete. Dieser Raum wirkte nicht mehr viktorianisch, sondern eher mittelalterlich. Sauber geputzte Ritterrüstungen standen auf Podesten an den Wänden, Fahnen schmückten die beiden Stirnseiten, und eine regelrechte Waffensammlung fand sich an der Längswand des Raumes. Von Schwertern über Morgenstern und Hellebarde bis zu Lanzen, Degen und wundervoll verzierten Schildern war wirklich alles vertreten. Die andere Längsseite nahm ein riesiger Kamin in Anspruch, in dem an einem Spieß ein Schwein und eine Ziege brutzelten. Das war nun mal eine echte Überraschung, der verlockende Duft breitete sich aus und erzeugte Appetit. Sechs schmale hohe Fenster, die mit schwerem samtenem Tuch verhüllt waren, deuteten an, dass es auch noch eine normale Welt draußen gab.
Zwei lange Tafeln durchzogen den Raum, beide mit Stühlen dicht bestückt. Und hinter diesen Stühlen standen wartend Menschen. Erstaunt stellte Helen fest, dass es wohl annähernd hundertfünfzig bis zweihundert Personen sein mussten, die sich hier zusammengefunden hatten.
Zwei Leute kamen auf Harding und Helen zu, ein Mann und eine Frau. Die Frau schien alt zu sein, doch die Falten in ihrem Gesicht fielen kaum auf, dafür jedoch die Augen. Sie strahlten intensiv grün unter dem fast schlohweißen Haar. Sie ging auf Sir Thomas zu und reichte ihm beide Hände.
„Wie schön, dass Sie gekommen sind, Sir Thomas, ich freue mich, dass Sie ein wenig Interesse für die Hexengilde zeigen. Kommen Sie, Sie werden mein Tischherr sein.“ Harding lächelte mechanisch und folgte der Frau, nachdem er Helen vorgestellt hatte.
„Das war Moira Winters, unsere Gildenmeisterin und Oberhexe“, erklärte Dalrina fast ehrfürchtig scheu und blickte der Frau verzückt hinterher. „Sie werden Sie nachher beim Zirkel noch einmal sehen.“
„Ich bin Kyle O’Bannon“, sagte der Mann mit weicher Stimme und reichte Helen die Hand. „Meine Funktion kann ich Ihnen vielleicht so erklären, dass ich mit Moira zusammen den Vorstand bilde, oder wie immer Sie das nennen wollen.“
Helen ergriff die Hand wie verzaubert. Diese samtene Stimme, zusammen mit der Ausstrahlung und dem intensiven Blick aus kühlen grauen Augen hatten eine merkwürdige Wirkung auf die Reporterin. Sie lauschte dem Klang seiner Worte nach, während sie ihm fast unbewusst folgte.
„Sie sind heute Abend meine Tischdame“, erklärte er weich. „Und ich bin entzückt, eine nettere Gesellschaft könnte ich mir kaum denken.“
Helen murmelte irgendetwas Unverständliches und fand sich gleich darauf an der Seite des Mannes sitzend wieder. Kaum nahm sie bewusst war, was sie aß, obwohl das Essen gut war, wie von allen Seiten lobend versichert wurde. Sie hörte fasziniert den Erzählungen des Mannes zu, auch wenn sie später nicht mehr hätte sagen können, worüber er gesprochen hatte. Es schien wirklich wie Hexerei, und irgendwann erwachte sie wie aus einem Traum, weil das Essen beendet war und alle aufstanden.
Sir Thomas zog sie am Ärmel, sein Gesicht sah ausgesprochen ernst und fast wütend aus.
„Was ist eigentlich los mit Ihnen?“, fragte er barsch, als sie auf seine erste Frage überhaupt nicht reagierte.
Nur langsam kam Helen wieder voll zu sich und schaute sich verwirrt um.
„Ich - weiß nicht“, erwiderte sie zögernd.
„Worüber haben Sie mit O’Bannon gesprochen?“, wollte Harding wissen.
„Er - er hat etwas erzählt“, sagte Helen langsam. Dann strich sie sich mit Hand über die Stirn. „Aber ich weiß nicht mehr, worüber.“
Harding fasste Helen hart am Arm. „Lassen Sie uns gehen, Sie müssen schleunigst raus hier. Es scheint fast, als wären Sie beeinflusst worden.“
„Ich? Beeinflusst? Bei Ihnen piept es wohl. Nur weil ich mich nicht an belangloses Geplauder erinnern kann?“
„O’Bannon hat noch nie belanglos geplaudert“, erwiderte Harding hart. „Und wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, dann sind Sie beeinflusst worden, das ist doch klar, oder?“
„Sonnenklar. Und morgen steht Elvis aus dem Grab auf“, erwiderte sie zynisch. „Machen Sie sich doch nicht lächerlich, Sir Thomas. Wie und warum sollte O’Bannon mich beeinflusst haben? Nennen Sie mir einen gescheiten Grund dafür.“
„Ist das nicht vollkommen klar? Wenn Sie sich an nichts erinnern können, dann ist es Ihnen auch unmöglich, einen Bericht für Ihre Zeitung zu schreiben.“
„Bilder sind unbestechlich“, meinte Helen. „Und ich habe schon eine Menge davon geschossen.“
„Sind Sie wirklich sicher?“, fragte Sir Thomas fast lauernd.
„Wollen Sie den Beweis? Hier, sehen Sie nach, es müssten schon mehr als zehn Fotos sein.“
Harding schaute auf die Anzeige der Kamera und lachte kurz und bitter auf. „Sehen Sie selbst, Helen, zwei - nicht mehr als zehn.“
Verstört schaute sie selbst nach, schüttelte dann den Kopf und blickte noch einmal genauer hin. „Die - die Anzeige spinnt wahrscheinlich“, erklärte sie zögernd.
„Ja natürlich. Und - wie sagten Sie gerade so schön, morgen steht Elvis aus dem Grab auf.“
„Ich verstehe das nicht“, schimpfte Helen und fummelte an dem Apparat herum. Harding nahm ihr sanft die Kamera aus der Hand. „Helen? Helen! Lassen Sie es. Irgendetwas stimmt hier nicht. Kommen Sie, wir wollen gehen.“
Aber es schien zu spät zu sein, um sich unbemerkt zu verdrücken. Mit breitem Lächeln tauchten Dalrina, O’Bannon und Moira Winters auf, um ihre Gäste in einen anderen Raum zu führen.
„Die Gildenmeisterin hat beschlossen, Ihnen beiden einen besonderes Genuss zu bieten“, erklärte Dalrina freudestrahlend auf eine Handbewegung von Moira hin. „Sie dürfen Zeuge einer Beschwörung werden.“
Da Helen und Sir Thomas sich nicht besonders begeistert zeigten, setzte die Hexe hinzu: „Das ist eine ganz besondere Ehre und eigentlich nur für Eingeweihte zugänglich. Sie werden die ersten sein, die anwesend sein dürfen, ohne zur Gilde zu gehören.“
„Ich bin beeindruckt“, sagte Sir Thomas etwas mühsam.
„Kommen Sie, meine Liebe“, sagte O’Bannon sanft und nahm Helen beim Arm. Sie folgte ihm wie verzaubert. Den überaus besorgten Blick von Sir Thomas bemerkte sie nicht mehr.
5
Der Raum war dunkel wie ein Kinosaal. Helen spürte mehr als sie sah, dass sich viele Menschen darin befanden, die sich sehr ruhig verhielten. Ganz am Ende des Raumes stand ein Tisch, auf dem eine kleine einzelne Kerze brannte, das war das einzige Licht. O’Bannon führte Helen zu einem Stuhl in der Nähe des Tisches, hieß sie sich setzen und ließ sie dann allein. Gleich darauf wurde Sir Thomas von Moira hereingeführt. Der Wissenschaftler setzte sich neben seine Freundin und versuchte ihr etwas ins Ohr zu flüstern. Doch Dalrina stand plötzlich wie aus dem Boden gewachsen neben ihnen und bat mit einem auf die Lippen gelegten Finger um Ruhe.
Harding verschränkte wütend die Arme vor der Brust und starrte wütend auf das Bild, das sich ihm bot.
Moira und O’Bannon setzten sich an den Tisch, an dem die Kerze brannte. Und ein weiterer Mann kam hinzu, groß, hochgewachsen, fast hager, von unbestimmbarem Alter. Er machte fast den Eindruck, als ginge ihn das alles nichts an, doch er musste ungeheuer wichtig sein, das spürten Helen und Harding. Seine Ausstrahlung war fast überwältigend, und Helen, die langsam in die Wirklichkeit zurückfand, merkte, wie sich die kleinen Härchen an ihren Armen aufrichteten.
Weitere Kerzen wurden angezündet und verbreiteten einen betäubenden Duft. Sir Thomas machte Anstalten, als wollte er davonlaufen, doch als er sah, wie Helen auf das Bild starrte, das sich ihnen bot, blieb er resigniert sitzen. Wahrscheinlich wäre er auch nicht weit gekommen. Und warum sollte er die Gilde brüskieren, sie hatte bis jetzt keinem etwas getan. Zumindest gab es keinen Beweis dafür. Und außerdem konnte er Helen nicht einfach allein lassen.
Ein Summen setzte ein, es schien von überall und nirgendwoher zu kommen. Es war fast, als würde der ganze Raum durch diesen Ton in Schwingung versetzt. Auch Helen verspürte für einen Augenblick das unwiderstehliche Gefühl aufzustehen und wegzulaufen. Ihre Augen blickten gehetzt umher. Sir Thomas spürte, dass sie mehr fühlte, als sie ihm jemals eingestehen würde. Trotzdem nahm er sich vor, sie später darüber auszufragen. Und dann würde er sich nicht mit ausweichenden Antworten zufrieden geben.
Das Ritual begann.
6
Raymond Brody, Chefredakteur des „Weekly Mirror“, saß an diesem Abend lange in seinem Büro. Er redigierte den Kommentar der Woche, las ein paar der Artikel, die seine Reporter zusammengetragen hatten und fühlte sich im Ganzen nicht so recht in der Stimmung, nach Hause zu gehen. Es wäre ein langweiliger Abend, der ihn erwarten würde, und wahrscheinlich würde er dann, wie so oft, vor dem Fernseher einschlafen. Er war längst nicht der Playboy, für den er sich gerne ausgab und für den ihn viele hielten. Doch er hatte ein Auge auf Helen geworfen und wäre einer engeren Beziehung auf keinen Fall abgeneigt. Doch die Frau widersetzte sich hartnäckig, und so konnte er im Grunde nicht viel mehr tun, als auf seine Art immer wieder um sie werben. Das alles nur, um sich den nächsten Korb einzufangen.
So zögerte er jetzt den Feierabend immer weiter hinaus und blieb in der Redaktion länger als nötig.
Der neue Kulturredakteur kam herein, James Hanley. Der sah Brody noch immer im Glaskasten sitzen, schüttelte heftig den Kopf und setzte sich selbst an seinen Schreibtisch, wo er gleich darauf heftig zu tippen begann.
Brody entschloss sich nun doch, endlich Feierabend zu machen. Er stand auf und reckte sich, steif vom langen Sitzen. Plötzlich jedoch durchzuckte seinen Körper ein heftiger Schmerz. Mit einem Ächzen sank er zusammen und hielt sich krampfhaft mit beiden Händen an der Schreibtischkante fest, bevor er schwer auf den Boden aufschlug. Und dann sah er vor seinem geistigen Auge das Bild einer triumphierend lachenden Helen. Es Schoss ihm der widersinnige Gedanke durch den Kopf, dass hier vielleicht der Zauber war, den sie mehr scherzhaft hatte finden wollen. Das Ganze war natürlich absurd, das wusste er. Oder sollte doch etwas Wahres daran sein?
Nein, unmöglich!
Aber wieso lag er dann hier und konnte sich nicht mehr rühren. Ein dumpfer Schmerz pochte in seinem Kopf, und der restliche Körper fühlte sich an, als würde er zerschnitten. Brody röchelte und hatte den dringenden Wunsch bewusstlos zu werden, damit die Qual aufhörte. Aber sein Körper hatte kein Einsehen, er musste alles miterleben.
James Hanley hatte den Aufprall des schweren Körpers gehört. Und als er jetzt nur noch Röcheln hörte, kam er herbei und rief gleich darauf einen Notarzt. Raymond Brody wurde mit allen Anzeichen eines Herzinfarktes ins nächste Hospital gebracht.
7
Helen meinte, durch den Geruch der Kerzen ersticken zu müssen. Das Luftholen fiel ihr schwer, und sie begann flach zu atmen. Die Luft im Raum war jedoch nicht sehr sauerstoffhaltig, und so atmete sie auf jeden Fall mehr von diesen betäubenden Dämpfen ein, als sie wollte. Aber das war ihr plötzlich alles egal. Das Mittel, das mit den Kerzen verbrannte, erzeugte eine gewisse Gleichgültigkeit, die zunächst von Helen, aber dann auch von Sir Thomas Besitz ergriffen hatte. Die beiden schauten mit gespannter Konzentration auf den Tisch, an dem Moira und die beiden Männer saßen. Das dumpfe Summen der Stimmen im Raum war angeschwollen, und die Stimmen der drei am Tisch hatten sich damit vermischt und erhoben sich nun. Dann stand Moira auf und hob die Hände wie zu einer bittenden Geste. Sämtliche Kerzen, die man noch angezündet hatte, flammten für einen kurzen Moment flackernd auf und verglühten zischend. Dann setzte sie sich wieder, ein Schatten unter anderen Schatten.
Nun standen die beiden Männer auf, reichten sich ihre Hände und begannen vor sich hin zu murmeln. Eine ganze Weile geschah gar nichts. Dann jedoch formte sich über den beiden Männern ein blau schimmernder Ball aus Licht. Er leuchtete fast schmerzhaft hell. Ein seltsamer Geruch breitete sich aus, doch das schien niemanden zu stören oder gar aufzufallen. Der Lichtball veränderte sich, er wurde zu einer Gestalt, entfernt menschenähnlich, aber nicht genau erkennbar. Wie von unsichtbaren Fäden gelenkt, bewegte sich diese Gestalt auf Helen zu, verharrte in der Luft über ihr und senkte sich dann auf die Reporterin hinab.
Helen saß regungslos auf ihrem Stuhl, als ginge sie das alles gar nichts an. Sie machte auch keine Abwehrbewegung, als das blaue Lichtwesen ihren Kopf einhüllte und sie in sich aufzusaugen schien. Das noch immer vorhandene Summen im Raum verstärkte sich, schien sich zu konzentrieren und ausschließlich auf Helen zu richten. Das Lichtwesen schien bei Helen gefunden zu haben, was es suchte. Es bildete lange Arme und schickte aus diesen einen blauen Blitz in den Raum. Und aus diesem Leuchten heraus schienen alle Anwesenden Helens Gedanken aufzunehmen. Klar erkannten sie Helens Abneigung gegen ihren Chefredakteur, und auch, dass sie ihm nichts Gutes wünschte.
Jetzt schienen sich alle Anwesenden zu einem Gedanken zu vereinen, den sie auf die Reise durch das Unfassbare schickten. Dieser Gedanke traf Raymond Brody mit vernichtender Klarheit.
So zumindest empfing es Sir Thomas, der das alles fast unbeteiligt aufnahm. Unter normalen Umständen hätte er Helen schon am Arm gepackt und das Weite mit ihr gesucht. Doch sein Körper gehorchte ihm nicht, und sein Geist schien seltsam benebelt. Also nahm das alles hin. Irgendwann würde er darüber nachdenken müssen, warum er so teilnahmslos sitzen blieb. Doch jetzt konnte er nicht aufstehen, und im Grunde war es ja auch egal. Aber er beobachtete weiter, wenn auch ohne innere Beteiligung.
8
Sir Thomas Harding erwachte mit furchtbaren Kopfschmerzen. Ein Lichtstrahl fiel durch die geschlossenen Vorhänge seines Schlafzimmers, traf seine Augen und ließ ihn schmerzerfüllt aufstöhnen. Ein kühles feuchtes Tuch wurde sanft auf seine Stirn gelegt, und er blinzelte, um zu sehen, wer da vor ihm saß.
Es war natürlich der Butler, Jenkins, der einen besorgten Gesichtsausdruck aufgesetzt hatte.
„Wie fühlen Sie sich, Sir?“, fragte er sanft.
Zur Antwort stöhnte Sir Thomas noch einmal. „O Gott, wessen Whiskyvorräte habe ich gestern eigentlich geplündert?“, fragte er dann undeutlich.
Jenkins sah plötzlich sehr bestürzt aus. „Sir, wissen Sie denn nicht mehr, wo Sie waren?“
Die etwas erhobene Stimme des Butlers löste im Kopf von Sir Thomas ein mittleres Erdbeben aus. „Schreien Sie mich nicht so an“, murmelte er. „Was war eigentlich los?“
„Sir, Sie suchten gestern mit Mrs. Jefferson das Treffen der Hexengilde auf. Und man hat Sie in einem erbarmungswürdigen Zustand zurückgebracht. Ich habe mir Sorgen gemacht und wollte schon Dr. Randall anrufen. Ich hoffe, Mrs. Jefferson ist wohlauf.“
Helen! Der Gedanke durchzuckte Harding wie ein Blitz. Abrupt versuchte er aufzustehen und sich umzusehen, doch gleich heftig aufstöhnend sank er wieder zurück.
„Hat man Helen nicht mit hergebracht?“, wollte er dann wissen.
„Nein, Sir, selbstverständlich nicht.“
Es dauerte eine Weile, bis Harding diese Antwort verdaut hatte. „Rufen Sie sie an, Jenkins, ich will wissen, wie es ihr geht. Und ich will versuchen nachzudenken, was gestern überhaupt passiert ist.“
Jenkins verschwand lautlos, und der Professor strengte seinen Kopf an, um die Erinnerung an den vergangenen Abend aufzufrischen. Seine letzte bewusste Erinnerung war Zorn und der innere Drang, mit Helen verschwinden zu müssen. Dann hatte sich eine gewisse Gleichgültigkeit in ihm ausgebreitet, und von da an war ihm der Film gerissen.
Was war nur passiert?
Und wie ging es Helen? Hatte sie die ganze Sache besser überstanden?
Jenkins kam wenig später zurück, mit einem bedauernden Gesichtsausdruck.
„Es tut mir sehr leid, Sir. Mrs. Jefferson meldet sich nicht.“
„Haben Sie es auch in der Redaktion versucht?“
Die drängende Frage wurde von einem erneuten Stöhnen begleitet.
„Selbstverständlich, Sir. Dort ist Mrs. Jefferson auch nicht aufgetaucht. Und als weitere Information habe ich mitzuteilen, dass Mr. Brody gestern Abend mit allen Anzeichen eines Herzanfalls ins Krankenhaus gebracht worden. Er schwebt jedoch nicht mehr in Lebensgefahr.“
„Tolle Nachrichten“, knurrte Harding. „Gehen Sie, Jenkins. Kochen Sie mir einen Kaffee, der Tote aufweckt, und meinetwegen kippen Sie einen Whisky hinein. Und das möglichst schnell.“
„Sir, sind Sie sicher, dass ich nicht doch Dr. Randall...?“
„Nein!“, brüllte Harding und fasste sich wieder an die Stirn.
Jenkins verschwand.
9
„Wo bin ich?“, fragte Helen undeutlich. Auch sie war mit Kopfschmerzen erwacht, doch sie befand sich in absoluter Dunkelheit, und niemand war da, der ihr kühle Umschläge auf die Stirn legte.
Ihre tastenden Finger signalisierten ein Bett, rechts von ihr war eine Wand, links befand sich Leere. Das war nicht ihr Zuhause. Langsam und vorsichtig versuchte sie sich aufzurichten, doch ihr schmerzender Kopf verhinderte das. Also blieb sie doch lieber liegen. Eigentlich müsste sie jetzt aufstehen und zur Arbeit fahren, ihre Artikel schreiben. Doch sie fühlte sich ganz und gar nicht wohl, und so blieb sie liegen. Irgendwann später würde sie Brody anrufen und sich für heute krank melden.
Helen wollte jetzt nicht weiter nachdenken, schon gar nicht darüber, dass sie sich eigentlich nicht zuhause befinden konnte. Sie rollte sich zusammen und schlief wieder ein.
10
Zwei Stunden später war Thomas Harding soweit, dass er langsam und vorsichtig aufstehen konnte. Jenkins hatte die Bemühungen seines Dienstherrn mit Sorge und Argwohn betrachtet. Ihm wäre es am liebsten gewesen, einen Arzt zu rufen, Sir Thomas in Watte zu packen und darauf aufzupassen, dass niemand ihn störte. Aber auch er machte sich Sorgen um Helen Jefferson. Er mochte die sympathische Reporterin, die häufiger Gast im Hause war und immer ein freundliches Wort für ihn hatte. Er hätte es gerne gesehen, wenn die Journalistin und sein Chef ein Paar würden, doch bisher machte keiner von beiden Anstalten dazu.
Mehrmals hatte er schon vergeblich versucht, Helen daheim oder in der Redaktion zu erreichen. Aber bei Helen zuhause meldete sich niemand, nicht einmal der Anrufbeantworter. Und in der Redaktion wurde ihm die immer gleiche Antwort gegeben, man würde ihn benachrichtigen, sobald sie auftauchte.
Sir Thomas ging nun mit wackeligen Beinen ins Wohnzimmer und ließ sich in einen Sessel direkt neben dem Telefon fallen. Er überlegte kurz, dann rief er Moira Winters an, die Hexe meldete sich sofort. Sir Thomas hatte nicht vor zuzugeben, dass er sich an fast nichts erinnern konnte, er gestand nur einige kleinere Lücken in seinem Gedächtnis zu.
„Habe ich mich gestern Abend sehr daneben benommen?“, fragte er mit einem Lächeln in der Stimme.
„Aber nein, mein Lieber, meine Gäste und ich sind noch immer ganz entzückt davon, dass Sie zu Gast waren.“
„Ehrlich gesagt, ich bin mit einem furchtbaren Kater aufgewacht und habe mich gefragt, wieviel Unsinn ich gestern geredet habe.“
„Aber nicht doch, Sir Thomas. Alles, was Sie gesagt haben, war im Rahmen des Erlaubten. Ich danke Ihnen nochmals für den Besuch, und auch für Ihre nette kleine Freundin. Wir hoffen, Sie werden uns bald wieder einmal die Ehre geben.“
„Ach ja, Mrs. Jefferson“, meinte Sir Thomas, als fiele sie ihm gerade erst wieder ein. „Wie lange ist sie denn noch geblieben, nachdem ich weg war.“
„Aber ich bitte Sie, Sir Thomas, Sie sind doch gemeinsam gefahren“, flötete Moira. „Sie Böser, Sie, haben Sie doch noch eine Bar in Soho unsicher gemacht?“
Sir Thomas war es, als würde ihn jemand mit einem Hammer auf den Kopf schlagen.
„Oh, ich muss wohl wirklich einen dicken Kater haben“, meinte er leicht verlegen. „Tut mir leid, da ist mir wohl etwas entfallen. Ich danke Ihnen, Moira. Einen schönen Tag noch.“
Nachdenklich legte er den Hörer auf. Es erschien ihm unwahrscheinlich, dass Helen mit ihm zusammen die Veranstaltung verlassen haben sollte, denn dann wäre sie mit Sicherheit auch hier gewesen. Und außerdem, wie war er überhaupt nach Hause gekommen? Jegliche Erinnerung daran fehlte ihm.
„Jenkins!“, brüllte er, doch kaum ein Flüstern verließ seinen Mund. Dennoch stand der Butler sofort parat.
„Sir! Was kann ich für Sie tun?“
„Wie bin ich nach Hause gekommen?“
„Sir, ich – ehm – nun ja.“
„Nun drucksen Sie nicht so herum, was war los?“
„Sir, Sie äh - Sie lagen vor der Tür.“
„So, so. Ich lag also vor der Tür. Und Sie haben natürlich angenommen, ich hätte einen über den Durst getrunken, was Sie, wie jeder gute Butler, selbstverständlich übersehen.“
„Nein, Sir. Soviel haben Sie noch nie getrunken, seit ich das Vorrecht habe, Ihnen dienen zu dürfen. Und außerdem nahm ich keinen Alkoholgeruch wahr, sondern nur einen undefinierbaren Duft. Also habe ich Sie ins Bett gelegt und ernsthaft erwogen den Arzt zu rufen.“
„Und Helen, war sie wirklich nicht bei mir?“
„Nein, Sir“, erwiderte Jenkins mit Nachdruck.
„Ist es vielleicht möglich, dass sie zwischenzeitlich zu sich gekommen war und irgendwo im Park herumirrt?“
„Sir, das halte ich für unwahrscheinlich. Aber wenn es Sie beruhigt, und auch mich, werde ich sofort sehen, ob sie sich dort noch irgendwo aufhält.“
„Warten Sie, ich komme mit!“
„Aber Sir, Ihr Zustand“, protestierte Jenkins.
„Na gut, vielleicht haben Sie recht.“ Noch immer dröhnte der Schmerz im Schädel des Wissenschaftlers, und im Grunde war er froh, wenn er sich nicht regen musste.
Gut eine Stunde später kam Jenkins jedoch wieder herein und erklärte unmissverständlich, dass es auch draußen keine Spur von Helen Jefferson gäbe. Nun war Harding doch mehr als beunruhigt und rief die Polizei an.
11
Zwei Tage später gab es noch immer keine Spur von Helen. Inspektor Myers von Scotland Yard war nach anfänglicher Skepsis nun auch davon überzeugt, dass der jungen Frau irgendetwas passiert sein musste. Trotzdem hielt er die ganze Geschichte immer noch für hanebüchen.
„Ein Hexenkongress!“, hatte er abfällig gesagt. „Das ist derart haarsträubend, dass ich es nicht einmal in meinem Bericht aufnehmen mag.“
„Was wollen Sie statt dessen hineinschreiben“, hatte Harding sarkastisch erwidert. „Vereinigung der kuchenbackenden Reporter?“
„Sie sind unsachlich, Professor.“
„Ich bin nicht unsachlich, ich versuche, Ihnen eine Sachlage zu erklären. Denn es ist und bleibt eine Tatsache, dass Helen Jefferson verschwunden ist.“
„Vielleicht macht sie ein paar Tage Urlaub.“
„In dem Zustand? Ich bin heute noch nicht wieder ganz bei mir.“
„Wer sagt Ihnen, dass es der jungen Frau ebenso ging? Und wer sagt Ihnen, dass es nicht eine Einbildung Ihrer überreizten Phantasie ist?“
Der Professor war kurz davor zu explodieren. Doch er beherrschte sich mühsam, wenn er Helen überhaupt irgendwie helfen wollte, dann durfte er es sich mit der Polizei nicht verscherzen. Und deshalb musste er Inspektor Myers irgendwie überzeugen.
Das war vor zwei Tagen gewesen, jetzt aber war sogar der gute Inspektor überzeugt davon, dass etwas nicht stimmen konnte.
Es war ganz einfach nicht Helens Art irgendwohin zu verschwinden und nichts von sich hören zu lassen. Und außerdem genoss Sir Thomas einen sehr guten Ruf bei Scotland Yard, niemand konnte ihn einfach als Spinner abtun.
Also lief jetzt die normale polizeiliche Fahndung an.
Thomas Harding besuchte Raymond Brody im Krankenhaus. Ganz sicher nicht aus Anteilnahme, nein, ihm kam etwas an dieser Krankheit merkwürdig vor, ohne dass er hätte sagen können, was es war. Da aber auch immer wieder Erinnerungsblitze an den verwunschenen Abend durch sein Gehirn zuckten, blieb ihm nur die offene Nachfrage, obwohl er selbst sich noch immer nicht gut fühlte.
Brody ging es mittlerweile etwas besser.
„Was haben Sie mit meiner Reporterin gemacht? Sie hat mich seit zwei Tagen nicht mehr beschimpft“, scherzte er noch gutgelaunt, als Harding das Zimmer betrat. Er wusste noch nicht, dass Helen wie vom Erdboden verschluckt war, sein Zustand hatte diese Information bisher nicht erlaubt. Jetzt brachte Sir Thomas es ihm so schonend wie möglich bei. Der Arzt hatte gewarnt, dass der Patient sich noch nicht aufregen dürfte, aber Brody wollte sich jetzt aufregen.
„Was, zum Teufel, soll das heißen, Helen ist verschwunden? Sie haben sie mitgenommen. Auf Ihre Empfehlung hin habe ich sie überhaupt erst mitgeschickt. Und jetzt erklären Sie mir, dass sie einfach weg ist? Und das alles nach einer ziemlich konfusen Story? Sehen Sie zu, dass Helen schnellstens wieder auftaucht.“
„Die Polizei tut schon alles, was in ihrer Macht steht“, versuchte Harding den aufgeregten Chefredakteur zu besänftigen.
„Und Sie? Was tun Sie hier an meinem Bett? Gehen Sie, und suchen Sie Helen, aber los!“
„Ich wusste gar nicht, dass Ihnen so viel an der Frau liegt, so wie Sie sie normalerweise behandeln“, bemerkte Harding trocken.
„Helen ist eine phantastische Frau und eine gute Journalistin, ich möchte sie ganz einfach nicht verlieren.“
Diese Aussage musste Harding so akzeptieren. Und so fuhr er nachdenklich nach Hause. Ihm fiel auf, dass sein Butler nicht wie gewohnt zur Stelle war, doch dann fiel ihm ein, dass dieser um einen freien Tag gebeten hatte.
Harding ging in die Bibliothek, nahm sich einen Whisky und setzte sich nachdenklich vor das Schachbrett, an dem er zuletzt mit Helen gespielt hatte. Seine Gedanken schweiften ab, während er sich die letzten Züge vergegenwärtigte. Wo mochte Helen sein?
12
Butler Jenkins war ein stets korrekter, zurückhaltender Mann, der seine Gefühle praktisch nie zeigte. Doch auch er machte sich ernsthafte Sorgen um die sympathische Frau, die er so mochte. Deshalb hatte er beschlossen, auf eigene Faust nach ihr oder einer Spur von ihr zu suchen. Sein Dienstherr wäre damit aber sicher nicht einverstanden, dessen war er sicher. Zumindest hätte Harding daran beteiligt sein wollen. Aber so wollte Jenkins das Ganze auf eigene Faust starten. Weil der Butler jedoch auch ein vorsichtiger Mann war, sicherte er sich ab, indem er in seinem Zimmer eine Nachricht hinterließ, wohin er aufgebrochen war. Schließlich konnte man nie wissen, was passieren würde.
Jenkins kannte das Haus, in dem der Kongress stattgefunden hatte. Es hatte früher einmal dem Earl of Graveston gehört, und ein Freund vom ihm war dort Butler gewesen. Mittlerweile war der Besitzer jedoch eine Immobiliengesellschaft, die das Haus für Veranstaltungen vermietete. Zwischen diesen Veranstaltungen stand es meist leer. Als kluger und vorausschauender Mann hatte Jenkins einen Satz Dietriche mitgenommen, aber er hätte sich strengstens dagegen verwahrt, das Ganze als Einbruch zu bezeichnen. Er suchte ganz einfach nach Spuren, nach einem Hinweis, wo Helen Jefferson geblieben sein konnte.
Um so wenig wie möglich aufzufallen, benutzte der Butler ganz dreist die Vordertür, und da er mit dem Dietrich sehr geschickt war, schien es für einen harmlosen Betrachter so, als hätte er einen Schlüssel. Niemandem wäre es aufgefallen, dass Jenkins dort nicht hingehörte.
Wenig später betrat er die große Eingangshalle. Das Haus schien peinlich sauber aufgeräumt, doch ein seltsam muffiger Geruch lag in der Luft. Jenkins ging ins oberste Stockwerk, und begann von dort aus rasch und gründlich sämtliche Räume zu durchsuchen. Aber es gab nicht einmal Hinweise darauf, dass vor kurzem jemand hier gewesen war. Alles war ordentlich und sauber. Aber im Grunde hatte er es nicht anders erwartet. In diesem Stockwerk gab es ohnehin keine Geheimtüren oder versteckten Gänge. Jenkins kannte das Haus gut, er hatte seinerzeit für seinen Freund einige Zeit die Vertretung übernommen.
Schließlich kam er hinunter in den ersten Stock. Die drei verborgenen Schränke schienen nicht entdeckt worden zu sein, jedenfalls gab es darauf keine Hinweise oder Spuren. Doch in einem der Zimmer lag halb verborgen vom Vorhang ein Fetzen Papier. Eine sinnlose Aneinanderreihung von Buchstaben war darauf geschrieben, und Jenkins steckte den Zettel erst einmal ein, er würde sich später damit befassen.
Sein Blick blieb plötzlich an etwas hängen, ohne bewusst wahrzunehmen, um was es sich handelte. Er drehte sich um und schaute aufmerksam auf den Boden. Wirklich, da lag ein kleiner Kerzenstummel. Jemand musste ihn beim Aufräumen übersehen haben. Der Butler hob ihn auf und steckte ihn sorgfältig ein. Er würde bald wissen, was dem Kerzenwachs beigemischt worden war. Wenn es sich denn überhaupt um die Kerze handelte, der sein Dienstherr ausgesetzt gewesen war und die ihn, vermutlich auch Helen Jefferson, soweit gebracht hatte, dass sie nicht mehr Herr ihrer Sinne waren.
Jenkins kontrollierte erfolglos auch das Erdgeschoss und ging dann in den Keller hinunter, das heißt, er wollte es. Doch da gab es plötzlich eine schwere Stahltür, die ihm den Weg versperrte. Und hier versagte auch sein Dietrich, die Ausrüstung reichte nicht aus. Nun gut, er hatte Geduld. Er würde zunächst gehen, die Fundstücke untersuchen lassen, und dann mit dem passenden Werkzeug zurückkehren. Denn hinter dieser Tür musste etwas sein, das nicht für jedermanns Augen zugänglich sein sollte, das also seine Aufmerksamkeit fesseln würde, dessen war er sicher.
13
Helen erwachte einmal mehr aus einem totenähnlichen Schlaf. Doch diesmal war sie fest entschlossen, sich nicht wieder in das angenehme Dunkel hinabsinken zu lassen. Noch war sie sich dessen nicht voll bewusst, aber irgendetwas stimmte hier nicht, das fühlte sie. Und so zwang sie sich selbst dazu, wach zu bleiben und sich auf ihre Umgebung zu konzentrieren. Außerdem hatte sie quälenden Durst. Wenn sie sich doch nur aufraffen könnte, um aufzustehen.
Aber da war diese Wand zu ihrer rechten. Wie kam die dahin?
Mühsam stand sie auf, zumindest versuchte sie es. Doch ein Schwindelgefühl erfasste sie, das sie zur Übelkeit trieb, sobald sie den Kopf hob. Sie ballte die Hände zu Fäusten, dass sich die Fingernägel ins Fleisch bohrten. Der Schmerz brachte sie für kurze Zeit zur Besinnung. Nun setzte sie sich auf und spürte unter ihren nackten Füßen kalten Steinfußboden.
Nackte Füße? Steinfußboden?
Entsetzt stellte sie fest, dass sie nur Unterwäsche trug, allerdings ein langes T-Shirt darüber. Wer hatte sie umgezogen? Und wo war sie hier nur?
Erinnerungsfetzen blitzten durch ihr Gedächtnis: Der merkwürdige Geruch von Kerzen, ein blaues Leuchten - und was suchte Brody in all diesen Erinnerungen?
„Verflixt!“, schimpfte sie leise, wobei ihre Stimme ihr selbst fremd vorkam. „Wenn es hier doch wenigstens Licht gäbe.“
Eine Tür öffnete sich, greller Lichtschein flutete herein, und Helen schloss geblendet die Augen.
„Wie schön, dass Sie wach sind“, sagte eine weiche, fast vertraute Stimme. Helen kannte diesen Klang. Sie fühlte, wie sich ihre Nackenhärchen aufstellten, während sie den Worten lauschte. Kyle O’Bannon, dieser Name entstand in ihrem Gehirn. Plötzlich wusste sie auch wieder, woher sie ihn kannte und was am Abend geschehen war. Unklar blieb jedoch, wie sie hierhergekommen war.
„Was ist passiert?“, fragte sie dann mühsam. „Was mache ich hier?“
„Wissen Sie das wirklich nicht mehr?“, fragte der Mann sanft.
Helen schüttelte den Kopf, was sie gleich darauf bereute.
„Sie hatten sich in den Hexenkünsten versucht“, erwiderte er zufrieden. „Und glauben Sie mir, meine Liebe, Sie sind die stärkste Hexe, die ich je kennengelernt habe.“
14
Seit ungefähr zehn Minuten lief Sir Thomas durchs Haus und suchte seinen Butler. Es war noch nie vorgekommen, dass Jenkins nicht augenblicklich zur Stelle war, wenn Harding einen Wunsch hatte. Nun gut, er hatte ihm freigegeben - Sir Thomas hielt inne. Klar, Jenkins hatte frei. Ungewöhnlich genug, doch Jenkins nutzte vielleicht die Gelegenheit, um für sich persönlich etwas zu erledigen. Obwohl Harding beim besten Willen nicht glauben konnte, dass sein Butler überhaupt ein Privatleben hatte. Dieser Vorfall zeigte dem Wissenschaftler jedoch, dass er noch längst nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte war. Immerhin hatte er im Auto noch gewusst, dass Jenkins aus war. Und jetzt war es ihm einfach wieder entfallen.
Jetzt aber ging er kurzerhand in die Küche, er hatte plötzlich Hunger bekommen. Dann stand er vor dem offenen Kühlschrank und starrte hinein. Der Kühlschrank war gut gefüllt, doch der Professor wusste nicht so recht, was er mit all den vielen Zutaten anfangen sollte. Etwas wahllos türmte er Käse, Schinken, Wurst, Butter, ein paar Gurken und Brot auf den Tisch und begann alles Mögliche auf dem Brot übereinanderzulegen. Als er damit fertig war, betrachtete er sein Kunstwerk. Nun, der Hunger war ihm erst einmal wieder vergangen.
In diesem Moment öffnete sich die Tür, und Jenkins kam herein. Er ließ sich keine Überraschung darüber anmerken, dass sein Chef hier in der Küche damit beschäftigt war, Stillleben zu erschaffen.
„Kann ich Ihnen helfen, Sir?“, fragte er stattdessen ruhig.
Sir Thomas deutet etwas fahrig auf sein überdimensionales Sandwich.
„Sagen Sie mir, was ich damit machen soll.“
„Essen, Sir?“
„Nein, ich glaube nicht“, erwiderte Harding plötzlich voller Abscheu.
„Wenn Sie Appetit haben, werde ich Ihnen gern eine Kleinigkeit zurechtmachen. Möchten Sie vielleicht wieder in die Bibliothek zurückkehren?“ Das klang wie ein sanfter Rauswurf.
Sir Thomas stand auf, während Jenkins damit begann, die ganzen Utensilien wieder in den Kühlschrank zurück zu packen.
„Wo sind Sie gewesen?“, fragte Harding plötzlich.
Jenkins hielt nicht einmal inne. „Ich hatte etwas zu erledigen, Sir. Verzeihen Sie, aber das steht mir an Privatleben zu.“
„Ich hatte nicht vor, in Ihrem Privatleben herumzuwühlen, aber in diesem Fall glaube ich Ihnen nicht. Ich kann mich dunkel erinnern, dass Sie mit dem Butler des Earls of Graveston befreundet waren. Und nun wünsche ich eine klare Antwort. Waren Sie in seinem Haus?“
Jenkins schwieg einen Augenblick, dann nickte er. „Ja, Sir. Ich habe nach Mrs. Jefferson gesucht. Sie ist eine reizende Frau, und ich mache mir Sorgen um sie.“
„Damit stehen Sie nicht allein. Und was haben Sie gefunden?“
„Sir, ein Großteil der Geheimgänge ist nicht benutzt worden. Doch der Kellerzugang wurde mit einer Stahltür gesichert, die ich mit den herkömmlichen Methoden nicht öffnen konnte.“
„Herkömmliche Methoden?“, ächzte Sir Thomas. „Sie hören sich an wie ein professioneller Einbrecher.“
„Aber Sir, Sie wissen doch, ein guter Butler kann alles.“
„Auch einbrechen?“
„Wenn es denn sein muss.“
Sir Thomas setzte sich wieder. Mit dieser Antwort hatte er nicht gerechnet, obwohl er dachte, er würde seinen Butler gut kennen.
Jenkins hatte nun das Chaos auf dem Küchentisch beseitigt und schaute seinen Dienstherrn fragend an.
„Sir Thomas, wenn ich bitten darf...“
„Was denn, wollen Sie mich aus meiner Küche werfen?“
„Sir, wenn der Butler im Hause ist, ist es seine Küche.“
Harding gab auf, dieser Logik hatte er nichts entgegenzusetzen, schon gar nicht in seinem jetzigen Zustand. Er gab nach.
„Gut, bringen Sie mir ganz einfach - einen heißen Tee“, bat er. „Und dann erzählen Sie mir genau, was Sie herausgefunden haben, oder auch nicht.“
Sir Thomas lief in der Bibliothek auf und ab, während er immer wieder Blicke zum Schachspiel hinüberwarf. Schließlich kam Jenkins mit dem Tee. Er begann minutiös zu berichten, was er gesehen und gefunden hatte, aber Harding unterbrach ihn.
„Um Himmels, Mann, setzten Sie sich. Im Augenblick machen Sie mich nervös, wenn Sie da herumstehen.“
Jenkins zog indigniert die Augenbrauen hoch, gab aber dann keinen Kommentar zu dieser Zumutung ab, sondern setzte sich auf eine Stuhlkante. Sir Thomas nahm das kopfschüttelnd zur Kenntnis, aber er hörte aufmerksam zu. Dann begann er einen Plan zu schmieden und legte ihn seinem Butler dar. Dieser war noch nicht ganz überzeugt, doch schließlich schloss er sich den Ausführungen Hardings an.
15
Helen saß in ihrer winzigen Zelle, denn eine Zelle war es, da machte sie sich nichts vor, und dachte nach. Sie versuchte die verlorene Zeit im Gedächtnis zu rekonstruieren, aber es klappte einfach nicht. Sie schien an einem massiven Gedächtnisschwund zu leiden, und je mehr sie nachdachte, umso stärker wurden die einsetzenden Kopfschmerzen.
Es hatte doch alles keinen Zweck, stellte sie irgendwann fest. Aber ausgerechnet Hexenkünste? Sie? Niemals hätte sie sich dafür hergegeben, das wusste sie genau. Im Grunde hatte sie eine Abneigung gegen alles Okkulte und Parapsychische. Und Hexerei fiel nach ihrem Verständnis auf jeden Fall darunter.
Außerdem, wie lange war sie wohl schon hier? Hatte sie denn noch niemand vermisst? Niemand in der Redaktion, der neugierige Fragen stellte? Und auch Sir Thomas nicht, dem zuliebe sie doch hergekommen war? Wo war Sir Thomas?
Lautlos öffnete sich die Tür, und Dalrina schlüpfte herein. Sie legte warnend einen Zeigefinger an die Lippen und kam dicht an Helen heran. Dann flüsterte sie ihr ins Ohr.
„Wollen Sie weg von hier? Soll ich Ihnen helfen, hier herauszukommen?“
Helen nickte, kaum überrascht. „Sie werden sich selbst Schwierigkeiten machen“, gab sie ebenso leise zurück.
„Das kann schon sein. Aber ich bin dafür, dass jeder über sich selbst bestimmt, ob er nun hext oder nicht.“
„Ich bin also nicht freiwillig hier?“, gab Helen zurück.
„Darüber sollten Sie selbst urteilen. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen, ich melde mich, wenn es soweit ist.“
Dalrina schlüpfte wieder hinaus, genauso lautlos, wie sie gekommen war, und Helen hatte plötzlich noch mehr zum nachdenken. Schließlich aber kam ihr eine Idee. Wenn sie eine solche Begabung hatte, wie O’Bannon, aber auch Sir Thomas, behaupteten, musste es doch eine Möglichkeit geben, geistig um Hilfe zu rufen.
Helen hatte nicht die geringste Ahnung, wie sie das anstellen sollte, zumal sie nicht einmal ernsthaft daran glaubte. Doch einen Versuch war es immerhin wert. Sie setzte sich aufrecht auf das Bett und begann sich zu konzentrieren. Sie rief geistig immer wieder um Hilfe, in der Hoffnung, dass irgendjemand diesen Ruf empfangen möge. Innerlich schalt sie selbst eine Verrückte, aber das war nun mal das einzige, was sie im Augenblick tun konnte. Und außerdem war es besser als herumzusitzen und zu grübeln. Das angestrengte Nachdenken brachte schließlich auch kein Ergebnis.
Irgendwann ging die Tür auf, und O’Bannon kam herein. Er lächelte, als er sie da sitzen sah.
„Ich sehe, Sie üben, meine Liebe. Das ist gut.“
Helen brach ihre Konzentration abrupt ab.
„Ich will hier raus!“, sagte sie klar und deutlich.
„Aber natürlich wollen Sie das, meine Liebe. Und es wird auch gar nicht mehr lange dauern. Ich freue mich zu sehen, dass Sie endlich auf dem richtigen Weg sind. Bald ist die große Versammlung, bei der sie offiziell in unsere Gilde aufgenommen werden. Und danach können Sie gehen, wohin Sie wollen.“
„Sofern es Ihren Zielen entspricht“, warf Helen treffend sarkastisch ein.
Er lächelte fein. „Haben Sie etwas anderes erwartet?“
16
Ein scheinbar uraltes Buch lag aufgeschlagen auf einem Tisch, die Blätter bestanden aus Pergament und waren mit seltsamen Schriftzeichen bedeckt, der Einband war aus Leder mit Silberbeschlägen, und davor saß Moira, die Gildenmeisterin und starrte angestrengt auf die unverständlichen Schriftzeichen.
„Allein schaffe ich es einfach nicht“, sagte sie zu O’Bannon, als dieser hereinkam. „Ich brauche unbedingt die Frau, die den Kontakt zur anderen Welt aufbaut, um dies hier zu verstehen. Wie gut, dass du frühzeitig ihre Gabe erkannt hast.“
„Es wird nicht mehr lange dauern“, erwiderte O’Bannon beruhigend. „Ich bin sicher, dass sich Mrs. Jefferson voll und ganz auf unsere Seite stellen wird. Freiwillig oder nicht.“
„Und dann werden wir endlich die letzten großen Geheimnisse erfahren und endlich die Macht ausüben können, die uns zusteht“, rief Moira begeistert. „Was meinst du, wie lange wird es noch dauern, bis sie soweit ist?“
„Ich denke, wenn wir sie noch ein oder zwei Tage schmoren lassen, werden wir es relativ einfach haben. Wir müssen ihren Widerstand brechen, und dann wird sie uns helfen, ob sie will oder nicht.“
„Und dann endlich werden wir die letzten Geheimnisse dieses Buches ergründen können.“ Moiras Stimme klang sehnsüchtig, aber auch machtbesessen, sie war bereit, jeden Widerstand zu brechen, um an ihr Ziel zu kommen. Und O’Bannon unterstützte sie augenscheinlich vorbehaltlos.
„Ja, meine Liebe, dann haben wir es endlich geschafft“, stellte er befriedigt fest. „Wir sollten schon einmal die Aufnahmezeremonie vorbereiten. Wir werden ein bisschen nachhelfen, damit Helen in den entsprechenden Zustand gerät. Sie wird mit Freuden das Tor zur anderen Welt öffnen.“
„Ja, so machen wir es“, sagte Moira mit leuchtenden Augen.
Keiner von beiden hatte bemerkt, dass ihr Gespräch belauscht worden war. Dalrina saß in einer versteckten Nische und hörte entsetzt zu. Die Hexe Ersten Grades war von Abscheu erfüllt. Auch sie hätte gern die Macht besessen, nach der die beiden strebten, doch sie würde sie auf ehrliche Weise haben wollen. Niemals würde sie mit Zwang einen anderen beherrschen wollen, um Schwarze Magie auszuüben.
Deshalb stand es für sie jetzt fest, dass sie Helen schnellstens helfen musste, sonst war die Reporterin verloren. Sie musste sie einfach befreien.
Lautlos zog sich Dalrina zurück, noch immer unbemerkt von den beiden anderen.
17
In dem normalen Krankenzimmer, in das man ihn endlich gebracht hatte, lag Raymond Brody allein und starrte aus dem Fenster. Er dachte nach. Er versuchte, die letzten bewussten Augenblicke zu rekonstruieren, bevor ihn dieser furchtbare Schmerz zu Boden geworfen hatte. War es wirklich Helens Gesicht gewesen, das er da gesehen hatte? Das ihn triumphierend angelächelt hatte? Oder spielte ihm sein Unterbewusstsein einen Streich? Warum auch sollte ausgerechnet Helen in seinen Gedanken erscheinen? Natürlich, er dachte viel an die Frau, die ihn so gnadenlos abblitzen ließ, wenn er auf seine Art versuchte freundlich zu sein. Aber ausgerechnet in dem Augenblick, da ihn ein fast tödlicher Anfall dahinraffte, erschien ihr Gesicht? Das war mehr als merkwürdig.
Doch alles herumgrübeln würde ihm jetzt nicht weiterhelfen. Also griff er zum Telefon, das man ihm auf sein unerbittliches Drängen hin gebracht hatte, und rief in der Redaktion an. Brody war mit Leib und Seele Journalist, er konnte nicht anders. Und wenig später hatte er Dennis am Apparat.
„Ich will die neuen Schlagzeilen, und dann will ich Jefferson sprechen“, befahl er barsch, noch bevor Dennis etwas sagen oder erklären konnte. Brody dachte mit Grausen an die neue Ausgabe. Wahrscheinlich würde es eine Ausgabe für den Kindergarten werden, wenn er nicht da war, um ordentliche Schlagzeilen aufzusetzen. Aber das konnte er jetzt nur in begrenztem Rahmen ändern.
Dann bemerkte er, dass Dennis herumdruckste, statt ihm rasch zu antworten, beziehungsweise Helen an den Apparat zu holen. Sollte es wirklich stimmen, was Harding erzählt hatte? Das konnte doch nicht wahr sein. Helen musste längst zurück sein.
„Wo ist Jefferson?“, fragte er grollend, die Stimme bereits erhoben.
„Sie ist verschwunden, schon seit Tagen. Die Polizei sucht sie, und Sir Thomas...“
„Zur Hölle mit Sir Thomas. Er hat sie doch erst in diese Sache hineingeritten“, schimpfte Brody. „Er war hier und deutete so etwas an, aber ich wollte es einfach nicht glauben.“ Seine Stimme wurde eher noch lauter. „Also, was wissen Sie über das Verschwinden von Helen?“
„Gar nichts“, antwortete Dennis betrübt. „Sie ist einfach nicht mehr aufgetaucht, seit sie mit dem Professor unterwegs war.“
„Und was sagt die Polizei? Und wen haben Sie auf die Story angesetzt? Das ist schließlich eine Sensation: Reporterin verschwindet bei Hexenkongress! Zaubersprüche in London! Sind Sie denn ganz und gar wahnsinnig? Das müssen wir aufgreifen, ob es uns nun selbst betrifft oder nicht, das können wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Und es ist mir egal, ob die Polizei etwas dagegen hat.“
„Die Polizei hat bisher keine Anhaltspunkte“, warf Dennis leise ein.
„Das ist ja wohl nicht wahr. Und Sie stehen da und warten auf Ergebnisse, was? Alles muss man selbst machen. Ich komme!“
Sein Gesicht war rot angelaufen, und sein Herz schlug schmerzhaft, was er aber ignorierte. In diesem Augenblick betrat eine Krankenschwester das Zimmer, sah seinen besorgniserregenden Zustand, nahm ihm den Hörer aus der Hand und knallte ihn auf die Gabel.
„Hat Ihnen niemand gesagt, dass Sie sich nicht aufregen dürfen?“, schnauzte sie ihren Patienten an.
„Ich will mich aber aufregen, meine beste Reporterin ist verschwunden, und ich soll hier liegen und mich bemuttern lassen?“
Seine Gesichtsfarbe wurde um noch einen Ton dunkler, und sein Herz begann gefährlich zu rasen. Die Krankenschwester drückte den Notfallknopf, damit schnellstens ein Arzt auftauchte. Währenddessen versuchte Brody jedoch aufzustehen.
„Nun bleiben Sie ruhig liegen“, versuchte die Schwester seine Erregung zu dämpfen. „Gleich ist der Doktor hier, und dann wird alles wieder gut.“
„Ich brauche keinen verdammten Arzt, ich will in meine Redaktion und dann mit der Polizei sprechen“, brüllte Brody.
„In Ihrem Zustand werden Sie mit niemandem sprechen“, stellte die Schwester mühsam ihre Unruhe überdeckend fest.
Schließlich sah Brody das ein, weil er vor Erregung kaum noch Luft bekam und sein Herz wie ein Dampfhammer schlug. Er zwang sich zur Ruhe. Wenn er wieder auf die Intensivstation verlegt wurde, dann würde er gar nichts mehr erreichen können. Aber er musste, er wollte etwas tun. So dachte er zumindest.
18
Eigentlich hatte Sir Thomas vorgehabt sofort mit dem Wagen loszufahren, um einen Anhaltspunkt auf Helen zu finden. Doch Jenkins war der Ansicht gewesen, dass sein Chef auch mal Ruhe brauchte. Und so hatte er mit Engelszungen auf ihn eingeredet. Außerdem hatte er den servierten Tee mit einem leichten Schlafmittel versetzt, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Das hatte Sir Thomas natürlich nicht gleich gemerkt. Doch er wurde plötzlich sehr, sehr müde, und so gab er dem Drängen seines Butlers nach.
Ein paar Stunden später erwachte er und fühlte sich frischer, wenn auch nicht völlig ausgeruht. Ein Blick zur Uhr belehrte ihn, dass es wenige Minuten nach Mitternacht war.
Wie auf ein unhörbares Signal hin kam Jenkins herein. Er lächelte fein, das heißt, es war nicht mehr als die Andeutung eines Lächelns, schließlich war er Butler. Jedwede offene Gefühlsregung hätte gegen seinen Status verstoßen.
„Sie sind ein ganz durchtriebener Kerl“, beschwerte sich Sir Thomas, dem aufging, was sein Butler getan hatte.
„Ja, Sir, wie Sie meinen.“
„Sie haben mir etwas in den Tee getan.“
„Es tut mir leid, Sir, aber ich hielt es für erforderlich.“
„Ich hoffe, Sie haben jetzt wenigstens die Zeit genutzt, um Vorbereitungen zu treffen“, grollte Harding.
„Selbstverständlich, Sir.“
„Können wir dann endlich loslegen?“, knurrte der Professor noch etwas ungehalten.
„Ganz wie Sie wünschen.“
Sir Thomas nahm den großen Bentley. Der Wagen war zwar schwer, aber dennoch schnell und wendig. Außerdem bot er einen gewissen Komfort. Harding war überzeugt davon, dass er Helen finden würde, aber niemand konnte vorhersagen, in welchem Zustand sie sich befand. Und es wäre sicher angenehmer für sie, in einem bequemen Wagen zu fahren, vielleicht würde sie den gewissen Luxus brauchen. Falls man sie überhaupt fand. Aber diese Gedanken verbot sich der Professor. Er wollte sie einfach finden.
Durch die nächtlichen Straßen ging die Fahrt zu ihrem Ziel recht schnell voran, und wenig später kamen Harding und sein Butler vor dem Haus an, in dem Helen zuletzt gesehen worden war. Harding sah zu, wie sein Butler fachmännisch die Haustür öffnete. Drinnen machte er dann kein Licht, sondern suchte mit einer Taschenlampe seinen Weg. Sir Thomas hatte ebenfalls eine Taschenlampe und folgte seinem Butler auf dem Fuße. Der stand schließlich vor der Stahltür, die ihm bei seinem ersten Besuch Widerstand geboten hatte.
Jenkins nahm ein Etui aus der Tasche, darin befand sich ein regelrechtes Einbrecherbesteck.
„Ich sollte wohl besser nicht fragen, wo Sie das herhaben“, bemerkte Sir Thomas seufzend.
„Ich denke, Sir, darauf müsste ich Ihnen auch die Antwort schuldig bleiben“, bemerkte Jenkins gemessen.
Es dauerte nicht lange, bis die Tür unter des Butlers beharrlichem Zutun aufgab und sich öffnete.
„Als diese Häuserzeile gebaut wurde, hatte man aus unerfindlichen Gründen Verbindungsgänge zu fast allen anderen Häusern angelegt“, erklärte Jenkins. „Ich weiß allerdings nicht, inwieweit die Gänge heute noch vorhanden und intakt sind, jedenfalls gab es ein regelrechtes Labyrinth unterhalb der Gebäude. Es kann unter Umständen sein, dass wir lange suchen müssen.“
„Das ist mir ziemlich egal“, erklärte Sir Thomas wegwerfend. „Ich will Helen wiederfinden. Hier oder anderswo.“
„Ja, Sir. Das ist auch mein Bestreben.“
Jenkins ging voran in die unbekannte Dunkelheit.
Der scharfgebündelte Lichtstrahl seiner Taschenlampe beleuchtete nur wenig von den Wänden rechts und links, doch Sir Thomas bemerkte trotzdem, dass die Wände sauber verputzt worden waren, und das vor nicht allzu langer Zeit. Es musste also jemanden geben, der diesen Gang regelmäßig benutzte. Er fragte sich für einen kurzen Augenblick, wie man Geheimgänge renovierte, ohne dass in den Häusern oben jemand etwas bemerkte. Aber dann schob er diese Frage beiseite, sie war im Augenblick nicht relevant.
Die beiden Männer kamen an einigen Türen vorbei, die jedoch alle verschlossen waren. Irgendwo und irgendwann gabelte sich der Gang, und sie überlegten kurz, welche Richtung sie nun einschlagen sollten, wobei Sir Thomas sich mehr auf den Instinkt seines Butlers verließ als auf seine Ahnungen. Plötzlich hörten sie ein Geräusch.
Rasch drückten sie sich eng in eine Nische hinein. Jemand ging den Gang entlang, den Schritten nach ein Mann. Das Geräusch der Schritte verklang gleich darauf, als sich eine Tür öffnete und wieder schloss.
„Sollen wir ihm folgen?“, raunte Jenkins.
„Nein, ich glaube nicht. Probieren wir es erst woanders, ich will noch keine Konfrontation. Nicht, bevor ich etwas über Helen weiß.“
Die beiden Männer hielten sich links, und die nächste Tür war unverschlossen, wie sie zu ihrer Überraschung feststellten.
In dem Raum brannte Licht, und was die Männer sahen, gefiel ihnen eigentlich gar nicht.
19
Helen hatte ein Tablett vor sich stehen, auf dem eine köstliche Mahlzeit verlockend duftete, sowie auch einen großen Krug mit Wasser. Ihr Magen knurrte erbärmlich, und ihr Mund war fast ausgetrocknet. Trotzdem hatte sie Angst, etwas von den Speisen oder dem Wasser anzurühren. Mittlerweile war sie sich sicher, dass sich ihr Gedächtnisschwund auf eine Droge zurückführen ließ, die man ihr unbemerkt verabreicht haben musste. Und der Himmel mochte wissen, ob sich nicht weitere Drogen in dem Essen vor ihr befanden.
Es war unglaublich schwer zu widerstehen, stellte sie widerwillig fest. Ihr Magen knurrte vernehmlich, und ihre Augen wurden wie magisch von dem frischen köstlichen Wasser angezogen. Aber noch beherrschte sie sich. Doch der Drang wurde mehr und mehr übermächtig.
Zögernd griff sie nach dem Wasserkrug und goss ein Glas voll. Mit zitternden Fingern führte sie es an die Lippen und begann zu trinken.