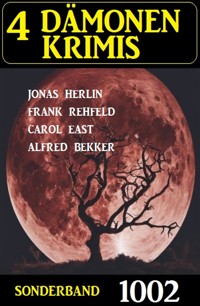Jetzt hatte der Hai mich gesehen. Er stieß zu mir herab, riß
das Maul auf und wollte zuschnappen.
Aber in diesem Augenblick hatte ich das Messer endlich in der
Hand. Ich stieß mich vom Untergrund ab und schnellte zur Seite weg.
Das Maul des Hais verfehlte mich nur um Haaresbreite.
Ich wollte mit dem Messer nachsetzen. Aber die Schwanzflosse
erwischte mich und wirbelte mich durchs Wasser. Für einen
Augenblick wußte ich nicht mehr, wo oben und unten war. Das Messer
hatte ich bei dem Schlag verloren. Ich ruderte verzweifelt mit den
Armen, um mich wieder in eine stabile Lage zu bringen. Rasch
orientierte ich mich. Aber viel Zeit blieb mir nicht, denn der Hai
setzte zum nächsten Angriff an. Plötzlich war er vor mir. Ein
weißgraues Ungetüm, das sein schreckliches Maul zum todbringenden
Biß aufgesperrt hatte. Panisch ruderte ich mit den Beinen. Aber es
hatte keinen Sinn. Mit meinen unkontrollierten Bewegungen stachelte
ich den Hai nur noch mehr an. Das Maul schoß auf mich zu. In
Erwartung des schmerzhaften und tödlichen Bisses schloß ich die
Augen…
Ich lag auf dem Deck unserer kleinen Segeljacht und genoß die
Sonne. Nur mit einem Bikini bekleidet, spürte ich, wie die
wohltuende Wärme der Maisonne meinen Körper durchdrang.
Das leise Plätschern der Wellen, die gegen den Rumpf der Jacht
schlugen, hatten zusätzlich eine beruhigende Wirkung auf mich. Und
das sanfte Schaukeln machte die Entspannung erst perfekt. Selten in
meinem Leben hatte ich mich so wohl gefühlt wie in den letzten
Wochen. Und das lag nicht nur allein daran, daß ich seit drei
Wochen auf einer kleinen und gemütlichen Segeljacht die spanische
und französische Mittelmeerküste bereiste. Der wahre Grund meines
Glücks saß in diesem Moment auf dem Dach des Kajütenaufbaus unter
einem Sonnensegel und hieß Erik Henderson. Auf seinen Knien lag ein
Stapel weißes Papier, das momentan seine ungeteilte Aufmerksamkeit
genoß. Mit einem Bleistift machte er dann und wann Eintragungen
oder strich etwas durch. Jetzt griff er nach einem Glas und nippte
von dem Orangensaft, den er immer während seiner Arbeit
trank.
Erik schrieb an einem neuen Drehbuch für seinen zweiten Film.
Sein erster Film sollte in einer Woche bei den Filmfestspielen in
Cannes vorgeführt werden. Erik erhoffte sich, daß sein Werk dadurch
internationale Anerkennung fand.
Für schwedische Filmemacher war dies nicht immer ganz einfach.
Aber Erik war mit Herz und Seele in seine Arbeit verliebt. Was für
mich allerdings kein Grund zur Eifersucht war. Denn noch mehr als
seine Arbeit liebte er mich.
Vor drei Wochen hatten Erik und ich in Stockholm geheiratet.
Gleich am darauffolgenden Tag setzten wir uns in ein Flugzeug und
flogen bis nach Valencia. In der spanischen Hafenstadt wartete eine
kleine Segeljacht auf uns – ein Hochzeitsgeschenk von Eriks Vater.
Sie trug den Namen KATTEGAT, so wie auch das kleine Binnenmeer
zwischen
Jütland und Schweden genannt wurde. Es war ein schönes kleines
Boot. Nicht zu vergleichen mit den aufgemotzten Jachten, die die
meiste Zeit über in irgendwelchen Häfen lagen und von den Besitzern
außer zu Vorzeigezwecken wenig genutzt wurden.
Die KATTEGAT war ein unscheinbares Boot. Der hellblaue
Anstrich ließ es auf dem schimmernden Wasser kaum auffallen
– was wiederum für meine Arbeit sehr von Bedeutung war. Ich
studierte Meeresbiologie. Und ähnlich wie Erik, so wollte auch ich
unsere Hochzeitsreise mit meinen beruflichen Interessen verbinden.
Und ein Boot, das die Meeresbewohner allein durch seine schreienden
Farben verscheuchte, war für mich von geringem Nutzen.
Die KATTEGAT verfügte über einen Mast und eine kleine, aber
gemütliche Kajüte, in der Erik und ich bereits sehr romantische
Nächte verlebt hatten. Vielleicht mußte Erik in diesem Moment auch
an diese Nächte denken, denn plötzlich sah er von seinem Manuskript
auf und schaute mich verliebt an.
»Du scheinst nicht recht zum Arbeiten aufgelegt zu sein«,
bemerkte er schmunzelnd.
»Die Meeresbewohner werden noch einen Tag auf meine
Anwesenheit verzichten müssen«, erwiderte ich und erhob mich
langsam.
»Ich möchte kein Fisch sein«, sagte Erik. »Denn ich könnte
keinen Tag auf deine Anwesenheit verzichten.« Er musterte mich
fröhlich mit seinen wachen, aufmerksamen Augen. Sie strahlten in
einem Blau, das selbst dem wolkenlosen Himmel Konkurrenz machen
konnte.
Ich trat auf Erik zu und legte ihm lächelnd die Hand um den
Nacken. »Einen Fisch hätte ich auch nicht geheiratet«, erwiderte
ich und näherte mich ganz langsam seinen Lippen.
»Ein rein wissenschaftliches Interesse hätte nur einen
dürftigen Grund für eine Hochzeit abgegeben«, fügte ich
hinzu.
Erik entzog sich mir in gespielter Zurückhaltung. Aber ich
ließ ihn nicht los. »Aus welchem Grund hast du mich sonst
geheiratet?« fragte er mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Aus reinem Selbsterhaltungstrieb«, sagte ich. Und flüsternd
fuhr ich fort: »Auch ich kann keinen Tag auf deine Anwesenheit
verzichten. Denn ich liebe dich. Und ohne dich wäre ich bloß ein
Fisch ohne Wasser.«
Erik zog mich zu sich und gab mir einen leidenschaftlichen
Kuß…
Eine Stunde später stand ich mit einem Fernglas an der Reling
und betrachtete das Meer und die Küste. Erik hatte sich unterdessen
in die Kajüte zurückgezogen und bereitete dort eine kleine Mahlzeit
für uns zu.
Schon gestern hatten wir zwanzig Kilometer östlich von Toulon
die Segel eingeholt und Anker geworfen. Dieser Küstenabschnitt der
Côte d’Azur war für eine Meeresbiologin von besonderem Interesse.
Der Küste vorgelagert befanden sich drei Inseln. Die mittlere und
kleinste von ihnen hieß Ile de Port Cros und war schon vor langer
Zeit zum Naturschutzgebiet erklärt worden. Ihr galt mein spezielles
Interesse. Denn der Status des Naturschutzgebietes beschränkte sich
nicht nur auf die Insel, sondern wurde auch auf eine Zone von
sechshundert Metern um die Insel herum ausgedehnt. Aufgrund dieser
Besonderheit hatten sich viele seltene Fischarten bei der Insel
angesiedelt. Auf der Insel selbst war Tourismus nur zu bestimmten
Tageszeiten zugelassen. Die etwa zwanzig ständigen Bewohner der
Insel mußten strenge Auflagen erfüllen. Ich hatte hier also
Gelegenheit, Meerestiere zu beobachten, die anderswo schon
lange ausgestorben waren – für eine junge Meeresbiologin fast
eine kleine Sensation.
Aber heute wollte ich mich erst darauf beschränken, das Gebiet
mit dem Fernglas zu beobachten. Zwar hatte ich von der
französischen Regierung eine Erlaubnis bekommen, in dem
Naturschutzgebiet zu tauchen, aber zuvor wollte ich mir von der
allgemeinen Lage ein Bild machen.
Ich wurde in meinen Bemühungen auch bald belohnt. Denn
plötzlich bemerkte ich, wie sich die Wasseroberfläche an einer
Stelle sonderbar kräuselte. Ich wußte natürlich, was dieses
Phänomen zu bedeuten hatte. Trotzdem schlug mein Herz schneller,
als ich den Schwarm fliegender Fische sah, der plötzlich aus dem
Wasser brach und über die seichten Wellen dahinglitt.
Ich stellte das Fernglas schärfer und verfolgte den
glitzernden Fischschwarm eine Weile. Ganz deutlich konnte ich
erkennen, wie die Fische ihre zu Flügeln ausgewachsenen
Brustflossen ausgebreitet hatten und mit der Schwanzflosse das
Wasser peitschten und sich so einige Sekunden über Wasser halten
konnten. Fliegende Fische gehörten zwar nicht zu den seltenen
Fischarten, aber da sie sehr scheu waren, bekam man sie nicht oft
zu sehen.
Dann sanken die Fische plötzlich ins Wasser zurück und waren
verschwunden. Ein Küstenabschnitt der Insel Port Cros erschien
plötzlich in meinem Fernglas. Die fliegenden Fische waren der
kleinen Insel so nahe gekommen, daß ich die steinige Küste
plötzlich im Visier hatte. Oben auf der Klippe befand sich eine
weiße Villa. Eins jener Häuser, die die wenigen Bewohner der Insel
beherbergten.
Bei dieser Villa mußte es sich jedoch um das Haus eines sehr
reichen Mannes handeln. Es war im mauretanischen Stil erbaut worden
und verfügte über mehrere terrassenförmig angelegte Stockwerke.
Dachgärten mit üppiger Vegetation fügten sich in
das Bild ebenso ein wie die großen Panoramafenster, die zum
Meer hinauswiesen.
Ich war von diesem märchenhaften Anblick so fasziniert, daß
ich mit dem Fernglas eine Weile auf dem prunkvollen Bauwerk
verweilte. Ich entdeckte sogar einen Park, der sich an das Haus
anschloß und wo langbeinige Flamingos eine Rast eingelegt
hatten.
Ich überlegte, wie schön es wäre, wenn dieses Modell von
Naturschutz, wo Mensch und Natur so harmonisch nebeneinander
existieren konnten, Schule machen würde.
Doch in diesem Augenblick bemerkte ich eine Bewegung hinter
einem der Fenster. Da bei diesem Fenster die Vorhänge
beiseitegezogen waren, konnte ich die beiden Gestalten in dem Haus
deutlich erkennen. Ich wollte das Fernglas schon in eine andere
Richtung lenken, da ich nicht vorhatte, ungefragt in die
Intimsphäre anderer Menschen einzudringen. Doch plötzlich stutzte
ich. Die beiden Gestalten schienen miteinander zu ringen.
Erschrocken drehte ich an der Einstellung des Fernglases und
konnte die Personen schließlich genauer erkennen. Es handelte sich
um einen Mann und eine Frau. Der Mann hatte seine Hände um den Hals
der Frau gelegt. Die Frau jedoch trommelte mit ihren Fäusten gegen
die Brust des Mannes, ohne dabei etwas auszurichten. Schließlich
wurde ihr Widerstand schwächer. Die Arme sanken erschlafft herunter
und baumelten an den Seiten herab. Der Mann aber drückte immer
erbarmungsloser zu. Die Knie der Frau gaben nach. Ihr Kreuz bog
sich auf unnatürliche Art durch. Schlaff wie eine Marionette hing
sie in den Händen des Mannes, der ihren Hals immer noch umklammert
hielt. Doch schließlich ließ er die Frau los, und sie fiel zu
Boden, wo sie regungslos liegenblieb.
Ich atmete heftig, als hätte der Mann auch mir die Luft
abgedrückt – so verängstigt war ich. Mein Herz schlug wie
wild, und der Pulsschlag rauschte mir in den Ohren. Ich war
unfähig, das Fernglas aus der Hand zu legen. Wie gebannt starrte
ich den Mörder durch das Fernglas an.
Der Mann blieb einen Augenblick neben der Toten stehen.
Dann wandte er sich plötzlich um und trat an das
Fenster.
Ich erschrak zu Tode. Denn der Mann schaute genau in meine
Richtung. Natürlich konnte er mich mit dem bloßen Auge nicht sehen.
Dafür war ich zu weit von ihm entfernt. Sogar mir war es nicht
möglich, mit Hilfe des Fernglases sein Gesicht zu erkennen. Aber
wenn er genau hinschaute, konnte er die KATTEGAT auf dem Meer
sehen.
Der Mann legte plötzlich eine Hand über die Augen, um sie
gegen das Sonnenlicht abzuschirmen. Er späht genau in meine
Richtung, dachte ich und fühlte, wie mir das Blut in den Adern zu
Eis erstarrte.
Aber es kam noch viel schlimmer. Für einen Augenblick
verschwand der Mann. Aber nur, um kurz darauf ebenfalls mit einem
Fernglas bewaffnet wieder zu erscheinen. Ich stieß einen spitzen
Schrei aus, als ich beobachtete, wie er das Fernglas genau auf mich
richtete.
Erschrocken riß ich das Fernglas von den Augen. In diesem
Augenblick erschien Erik und streckte seinen Kopf aus dem
Kajütenaufgang. Besorgt schaute er mich an.
»Hast du gerade eine Monsterkrake gesehen?« fragte er. »Du
siehst ja kreidebleich im Gesicht aus. Und was hatte der Schrei zu
bedeuten?«
Ich sah Erik einen Moment lang sprachlos an. Ich wollte etwas
sagen. Aber meine Lippen zitterten, und ich war unfähig, auch nur
einen Laut hervorzubringen.
Sofort war Erik bei mir. Er schloß mich in die Arme und strich
mir beruhigend übers Haar.
»Was ist los mit dir?« fragte er mit ernster Stimme und sah
mich mit wachen blauen Augen forschend an.
»Ich… ich habe gerade gesehen, wie ein Mann eine Frau
ermordete«, brachte ich endlich hervor. Die Tränen schossen mir in
die Augen. Ich konnte es nicht mehr verhindern. Laut schluchzend
warf ich mich an Eriks Brust.
»Beruhige dich«, flüsterte Erik und streichelte mir über den
Rücken. »Wo hat sich der Mord denn abgespielt?«
Ich hob meinen zitternden Arm und gab Erik das Fernglas.
»Auf Port Cros steht eine mauretanische Villa«, erklärte ich
mit zittriger Stimme. »Ich hatte gerade fliegende Fische
beobachtet, als ich zufällig Zeuge des Mordes wurde.«
Erik ergriff das Fernglas und setzte es mit einer Hand an die
Augen.
Der andere Arm lag noch um meine Schultern. Ich fühlte, wie
etwas von Eriks Kraft und Ruhe auf mich überströmte und beruhigte
mich wieder. Schließlich gab ich Erik genaue Anweisungen, wo genau
sich die Villa befand. Schließlich hatte er sie gefunden.
»Ich kann nichts sehen«, sagte er mit angespannter
Stimme.
»Überall sind die Vorhänge zugezogen.«
»Aber eben waren sie noch offen«, beharrte ich und nahm ihm
das Fernglas wieder aus der Hand. Ich setzte es an meine Augen und
suchte die Villa ab.
Aber ich mußte feststellen, daß Erik recht hatte. Es gab kein
Fenster, in das man hätte hineinsehen können. Überall hingen
Vorhänge vor.
»Er muß die Vorhänge zugezogen haben«, sagte ich nachdenklich.
»Vorhin waren sie jedenfalls noch offen. Denn nachdem der Mann die
Frau erwürgt hatte, trat er ans Fenster.
Ich bin mir sicher, daß der Mörder uns bemerkt hat. Er hat
sogar selbst ein Fernglas geholt und ganz eindeutig in unsere
Richtung gesehen.«
Erik sah mich mit gerunzelter Stirn an. »Und du bist dir
hundertprozentig sicher?« fragte er. »Du hast wirklich gesehen, wie
der Kerl die Frau getötet hat?«
Ich nickte eifrig. »Ja«, stieß ich hervor. »Es war
schrecklich.
Was sollen wir denn jetzt tun?«
»Wir werden natürlich die Küstenwache verständigen«, entschied
Erik. »Wenn sich in dem Haus wirklich ein Mörder aufhält, muß er
sofort gestellt werden.«
Mit diesen Worten wandte sich Erik von mir ab und verschwand
wieder in der Kajüte. Ich hörte, wie er sich an dem kleinen
Funkgerät zu schaffen machte. Und während Erik mit der Küstenwache
sprach, suchte ich mit dem Fernglas noch einmal die Villa ab.
Aber nichts Verdächtiges regte sich dort. Unschuldig und
verträumt lag der weiße Gebäudekomplex da. Die Flamingos erhoben
sich in diesem Augenblick aus dem Park, ließen sich mit
ausgebreiteten Schwingen zum Meer hinabgleiten und steuerten das
Festland an, wo bei den ausgedienten Salzsalinen bei Hyeres eine
ganze Kolonie von diesen wunderschönen Vögeln lebte.
Bei dem Anblick der dahinschwebenden Vögel mußte ich
unwillkürlich an die Frau denken, die vor wenigen Minuten ihr Leben
lassen mußte. Tränen sammelten sich in meinen Augen und machten die
Sicht durch das Fernglas verschwommen.
Wieder eine Stunde später erreichte uns das Motorboot der
Küstenwache. Erik hatte unsere Position durchgegeben und
versichert, daß wir dort für Fragen zur Verfügung stehen
würden.
Das Motorboot legte längsseits der KATTEGAT an. Zwei
Polizeibeamte vertäuten die beiden Boote miteinander.
Schließlich wurden wir zum Polizeiboot hinübergebeten.
Erik
half mir dabei, weil ich immer noch ein unsicheres Gefühl in
den Knien spürte.
In der Kajüte erwartete uns ein beleibter Herr, den ich auf
Ende Fünfzig schätzte. Er saß an einem einfachen Holztisch und las
einen Bericht. Als wir eintraten, schaute er kurz auf und deutete
mit einem Kopfnicken auf zwei Stühle, die ihm gegenüber
standen.
Ich fühlte, wie mich eine eigenartige Erregung ergriff. Mich
drängte es zu wissen, ob der Mörder gefaßt und die Frau vielleicht
noch gerettet werden konnte.
Aber der dickleibige Polizist hatte offenbar vor, mich auf die
Folter zu spannen. Ich betrachtete sein gelichtetes, dunkles Haar
und seine braunen unsteten Augen, die den Bericht überflogen.
Ich hielt das Schweigen schließlich nicht mehr länger
aus.
»Haben Sie den Mörder fassen können?« platzte es aus mir
heraus.
Der Polizist blickte auf und sah mich ruhig und überlegend an.
»Es gibt keine Tote«, sagte er seelenruhig. »Es gibt auch keinen
Mörder. Die Villa ist leer. Ihr Besitzer hält sich zur Zeit in
Cannes auf, wo er die Filmfestspiele mit vorbereitet.«
Seine Worte trafen mich wie eine kalte, nasse Woge. Ich
schnappte nach Luft und wollte zu einer Erwiderung ansetzen.
Aber Erik legte mir die Hand auf den Arm und bedeutete mir,
ich solle ihm das Reden überlassen. Da ich immer noch unter Schock
stand, ließ ich ihn gewähren.
»Soll das heißen, daß Sie in der Villa keine Anzeichen
entdeckt haben, daß dort ein Mord stattgefunden haben könnte?«
fragte Erik vorsichtig.
Der Polizist nickte bedächtig. »Kein einziges.« Dann erhob er
sich, vergrub seine Hände in den Taschen seiner ausgebeulten Hose
und sah Erik und mich streng an.
»Eigentlich müßte ich Sie wegen Irreführung der Polizei
anklagen«, sagte er mit gleichbleibend ruhiger Stimme.
»Aufgrund Ihrer Anschuldigungen sind meine Leute in die Villa
eingedrungen. Sie konnten jedoch nichts Verdächtiges feststellen.
Nicht einmal eine Spur, die auf Einbruch oder dergleichen schließen
lassen könnte. Monsieur und Madame Tyras, denen die Villa gehört,
befinden sich in Cannes. Sie kommen also weder als Täter noch als
Opfer in Frage. Einen Einbruch hat es auch nicht gegeben. So daß
auszuschließen ist, daß ein Fremder den Mord in der Villa beging.«
Der Polizist stemmte nun seine Fäuste auf die Tischplatte, beugte
sich zu mir herab und sah mich mit seinen braunen Augen lauernd
an.
»Sie müssen sich also geirrt haben, als Sie glaubten, einen
Mord beobachtet zu haben.«
Entrüstet erhob ich mich. »Ich habe mich nicht geirrt«,
entgegnete ich und schüttelte Eriks Hand ab, der schon wieder
versuchte, mich zu beruhigen. »Ich habe den Mord mit eigenen Augen
gesehen. Und der Mörder hat dies sogar bemerkt.
Wahrscheinlich hat er schnell alle Spuren beseitigt.«
Der Polizist ließ sich von mir nicht aus der Ruhe
bringen.
»Meine Leute haben die ganze Villa auf den Kopf gestellt. Sie
können mir glauben, daß wir solche Meldungen nicht auf die leichte
Schulter nehmen.«
»Sie glauben mir also nicht«, stellte ich resigniert fest und
mußte wieder mit den Tränen kämpfen.
Mein Gegenüber zuckte nur mit den Schultern. »Ich glaube nur
das, was sich beweisen läßt«, erklärte er in seiner ruhigen Art.
»Und nun zeigen Sie mir einmal, wie Sie den Mord beobachtet
haben.«
Etwas umständlich folgte uns der beleibte Polizist in unser
Boot. »Ich vergaß ganz, mich vorzustellen«, sagte er, während seine
beiden Untergebenen ihm dabei halfen, über die Reling zu klettern.
»Ich bin Inspektor Grimoud von der Französischen
Mordkommission. Ich habe schon viele Mordfälle
untersucht.
Aber einer, der vom Meer aus beobachtet wurde, ist mir während
meiner ganzen Laufbahn noch nicht untergekommen.«
Ich zuckte nur gleichgültig mit den Schultern. Schließlich
hatte ich es mir nicht ausgesucht, Zeugin eines Mordes zu werden.
Und nun wurde dieser Mord auch noch in Zweifel gezogen.
Die nächste halbe Stunde verbrachte ich damit, dem Inspektor
der Mordkommission bis ins kleinste Detail zu schildern, wie ich
den Mord beobachtet und wie er sich abgespielt hatte. Sogar die
fliegenden Fische und die Flamingos durfte ich dabei nicht
auslassen.
Als ich Grimoud jedoch das genaue Aussehen von Opfer und Täter
beschreiben sollte, mußte ich eingestehen, daß ich dazu nicht in
der Lage war. Zwar konnte ich durch das Fernglas erkennen, daß es
sich um Mann und Frau handelte. Aber die Entfernung war doch zu
groß gewesen, um das Gesicht oder andere Körpermerkmale genau
beschreiben zu können.
Grimoud wirkte daher sehr unzufrieden, als er unser Boot
wieder verließ.
»Ihre Beschreibung könnte auf fast jeden Menschen zutreffen,
der relativ groß und von weißer Hautfarbe ist«, sagte er zum
Abschluß, ehe er wieder in seiner Kajüte verschwand.
Und diesmal klang seine Stimme das erstemal mürrisch und
unzufrieden.
Erik war sehr einfühlsam und verständnisvoll. Den Rest des
Tages widmete er ganz allein mir. Er hatte zauberhaft gekocht und
noch irgendwo eine Flasche Rotwein ausgegraben. Als wir gemeinsam
auf Deck saßen, wo Erik für uns den lisch gedeckt hatte, schickte
sich die Sonne gerade an, rotglühend im Meer zu versinken.
Ich hatte mich unterdessen von dem Schrecken erholt.
Trotzdem ließen mir die Worte von Inspektor Grimoud keine
Ruhe. Ständig mußte ich daran denken, daß es keinen einzigen
Anhaltspunkt für einen Mord gegeben hatte.
Habe ich die Vorgänge in der Villa vielleicht nur falsch
gedeutet? fragte ich mich. Aber ich mußte diese Frage verneinen.
Was ich gesehen hatte, war eindeutig ein Mord gewesen. Nur daß es
eben kein Anzeichen dafür gab, daß sich überhaupt jemand zur
fraglichen Zeit in der Villa aufgehalten hatte.
Verzweifelt schüttelte ich den Kopf. Hatte ich mir den ganzen
Vorfall nur eingebildet? Hatte mich eine Spiegelung auf dem
Fensterglas genarrt und mir einen Kampf um Leben und Tod
vorgegaukelt?
Plötzlich spürte ich Eriks Hand auf der meinen. Ich blinzelte
verwirrt und wischte meine Gedanken fort. Unsicher lächelte ich
meinen jungen Gemahl an.
»Ich glaube dir«, sagte Erik einfühlsam und zeigte einmal
mehr, daß er meine Gefühle und Gedanken recht gut durchschaute.
»Grimoud wird sicherlich noch einen Hinweis entdecken. Er machte
nicht den Eindruck, als würde er deine Anschuldigungen auf die
leichte Schulter nehmen. Wenn in der Villa ein Mord stattgefunden
hat, wird Grimoud den Mörder finden. Davon bin ich fest
überzeugt.«
Ich lächelte meinen Mann dankbar an. Es tat gut zu wissen, daß
ich mit meinen Gedanken und Gefühlen nicht allein dastand.
Schließlich versuchte ich mich auf das wunderbare Essen zu
konzentrieren. Und Erik gelang es mit seinem Charme, daß ich das
schreckliche Erlebnis für einige Stunden vergaß.
Am nächsten Morgen holte ich meine Taucherausrüstung aus dem
Gepäck und bereitete alles für einen Tauchgang vor. Erik
assistierte mir dabei. Half mir, in den engen Taucheranzug zu
steigen und die schweren Sauerstoffflaschen auf den Rücken zu
schnallen. Er bestand darauf, daß ich ein Messer mitnahm, und
überprüfte die wasserdichte Kamera, mit der ich die seltenen Fische
fotografieren wollte.
Bevor ich die Taucherbrille aufsetzte, drückte er mir noch
einen Kuß auf die Lippen und wünschte mir viel Erfolg. Dann ließ
ich mich ins Wasser fallen.
Die See war ruhig, und es herrschten günstige
Wetterbedingungen. Daher war das Wasser sehr klar und erlaubte eine
weite Sicht. Ich kam schnell voran und hatte die unterseeischen
Ausläufer der Insel rasch erreicht. Zwischen den Felsen tummelte
sich ein buntes und vielfältiges Leben, wie es nur an wenigen
europäischen Küsten noch anzutreffen war. Ich entdeckte unzählige
Hummer und Langusten, die sich zwischen den Spalten des
Felsgesteins versteckt hielten. Sie zu jagen, war streng verboten
und wäre mir auch nicht in den Sinn gekommen. Seeigel, Seegurken
und Seesterne lagen friedlich auf dem Meeresgrund. Und stellenweise
war das Gestein von Wasserpflanzen und Korallen überwuchert.
Ich löste die Unterwasserkamera von meinem Gürtel und schoß
ein paar Aufnahmen. Es gelang mir sogar, ein paar seltene Fische
vor das Objektiv zu bekommen. Sie nisteten in Höhlen und Spalten
und jagten Plankton und Algen hinterher.
Die paradiesischen Zustände dieses einmaligen
Naturschutzgebietes unter Wasser faszinierten mich so sehr, daß ich
ganz die Gefahren vergaß, die im Meer auf einen arglosen Taucher
lauern konnten. Natürlich war ich als Meeresbiologin über diese
Gefahren informiert. Und es gab einfache Verhaltensmaßregeln, die
ein Risiko von vornherein ausschlossen.
Als ich den weißschillernden Hai bemerkte, der sich mir von
der Insel kommend näherte, war es fast schon zu spät. Immer wieder
hatte ich mich umgeschaut, um keine unliebsame Überraschung zu
erleben, wenn sich mir ein gefährliches Tier vom offenen Meer
näherte. Dieser Hai aber mußte sich irgendwo in der Nähe der Insel
aufgehalten haben – für ein Raubtier, das das flache Wasser und die
Nähe von Menschen scheute, ein ungewöhnliches Verhalten. Aber
dieser Hai, der in schlängelnden, kraftvollen Bewegungen direkt auf
mich zukam, bildete offenbar eine Ausnahme.
Mein erster Impuls war, so schnell wie möglich zum Boot
zurückzuschwimmen und mein Heil in der Flucht zu suchen.
Aber eine Flucht war genau das Falscheste, was ich jetzt tun
konnte. Der Hai würde erst recht auf mich aufmerksam werden und mir
nachsetzen. Also verhielt ich mich ruhig und ließ den Menschenhai
auf mich zukommen. Ich wußte, daß der Ruf des sogenannten weißen
Hais schlechter war, als es sich in der Realität wirklich verhielt.
Haie griffen Menschen nicht so ohne weiteres an.
Auf dieses Wissen vertraute ich, als ich reglos im Wasser
schwebend der mächtigen Gestalt des Fisches entgegenblickte.
Seine Schwanzflosse ruderte durchs Wasser. Die gefährlich
wirkende Rückenflosse war aufgestellt. Das Maul halb geöffnet, so
daß ich die nadelspitzen Zähne deutlich sehen konnte. Ein Schwarm
Mondfische, die ich gerade fotografieren wollte, ergriff die Flucht
und suchte in einer Felsspalte Zuflucht vor dem Mörder.
Aber der Hai schien sich für die Fische nicht zu
interessieren.
Ohne sich ablenken zu lassen, schoß er geradewegs auf mich zu.
Plötzlich riß er sein Maul weit auf und entblößte seine spitzen
Zähne.
In diesem Moment begriff ich, daß der Hai wirklich eine Gefahr
für mich darstellte. Ich konnte mir sein Verhalten nicht erklären.
Aber offenbar hatte er es auf mich abgesehen.
Im nächsten Augenblick hatte der Hai mich erreicht.
Instinktiv duckte ich mich und riß die Kamera schützend in die
Höhe. Ich spürte die Strömung, als der Hai knapp über mich
hinwegfegte. Sein Maul schnappte nach der Kamera und riß sie mir
aus der Hand.
Entsetzt wandte ich mich um und beobachtete, wie der Hai sich
hin und her warf, als wollte er das Opfer zerreißen, das er in
seinem Maul trug. Rasch sah ich mich nach einem Versteck um. Ich
mußte mich in Sicherheit bringen, ehe der Hai bemerkte, daß es
nichts Lebendes war, was er da zwischen den Zähnen hatte.
Ich tauchte in die Tiefe und erreichte eine Fläche aus hohem
Seegras.
Ich preßte meinen Körper auf den rauhen Felsgrund und hielt
den Atem an, damit die aufsteigenden Luftblasen mich nicht
verrieten. Das Seegras war lang, und die Strömung trieb die Halme
über meinen Körper, die mich halb verdeckten.
Der Hai hatte inzwischen seinen Irrtum bemerkt. Er hatte die
Kamera ausgespuckt, die jetzt nur noch ein Klumpen verformten
Metalls war. Langsam und sich seiner Beute gewiß, wandte er sich um
und schwamm den Grund ab.
Haie verfügen über einen ausgezeichneten Geruchssinn. Ich
durfte nicht darauf hoffen, daß ich in meinem Versteck sicher war.
Zumal ich nicht ewig die Luft anhalten konnte.
Irgendwann würden die aufsteigenden Blasen meiner Atemluft
mich verraten.
Aber der Hai hatte offenbar schon Witterung aufgenommen.
Plötzlich schnellte er herum und hielt direkt auf mich
zu.
Voller Panik griff ich nach dem Tauchermesser, das sich
oberhalb meines Fußknöchels befand. Aber die Angst machte
meine Bewegungen fahrig. Verzweifelt versuchte ich die
Sicherung zu lösen, die verhindern sollte, daß das Messer während
des Tauchens aus dem Futteral glitt.
Jetzt hatte der Hai mich gesehen. Er stieß zu mir herab, riß
das Maul auf und wollte zuschnappen. Aber in diesem Augenblick
hatte ich das Messer endlich in der Hand. Ich stieß mich vom
Untergrund ab und schnellte zur Seite weg. Das Maul des Hais
verfehlte mich nur um Haaresbreite. Ich wollte mit dem Messer
nachsetzen. Aber die Schwanzflosse erwischte mich und wirbelte mich
durchs Wasser.
Für einen Augenblick wußte ich nicht mehr, wo oben und unten
war. Das Messer hatte ich bei dem Schlag verloren. Ich ruderte
verzweifelt mit den Armen, um mich wieder in eine stabile Lage zu
bringen. Rasch orientierte ich mich. Aber viel Zeit blieb mir
nicht, denn der Hai setzte zum nächsten Angriff an.
Plötzlich war er vor mir. Ein weißgraues Ungetüm, das sein
schreckliches Maul zum todbringenden Biß aufgesperrt hatte.
Panisch ruderte ich mit den Beinen. Aber es hatte keinen Sinn.
Mit meinen unkontrollierten Bewegungen stachelte ich den Hai nur
noch mehr an. Das Maul schoß auf mich zu. Und in Erwartung des
schmerzhaften und tödlichen Bisses schloß ich die Augen.
Aber der Schmerz blieb aus.
Irritiert öffnete ich die Augen wieder. Über mir befand sich
der Hai, der sich mit wildpeitschender Schwanzflosse wütend hin und
her warf. Dann sah ich den hauchdünnen Blutfaden, der sich von
seiner Brustflosse wie ein Nebelstreifen absonderte. Ein
Harpunenpfeil hatte die Flosse durchbohrt!
Ich schaute nach oben. Im gleißenden Sonnenlicht, das von der
Wasseroberfläche reflektiert wurde, erkannte ich eine dunkle
Gestalt. Ein Mann ohne Taucheranzug und Taucherflossen, der im
blendenden Sonnenlicht wie ein
Scherenschnitt wirkte. In den Händen hielt er eine
Harpune.
Und war gerade damit beschäftigt, einen neuen Pfeil
einzulegen.
Erik! durchfuhr es mich, als ich den Mann erkannte. Doch im
nächsten Augenblick schoß der Hai auch schon auf Erik zu.
Wenn ich gekonnt hätte, ich hätte in dieser Sekunde laut
aufgeschrien. Aber das Mundstück zwischen meinen Lippen hinderte
mich daran. Hilflos mußte ich mit ansehen, wie der Hai wütend auf
meinen Geliebten zustrebte. Er hatte Erik fast erreicht. Aber da
war es Erik endlich gelungen, den zweiten Pfeil einzuspannen. Er
legte an und drückte ab.
Erik war kein besonders guter Schütze. Wahrscheinlich stand er
unter demselben Druck wie ich. Auf jeden Fall verfehlte der Pfeil
den Hai nur knapp. Aber Erik hatte Glück im Unglück.
Denn der Pfeil hatte den Kopf des Hais gestreift und ihn am
linken Auge verletzt.
Das Her bäumte sich auf, schnellte orientierungslos durchs
Wasser. Schließlich schoß es auf den Meeresgrund zu und bewegte
sich sichtlich angeschlagen die unterseeischen Ausläufer der Insel
hinauf.
Nur eine Sekunde wunderte ich mich über das sonderbare
Verhalten des Hais, der, anstatt sein Heil im offenen Meer zu
suchen, wieder auf die Insel zuschwamm.
Aber dann wurden diese Überlegungen ausgelöscht. Erik!
war der einzige Gedanke, der in meinem Bewußtsein noch Raum
hatte. Wir mußten uns in Sicherheit bringen, ehe der Hai
zurückkehrte.
Rasch setzte ich mich in Bewegung und hielt auf Erik zu.
Gemeinsam erreichten wir die Wasseroberfläche. In der Nähe
trieb das kleine Ruderboot, das immer mit dem Kiel nach oben auf
dem Deck der KATTEGAT geruht hatte.
Erik hatte es zu Wasser gelassen, und es stellte nun unsere
letzte Rettung dar.
Ich ergriff Eriks Arm und schwamm mit Hilfe der Schwimmflossen
so schnell ich konnte zum Ruderboot. Dabei saß mir die Angst im
Nacken und spornte mich dazu an, die letzten Kraftreserven aus
meinem Körper herauszuholen.
Dann hatten wir es geschafft. Erik zog sich als erster über
den Bootsrand. Dann ergriffen seine starken Arme meinen Körper und
zogen mich in die Höhe.
Keine Sekunde zu früh. Denn schon näherte sich die bedrohlich
wirkende Rückenflosse, die spitz aus dem Wasser herausragte und
eine Kette von Bläschen und Schaum hinter sich herzog.
Der Hai war zurückgekehrt!
Gebannt hielt ich den Atem an. Rechnete jeden Augenblick
damit, daß der Hai das kleine Boot kenterte. Aber Erik drosch mit
dem Ruder wie verrückt auf das Wasser ein und schlug den Hai damit
erneut in die Flucht. Dann machte sich Erik daran, uns mit
kräftigen Ruderzügen zur KATTEGAT
zurückzubringen.
Mir kam es fast wie eine Ewigkeit vor, bis wir die Segeljacht
endlich erreicht hatten. Aber der Hai griff uns nicht noch einmal
an. Offenbar hatte er die Nase voll und es vorgezogen, sich
zurückzuziehen.
Als wir endlich an Deck standen, sahen Erik und ich uns ganz
außer Atem in die Augen. Wir wußten beide, daß wir nur knapp dem
Tod entronnen waren.
»Als ich die Rückenflosse des Hais an der Wasseroberfläche
sah, habe ich sofort reagiert«, erklärte Erik, als er wieder zu
Atem gekommen war. »Ich ließ das Beiboot zu Wasser und ruderte wie
verrückt. Und als ich sah, wie sich das Wasser wegen eures Kampfes
aufwühlte, fürchtete ich schon, ich würde zu spät kommen…«
Ich legte ihm einen Finger auf die Lippen. »Es ist ja noch
einmal gutgegangen«, sagte ich sanft. »Du hast mir das Leben
gerettet!«
Schließlich fielen wir uns in die Arme und klammerten uns wie
Ertrinkende fest aneinander…
Am darauffolgenden Tag lichteten wir die Anker und setzten die
Segel. Bis nach Cannes, unserem nächsten Reiseziel, waren es noch
sechzig Kilometer. Ich hatte auf der Abreise bestanden, obwohl Erik
Einwände dagegen erhoben hatte. Er befürchtete, daß ich meinen
Entschluß zu voreilig traf und ihn hinterher bereuen würde.
Schließlich hatte ich mich schon seit geraumer Zeit auf die
Tauchgänge in dem Naturschutzgebiet gefreut. Aber der Mord und der
Angriff des Haifisches hatten mir den Aufenthalt bei Port Cros
gründlich verdorben. Ich versicherte Erik mehrmals, daß es mir mit
der Abreise ernst sei.
»Außerdem ist die Insel Port Cros nicht die einzige
Sehenswürdigkeit, die sich einer angehenden Meeresbiologin an der
Côte d’Azur anbietet«, erklärte ich. »Wir können später immer noch
zu den Inseln zurückkehren. Aber im Moment ist mir der Aufenthalt
in diesem kleinen Paradies mehr als verleidet.«
Schließlich hatte Erik eingesehen, daß mich nichts in dieser
Gegend halten würde. Er gab zu, daß er es selbst für sehr
bedenklich hielt, in Anbetracht des gefräßigen Haifisches, der in
diesen Gewässern sein Unwesen trieb, mich zu weiteren Tauchgängen
zu ermutigen.
Also stachen wir wieder in See. Der Wind war nur mäßig, und so
benötigten wir fast zwei Tage, bis wir endlich den Hafen von Cannes
erreichten.
Es war nicht einfach, in dem überfüllten Hafen noch einen
Liegeplatz für die KATTEGAT zu finden. Die bevorstehenden
Filmfestspiele hatten schon viele Neugierige angelockt. Große
Motorjachten und teuer anmutende Segeljachten lagen hier dicht bei
dicht. Aber schließlich gelang es uns doch noch, einen Liegeplatz
zu ergattern. Zwar mußten wir einen stolzen Preis dafür bezahlen,
aber wir hatten genügend Geld von Eriks Eltern erhalten, so daß uns
die Kosten nicht in die Knie zwangen.
Eriks Vater hatte darauf bestanden, daß wir unsere
Flitterwochen in einem der besten und bekanntesten Hotels von
Cannes verbrachten. Zu diesem Zweck hatte er uns im Negress ein
Zimmer mit Doppelbett vorbestellen lassen. Im Negress verkehrten
angesehene Regisseure und Schauspieler, Filmproduzenten und
Autoren. Und Eriks Vater hatte keine Kosten und Mühen gescheut, um
seinem Sohn und seiner jungen Braut dort ein Zimmer zu
besorgen.
Erik sah sich ein wenig unbehaglich in dem Foyer des
luxuriösen Hotels um. Die Rezeption bestand aus goldgeädertem
Marmor. Von der hohen Decke hingen schwere Kronleuchter. Die
Sitzgarnituren, die um die niedrigen Mahagonitische gruppiert
waren, waren mit feinem, handschuhweichem Leder bezogen.
Der Herr an der Rezeption war ein wenig verwirrt, weil wir
zwei Tage eher angereist waren, als es die Buchung vorgab.
Aber es stellte sich heraus, daß unser Zimmer nicht belegt war
und wir es jetzt schon beziehen konnten.
»Ich glaube, mein Vater hat es mal wieder gut mit uns
gemeint«, kommentierte Erik. »Ein einfacheres, schlichtes Hotel
hätte es auch getan. Noch bin ich nicht der berühmte Regisseur und
Drehbuchautor, als den mein Vater mich gerne sehen würde. Und es
ist überhaupt die Frage, ob ich je so bekannt werde wie Chabrol
oder Steven Spielberg.«
Ich hakte mich bei ihm unter und lächelte ihn aufmunternd an.
»Man fährt eben nur einmal in die Flitterwochen«, dämpfte ich seine
Bedenken. »Sicherlich hat dein Vater uns auch unter diesem Aspekt
dieses prunkvolle Hotel ausgesucht. Und daß du nicht so berühmt
bist wie die beiden Männer, die du eben aufgezählt hast, darüber
bin ich recht froh. Ich glaube kaum, daß du noch Zeit für mich
hättest, wenn du ständig an irgendwelchen Drehorten wärst.«
Erik schaute zu mir herab und lächelte. »Wahrscheinlich hast
du recht. Laß uns diesen Aufenthalt in Cannes genießen. Das nächste
Mal, wenn wir hier sind, um einen Film von mir vorzustellen, müssen
wir vielleicht am Strand schlafen, weil wir uns kein Hotel leisten
können.«
Bei diesem Gedanken mußte ich unwillkürlich lächeln. Ich hatte
Vertrauen in Erik und seine Arbeit als Filmemacher.
Sicher würde er es nicht zu solchem Ruhm wie einige seiner
amerikanischen Kollegen bringen. Aber am Hungertuch brauchte er
trotzdem nicht zu nagen. Außerdem hatte eine Meeresbiologin auch
kein schlechtes Einkommen.
Während wir uns über dieses Thema noch länger unterhielten,
führte uns ein livrierter Hotelpage zu unserem Zimmer im dritten
Stock.
Staunend hielt ich den Atem an, als der Page die Tür zu
unserem Zimmer öffnete und sich ein großer, pompöser Raum dahinter
auftat.
Ein rundes, großes Bett mit Seidenüberzug befand sich in der
Mitte des Raumes. Eine Wandseite wurde ganz von einem verspiegelten
Schrank ausgefüllt. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich
eine Tür, die in das mit Marmor ausgelegte Badezimmer führte.
Daneben befand sich eine kleine Zimmerbar.
Am schönsten aber war der Ausblick, der sich aus den hohen,
bogenförmigen Fenstern darbot. Von hier aus konnten wir den
Hafen und das Meer sehen. Ein kleiner, halbrunder Balkon lud
dazu ein, aus sicherer Entfernung das rege Straßenleben von Cannes
zu betrachten.
»Wunderschön«, gab ich meiner Begeisterung Ausdruck.
Erik gab dem Pagen ein Trinkgeld und wies ihn an, unsere
Koffer vor den verspiegelten Schrank abzustellen. Als der Page
gegangen war, trat Erik von hinten an mich heran und umarmte mich.
Gemeinsam sahen wir still aus dem Fenster und genossen die Nähe des
anderen.
»Ich habe Hunger«, gestand ich nach einer Weile.
»Dann laß uns in das Restaurant des Hotels gehen«, schlug Erik
vor. »Dann können wir uns auch gleich ein Bild davon machen, mit
wem wir alles unter einem Dach wohnen.«
An dem Glitzern in seinen blauen Augen konnte ich ablesen, daß
er sich die ganze Zeit schon auf diesen Augenblick gefreut
hatte.
Ich löste mich von Erik und verschwand im Badezimmer, um mich
für den Auftritt im Restaurant zurechtzumachen. Cannes verwandelte
sich zur Zeit der Filmfestspiele in einen überdimensionalen
Laufsteg. Dementsprechend fiel auch die Wahl meiner Garderobe aus,
als ich in Stockholm meine Koffer für die Flitterwochen
packte.
»Du siehst einfach umwerfend aus«, lobte mich Erik, als ich
fertig war. Ich hatte ein langes schwarzes Kleid angezogen, dessen
Oberteil mit Straßsteinen reich verziert war. Meine blonden Haare,
die ich elegant hochgesteckt hatte, wurden durch den schwarzen
Stoff und die glitzernden Steine noch zusätzlich
hervorgehoben.
Stolz auf seine schöne Frau, umschlang Erik meine Hüfte und
trat mit mir hinaus auf den Flur. Erik trug einen grauen luftigen
Anzug aus Leinen. Wir waren beide sehr glücklich.
Aber kaum hatten wir den Flur betreten, da wurde die Zimmertür
schräg gegenüber geöffnet, und ein älteres Paar trat heraus.
Als ich den Mann und die Frau sah, setzte mein Herzschlag für
einen Augenblick aus. Ich hielt plötzlich in meiner Bewegung inne
und starrte die Fremden an.
Die beiden hatten eine erschreckende Ähnlichkeit mit dem Paar,
das ich in der mauretanischen Villa auf Port Cros gesehen hatte.
Nur daß der gesetzt wirkende Mann mit dem graumelierten Haar seine
schlanke, hochgewachsene Begleiterin untergehakt hatte und
ungezwungen mit ihr sprach.
Diese Frau hätte eigentlich tot sein müssen. Erwürgt von dem
Mann, an dessen Seite sie sich nun befand.
Erik, der spürte, daß irgend etwas mit mir nicht stimmte, sah
mich besorgt an. Auch dem älteren Paar schien aufgefallen zu sein,
daß ich sie aus weit aufgerissenen Augen angestarrt hatte.
Der Mann sah mich stirnrunzelnd an. Blickte dann auf die
Nummer unseres Zimmers und nickte kaum merklich. Er löste sich von
seiner Partnerin und ging auf uns zu.
»Madame und Monsieur Henderson, wenn ich mich nicht täusche«,
sagte er ohne erkennbare Regung.
Erik sah den Mann verwundert an. »Das ist richtig«, bestätigte
er. »Kennen wir uns?«
»Wohl kaum«, ließ sich der Mann abschätzig vernehmen.
»Die Polizei hat mich heute aufgesucht. Ich muß zugeben, es
war schwer für die Beamten, mich zu finden. Die Vorbereitungen für
die Filmfestspiele sind sehr zeitraubend.
Die verschiedenen Kinos müssen ihr Programm erstellen. Ich bin
also viel unterwegs. Aber die Herren von der Polizei konnten mich
schließlich doch noch ausfindig machen. Sie erzählten mir, jemand
habe beobachtet, wie in meiner Villa ein Mord geschehen sei. Ich
war natürlich schockiert. Aber es hat sich wohl herausgestellt, daß
die Zeugin«, und hierbei sah er
mich durchdringend an, »sich offenbar geirrt hatte. Es wurde
weder eine Leiche noch der Mörder gefunden.«
»Dann sind Sie Monsieur Tyras«, bemerkte Erik, der die
Zusammenhänge langsamer begriff als ich.
»Etienne Tyras«, stellte der Mann sich vor. Und während er auf
die Frau im Hintergrund deutete, sagte er: »Und das ist meine Frau
Mona. Von der Polizei erfuhren wir, daß Sie ebenfalls in diesem
Hotel wohnen werden. Ich brannte daher schon darauf, diejenigen
kennenzulernen, die glauben, in meiner Villa gingen Mörder ein und
aus.«
Ich hätte in diesem Augenblick vor Scham im Boden versinken
mögen. Aber trotzdem hielt ich meinen Kopf aufrecht und sah mein
Gegenüber fest an. Ich hatte den Mord wirklich gesehen. Und für
einen Augenblick hatte ich sogar geglaubt, in dem Ehepaar Tyras
Opfer und Täter vor mir zu sehen.
»Sie müssen entschuldigen«, sagte Erik in diesem Augenblick.
»Es lag gewiß nicht in unserer Absicht, Sie in Schwierigkeiten zu
bringen. Aber meine Frau ist sich sicher, daß sie diesen Mord
wirklich gesehen hat. Sie an meiner Stelle hätten genauso
gehandelt. Es war einfach meine Pflicht, die Polizei zu
verständigen.«
Etienne Tyras sah Erik aus zusammengekniffenen Augen an.
Aber dann entspannten sich seine Gesichtszüge, und ein Lächeln
huschte über seine schmalen Lippen.
»Da muß ich Ihnen natürlich zustimmen«, sagte er, wobei kein
Vorwurf mehr in seiner Stimme mitschwang. »Frauen können sehr
eigenwillig sein. Ich selbst kann davon auch ein Lied singen.«
Verstohlen blickte er dabei zu seiner Frau, die immer noch im
Hintergrund stand und sich uninteressiert von uns abgewandt
hatte.
»Es ist manchmal besser, sich dem Willen der Frau zu beugen.
Und besonders dann, wenn sie glauben, etwas gesehen zu haben, was
ihre leicht erregbaren Gemüter erhitzt.«
Erik an meiner Seite wurde unruhig. Ich spürte, daß er weder
mir noch Etienne Tyras zu nahe treten wollte und es daher vorzog zu
schweigen. Mir allerdings war die Art, wie Tyras über Frauen
sprach, sehr zuwider. Aber bevor ich einen Einwand erheben konnte,
wandte sich Tyras direkt an mich.
»Wie wäre es, wenn wir diesen kleinen Vorfall, der uns
notgedrungen miteinander bekannt gemacht hat, vergessen. Ich lade
Sie zu einer Party auf meiner Jacht ein.« Tyras wandte sich wieder
an Erik. »Ich habe gehört, Sie sind Filmemacher aus Schweden und
werden in Cannes Ihr Debüt vorführen. Auf der Party werden auch
einige Größen der Filmindustrie anwesend sein. Es dürfte für Sie
nicht von Schaden sein, sich bei ihnen bekannt zu machen.«
»Sie sind sehr zuvorkommend«, sagte Erik zurückhaltend.
Etienne Tyras zuckte gleichmütig mit den Schultern. »Junge
Talente müssen gefördert werden«, behauptete er. »Mein Schiff heißt
NACHTPERLE. Um zwanzig Uhr beginnt die Party.«
Mit diesen Worten wandte er sich um und kehrte zu seiner Frau
zurück. Erik und ich blieben noch eine Weile stehen. Die Einladung
kam für uns sehr überraschend. Mit gemischten Gefühlen sah ich dem
Ehepaar Tyras nach. In meinen Augen waren die beiden sehr
undurchsichtige Gestalten.
»Sonderbarer Mensch«, flüsterte Erik, als die beiden um eine
Korridorbiegung verschwunden waren. Aber dann schüttelte er seine
Beklemmungen ab und lächelte mich fröhlich an.
»Besser hätte unser Einstieg in Cannes gar nicht laufen
können«, sagte er schmunzelnd. »Jetzt haben wir sogar schon eine
Einladung zu einer Party, auf der wichtige Leute vertreten sind.
Wenn das kein glücklicher Zufall ist.«
Ich war froh, daß Erik der ganzen Sache nur eine positive
Seite abgewinnen konnte. Ich konnte ein gewisses mulmiges Gefühl
jedoch nicht abschütteln. Die Ähnlichkeit des Ehepaars Tyras mit
den beiden Menschen, die ich in der Villa beobachtet hatte,
verwirrte mich. Ich konnte mir die Vorfälle einfach nicht
erklären.
Aber schließlich folgte ich Erik in den pompösen
Speisesaal.
Und in Anbetracht all des Glamours vergaß ich den kleinen
Zwischenfall rasch wieder.
Um acht Uhr abends begaben wir uns zum Hafen. Die Stadt
leuchtete in bunten Farben. Die Straßen waren geschmückt, und
überall hingen Vorankündigungen auf die Programme der verschiedenen
Kinos. Jeder Winkel der Stadt schien von hektischer Aktivität
erfüllt. Cannes bereitete sich auf das große Filmfestspiel
vor!
Mit einem kleinen Motorboottaxi ließen wir uns zur NACHTPERLE
übersetzen, die einen Kilometer vom Hafen entfernt Anker gelichtet
hatte. Schon als wir uns der großen Jacht näherten, waren die
Geräusche eines ausgelassenen Festes zu vernehmen. Bunte Girlanden,
Leuchtketten und Lametta glänzten im Licht der Deckbeleuchtung.
Männer in schwarzen Anzügen und Frauen in Galakostümen waren zu
sehen.
Erik und ich sahen uns einen Augenblick stumm an. »Dann wollen
wir uns mal in das Getümmel stürzen«, sagte Erik, der eigentlich
nicht viel für solche Veranstaltungen übrig hatte.
Aber diese Partys gehörten zum Filmgeschäft nun einmal
dazu.
Das Taxiboot legte längsseits an, und wir erklommen die
NACHTPERLE über eine Metalltreppe, die extra für diesen Zweck
angebracht worden war.