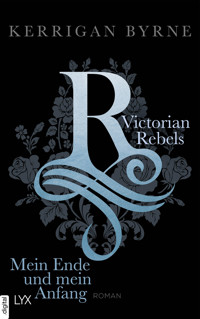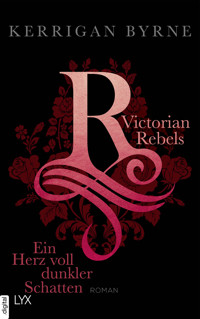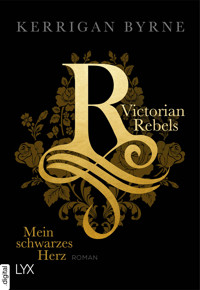9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Serienkiller versetzt Portland in Angst und Schrecken: "John the Baptist" kreuzigt junge Frauen und lässt sie gnadenlos verbluten. Detective Luca Ramirez tappt im Dunkeln, bis ein weiteres Opfer gefunden wird - und plötzlich die Augen aufschlägt. Luca stellt Hero Katrova augenblicklich unter seinen persönlichen Schutz, auch wenn er dafür rund um die Uhr mit ihr zusammenbleiben muss ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Kerrigan Byrne bei LYX
Impressum
KERRIGAN BYRNE
Spuren
der Vergeltung
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Katrin Mrugalla und Richard Betzenbichler
Zu diesem Buch
Special Agent Luca Ramirez ist außer sich, als er mitten in der Nacht die Nachricht erhält, dass schon wieder eine rothaarige Frauenleiche am Ufer des Willamette Rivers gefunden wurde. Seit Monaten ist Luca einem Serienkiller auf der Spur, der hübsche junge Frauen foltert und jämmerlich verbluten lässt. Doch auch diesmal ist es ihm nicht gelungen, »Johannes den Täufer« – wie die Presse ihn nennt – zu fassen, bevor er erneut zuschlagen konnte. Aber als Luca am Tatort ankommt und die Tote untersuchen will, wird schnell deutlich, dass der Mörder diesmal einen entscheidenden Fehler gemacht hat: Denn die junge Frau schlägt plötzlich die Augen auf! Hero Katrova lebt, und Luca hat endlich eine Zeugin, die Hinweise auf den Täter geben kann. Hero ist schwer verletzt, und nur das tiefe Vertrauen, dass Luca ihren Peiniger bald finden wird, gibt ihr die Kraft, nicht aufzugeben. Doch schnell wird klar, dass Hero kein zufälliges Opfer war. Der Mörder hat es auf sie abgesehen und setzt alles daran, sein blutiges Werk vollenden zu können. Luca bleibt nichts anderes übrig, als die Sache selbst in die Hand zu nehmen und Hero unter seinen persönlichen Schutz zu stellen – auch wenn das bedeutet, dass er rund um die Uhr mit der Frau zusammen sein wird, die mit einem einzigen Blick sein Herz erobert hat …
Für meinen Anam Cara.
Ich habe dich sofort erkannt und
nie zurückgeblickt.
Prolog
Der Mann, der nur ’ne Zung’ hat, ist kein Mann,
Des Wort nicht jedes Weib gewinnen kann.
William Shakespeare, Die beiden Veroneser
Vierzig Jahre zuvor
Die Russen verkauften seit jeher die besten Waffen.
Er prüfte seinen Abstand zu den Sprengladungen, die er an der Stelle im Boden vergraben hatte, wo die beiden Lieferwagen parkten. Eine falsche Bewegung, und sie würden alle zu Petrus auffahren, während ihnen von der Explosion noch die Ohren klingelten. Natürlich würde der himmlische Türsteher den alten »Danny Boy« durch die Pforte lassen, schließlich wäre er ein Märtyrer, gefallen im Heiligen Krieg.
Genau deshalb machte er solche Sachen lieber allein. Er wollte nicht schuld daran sein, wenn ein Bruder in Stücke gerissen wurde.
Er selbst? Nun, einen besseren Tod konnte er sich nicht vorstellen.
Die Russen? Nichts würde ihn glücklicher machen, als sie in kleinste Teilchen zu zerfetzen. Zumal sie sowieso versuchen würden, ihn zuerst zu töten.
Aber einen Sinn-Féin-Kameraden? Verdammt, der war es nicht wert, dass er seine Seele riskierte.
Das Treffen in der Schweiz stattfinden zu lassen war eine brillante Idee von ihm gewesen. Neutraler Boden und so. Außerdem hatte die Irish Republican Army hier jede Menge Konten, und für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Deal tatsächlich wie geplant über die Bühne ging, musste er vielleicht rasch an mehr Geld herankommen.
Danny Boy ließ den Blick über die malerische bergige Umgebung wandern, dann öffnete er die Tür seines gemieteten Volkswagens und stieg aus.
Sein prallvoll mit Geld gefüllter Aktenkoffer war mit einer Handschelle an seinem rechten Handgelenk befestigt. Es überraschte die Leute jedes Mal, wenn er seine Waffe mit der linken Hand aus dem Holster zog. Lange hielt ihre Überraschung allerdings nie an. Er zog die Waffe nur, wenn er vorhatte, sie auch zu benutzen.
Linkshänder waren doch angeblich künstlerisch veranlagt, nicht wahr? Verdammt, da war echt was dran. Er war ein Virtuose. Ein Meister aller Dinge, die entflammbar waren. Sprengstoffe, Feuerwaffen, Motoren … Frauen.
Er streckte die Arme zur Seite aus und drehte sich langsam einmal um sich selbst, um ihnen den Aktenkoffer und die gefährliche Waffe in seinem Schulterholster zu zeigen.
Genau, ihr doppelzüngigen Idioten, schickt euren besten Mann, wenn ihr es mit mir aufnehmen wollt.
Die Beifahrertür des vorderen Wagens wurde geöffnet. Der Stiefel, der auf den steinigen Boden auftraf, schockierte ihn. Leder. Mit Absätzen, die mindestens acht Zentimeter hoch sein mussten.
In den kniehohen Stiefeln steckten die längsten Beine, die er je gesehen hatte. Und die Frau, die zu diesen perfekten Beinen gehörte? Sie hätte über einen der Pariser Laufstege stolzieren können statt über eine feuchte, Unheil verheißende Landstraße in den Alpen. Langes, glänzendes schwarzes Haar verschwand hinter schmalen Schultern. Es umrahmte ein vollkommen symmetrisches, zartes Gesicht mit makelloser, olivfarbener Haut.
War das etwa die sagenhafte Zoya? Der mörderische Arm eines korrupten KGB-Generals, der illegal Waffen an … nun ja, an Männer wie ihn verkaufte?
Die Hände hatte sie in den Taschen ihrer kurzen Lederjacke vergraben. Er hätte seinen Lieblingsrosenkranz darauf verwettet, dass sie statt einer Pistole etwas Scharfes in der Hand hielt.
Also musste sie nahe an ihn herankommen. Die Vorstellung entlockte ihm ein Lächeln.
Mit den Stiefeln war sie fast einen Meter achtzig groß, was bedeutete, dass sie ohne Stiefel zwei bis drei Zentimeter größer als er sein musste.
Egal – bei dem, was sie die meiste Zeit tun würden, wären sie sowieso in der Waagerechten. Außer, sie hätte diese fantastischen Beine um ihn geschlungen, während sie standen. Dann wären ihre Gesichter auf gleicher Höhe. Sein Körper reagierte sofort auf diese Vorstellung.
Er konnte es kaum erwarten.
Wenige Zentimeter vor ihm blieb sie stehen und betrachtete ihn aus dunklen Mandelaugen missbilligend von oben bis unten.
Er grinste, denn er wusste, was sie sah, schließlich rasierte er seine sommersprossige, rothaarige Visage jeden Morgen vor dem Spiegel. Was ihm an Größe fehlte, machte er durch Breite wett. Durch manche Türen passte er nur seitwärts. Seine kräftigen Arme hätten bei der Länge eigentlich zu einem viel größeren Mann gehört, aber seine riesigen, hässlichen Hände waren überraschend geschickt in Dingen, bei denen es auf Präzision ankam. Er war keine Schönheit, aber er wusste, dass seine grünen Augen funkelten, wenn er lächelte.
Und dieses Wissen setzte er jetzt schamlos ein.
»›Den Augenblick, da ich Euch sahe, flog mein Herz in Euern Dienst‹.« Danny Boy konnte nicht gut mit Worten umgehen. Nur der große Dichter konnte seine Gefühle in die richtigen Worte kleiden.
Verblüfft sah sie ihn an. Sie räusperte sich, schien aber unbeeindruckt. »Sie sind Daniel?«, fragte sie mit hartem russischem Akzent.
»Einfach Danny Boy, bei militärischen Operationen verwende ich nie meinen richtigen Namen.«
Bei dem Wort »militärisch« verzog sie ihre vollen, entzückenden Lippen. Sie gehörte zu denen, die die IRA eher unter dem Stichwort »terroristisch« als »militärisch« abgespeichert hatten.
Egal, so hatten sie wenigstens ein Thema für ihr Bettgeflüster.
»Ist das das Geld?« Sie deutete mit dem Kinn auf den Aktenkoffer.
»Ja.«
Ihre Blicke trafen sich. Vielleicht funktionierte das gute alte irische Funkeln ja? Er intensivierte es noch ein wenig.
Sie sah weg.
Ja, es funktionierte.
»Mein Auftrag lautet: das Geld nehmen und Sie töten«, informierte sie ihn. »Ich bin gut in meinem Job.« Ihr Pokerface war verdammt hinreißend. Allerdings gab es da ein Problem. Ihre schwarzen Augen waren alles andere als tot. Sie sprühten vor Leben. Vor Neugier. Vor Leidenschaft. Wenn sich die Gelegenheit bot, würde sie ihn töten. Daran zweifelte er nicht eine Sekunde.
»Ich weiß.« Er hob den Arm mit dem Aktenkoffer. »Nur ich habe den Schlüssel, und den gebe ich dir erst, wenn du mir die Ware ausgehändigt hast.«
Sein Blick war auf das lange Sägemesser gerichtet, das sie aus der Tasche gezogen hatte, deshalb sah er den vernichtenden Schlag in seine Magengrube nicht kommen. Er schnappte noch immer nach Luft, als sie ihm bereits mit irgendeinem Kung-Fu-Trick beide Hände hinter den Rücken gedreht und ihm von hinten das Messer an die Kehle gesetzt hatte.
»Ich könnte dir den Arm abschneiden, an dem das Geld hängt, und dich einfach verbluten lassen«, schnurrte sie ihm mit ihrem erotischen russischen Akzent ins Ohr.
Er hätte gern die Hände frei gehabt, um zurechtzuschieben, was sich in seiner Hose anbahnte. Aber dann würde sie aus seiner Halsschlagader eine Fontäne schießen lassen, also ließ er ihr den Spaß. Außerdem pressten sich ihre vollen Brüste bei jedem Atemzug gegen seinen Rücken, und das gefiel ihm.
Das Messer schnitt in seine Haut.
»Nur zu, dann werden die Sprengsätze unter euren Wagen den Skiläufern ein paar neue Abfahrten bescheren.«
Sie holte tief Luft und sprudelte eine Reihe russischer Wörter hervor, die vermutlich ihre Großmutter hätten erröten lassen.
»Wo ist der Zünder?«, fragte sie.
»In meinem Stiefel. Wenn ich den Zeh nach oben drücke, wird er aktiviert.«
»Wie hast du die Explosion verhindert, als wir eben gekämpft haben?« Sie klang beeindruckt. Gut. Er kam seinem Ziel näher.
»Wir Iren sind leichtfüßig. Ich bin beweglicher, als ich aussehe. Ich habe die absolute Kontrolle über jeden meiner Körperteile.« Er riskierte es, mit der rauen Spitze seines Daumens über ihr Handgelenk zu streichen.
Sie musste die Andeutung verstanden haben, denn sie verdrehte ihm den Arm so heftig, dass sie einem schwächeren Mann das Schultergelenk ausgerenkt hätte. Aber sie schnitt ihn nicht wieder. Also … ein Fortschritt.
»Das glaube ich kaum«, erwiderte sie trocken. »Im Moment kontrolliere ich einige Teile, stimmt’s?«
Machte ihn das nicht mehr an, als es sollte? Er hatte sich noch nie von einer Frau fesseln lassen, aber er würde sich mit Vergnügen jeder Folter unterwerfen, die sie sich ausdenken mochte.
»Noch nie hat es jemand bei mir mit Der Sturm versucht.« Sie klang, als würde sie lächeln.
Sie kannte Shakespeare? Danny Boy beschloss, den Rest seines Lebens mit ihr zu verbringen. Sie würden wunderschöne Kinder zeugen.
Eine Tür schlug zu. »Zoya?«, brüllte eine raue, männliche Stimme.
»›Ich folge dir und finde Wonn’ in Not, gibt die geliebte Hand mir nur den Tod.‹« Danny Boy beschloss, sich an das zu halten, was funktionierte. Bei Shakespeare fand man für jede Situation das passende Zitat.
Der Druck des Messers an seiner Kehle ließ etwas nach. »›Begegnet Lieb’ Euch rauh, so tut desgleichen!‹« Ein Zwicken an seinem Ohr unterstrich die Herausforderung.
»Meine Güte, wenn wir keine Gesellschaft hätten, hätte ich dich schon längst gegen die erstbeste harte Stelle gedrückt.« Okay, das hatte Shakespeare nicht gesagt, aber er hätte es sicher sagen wollen.
»Dann …« Sie ließ ihn los. »Schaff uns unsere Gesellschaft vom Hals.«
»Hast du den Sprengstoff dabei, den wir bestellt hatten?«
»Nein«, gestand sie.
»Gut.« Er grinste, packte ihr Handgelenk und rannte in Deckung.
Die Explosion war nichts im Vergleich zu dem, was kommen würde, sobald er sie aus diesen Stiefeln herausgeholt hatte.
1
Was Fliegen für muthwillige Knaben sind,
sind wir den Göttern; sie tödten uns
zu ihrem Zeitvertreib.
William Shakespeare, König Lear
Wenn er so spät am Abend von der Zentrale aus angerufen wurde, konnte das nur eins bedeuten: eine Leiche.
Luca Ramirez rieb sich müde übers Gesicht und blinzelte ein paarmal, um die Schlieren auf seinen Kontaktlinsen wegzuwischen. Es funktionierte nicht. Vielleicht herrschte draußen Nebel? Um Mitternacht konnte beides der Fall sein. Er war so erledigt, dass das Licht der Straßenlaternen ineinanderfloss, und er würde sich alle Mühe geben müssen, seinen neuen Dienstwagen, einen schwarzen Dodge Charger, nicht zu Schrott zu fahren. Weiter gingen seine Pläne für den Rest des Wochenendes vorläufig nicht. Plötzlich spürte er ein so starkes Verlangen danach, das Handy zu packen und in den Willamette River zu werfen, dass er sich am Lenkrad festklammern und erst einmal tief einatmen musste, bevor er danach griff.
»Ramirez«, bellte er.
Die weibliche Stimme am anderen Ende war das Äußerste an Nachtleben, das ihm in letzter Zeit vergönnt gewesen war. Und das war wirklich eine Schande, denn die dazugehörige Frau war zwanzig Jahre älter, doppelt so lange verheiratet und Großmutter von Zwillingen.
»Die Polizei hat gerade einen 10–90-Notruf vom Ufer des Flusses bekommen. Ein Obdachloser hat ihn vom Cathedral Park aus gewählt.«
Von Zeit zu Zeit war es einfach zum Kotzen, wenn man recht behielt.
»Ich dachte, ich gebe Ihnen schon mal Bescheid, weil Sie in der Gegend wohnen.« Beatrice Garber, die die Nachtschicht in der Telefonzentrale machte, wusste, dass er in der Nähe vom Cathedral Park sein musste, weil er ihr vor gerade mal einer Viertelstunde zum Abschied zugewunken hatte, als er endlich sein Büro im FBI-Hauptquartier verlassen hatte.
»Äh, Bea, ich habe einen Vierzehn-Stunden-Tag hinter mir. Ich brauche dringend ein paar Stunden Schlaf.« Vor fünf Jahren wäre er auf den Anruf hin sofort losgedüst. Vor fünf Jahren war er auch noch in seinen Zwanzigern gewesen. »Passt die Leiche tatsächlich in das Schema?«
Bea schwieg einen Moment. »Das Opfer wird beschrieben als weiblich, rothaarig, eingehüllt in weiße und rote Gewänder.«
»Verdammt«, fluchte er und hämmerte auf das Lenkrad ein. »Mist!« Das war es, was er befürchtet hatte. Deswegen hatte er die ganzen letzten Monate bis zum Umfallen geschuftet. Er hatte sich das Versprechen gegeben, Johannes den Täufer zu erwischen, bevor er einen weiteren Menschen tötete. »Dieser schwanzlutschende Huren…«
»Ich bin noch hier«, flötete Bea, halb amüsiert, halb tadelnd.
»Ich übernehme.« Luca schaltete den Lichtbalken ein. »Rufen Sie Di Petro an, außerdem die Spurensicherung, das Labor …«
»Schon dabei.«
Er warf sein Handy auf den Beifahrersitz und trat das Gaspedal bis zum Boden durch. Sein Wagen machte einen Satz wie eine Raubkatze und schoss durch den nachlassenden Freitagabendverkehr.
Unter den tief hängenden Wolken, die drohten, ihren Inhalt jeden Moment herabregnen zu lassen, war das Wasser des Willamette River in dieser Nacht nicht zu sehen. Es wirkte eher wie ein breites, dunkles Band, das die hellen Lichter Portlands in zwei Hälften teilte. In Downtown würde sich das Stadtbild im Wasser spiegeln und so eine instabile Visualisierung der architektonischen Giganten des Nordwestens schaffen.
Die Abzweigung auf die Pittsburgh Avenue nahm er auf zwei Rädern, um dann quietschend neben dem einzigen Streifenwagen auf dem kleinen Parkplatz beim Cathedral Park zum Stehen zu kommen. In spätestens zehn Minuten würde dieser Ort von mehr Blitzlichtern erhellt sein als Downtown bei einer Technoparty.
Er sprang aus dem Wagen. Die feuchtkalte Oktoberluft drang ihm in die Lungen und gab ihm das Gefühl, Eiswürfel einzuatmen. Immerhin wurde so zu Ende gebracht, was der Adrenalinschub angestoßen hatte: Er war hellwach und voll und ganz da.
Das Nordufer des Flusses war in tiefe Dunkelheit getaucht, trotz der Verkehrsampeln oben auf der St. Johns Bridge und einiger matter Straßenlaternen in der Umgebung, die die berühmten Steinpfeiler beleuchteten, auf denen der Viadukt über dem Park ruhte.
Im Vorbeigehen warf er einen Blick auf den Streifenwagen. Das hintere Fenster war herausgeschlagen worden, das Sicherheitsglas bildete auf dem Boden einen wüsten Haufen, in dem sich das blaue und rote Licht abwechselnd spiegelten. Luca ging mit gezogener Waffe um den Wagen herum und hielt nach einem verletzten Polizisten Ausschau. Als er keinen fand, ließ er den Blick über die menschenleere Umgebung schweifen.
Hatten sie den Tatverdächtigen erwischt? War er geflohen?
Vorsichtig stieg er über die Betonmauer und bahnte sich durch eine schmale Reihe von Bäumen einen Weg zum Ufer. Er lief auf die Kegel zweier Taschenlampen zu, mehrere Meter die Uferböschung hinunter, die Dienstwaffe seitlich am Körper.
Zwei Polizisten richteten die Waffen auf ihn, und er hörte die Entsicherungshebel klicken. »Bleiben Sie sofort stehen«, sagte einer der Uniformierten. »Das hier ist ein abgesicherter Tatort.« Ein fetter Regentropfen traf Lucas Nasenrücken, woraufhin sein Bedürfnis wuchs, die Leiche anzuschauen, bevor sämtliche Beweise von einem Unwetter davongespült würden.
»FBI. Special Agent Ramirez. Ich werde jetzt mit der linken Hand meine Marke rausholen.« Er wusste genau, dass er an einem Tatort keine plötzlichen Handbewegungen machen durfte.
»Zeigen Sie her«, kam die unwirsche Antwort.
Luca ging weiter auf die beiden zu, griff in seine Tasche und zog die Marke und den Ausweis heraus, die ihn eindeutig als FBI-Agenten identifizierten.
Die Polizisten senkten ihre Waffen.
»Ist die Leiche eine von seinen?« Luca brauchte den Namen nicht auszusprechen.
»Sieht so aus.« Die Polizisten richteten den Strahl ihrer Taschenlampen wieder auf das regungslose weiße Bündel, das teilweise in einen roten Stoff eingehüllt war. Luca musste die blinden Flecken wegblinzeln und seine Augen wieder an die Dunkelheit gewöhnen.
Auf den ersten Blick konnte man das unförmige, dreckige Bündel in der Dunkelheit leicht für Abfall halten, der an das schmale Ufer gespült worden war, aber das war offenkundig unmöglich. Luca sah flussaufwärts und stellte spontan ein paar Berechnungen an.
Der Cathedral Park lag an einer Biegung des Willamette, was einem den flüchtigen Eindruck vermittelte, es handle sich um einen malerischen Park in der Vorstadt. Dabei lag er zwischen zwei der größten Hafenindustriekomplexe von Portland. Hinter der westlichen Biegung beluden Swan Island Basin und Northwest Industrial Dutzende von Schiffen und betrieben weltweiten Handel. Von der Ostseite des Parks bis fast zu der Stelle, wo Willamette und Columbia zusammenflossen, erstreckten sich mehrere Quadratmeilen Arbeiterparadies, mit allem, was dazugehörte, von Firmen für Reifenentsorgung und -recycling bis hin zu Speditionen.
Luca registrierte die verschatteten Vorsprünge der alten Pfeiler entlang des gesamten Westufers des Flusses und die Stellen, an denen sich am Ufer Treibholz angesammelt hatte, und wie weit dieses von der schmalen Reihe von Bäumen entfernt war. Um an das Ufer zu gelangen, hätte die Leiche auf wundersame Weise durch die Pfeiler hindurchtreiben und dann fast einen Meter weit an Land gespült werden müssen.
Luca spürte einen weiteren kalten Tropfen auf seinen Kopf fallen. »Hat einer von Ihnen die Leiche bewegt?«, fragte er streng.
Der ältere der beiden Polizisten kniff die blauen Knopfaugen zusammen und schob seinen Waffengürtel auf seinen mächtigen Wanst hoch. Der andere, ein junger Afro-Amerikaner, schüttelte den Kopf.
»Das ist ab sofort mein Tatort, verstanden?«
Er war zu erschöpft und zu genervt für Diplomatie und riss die Leitung einfach an sich, bevor der Fettwanst ihm mit irgendwelchen Vorschriften kam und ihm die Nacht noch mehr versaute. Er war auch nicht in der Stimmung, auf FBI-Verstärkung zu warten. »Nehmen Sie Ihr Funkgerät und sagen Sie den Streifen hier in der Gegend, sie sollen nach demjenigen suchen, der Ihr Fenster eingeschlagen hat und vom Rücksitz Ihres Wagens geflohen ist. Und dann erkundigen Sie sich, wann der Coroner und die Spurensicherung hier eintreffen.«
Der ältere Polizist und er wogen in etwa gleich viel, aber mit seinen 1,87 Metern war Luca gut zehn Zentimeter größer als der andere. Außerdem war Lucas kräftige Gestalt das Ergebnis von regelmäßigem Gewichtstraining und Rugby oder Football am Wochenende, und nicht von trockenen Donuts und zu vielen Reuben-Sandwiches. Er hätte seine Lieblings-Sig-Sauer verwettet, dass der Typ Diabetiker war. Er wandte sich an den Jungen, überging einfach gut neunzig Kilo geifernde Wut. »Sagen Sie mir, was Sie bis jetzt haben.«
Der Junge riss die Augen auf, sodass sich das Weiße hell gegen sein dunkles Gesicht abzeichnete. »Er … er ist geflohen?« Er wirkte grimmig und gedemütigt zugleich, fing sich jedoch rasch wieder.
»Wir waren auf Patrouille im Park, als wir vor ein paar Minuten einen Anruf von der Zentrale bekamen. Ein offensichtlich Nichtsesshafter hatte gemeldet, er habe eine Leiche aus dem Wasser gefischt.« Luca zog Latexhandschuhe aus der Tasche und trat an die Leiche heran. Er wartete, dass der Junge ihm etwas erzählte, was er noch nicht wusste. »Der Obdachlose hatte einen totalen psychotischen Schub, als wir hier ankamen. Ich dachte, O’Reilly hätte ihm im Streifenwagen Handschellen angelegt.«
O’Reilly. Luca fügte den Dreckskerl seiner schwarzen Liste hinzu. Wie hatte er es versäumen können, den armen Kerl vernünftig zu sichern? So etwas war ein Anfängerfehler, der Leben kosten konnte.
»Tja, hat er aber nicht«, stellte Luca das Offensichtliche fest. Hinzu kam, dass die beiden Polizisten trotz der Entfernung und des Verkehrslärms das Zerbersten der Heckscheibe hätten hören müssen. Sein Gesicht begann zu brennen, ein Symptom seines in die Höhe schnellenden Blutdrucks. »Richten Sie Ihre Taschenlampe auf die Leiche«, befahl er, stocksauer über die Inkompetenz der beiden Männer.
Luca zwang sich, systematisch vorzugehen, mit anderen Worten: die einzelnen Teile von der Gesamtheit der Leiche abzuspalten. Er begann mit den Händen.
Die Nägel waren weder lackiert noch unecht, sondern zugefeilt und gepflegt. Anders als bei den anderen.
»Jagt Johannes der Täufer wirklich Pflöcke durch ihre Hände, während sie noch leben?« Der Polizist benutzte den Namen, den Öffentlichkeit und Medien dem schlimmsten Serienmörder verpasst hatten, den die Nation seit Jahrzehnten erlebt hatte.
»Wie man Jesus ans Kreuz genagelt hat.« Luca zog die Handschuhe an und verfluchte innerlich den leichten Regen, den er in den Fluss plätschern hörte. Obwohl es für sie keine Rolle mehr spielte, musste er das Bedürfnis unterdrücken, die kleine, weitgehend nackte Frau zuzudecken und sie vor dem eisigen Regen zu schützen.
Luca ging neben ihr in die Hocke und bog ihre schlanken Finger auf. Der junge Polizist schnappte nach Luft und fluchte. Solche Empfindlichkeiten kannte Luca schon seit langer Zeit nicht mehr. In der Handfläche klaffte ein etwa zweieinhalb Zentimeter langes und fünf Millimeter breites Loch. Blut, vermischt mit Wasser und Dreck aus dem Fluss, bedeckte ihre blasse Haut. Die Hand war noch elastisch, und die Finger ließen sich leicht bewegen, die Totenstarre hatte also noch nicht eingesetzt.
Dieser Mord war erst vor Kurzem begangen worden.
Luca kniff mehrmals die Augen zu, als könne die Nacht ein paar Antworten für ihn bereithalten. Johannes der Täufer hielt sich vielleicht in der Nähe auf. Vielleicht beobachtete er sie sogar. Als der Regen stärker wurde, ihm das Haar an den Kopf klebte und ihn in seinem Anzug zittern ließ, seufzte er entnervt auf.
Eigentlich stellte der Regen keine besondere Komplikation dar. Dass es irgendwelche Spuren gab, die der Regen fortwaschen konnte, war reines Wunschdenken. Dieser Hurensohn hinterließ nie Spuren. Nur eine weitere hübsche Rothaarige mit Löchern in den Händen und einer Stichwunde in der Seite, die noch dazu im Fluss getauft worden war. Normalerweise waren die Leichen fest in weiße und rote Messgewänder eingehüllt, wie ein schauriger Burrito, aber diese hier war bis zur Taille nackt, die Gewänder hatten sich um die untere Körperhälfte gewickelt, und sie war voller Schlamm und Blut.
In der Ferne heulten Sirenen, einige aus Richtung Universität, andere von der Brücke her.
O’Reilly kam leicht außer Atem auf sie zugestolpert. »Diese Hure muss eine von den erstklassigen, teuren gewesen sein«, bemerkte er, ohne den Blick von den perfekten blassen Brüsten des Opfers abzuwenden.
Luca und der andere Polizist sahen sich an. Es tröstete Luca, dass der junge Mann genauso angewidert zu sein schien, wie er selbst es war. Bei seinem Job traf man auf alle möglichen Arten von Bullen. Nicht immer waren sie die Guten. Manchmal hatten die Kriminellen einen respektableren Verhaltenskodex.
Luca stählte sich innerlich und blickte dann auf ihr Gesicht. Ihre Augen waren geschlossen. Gott sei Dank.
O’Reilly hatte seine Kamera aus dem Wagen geholt und machte jetzt Fotos, wie es den Vorschriften entsprach. Die Vorstellung, dass dieser lausige Bulle diese Fotos hatte, behagte Luca ganz und gar nicht. Objektiv betrachtet hatte der Mistkerl recht. Diese Frau sah besser aus als die meisten anderen Opfer. Sie war nicht nur hübsch, sondern schön. Jung, Mitte zwanzig, mit einem geschmeidigen Körper, der offensichtlich – ihm fiel die fehlende Behaarung auf – gut gepflegt worden war. Die Stichwunde an der linken Taille nässte noch ein wenig. Das Blut mischte sich mit dem Regen und lief in rosa Rinnsalen in die Gewänder unter ihr.
Ihre elfenbeinfarbene Haut war makellos, abgesehen von ein paar blauen Flecken sowie Spuren von Fesseln an Handgelenken und Fußknöcheln. Sie war eine unbestimmte Zeit lang gefesselt gewesen, genau wie all die anderen, und sie war durch die Hölle gegangen, bevor sie gestorben war.
Wieder überfiel ihn die Müdigkeit. Oder war es eher Erschöpfung? Armes Mädchen. Luca war egal, wie sie vor ihrem Tod gelebt hatte. Von ihm aus konnte sie auch die Hure Babylon gewesen sein, das spielte für ihn keine Rolle. Die meisten vorherigen Opfer waren Huren gewesen. Egal. Vorher hatte sie gelebt, war ein Mensch mit Bedürfnissen, Wünschen, Zielen und Hoffnungen gewesen – und mit Schmerzen. Vielleicht gab es jemanden, der sie liebte und vermisste. Vielleicht auch nicht. Trotzdem war sie wichtig. Sie verdiente, dass ihr Gerechtigkeit widerfuhr. Egal, wer sie war.
Luca hörte Schritte, die Rufe seiner Kollegen. Das Atmen bereitete ihm Schmerzen. »Wir müssen ihre Identität so rasch wie möglich …«
»Heiliger Bimbam!« Der junge Polizist zuckte zurück und deutete verblüfft auf die Leiche.
Die Kamera zerbarst, als O’Reilly sie auf den steinigen Boden fallen ließ.
»Was zum Teufel ist mit Ihnen los?«, fuhr Luca die beiden an.
Dann sah er es selbst. Ein Zittern durchlief die Leiche. Einmal. Zweimal. Dann hob sich heftig ihre Brust.
»Rufen Sie einen Krankenwagen, und zwar sofort«, brüllte Luca.
Die Stimme des Jungen überschlug sich fast, als er in sein Funkgerät schrie. Die kaputte Kamera war vergessen. Luca ging auf die Knie und drückte ein paarmal auf die Brust der Frau, bevor er ihren bebenden Körper auf die Seite rollte. Unter heftigen Zuckungen erbrach sie eine alarmierende Menge dreckiges Wasser, bevor sie pfeifend einatmete, um danach noch mehr Wasser herauszuhusten. Der kalte Regen musste sie irgendwie wiederbelebt haben, und ihr Körper versuchte verzweifelt, trotz des Wassers in ihren Lungen zu atmen.
»Genau. So ist es gut. Husten Sie weiter.« Er achtete darauf, dass sie nichts von dem einatmen konnte, was sie erbrach.
»Das … das ist doch nicht möglich«, stammelte O’Reilly. »Sie war kalt. Sie hat nicht geatmet. Sie … sie hatte keinen Puls!«
»Wo haben Sie danach getastet?«, fauchte Luca ihn über die Schulter hinweg an, während er ihr ein paar ermunternde Klapse auf den Rücken gab.
»Am rechten Handgelenk. Ich wollte die Leiche nicht bewegen.« O’Reillys Stimme war nur noch ein schrilles Wimmern.
»Das kostet Sie Ihre Marke, Sie dumme Nuss, dafür sorge ich«, knurrte Luca. Am rechten Handgelenk eines Opfers, das nicht atmete und aus mehreren Wunden blutete, nach einem Puls tasten? Hätte er eine noch schlechtere Stelle finden können? Jeder, der auch nur ein bisschen Ahnung hatte, tastete am Hals. Hätte der Idiot einen schwachen Puls mit seinen Wurstfingern überhaupt spüren können?
Luca riss sich die Anzugjacke vom Leib und wickelte ihren Oberkörper darin ein, nicht nur, um sie zu wärmen, sondern auch, um sie vor O’Reillys gierigem Blick abzuschirmen. Befriedigt stellte er fest, dass sie zwischen den Hustenanfällen immer wieder Luft in die Lungen sog.
Sie würde nicht lange überleben, wenn ihre Wunden nicht bald versorgt wurden. »Wo bleibt der verdammte Krankenwagen?«, rief er.
»Schon unterwegs«, rief jemand zurück. »Der nächste Standort ist keine vier Blocks entfernt, in zwei Minuten ist er da.«
Er hoffte, sie hatte noch zwei Minuten. Die Nachricht, dass das Opfer lebte, hatte sich wie ein Lauffeuer unter den immer zahlreicher eintreffenden Polizeikräften verbreitet. Je mehr Leute auftauchten, desto größer war die Chance, dass ihm irgendein mitdenkender Mensch einen Erste-Hilfe-Kasten brachte.
»Hier.« Eine offene schwarze Plastikkiste voller Bandagen, Tabletten, Antiseptika, steriler Pflaster und sonstiger Erste-Hilfe-Utensilien wurde ihm in die Hand gedrückt. Er sah hoch. Detective Regan Wroth von der Mordkommission des Portland Police Department kniete auf der anderen Seite des Opfers.
Luca mochte sie. Himmel, er hatte mehr als einmal versucht, sie flachzulegen, genau wie alle anderen männlichen Mitglieder der Polizei von Portland.
»Danke.« Er riss ein paar Bandagenpackungen auf und nahm seine Jacke, um die Bandagen damit gegen die Seite des Opfers zu pressen. »Drücken Sie hier«, wies er Wroth an. Sie bedachte ihn mit einem Ich-bin-doch-nicht-blöd-Blick, sagte aber nichts. Er wusste, dass er sie nicht nur mochte, weil sie wie eine kluge Version von Emilia Clarke aussah.
Sobald Wroth Druck auf die Wunde ausübte, riss die junge Frau die Augen auf und schlug wild um sich. Ein heiserer Schrei entrang sich ihrer Kehle, dann versuchte sie, Luca am Hemd zu packen. Sobald es ihr gelungen war, stieß sie erneut einen schmerzerfüllten Schrei aus und zog ihre verletzten Hände in den Schutz ihres zusammengekrümmten Körpers. Ihr panischer Blick wanderte von Gesicht zu Gesicht, und ihr verängstigtes Schluchzen wurde immer wieder von kräftezehrenden Hustenanfällen unterbrochen.
»He. He … ganz ruhig.« Luca ergriff sanft ihre schlanken Handgelenke. »Ich weiß, das tut weh. Aber wir müssen die Blutung stoppen.« Er hockte sich so hin, dass er ihr Gesichtsfeld möglichst ausfüllte, in der Hoffnung, all das Chaos und die Gesichter und die blinkenden Lichter abblocken zu können. »Schauen Sie mich an, Süße«, sagte er freundlich, als sie ihre weit aufgerissenen grünen Augen auf ihn richtete.
Sie blinzelte unentwegt, hörte aber auf zu schluchzen. Zitternd starrte sie ihn an, und ihre Tränen vermischten sich mit dem Regen. Sofort trat das Chaos um sie herum in den Hintergrund. Wieder durchlief Luca ein Schauder, doch nicht, weil ihm sein dünnes Hemd klatschnass am Körper klebte. Als sich ihre Blicke trafen, war es, als würde ein Puzzlestück an seinen richtigen Platz geschoben. Das Gefühl, das sein Herz mit dem Druck eines eisernen Schraubstocks packte, rief Assoziationen wie Schicksal und Vorhersehung wach.
Dabei glaubte er nicht einmal an solchen Mist.
Lucas Gehirn wehrte sich gegen dieses Gefühl, wie sich ein Körper gegen eindringendes Gift wehrt. Dieses Mädchen – diese Frau – war nicht nur ein Opfer, sondern auch eine Zeugin. Seine Zeugin. Sie hatte dem Teufel in die Augen gestarrt. Er hatte sie gekreuzigt, erstochen und ersäuft, und doch war sie an der Schwelle zum Tod stehen geblieben und umgekehrt. Dieses seltsame Gefühl epischer Größe konnte also nur bedeuten, dass sie vielleicht die Schlüsselfigur war, die dem Bösen, das die Frauen dieser Stadt in Angst und Schrecken versetzte, ein Ende bereitete. Zumindest war Luca wild entschlossen, sich an diese Interpretation zu halten.
»Sie brauchen eine Decke«, stellte er fest. »Verdammt, besorgt vielleicht mal jemand eine Decke?«, rief er über die Schulter. Sein Zorn legte sich ein wenig, als er sah, welche Hektik ausbrach, um seinem Befehl nachzukommen. An guten Tagen geschah es selten, dass Leute ihm widersprachen. Aber in einer Nacht wie dieser? Er hoffte inständig, irgendjemand würde ihn blöd anreden, denn er brauchte dringend jemanden, an dem er seine Wut auslassen konnte.
Als er sich wieder zu ihr umwandte, sah er in ihren grünen Augen etwas, womit er nun wirklich nicht gerechnet hatte. Hoffnung. Erleichterung. Vertrauen?
Wortlos hielt sie ihm die verletzten Hände hin, wie ein Kind, das seiner Mutter eine harmlose Wunde zeigt. Tränen rannen ihre Wangen hinab. Es zerriss ihm schier das Herz, aber er war auch unglaublich erleichtert, dass sie überhaupt eine Reaktion zeigte.
»Ich weiß«, murmelte er und presste behutsam Gaze auf ihre Handflächen. »Ich weiß. Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Können Sie bis dahin durchhalten, mir zuliebe?«
Vielleicht stellte die leichte Bewegung ihres Kopfes ein Nicken dar.
»Braves Mädchen.« Er legte ihr die Hand aufs Haar und sah erneut über die Schulter. »Verdammt!«, explodierte er. »Wir haben bald zwanzig Grad minus, und keiner von euch Idioten kann eine Decke auftreiben? Aye, chingau, pendejos! Man hat sie gerade erst aus dem Fluss gefischt! Ich schwöre bei der Madre de Dio …«
Eine Decke wurde in seine Hände gelegt, eine dieser rauen Notfallwolldecken, wie sie die Leute in ihrem Kofferraum spazieren fahren, in der Hoffnung, sie nie benutzen zu müssen.
Hatten sie die erst weben müssen, bevor sie sie hierhergeschafft hatten?
Wroth half ihm, die Decke aufzuschlagen und über das Opfer zu legen. Noch immer spürte er die junge Frau unter seinen Händen zittern. Wenn es Komplikationen wegen Unterkühlung geben sollte, würde er O’Reilly mit dessen eigenem Schlagstock zu Tode prügeln. Wenn sich ihr Zustand weiter verschlimmerte, würde dieses fette Arschloch die volle Wucht seines Zorns zu spüren bekommen.
Luca atmete tief die kühle Luft durch die Nase ein und gab beim Ausatmen ein zischendes Geräusch von sich. Was hatte er im Wutbewältigungsseminar gelernt? Während er langsam bis zehn zählte, erst auf Englisch, dann auf Spanisch, stopfte er behutsam an der Stelle, wo Wroth noch immer auf die Wunde drückte, die Decke unter den Körper des Opfers.
Wroth sagte nichts, sah ihn nur mit gerunzelter Stirn an.
»Habe ich gerade wirklich auf Spanisch gebrüllt?« Er hantierte viel länger mit der Decke herum, als nötig war. Im College hatte er sich seinen spanischen Akzent völlig aberzogen. Nur bei Wutausbrüchen fiel er in seine Muttersprache zurück. In letzter Zeit hatte er das im Griff gehabt. Meistens.
»Und wie.«
»Tut mir leid«, murmelte er, mehr an das Opfer als an den Detective gerichtet.
Die junge Frau sah ihn verblüfft an. Sie schien vollauf damit beschäftigt zu sein, zu keuchen und zu zittern. Ihn überkam das leichtsinnige und verstörende Bedürfnis, ihren zitternden Körper in die Arme zu nehmen und ihr von seiner Wärme abzugeben, und er ballte abwehrend die Fäuste.
Jemand brüllte, dass der Krankenwagen da sei. Er war wirklich schnell gekommen, aber die Blässe der jungen Frau machte ihm allmählich ernsthaft Sorgen.
»Sie sehen aus, als hätten Sie einen höllischen Tag hinter sich, Ramirez«, sagte Wroth mit ihrer samtigen Stimme, mit der sie schon so manchem ahnungslosen Kriminellen ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt hatte. »Fahren Sie nach Hause und schlafen Sie ein paar Stunden. Ich fahre mit ihr im Krankenwagen und rufe Sie …«
»Nein!«
Beide sahen sie überrascht nach unten.
Das Opfer versuchte verzweifelt, sich zu ihm hin zu rollen, und streckte ihm die verletzten Hände entgegen, von denen sich dadurch die Gaze löste. Wild um sich blickend rief die junge Frau: »Nein! Nein! Sie!« Sie schüttelte heftig den Kopf.
»He, schon gut. Beruhigen Sie sich.« Er fasste sie behutsam an den Schultern, um ihre hektischen Bewegungen zu stoppen.
Sie versuchte, trotz ihrer klappernden Zähne etwas zu sagen. »Lassen Sie … mich nicht … allein.«
»Okay. Ich fahre mit Ihnen ins Krankenhaus. Aber Sie müssen unbedingt still liegen, Süße. Ihre Seite fängt schon wieder an zu bluten.«
Sie gehorchte sofort und entspannte sich.
Er wechselte einen Blick mit Wroth. Die junge Frau hatte sie beide gerade völlig schockiert. Warum wollte sie nicht den freundlichen und hübschen, nichtsdestotrotz fähigen weiblichen Detective dabeihaben, sondern ihn gereizten, vulgären Idioten?
Im Geheimen vermutete Luca, dass er Wroth sowieso widersprochen hätte. Himmel, er hätte gar nicht groß widersprechen müssen. Er wäre einfach mit in den Krankenwagen eingestiegen. Aus irgendeinem lächerlichen Grund machte ihn die Vorstellung, sie der Obhut einer anderen Person zu überlassen, total verrückt. Wenn nun etwas auf dem Weg zum Krankenhaus passierte? Wer achtete darauf, dass die Sanitäter ihre Arbeit richtig machten? Oder die Ärzte, sobald sie in der Notaufnahme war?
Es ging nicht um das Bleigewicht, das er jedes Mal in seinem Bauch spürte, wenn er sie ansah. Oder um die unpassenden primitiven Instinkte, die sein Blut in Wallung brachten. Damit hatte das gar nichts zu tun. Sie war seine erste und einzige Zeugin in diesem Fall. Verdammt, er würde sie sich nicht für ein paar Stunden Schlaf durch die Lappen gehen lassen.
»Entschuldigung, Sir.« Eine winzige Sanitäterin mit honigfarbener Haut und ihr blonder Partner schoben ihn zur Seite und stellten rasch die Tragbahre ab. Ihre Zusammenarbeit war effektiv, und es schien ihnen nichts auszumachen, dass er neben ihnen hocken blieb.
»Sie können helfen, sie den Hügel hinaufzutragen, und ich übernehme die Erstversorgung«, befahl die Frau Luca und deutete auf die offenen Wunden.
Luca mochte sie auf Anhieb. Wieso gab es nicht mehr Frauen in diesem Beruf? Seiner Erfahrung nach bewahrten Frauen in Krisensituationen eher einen kühlen Kopf und klappten erst später zusammen. Damit schlug er sich lieber herum als mit solchen Riesenarschlöchern wie O’Reilly.
Sobald sie im Krankenwagen waren und auf das Legacy Emanuel Medical Center zurasten, beugte er sich zu dem Opfer hinunter, um es davon abzuhalten, in einen Schockzustand abzugleiten.
Sie zu wärmen bedeutete eine bessere Blutzirkulation. Obwohl die Sanitäterin etwas von ihrer Arbeit zu verstehen schien und die Vitalfunktionen des Opfers stabiler waren, als er erwartet hatte, hatte er noch immer höllische Angst, sie könne es nicht schaffen.
»Wie heißen Sie?«, fragte er und strich ihr eine schmutzige Haarsträhne aus der Stirn.
Sie versuchte, den Blick auf sein Gesicht zu richten, dann flüsterte sie: »Hero.«
Ein trauriges Lächeln spielte um seinen Mund. »Nein, ich bin kein Held, Mädchen. Ich bin alles andere als ein Held.«
2
Was ist ein Name? Was uns Rose heißt,
Wie es auch hieße, würde lieblich duften.
William Shakespeare, Romeo und Julia
Hero Viola Katrova-Connor. Was für ein bizarrer Name!
Luca saß auf dem unbequemen Stuhl, der jedes Mal ein furzendes Geräusch von sich gab, sobald er sich bewegte, und ließ die Gedanken schweifen, während er gleichzeitig das regelmäßige Heben und Senken ihrer Brust beobachtete. Dieser Rhythmus und das gleichmäßige Geräusch der Maschinen hatten eine hypnotisierende Wirkung auf ihn. Er starrte jetzt schon seit – er sah auf seine Uhr – einer guten halben Stunde vor sich hin. Verdammt. Er hätte geschworen, dass noch keine fünf Minuten vergangen waren, seit man sie in dieses Einzelzimmer gebracht hatte.
Sie war ausgeflippt, als die Leute in der Notaufnahme sie hatten trennen wollen. Ihr entsetzter Blick ging ihm nicht aus dem Kopf. Sie hatte gebettelt, man möge ihn bei ihr bleiben lassen, und schließlich hatte man erlaubt, dass er blieb, bis das Beruhigungsmittel wirkte. Bei ihm fühlte sie sich geborgen, nahm Luca an, aber er konnte beim besten Willen nicht verstehen, wieso. Die meisten Menschen, die beruflich mit ihm zu tun bekamen, konnten es kaum erwarten, möglichst schnell von ihm wegzukommen.
Sein Blick wanderte zu ihren Händen, die in dicke Verbände eingewickelt zu beiden Seiten ihres Körpers lagen. Am liebsten hätte er etwas an die Wand geworfen, und um den Impuls zu unterdrücken, begann er, sie genauer zu betrachten. Ihre Nase, in der jetzt die Schläuche vom Sauerstoffgerät steckten, war klein und wohlgeformt, dazu mit ein paar wenigen Sommersprossen gesprenkelt, die ihm vorher entgangen waren. Ihr ovales Gesicht war fein geschnitten und verlieh ihr einen Hauch jugendlicher Unschuld. Ihr Körper war kräftig, mit Kurven an all den richtigen Stellen, und – wie er sich erinnerte – muskulös wie der einer Athletin.
Als Prostituierte würde sie jede Menge Kohle machen.
Sie war drei nicht enden wollende Stunden lang im OP gewesen. Nachdem sie in die Notaufnahme gerollt worden war, hatte Barbara, die Verwaltungsangestellte mit den katzenartigen Fingernägeln und den toupierten Haaren eines Texas-Landeis, Hero als eine der regelmäßigen freiwilligen Helferinnen des Krankenhauses erkannt. Noch etwas, das nicht in das Schema Johannes’ des Täufers passte. Gierig danach, endlich auf eine Spur zu stoßen, hatte Luca die arme Barbara über eine Stunde lang ausgequetscht. Bis er mit ihr fertig war, mochte ihn die Angestellte auch nicht mehr. Welch Überraschung.
Trotz ihrer Tränen und ihres Hinterwäldlerdialekts hatte er herausgefunden, dass das Opfer Yoga-Lehrerin und eine in der Gegend recht bekannte Künstlerin war. Wie es schien, stellte sie Keramiken her. Barbara hatte ihm sogar einen hellrosa Kaffeebecher mit gelben geschlängelten Linien gezeigt, den sie bei einer weihnachtlichen Wohltätigkeitsveranstaltung gekauft hatte. Als sie den Kaffeebecher in der Hand gehalten hatte, waren die Tränen noch heftiger geflossen, und ihr Make-up war in die Fältchen rund um ihre Augen zerlaufen.
Nein, sie wisse nicht, ob Hero mit jemandem zusammen sei.
Nein, es sei unvorstellbar, dass sie Feinde habe.
Nein, sie könne nicht sagen, wo Hero wohne und womit sie sonst ihren Unterhalt verdiene. Und Luca sei ein Schwein, da er auch nur anzudeuten wage, sie sei irgendetwas anderes als ein wahrer Engel.
Danach war die Frau zu nichts mehr zu gebrauchen gewesen. Luca hatte sie weggeschickt, damit sie ihr Gesicht zurechtmachen konnte.
Inzwischen wurde fieberhaft daran gearbeitet, alles an Informationen über Hero zusammenzutragen. Eine Armee von FBI-Angestellten untersuchte ihre Vergangenheit. Er würde alles über sie erfahren, von ihrem Wohnort über ihre Krankengeschichte bis hin zu ihrem Lieblingsnagellack.
Bis der Chirurg aufgetaucht war, um eine Prognose abzugeben, hatte Luca einen neuen Weg in den abgetretenen Teppich des Wartezimmers gelaufen. Sie hatten einen Teil des Dickdarms entfernen und einen kleinen Riss in der Niere verschließen müssen. Hero hatte mehrere Bluttransfusionen erhalten, und es bestand nach wie vor Sorge wegen der Parasiten im Flusswasser. Andererseits hatte ihr die Tatsache, dass sie einige Zeit in dem eiskalten Wasser verbracht hatte, vermutlich das Leben gerettet. Sie war kräftig und gesünder als viele andere, also würde sie voraussichtlich überleben. Diese Nacht schien ihre Glücksnacht zu sein.
Wenn man davon absah, dass sie einem Mörder in die Hände gefallen war.
Erleichtert hatte Luca sich auf den Stuhl fallen lassen und sich nicht mehr gerührt. Er starrte auf seine Bruno-Magli-Palatino-Cap-Toe-Boots. Seine Schuhe zu betrachten half ihm beim Denken. Regen und Schlamm hatten ihnen nicht gutgetan. Luca seufzte. Das hatte er nun davon, dass er vierhundert Dollar teure Schuhe bei der Arbeit trug.
Dieser Mordanschlag ergab einfach keinen Sinn. Bisher waren die Opfer von Johannes dem Täufer Huren gewesen. Oder, in einem Fall, eine Frau von einem Begleitservice, aber wenn man ehrlich war, gab es da letztlich kaum einen Unterschied. Vielleicht bei der Steuererklärung. Prostituierte sich Hero, um ihr Künstlerleben zu finanzieren? Nun, wenn das heutzutage schon College-Studentinnen machten, lag das durchaus im Bereich des Möglichen. Und dennoch war bei diesem Opfer zu vieles anders als bei den anderen.
Und dann ihre Familie. Im Telefonbuch waren keine Katrova-Connors verzeichnet. Seltsamerweise wusste er von einer weiteren Person, die diesen Namen trug, und dieser bedrohliche Kerl war auch noch ein FBI-Kollege. Und Heros Bruder. Vielleicht hatte das etwas zu bedeuten?
Aufgrund der öffentlichen Entrüstung über Johannes den Täufer war es allgemein bekannt, dass Luca der leitende Ermittler war. Er hatte ein paar lästige Pressekonferenzen abgehalten. War dieser Mordversuch vor allem dazu gedacht, das FBI zu verhöhnen? Oder hatten sie es hier eventuell sogar mit einem Nachahmungstäter zu tun?
Während Hero im OP gewesen war, hatte Luca seinen Partner, Vincent Di Petro, angerufen und ihn über Heros Bruder ausgefragt. Er kannte den Mann vom Sehen, aber sie hatten noch nie zusammengearbeitet.
Sein Partner war am Tatort und überwachte die Beweisaufnahme, während Luca bei dem Opfer blieb, aber er konnte Luca die gewünschten Informationen über Heros Bruder geben.
Berowne »Rown« Katrova-Connor arbeitete in der Abteilung für Wirtschaftskriminalität und gehörte außerdem der Sondereinheit für internationale Verbrechen an. Er war Ex-Soldat, Meisterschütze, ein fantastischer Kämpfer und so etwas wie ein Computer-Genie. Die gesamte Familie, die offenbar sehr fruchtbar war, war beim Militär oder bei den Strafverfolgungsbehörden. Außer Hero, wie es schien. Und was hatte es mit diesen durchgeknallten Namen auf sich? Hero? Berowne?
Luca trank einen Schluck von dem ekelhaften Kaffee aus dem Krankenhausautomaten. Inzwischen war er lauwarm und schmeckte wie Pisse. Der Bodensatz blieb ihm im Hals stecken, und er musste erst ein wenig kauen, bevor er ihn hinunterwürgen konnte.
Schließlich stand er auf und warf den Styroporbecher in den Abfalleimer neben der Tür. Meine Güte, hatte er die Schnauze voll von schlechtem Kaffee! Aber er würde nicht bei irgendeinem angesagten Schicki-Micki-Kaffeehaus voller Kiffer und Studenten – was sich gegenseitig nicht ausschloss – Schlange stehen, nur um eine anständige Tasse Kaffee zu bekommen.
»Geschafft.« Das Lächeln, das in ihrer schwachen Stimme mitschwang, ließ ihn sich fragen, ob er vor lauter Schlafentzug jetzt schon halluzinierte.
Er wirbelte herum, als hätte er einen Schuss gehört. »Wie bitte?« Die auf ihn gerichteten müden jadegrünen Augen lösten eine Reihe verwirrender Gefühle in ihm aus. »Ms Connor, ich …«
»Wo sind sie alle?«, fragte sie leicht lallend und sah sich verwirrt in dem abgedunkelten Zimmer um.
»Wer?« Schwammen heute Abend noch mehr Frauen im Fluss? War sie mit jemandem zusammen gewesen? Oder meinte sie den Rest der Ersthelfer am Tatort?
»Knocks«, murmelte sie. »Brown. Rohm. Dim Tree. Dra. Pop. Mmph.« Verängstigt und verwirrt sah sie ihn an.
Okay, jetzt redete sie eindeutig nur noch Unsinn. Vermutlich sollte er einen Arzt holen und Bescheid sagen, dass sie wach war. Und vermutlich eine Hirnverletzung hatte. Meine Güte, hoffentlich nicht. Er brauchte die grausigen Informationen, die sie in ihrem Gedächtnis gespeichert hatte. Er brauchte jedes noch so winzige Detail. Der Hai in ihm wollte sie mit Tausenden von Fragen angreifen.
Eine laute Stimme ertönte aus der Richtung, in der das Schwesternzimmer lag. »Mir ist scheißegal, dass keine Besuchszeit ist oder dass sich schon jemand im Zimmer befindet. Wer nicht zur Familie gehört, soll verschwinden!«
»Aber Mr Connor, er ist vom FBI«, hörte er Barbara sagen, und gleichzeitig hörte er ihre lächerlichen Schuhe dem Mann mit der dröhnenden Stimme hinterherklacken, Richtung Zimmer.
»Na und? Ich auch«, lautete die wütende Antwort.
»Und er ist Mexikaner«, flüsterte sie theatralisch in ihrem Südstaatendialekt.
Luca verdrehte die Augen. Er war halb Brasilianer mit europäischen Wurzeln, halb Puerto Ricaner, aber egal. Heros Kopf fiel auf das Kissen zurück, und sie entspannte sich.
Offensichtlich hatte Di Petro sein Versprechen gehalten und Rown angerufen. Und der besorgte Bruder war herbeigeeilt und hatte vermutlich auch den Rest des Clans informiert.
Es überraschte Luca, wie sehr es ihm gegen den Strich ging, Hero mit jemand anderem zu teilen. Nicht einmal ihre Familie wollte er im Zimmer haben. Sie hatte sich so wild an ihn geklammert, und er war nicht bereit, das herzugeben. Okay – damit begab er sich auf ein neues und gefährliches Terrain.
Hero war einfach eine wertvolle Zeugin, mehr nicht. Es gab keinen Grund, den edlen Ritter zu spielen.
»Hier«, zwang er sich zu sagen, während er zur Tür ging und den Bruder hereinwinkte. Entweder das, oder er musste ihm die Tür vor der Nase zuknallen und Hero vor dem Rest der Welt wegsperren.
Ja, er musste wirklich total erschöpft sein, wenn er so etwas auch nur in Erwägung zog.
»Ramirez.« Rown sah ihn überrascht aus zusammengekniffenen Augen an, die genauso grün waren wie Heros. Er trug eine Trainingshose, ein T-Shirt, das fast von seinen Muskelpaketen gesprengt wurde, und Flipflops. Vermutlich hatte Di Petros Anruf ihn aus dem Bett geholt. Luca hatte ihn noch nie anders als in einem billigen Anzug von der Stange gesehen, wie die, die auch in seinem Schrank hingen, und wie der, den er gerade trug. Der Mann war gebaut wie ein Held aus einem Comic, mit außergewöhnlich breiten Schultern und einer unverhältnismäßig schmalen Taille. Er schob sich an Luca vorbei ins Zimmer.
Wäre es nicht seine Schwester gewesen, die dort im Bett lag, hätte Luca den Typen glatt aus dem Fenster geschmissen. Einem Fenster im zweiten Stock. Aber er hielt sich zurück. Vorläufig. Das wilde Flackern in den Augen seines Kollegen verriet ihm, dass dieser notfalls auch gewalttätig werden würde. Und auch wenn dieses Riesenbaby nicht in der Mordkommission arbeitete, war Luca sich nicht sicher, wie solch ein Kampf ausgehen würde.
»Hero? Hero, was zum Teufel …?« Instinktiv wollte Rown nach ihrer Hand greifen, zog die seine aber rasch zurück, als er die Verbände sah, die nur die Fingerspitzen freiließen. »Was hat er mit dir gemacht?«
Hero antwortete nicht. Sie hatte erneut das Bewusstsein verloren.
Ihr Bruder beugte sich über sie, als suche er nach einer Stelle, wo er sie gefahrlos berühren konnte. Beim Anblick der Kratzer, der sich allmählich verfärbenden Schwellungen in ihrem Gesicht, ihrer Hände und der verschiedenen Schläuche, die unter dem Laken nach Gott weiß wohin verschwanden, verließ ihn offensichtlich der Mut.
»Verdammt.« Er wandte sich von ihr ab und schien nach etwas zu suchen, was er an die Wand werfen konnte. Oder auf den Boden schmettern. Dieses Bedürfnis war Luca überaus vertraut.
»Vor ein paar Sekunden war sie kurz wach.« Er versuchte, seine Stimme möglichst ruhig und nicht bedrohlich klingen zu lassen. Die Situation konnte rasch eskalieren. Sie standen hier auf derselben Seite. Es gab keinen Grund, sich wie testosterongesteuerte Neandertaler zu benehmen. »Ich glaube, sie hat nach Ihnen gefragt. Sie war ziemlich benommen.«
Rown drehte sich um und sah ihn durchdringend an. Er schien sich wieder gefasst zu haben, aber seine Kiefermuskulatur wirkte noch immer angespannt. Luca kannte dieses Gefühl nur zu gut. Press die Zähne aufeinander, bis du dir sicher sein kannst, dass du nicht so etwas Lächerliches wie ein Knurren oder ein Brüllen von dir gibst.
Mach stattdessen Handbewegungen.
Luca beantwortete Rowns unausgesprochene Frage: »Ihre Hände wurden durchbohrt, außerdem die linke Seite, und danach wäre sie beinahe im Fluss ertrunken. Sie hat sehr viel Blut verloren, aber sie haben ihr Transfusionen gegeben und gehen davon aus, dass sie es schafft. Hier ist die Handynummer des Chirurgen. Er ist nach Hause gegangen, meinte aber, man könne ihn jederzeit anrufen.«
Noch immer vor Wut vibrierend warf Rown einen kurzen Blick auf die Visitenkarte, die Luca ihm hinhielt, dann nahm er sie. »Danke.«
»Ja.«
»Und für …« Er deutete auf den Stuhl.
»Ja.« Luca vergrub die Fäuste in seinen Taschen. »Sie war völlig verängstigt. Ich wollte nicht, dass sie beim Aufwachen allein ist.«
Zurückgehaltene Wut flackerte in Rowns Augen auf.
»Wir haben weder eine Handtasche noch irgendwelche Ausweispapiere gefunden«, fuhr Luca fort. »Wir haben Sie verständigt, sobald wir ihre Identität geklärt hatten.«
Nach kurzem Zögern nickte Rown, fuhr sich frustriert mit den Fingern durch das kurze rotbraune Haar und verschränkte die Finger dann hinter dem Kopf, was seine Bizepse beinahe platzen ließ. »Dieser verdammte Johannes der Täufer?«
Luca nickte. »Sieht so aus.«
»Das ist doch unlogisch. Hat der es nicht nur auf Huren abgesehen? Wie zum Teufel konnte das passieren? Meine Schwester ist keine Prostituierte!«
Luca räusperte sich. »Wie … sicher sind Sie sich da?«
»Hundertprozentig sicher.« Rown schubste einen Klappstuhl so heftig aus dem Weg, dass er von der Wand abprallte und auf Luca zuschlidderte. Luca zuckte nur mit den Schultern. So leicht ließ er sich nicht einschüchtern.
»Ich muss das fragen. Sie wissen das.«
»Ach herrje«, stöhnte Barbara, die in der offenen Tür stehen geblieben war. Luca dachte zunächst, sie hätte Rowns mordlüsternen Blick gesehen, doch entweder hatte sich gerade ein aufrührerischer Mob versammelt, oder der Rest von Heros Familie stürmte über die Flure der Notaufnahme. Hoffentlich traumatisierten sie mit ihrem Geschrei nicht die anderen Patienten auf der Station.
»Wo ist sie? Wo ist meine Kleine?« Klang da ein irischer Akzent in diesem volltönenden Bariton mit?
»Was zum Teufel hat Rown am Telefon gesagt?«, fragte eine wütende, heisere Stimme. Da war jemand noch nicht ganz wach, sprach aber akzentfreies Amerikanisch.
»Pass auf, wie du in Anwesenheit deiner Mutter redest. Auch wenn du bei den Special Forces bist, kann ich dich kräftig über die Knie legen.«
»Das heißt: ›übers Knie legen‹, Dad«, war eine weitere männliche Stimme zu hören. Sie klang gelassener. Dunkler.
»Beruhige dich, Dad. Ich suche den Arzt, der Nachtschicht hat, und der wird uns sagen, was los ist.« Eine weibliche Stimme. Offensichtlich die Stimme der Vernunft in dem ganzen Chaos.
»Rown hat nur gesagt, dass sie eine Stichwunde hat und im Fluss gefunden wurde – und dass sie lebt.« Die gelassene, dunkle Stimme.
»Lennox wird ausflippen, wenn er hört, was seiner Hero zugestoßen ist.« Wie international war diese Familie? Das klang doch nach einem osteuropäischen Akzent – vielleicht russisch?
Moment mal. Seine Hero? War dieser Lennox Heros Mann? Wieso war er dann noch nicht da?
Würde ihm denn nicht auffallen, wenn seine Frau die ganze Nacht fortblieb? Egal, Luca hatte es nicht eilig, ihn kennenzulernen. Wieso, hätte er nicht sagen können.
»Hören Sie, Ramirez.« Rown nutzte die Verwirrung seiner Familie, um sich drohend vor Luca aufzubauen.
Luca gefiel das gar nicht.
»Ein Wort zu meinem Vater oder meiner Mutter, dass sie vielleicht eine Prostituierte ist, und ich reiße Ihnen den Kopf ab und spucke Ihnen in den Stumpf. Verstanden?«
Sein durchdringender Blick verhieß nichts Gutes.
Luca konnte das respektieren. »Treten Sie zurück, und wir sind uns einig.« Jemanden niederstarren konnte er auch. Aber er konnte sich auch anständig benehmen, ohne dass man ihn bedrohte.
Rown schob das Kinn vor, trat aber einen Schritt zurück, bevor er sich umdrehte und der Meute im Flur zuwandte.
Wie sich herausstellte, zwängten sich nur fünf Leute in das kleine Zimmer, und nicht sechs, wie Luca vermutet hatte.
»Wo ist Knox?«, fragte Rown.
»In London.« Der kräftigste der fünf Männer im Zimmer war mit seinen etwa ein Meter achtzig zwar nicht der größte, aber seine Schultern füllten den gesamten Türrahmen aus. Seine ebenfalls grünen Augen wirkten tot, und eine beunruhigende Kälte umwehte ihn wie eine Aura.
»Wir wollten ihn erst anrufen, wenn wir Genaueres wissen.« Das kam von dem Mann, der offensichtlich der Familienpatriarch und gleichzeitig der Kleinste im Zimmer war. Wenn man Hero nicht mitzählte. Mit gut einem Meter siebzig war er der stämmigste der vier männlichen Katrova-Connors.
Himmel, war Heros Verwandtschaft etwa SEAL-Team 6?
»Jesus, Maria und Josef … meine süße Kleine!« Der alte Ire bekreuzigte sich und küsste seine Finger, bevor er die Hand einer großen, zeitlos schönen, etwa sechzig Jahre alten Brünetten packte und an das Bett seiner Tochter eilte. Die anderen folgten pflichtschuldig seinem Beispiel – sich bekreuzigen, Finger küssen, sich über ihre Schwester beugen.
Luca bekreuzigte sich ebenfalls, Hero zuliebe. Inzwischen war ihm diese Geste völlig fremd geworden. Die meiste Zeit verfocht er die Meinung, dass solche Dinge, wenn es einen liebenden Gott gäbe, nicht passieren würden. Aber ein Teil von ihm war noch immer darauf gefasst, vom Blitz getroffen zu werden, wenn er so etwas dachte.
Der mit den toten Augen war am Rand der Gruppe stehen geblieben, Lucas Geste war ihm nicht entgangen. Unter seinem Blick fühlte Luca sich, als sei er gerade zum Todeskandidaten bestimmt worden. »Wer sind Sie?«, fragte der breitschultrige Mann mit der seltsam kratzigen Stimme. Mit dem Typen stimmte irgendetwas nicht. Ganz und gar nicht.
Rown übernahm gewandt die Vorstellung. »Das hier ist Special Agent Luca Ramirez vom FBI. Er leitet die Ermittlungen im Fall Johannes der Täufer.« Er deutete auf seinen Vater und die entzückende dunkelhaarige, schwarzäugige Frau an seiner Seite. »Meine Eltern, Eoghan und Izolda Katrova-Connor.«
Das also war der Grund für den Doppelnamen? Was für ein progressives Paar.
»Mein kleiner Bruder, Demetri.« Rown deutete auf ein schwarzhaariges, schwarzäugiges Ebenbild seiner Mutter. »Klein« musste ironisch gemeint sein. Der Mann trug Jeans und eine schwere Lederjacke und in der Hand einen schwarzen Motorradhelm mit Schädel und gekreuzten Knochen.
Sie nickten sich zu. Zu diesem gehörte die dunkle, samtige Stimme.
»Der Älteste, Romeo.« Er nickte dem muskulösen Abziehbild einer Sturmwolke zu.
»Connor«, korrigierte der mit der heiseren Stimme, die immer gleich tonlos klang.
Klar doch. Der bedrohlich wirkende Ire würde nicht wollen, dass jemand auf falsche Gedanken kam. Dieser Typ war kein Gedichte heraussprudelnder Ladykiller. Luca richtete den Blick auf Hero, die noch immer schlief wie ein Baby. Okay, falsche Wortwahl. Selbst in Gedanken.
Luca war noch nie so froh gewesen, dass er so groß war und gebaut wie ein Linebacker. Bei diesen Leuten würde ihm das vielleicht noch nützlich sein.
»Ah, und da kommt Andra.« Rown deutete auf den schlanken Rotschopf, der soeben in der Tür aufgetaucht war. Eine Nerdbrille mit dicken Rändern umrahmte ihre whiskeyfarbenen Augen. Ihr Haar, das ein etwas dunkleres Rot als das von Hero und Rown hatte, war zu einem festen Knoten hochgesteckt, der zu ihrer eleganten Hose und der Hemdbluse passte.
»Timandra Katrova-Connor.« Sie kam in das Zimmer gerauscht, gefolgt von einem Arzt in mittleren Jahren, der so frisch wirkte, als hätte er seine Schicht gerade erst angetreten.
»Sie sind die …«
»Stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Andra Connor, genau.« Sie reichte ihm die Hand, die er kollegial schüttelte. Er konnte nicht glauben, dass er darauf nicht vorher gekommen war. Verdammt.
Also hatte Hero vorhin doch keinen Unsinn vor sich hin geplappert. »Brown, Rohm, Dim Tree, Pop, Dra und Mmph« stellten sich als Rown, Romeo, Demetri, ihr Vater, Timandra und Mom heraus.
Moment mal. Das Fach hatte er doch im College gehabt. Einige dieser Namen waren aus Theaterstücken und Ähnlichem. Shakespeare, nicht wahr?
»Nachdem wir das nun geklärt hätten«, übernahm Izolda mit ihrem rauen russischen Akzent das Kommando, »erzählen Sie mir doch bitte, was hier los ist.«
Luca räusperte sich. Ihr katzenartiger Blick verunsicherte ihn ein wenig. Sie war an sich schon eine beeindruckende Persönlichkeit, aber flankiert von ihren riesigen Söhnen und am Arm eines Ehemanns, der in einem früheren Leben ein rothaariger Gorilla hätte gewesen sein können, wirkte sie regelrecht ehrwürdig. »Wir glauben, dass Ihre Tochter Hero ein Opfer von Johannes dem Täufer ist.«
Die nächsten drei Sekunden, in denen niemand etwas sagte, waren quasi die Ruhe vor dem Sturm. Trotz all seiner Erfahrungen mit Sportkameraden und Leuten von der Polizei hatte Luca noch nie so viele Flüche auf einmal gehört. Sogar die Ohren des Arztes röteten sich leicht. Und dann prasselten die zu erwartenden Fragen auf Luca und den Arzt ein. Was war passiert? Würde Hero wieder gesund werden? Hatte man den Täter festgenommen? Und so weiter.
»Es tut mir leid«, sagte der Arzt. Auf seinem Namensschild stand Karakis, was zu seinem mediterranen Aussehen passte. »Das hier ist ganz schlecht für die Patientin. Bitte folgen Sie mir ins Sprechzimmer, dann kann ich Ihnen die gewünschten Informationen geben.«
»Ich bleibe bei meiner Tochter.« Eoghan stemmte buchstäblich seine Füße in den Boden, während er seine fleischige Hand zärtlich auf Heros Unterarm legte. »Sie können uns die Informationen auch hier geben.«
»Ich muss leider darauf bestehen.« Der Arzt ließ sich nicht beeindrucken.
»Machen wir die Sache doch nicht komplizierter, als sie ist.« Luca sah Rown hilfesuchend an, aber der hatte sich auf die Seite seiner Eltern geschlagen. Verräter.
»Halten Sie sich da raus.« Connor richtete den Zeigefinger auf Luca. »Wenn Sie Ihre Arbeit gemacht hätten, statt die ganze Zeit mit Ihrem Schwanz zu spielen, würde meine kleine Schwester nicht hier in diesem Bett liegen.«
»He!« Die schwache Stimme aus besagtem Bett ließ alle überrascht verstummen und rettete Romeo vermutlich das Leben. Hero hob den Kopf und warf ihrem ältesten Bruder einen liebevoll-vorwurfsvollen Blick zu. »Sei brav.«
3
Dein Trank wirkt schnell.
William Shakespeare, Romeo und Julia
Der Krawall war angenehm gewesen, zumindest am Anfang, als Hero noch halb betäubt war von den Schmerz- und Beruhigungsmitteln, die man ihr im Krankenhaus verabreicht hatte. Sie liebte diese Stimmen so sehr! Sie lebte. War in Sicherheit. Sie war nicht tot, und sie hing nicht mehr an einem Kreuz. Darüber brauchte sie jetzt nicht mehr nachzudenken, denn dann würde ihr Herz nur wieder anfangen zu rasen, und sie würde am ganzen Körper zittern. Und schwitzen würde sie! Sie hatte schon immer geschwitzt, wenn sie nervös war, und falls dieser hübsche Latino-Bulle noch in der Nähe war, wollte sie nicht, dass er sie verschwitzt sah. Also würde sie sich einfach treiben lassen, eingehüllt in die einlullende Wärme ihrer Familie.
Und der Beruhigungsmittel.
Hero dachte an das freundliche, die Grübchen betonende Lächeln ihres zornigen Retters. Freundlich zu sein fiel ihm vermutlich nicht leicht – und zu lächeln auch nicht.
Irgendwo jenseits des wohltuenden Nebels wurden die männlichen Stimmen immer aggressiver. Hero beschloss, aus dem Nebel aufzutauchen, um schlichtend einzugreifen. Sie gönnte sich noch einen tiefen, unhörbaren Seufzer, bevor sie die Augen öffnete. Gut, sie funktionierten, auch wenn ihre Sicht ein wenig verschwommen war.
Connor zu sagen, er solle sich benehmen, funktionierte ausnahmsweise einmal, wie sie befriedigt feststellte. Also ließ sich dieser ganzen Krankenhaus-Geschichte doch etwas Gutes abgewinnen. Das würde sie noch kräftig ausnutzen.
Sobald sie wieder deutlicher sehen konnte, nutzte Hero die schockierte Stille, um unter den vertrauten Gesichtern nach seinem zu suchen. Ah, da war er ja, in der Ecke. Der rettende Engel mit der Mokkahaut und den funkelnden schwarzen Augen.
Meine Güte, eines Tages würde sie eine Skulptur von seinem nackten Körper anfertigen. Und wenn er ihr nicht erlaubte, ihn nackt zu sehen? Dann würde einfach ihre Fantasie zum Einsatz kommen müssen, ihre sehr lebhafte Fantasie. Trotzdem würde sie vermutlich alles daransetzen, ihn nackt zu sehen.
»Hallo.« Sie versuchte, verführerisch zu lächeln, aber ihr taubes Gesicht spielte nicht mit. Was hatten die ihr bloß gegeben? Echt ein tolles Zeug! Sie führte ihrem Körper sonst grundsätzlich keine nicht organischen Stoffe zu, aber dies war ein medizinischer Notfall. Und Tatsache war, dass sie sich völlig wohl damit fühlte. Es schadete auch nichts – nach ihrer Entlassung aus dieser großartigen Einrichtung würde sie einfach eine reinigende Saftkur machen und alle eventuell schädlichen Chemikalien aus ihrem Körper spülen.
Der große, dunkle, gefährliche Mann war umwerfend, wenn er nervös war. »Hi«, antwortete er mit seiner samtigen Baritonstimme. Scheu warf er rasch einen Blick auf Rown und ihren Vater. Seine vollen Lippen deuteten ein Lächeln an, das das wunderbare Grübchen in der linken Wange seines wie gemeißelt wirkenden Gesichts betonte.
Sie wünschte, er würde die Anzugjacke ausziehen, damit sie feststellen konnte, ob die breiten Schultern echt oder nur Watte waren.
»Himmel, sie ist völlig zugedröhnt.« Rown verdrehte die Augen.
»Nein, bin ich nicht«, widersprach sie. Ihre Nase juckte wie verrückt, aber ihre Hände fühlten sich an, als wären sie mit Ziegelsteinen beschwert. Sie richtete ihre ganze Aufmerksamkeit darauf, eine von ihnen zu bewegen, und vergaß darüber alle im Zimmer Anwesenden. Als sie es geschafft hatte, den rechten Arm zu heben und in Richtung ihrer Nase zu lenken, lächelte sie triumphierend – vermutlich. Dass sie sich ins Auge stach, frustrierte sie. Eigentlich sollte es doch nicht so schwierig sein, die eigene Nase zu finden. »Na ja, vielleicht ein bisschen«, gestand sie. Wenn man seine Glieder nicht spüren konnte, war man wohl ein bisschen high. Heilige Mutter Gottes, waren diese Verbände riesig! Nur die Fingerspitzen schauten heraus, und die Verbände saßen so eng, dass sie sich nicht abstreifen ließen.