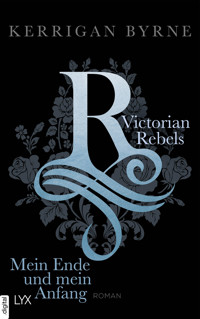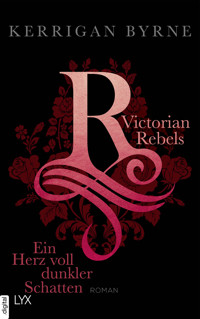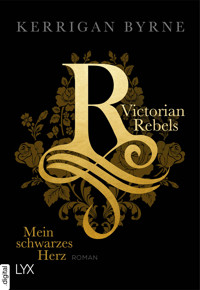9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: The Victorian Rebels
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Nur sie kann Licht in seine Seele bringen ...
Liam MacKenzie wird von allen "Der Highlandteufel" genannt. Nur wenige haben es je gewagt, ihm die Stirn zu bieten. Als er eine Gouvernante für seine Kinder sucht, tritt die Engländerin Philomena Lockhart auf den Plan - und der grimmige Krieger findet sich plötzlich auf einem Schlachtfeld wieder, auf dem er keinerlei Erfahrung hat. Der jungen Frau gelingt es nicht nur, seinen widerspenstigen Nachwuchs für sich zu gewinnen, sondern auch ungeahnte Gefühle in ihm zu wecken. Denn in ihren Augen sieht er, dass Mena durch eine Dunkelheit gegangen ist, die der seiner Seele gleicht - und dass sie den Schmerz hinter seiner finsteren Fassade erkannt hat ...
"Emotional, gewaltig, ein Buch, das man nicht mehr weglegen kann!" Romantic Times
Band 3 der VICTORIAN-REBELS-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchProlog123456789101112131415161718192021222324EpilogDie AutorinKerrigan Byrne bei LYXImpressumKERRIGAN BYRNE
Victorian Rebels
Das Licht unserer Herzen
Roman
Ins Deutsche übertragen von Inka Marter
Zu diesem Buch
Philomena Lockhart hat Furchtbares erlebt, seitdem ihr grausamer Ehemann sie in eine Irrenanstalt einliefern ließ. Mit knapper Not von dort entkommen, will sie nichts anderes, als ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Als sie in Schottland eine Stelle als Gouvernante antritt, ist sie froh um die abgelegene Zuflucht in den Highlands. Bis sie ihrem neuen Arbeitgeber gegenübersteht: Liam MacKenzie wird von allen nur »Der Highlandteufel« genannt und ist wegen seiner Taten auf dem Schlachtfeld gefürchtet. Doch dass sie ausgerechnet in dem berüchtigten Laird des MacKenzie-Clans eine verwandte Seele finden würde, hätte Mena niemals zu träumen gewagt. Obwohl die Präsenz des hünenhaften Highlanders sie zunächst zurückschrecken lässt, erkennt sie schon bei ihrer ersten Begegnung den Schmerz hinter Liams finsterer Fassade. Ihr wird klar, dass er mit inneren Dämonen kämpft, von denen niemand etwas ahnt. Und sie findet eine Stärke in sich, die sie für unmöglich gehalten hätte – den Mut, Liam die Stirn zu bieten und ihm zu zeigen, dass er nicht der Dämon ist, für den er sich selbst hält. Und mit jedem Tag in seiner Nähe wächst ihre Hoffnung, dass die Liebe die Dunkelheit aus ihrer beider Herzen verbannen kann.
Prolog
Wester Ross, Schottland
Er musste etwas unternehmen, beschloss Liam Mackenzie, als er auf seine schaurige Entdeckung hinunterblickte.
Wegen des bösen Mannes, der die Mackenzies von Wester Ross mit sadistischen Launen und kaltem Terror regierte. Wegen der hohläugigen Frau, die Liams eigene, arme Mutter ersetzt hatte und nun wie ein dürres, von Reue und Angst geplagtes Gespenst durch die Gänge von Ravencroft Keep spukte. Wegen ihres Sohnes, Liams Halbbruder, der sich in Schränken versteckte und in seinem ganzen jungen Leben noch nicht einmal gelächelt hatte. Und wegen des Mackenzie-Bastards, der vor Kurzem im Newgate-Gefängnis totgeprügelt worden war.
Und er musste etwas unternehmen wegen der Leiche, die er gerade aus dem Bryneloch-Moor gezogen hatte.
Tessa McGrath.
Sie war kaum mehr als ein mit Schlamm, Torf und Matsch bedecktes Skelett, aber Liam hatte sofort gewusst, dass sie es war. Sobald er die Überreste des Umhangs gesehen hatte, den er ihr in jener Nacht vor ein paar Jahren gegeben hatte, hatte er es gewusst.
Der Umhang – ein später Akt der Güte, die er ihr am Ende erwiesen hatte – war ihr Leichentuch geworden.
Tessa war eine Hure gewesen, die mit unvergleichlicher Kunstfertigkeit und dunklen Praktiken geprahlt hatte. Deshalb hatte Laird Hamish Mackenzie sie für seine Söhne geholt. Deshalb war sie auserwählt worden, die Jungen zu Männern zu machen. Nay, nicht zu Männern, sondern zu etwas viel Schrecklicherem.
Tessa hatte die entsetzliche Grausamkeit des Marquess of Ravencroft unterschätzt. Sie hatte nicht gewusst, wie weit Hamish Mackenzies Bösartigkeit reichte.
»Sie will es«, hatte Liams Vater höhnisch grinsend gesagt, als er die nackte Tessa mit verbundenen Augen ans Bett gefesselt hatte. »Sie bettelt darum.«
Und die Hure hatte wirklich darum gebettelt. Um leichte, spielerische Hiebe mit der weichen Peitsche, die sie in ihrem Ranzen mit Lustspielzeug mitgebracht hatte. Sie hatte die entsprechenden Laute von sich gegeben, sich entsprechend gewunden. Sie hatte gestöhnt und zu Obszönitäten eingeladen, die jeden sechzehnjährigen Jungen in einen Rausch der Lust versetzt hätten.
Nur Liam nicht.
Sie traf keine Schuld. Wie hätte sie ahnen können, was der Laird mit ihr vorhatte. Zwar spielte sie gern mit ein wenig Schmerz, aber Hamish Mackenzie hörte nicht auf zu spielen, wenn er gesiegt hatte, er machte weiter, bis seine Gegner zerstört waren.
Liam hatte bereits befürchtet, dass Hamish das Mädchen vor ihren Augen züchtigen wollte. Damit seine Söhne zusahen. Aber nie wäre er auf den Gedanken gekommen, dass sein Vater sie selbst zwingen würde zuzuschlagen. Um mit krankem, sadistischem Vergnügen zu erleben, wie die Jungen, die er gezeugt hatte, zu Monstern wurden.
Zu Monstern wie er selbst eines war.
Liam hatte es erst erraten, als der Laird ein eigenes Spielzeug hervorgeholt hatte. Eine antike, römische Peitsche mit Bleispitzen und so vielen Lederriemen, wie Medusa Schlangen auf dem Kopf hatte.
Die Söhne des Laird zitterten bei ihrem Anblick. Hamish, der Bastard, der den Namen seines Vaters trug. Liam, sein rechtmäßiger Erbe. Und der Junge, den sie »Thorne« nannten, aus der zweiten Ehe des Laird. Sie alle kannten die Peitsche nur zu gut. Sie kannten den Schmerz ihrer Hiebe, bei denen jedes Mal ein Stück Haut abgerissen wurde.
In der Tat hatten sie die Peitsche mit großen Augen angestarrt, als der Laird sie über den Rücken der schnurrenden Hure gezogen hatte. Zuerst hatte sie den Rücken durchgebogen und lüstern gestöhnt. Dann hatte sie geschrien und geweint, sich gewunden und gefleht – und das nach nur zwei Schlägen.
Mit vor perverser Erregung glühenden Augen war Hamish vor seine Söhne getreten und hatte ihnen den Griff der verhassten Peitsche hingestreckt. Die drei hatten wie Soldaten in einer Reihe gestanden und ihn angestarrt.
»Für jeden von euch zwei Hiebe«, hatte der Laird befohlen.
»Das überlebt sie nicht«, hatte Thorne eingewandt, und seine pubertierende Stimme hatte sich vor Angst überschlagen.
Der Laird hatte die Widerworte seines Sohnes mit der Faust beantwortet, und Thorne war zu Boden gegangen. »Für jeden. Zwei. Hiebe«, hatte er wiederholt. »Mir ist egal, wer von euch wie oft zuschlägt, aber sie wird erst losgebunden, wenn sie sechs Hiebe erhalten hat.«
Laird Hamish Mackenzie, ein Riese von einem Mann, überragte seine Söhne wie auch fast jeden anderen. Aber an diesem Abend konnte Liam seinem Vater zum ersten Mal auf gleicher Höhe in die Augen sehen. Nur wenige wagten es, den Blick des Vaters zu erwidern, geschweige denn, sich ihm zu widersetzen.
»Ihr tut es«, befahl der Laird mit einem bösen Lächeln. »Sonst tue ich es selbst.«
Es war gelinde gesagt befremdlich, wenn der Mensch, den man am meisten hasste, die eigenen Gesichtszüge trug. Eines Tages, in zwanzig Jahren vielleicht, würde Liam im Spiegel dieselben monströsen dunklen Augen sehen, eine Erinnerung an die widerliche Grausamkeit, die durch sein vergiftetes Mackenzieblut floss. Als Liam den herausfordernden Blick seines Vaters sah, begriff er, dass er eines Tages keine Angst mehr vor diesem Mann haben würde. Er würde nur genauso groß, gemein, rücksichtslos und brutal werden müssen, aber irgendwann wäre da ein eigenes Monster in ihm, das diesem Ungeheuer gegenübertreten konnte.
Und das Funkeln in den Augen seines Vaters hatte ihm verraten, dass er sich auf diesen Tag freute.
Hamish, der Jüngere, ergriff die Gelegenheit, seinen Vater zu beeindrucken und streckte die Hand schon nach der Peitsche aus. In seinen noch nicht ganz so markanten Zügen zeigte sich neben der Angst schon die vertraute Grausamkeit.
Hamish würde tun, was sein Vater sagte. Und Tessa würde es nicht überleben.
»Nay.« Liam trat vor und nahm seinem Vater die Peitsche aus der Hand, bevor Hamish sie bekam. »Ich werde es tun.«
Der Wind schrie über dem Bryneloch-Moor, nicht unähnlich den Lauten, die Tessa in jener Nacht von sich gegeben hatte, als die Riemen mit den Bleispitzen sich in ihre makellose Haut gruben. Die schreckliche Angst und die Verwirrung in ihrem Schluchzen hatte Liam das Herz aus der Brust gerissen, bis nur noch eine tiefe, offene Wunde übrig war.
Als er jetzt über ihrer Leiche stand, ballte Liams Hand sich zur Faust. Seine Knöchel wurden weiß wie in jener Nacht, als er den geflochtenen Griff der Lederpeitsche in der Hand gehalten hatte.
Tessa hatte nicht gewusst, dass er ihr auf die einzig mögliche Art einen Gefallen erwiesen hatte. Nur indem er als Einziger den mitleidlosen Befehl seines Vaters ausführte, konnte er ihr weniger Schaden zufügen.
Woher hätte sie das auch wissen sollen.
Liam hatte zu Gott gefleht, dass die Nacht damit beendet war … aber die Grausamkeit des Laird kannte keine Grenzen, und es verging noch eine höllische Stunde voller unaussprechlicher Dinge, bevor Liam die Frau in den Umhang hüllen und ihr zur Flucht verhelfen konnte.
Man musste ihr anrechnen, dass sie nicht aufgehört hatte zu kämpfen. Trotz des endlosen Stroms angsterfüllter Tränen hatte sie immer wieder mit Vergeltung gedroht. Aber diese Drohungen waren ein Fehler gewesen.
Sie hatte sich kaum aufrecht halten können, als sie die Treppe hinuntergehumpelt war. Ihre rosige Haut hatte sich an manchen Stellen zu hässlichen Blutergüssen verfärbt. Das war Hamish gewesen.
Trotz seiner Jugend hatte Liam die Kraft gehabt, sie über die Felder zum Dorf zu tragen, und er hatte – Gott, wie sehr – mit ihr zu reden versucht. Sich entschuldigt. Um die Scham zu lindern, die sein Inneres besudelte.
Aber sie wollte nichts davon hören – nicht, dass er ihr das vorwerfen konnte.
»Ich hetze den Clan gegen dich und deine verruchte Familie«, zischte sie. »Das werd ich tun. Ich sage und zeige jedem, was ihr barbarischen Teufel mit mir gemacht habt. Sie werden euch holen. Euch alle!«
Aber sie hatte keine Gelegenheit dazu bekommen. Jemand hatte sie zum Schweigen gebracht. Ermordet.
Liam musste sich nicht fragen, wer das getan hatte.
Und Böses zeugte Böses. Man konnte ihm nicht entfliehen. Selbst Dougan, der jüngste Bastard seines Vaters, der weit entfernt von den roten Mauern von Ravencroft Keep aufgewachsen war, hatte schon als Kind einen Priester getötet.
Dougan. Sein Vater hatte jemanden angeheuert, der seinen jüngsten Sohn im Gefängnis totprügeln sollte. Aber irgendwie war der Junge entwischt, hatte sich eine neue Identität zugelegt und sich heimlich bei Liam gemeldet, während er um die Vormachtstellung in der Londoner Unterwelt kämpfte.
Hamish Mackenzies Söhne waren aufgezogen worden, um Blut zu vergießen. Die Parzen woben Gewalt in ihre Körper wie in einen schaurigen Gobelin, brauten die Unbarmherzigkeit, die durch ihre Adern floss.
Wenn der König tot ist … lang lebe der König.
So hatte Dougan den Brief unterschrieben, in dem er Liam bat, das zu vollbringen, von dem er immer fantasiert hatte.
Liam hüllte Tessas sterbliche Überreste wieder in den zerschlissenen Umhang und ließ das Moor endgültig zu ihrem Grab werden. Als er zusah, wie die Erde sie langsam verschluckte, fühlte er den letzten Rest seiner Hoffnung und Menschlichkeit mit ihr versinken. Glühender Hass trat an ihre Stelle, entzündete sich in seiner leeren Brust und wurde vom stinkenden Schwefelatem des Teufels zu einem Inferno entfacht.
Vielleicht musste diese Fantasie endlich Wirklichkeit werden.
Als er über die grüne Landschaft hinüber zu den zerklüfteten Kinross Mountains blickte, dachte Liam an seine Mutter, und wie sein Vater ihren Körper und ihren Geist gebrochen hatte. Er dachte an seinen Clan, die Mackenzies von Wester Ross, die so hart arbeiteten und sich unter der eisernen Faust ihres Laird beugten. Er dachte an seine Brüder, den Bastard und den legitimen Sohn, von denen keiner stark genug war, um die Züchtigung seines Vaters auszuhalten.
Liam ließ sich oft an ihrer Stelle schlagen. Aber wer würde sie beschützen, wenn er jetzt in den Krieg zog?
Liam war ein Mann geworden. Nicht nur groß genug, um seinem Vater in die bösen Augen zu blicken. Seine Schultern waren auch breit genug, um die zahllosen Peitschenhiebe auszuhalten, die seinen Rücken geformt hatten, als hätte Satan selbst ihn mit Hammer und Meißel bearbeitet. Und seine Fäuste waren stark genug, um zurückzuschlagen.
Er hatte sich zum Dienst in der Armee Ihrer Majestät gemeldet. Er würde das Feuer in seinem Blut dafür nutzen, Gewalttaten im Dienst der Krone zu begehen. Erlaubt von Gott und Vaterland.
Es war sein einziger Ausweg.
Aber zuerst musste er etwas unternehmen. Der Tag war gekommen.
Laird Hamish Mackenzie hatte aus seinem Sohn und Erben ein Monster machen wollen. Jemanden, der ihm glich. Aber Monster waren nur erfunden, die Hirngespinste abergläubischer Vorstellungskraft, absurde Geschichten aus der Vergangenheit. Liam wollte kein Monster sein. Nein, er hatte einen besseren Plan.
Er würde ein Teufel werden.
1
London, September 1878
Zwanzig Jahre später
ZIEHEN SIE SICH aus. Es war nicht das erste Mal, dass Lady Philomena St. Vincent, Viscountess Benchley, diesen Befehl hörte. Schließlich war sie mit einem brutalen Wüstling verheiratet. Und trotzdem war sie für einen Augenblick sprachlos und starrte verständnislos in das hängebackige Gesicht von Dr. Percival Rosenblatt. Er konnte unmöglich meinen, dass sie in seiner Gegenwart ihre Kleidung ablegte. Nur Schwestern führten die Aufsicht bei den Eisbadtherapien hier im Belle-Glen-Irrenasyl. Dass ein Arzt ihr beiwohnte, war noch nie da gewesen.
»Aber Doktor, ich … ich war folgsam.« Unwillkürlich machte sie einen Schritt rückwärts, und Angst flammte in ihrem Magen auf, als sie die Wanne sah, in der Eisstücke scharfkantig wie Scherben an der Oberfläche trieben. »Ich habe nichts getan, was eine solche … Behandlung rechtfertigen würde.«
Behandlung. Ein eigentümliches Wort. An einem Ort wie diesem hatte es viele Bedeutungen.
»Sie hat sich schon wieder an sich selbst vergriffen.« Schwester Greta Schopf, ihre selbst ernannte Nemesis hier im Belle Glen, trat vor, packte kräftig ihr Handgelenk und riss die weiten Ärmel bis zu den Ellbogen hoch. Die große Deutsche in der hochgeschlossenen dunklen Uniform mit weißer Schürze und Haube hielt Menas Unterarm mit den frischen Kratzern hoch, damit der Arzt sie inspizieren konnte. »Sie hat sich auch in anderer Weise … angefasst, Doktor. Wir mussten sie über Nacht fixieren, um sie von ihren unsittlichen Trieben abzuhalten.«
Mena starrte die Schwester ungläubig an.
»Das ist nicht wahr«, stieß sie hervor und wandte sich dann an den Arzt. »Bitte, sie irrt sich, Dr. Rosenblatt. Eine andere Patientin, Charlotte Pendergast, hat mich gekratzt. Und ich schwöre, ich habe niemals …« Sie wollte es nicht aussprechen, wollte nicht, dass das Feuer in seinen faltigen, trüben Augen aufflammte bei der Vorstellung, dass sie sich selbst berührte. Allerdings würde sie in diesem Moment auch so ziemlich alles tun, um dem Eisbad zu entgehen. »Ich habe mich niemals selbst verletzt … und ich habe mich auch keinen … unsittlichen Trieben hingegeben.«
Das hatte sie dem Arzt natürlich längst gesagt, schon in ihren ersten gemeinsamen Sitzungen. Sie hatte ihm erklärt, dass sie sich die Blutergüsse und Wunden nicht selbst beigebracht hatte, sondern dass es im Gegenteil ihr sadistischer Ehemann, Lord Gordon St. Vincent, Viscount Benchley, gewesen war. Die ersten Tage nach ihrer Einweisung hatte sie nachdrücklich jeden Verdacht auf Verrücktheit oder Wahnsinn oder sexuelles Fehlverhalten von sich gewiesen, schließlich war das die absolute Wahrheit.
Und so verängstigt und allein, wie sie gewesen war, als sie hier im Belle-Glen-Irrenasyl ankam, hatte Mena verzweifelt alles über sich preisgegeben.
Anfangs hatte Dr. Rosenblatt sie nämlich an ihren Vater erinnert, der hinter seinem imposanten Büroschreibtisch Verständnis und Mitgefühl ausgeströmt hatte. Mit dem angenehmen, rundlichen Gesicht mit Backenbart und Doppelkinn, den lustigen roten Wangen und dem stattlichen Bauch schien Dr. Rosenblatt ein sanftmütiger Gentleman mittleren Alters zu sein.
Sie hätte wissen müssen, dass sie ihren Instinkten nicht trauen durfte, vor allem nicht, wenn es um Männer ging. Irgendwie lag sie ständig falsch damit.
Dr. Rosenblatt schlug ihre Akte auf und las, als wäre er nicht ohnehin der einzige Verfasser der Lügen, die darin standen. »Sie regen sich wieder auf, Lady Benchley«, sagte er mit dieser sanften Stimme, die man in der Regel für weinende Kinder und Geisteskranke aufsparte.
»Nein!«, rief sie, lauter als gewollt, als Schwester Schopf sie auf die Wanne zuschob. »Nein.« Sie zwang sich, damenhafter und freundlicher zu klingen, auch wenn sie fest die Füße in den Boden stemmte. »Doktor, ich rege mich wirklich nicht auf, aber ich würde es in der Tat vorziehen, dieses Eisbad nicht zu nehmen. Bitte. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Die Elektroden vielleicht – oder schicken Sie mich einfach zu Bett und ziehen mir die Fäustlinge an.« Sie wollte nicht über die Alternativen nachdenken, die sie gerade vorgeschlagen hatte. Sie fürchtete die Elektroden und hasste die scheuernden, kleinen Gefängnisse aus Leder, die um die Handgelenke gebunden wurden und dafür sorgten, dass sie nichts mit ihren Händen tun konnte.
Aber sie hatte vor überhaupt nichts solche Angst wie vor den Eisbädern.
»Ich bitte Sie«, flehte sie noch einmal. Tränen der Angst stiegen ihr in die Augen.
»Sie bitten so reizend, Lady Benchley.« Er sah ihr nie in die Augen, sondern auf den Mund oder die Brüste, die die Nähte des engen und unbequemen schwarzen Kleids auf die Probe stellten. »Aber ich bin Ihr Arzt, und meine erste Pflicht ist es, Ihre Krankheit zu behandeln. Wenn Sie jetzt bitte Ihre Kleidung ausziehen würden, sonst muss jemand anders das übernehmen.«
Schwester Schopf umfasste wiederum Menas Handgelenk mit einer für eine Frau außergewöhnlichen Kraft. Sie zerrte Mena noch ein Stück weiter vor zu der Wanne und packte sie mit der anderen Hand am Oberarm. »Wollen Sie sich weiter wehren, Countess Feuermuschi, oder werden Sie sich endlich benehmen?«
Countess Feuermuschi war der Name, den eine der Patientinnen ihr an jenem ersten schrecklichen Tag im Belle Glen gegeben hatte. Alle hatten sich nackt ausziehen müssen, in einem Raum mit etwa fünfzehn Frauen. Sie waren herumgestoßen, entlaust und dann mit Eimern voll kaltem Wasser übergossen worden. Jemand hatte eine Bemerkung über ihr ungewöhnlich rotes Haar gemacht, und dann über den etwas dunkleren Rotton der Haare zwischen ihren Beinen. Mena war in ihrem Leben schon mit vielen grausamen Namen bedacht worden. Die meisten stammten von ihrer Familie, den St. Vincents, und bezogen sich auf ihre Körpergröße oder ihre breiten Hüften und Schultern, aber die Bezeichnung »Countess Feuermuschi« war bisher die demütigendste gewesen. Vor allem, wenn die Schwestern oder andere Mitarbeiter des Belle Glen sie so nannten.
»Ich habe nichts Falsches getan.« Mena sah Dr. Rosenblatt, der ohne hinzusehen die Papiere in ihrer Akte hin- und herschob, panisch und flehentlich an. »Bitte tun Sie das nicht!«
»Sie sind hysterisch«, sagte er leise. »Was mir nur das wahre Ausmaß Ihres Wahnsinns beweist.«
Jetzt waren zwei Schwestern da, jede an einer Seite, und hielten sie an den Armen fest. Sobald sie nah genug war, trat Mena mit beiden Füßen gegen die Wanne, in der Hoffnung, sie umzukippen. Die massive Wanne rührte sich zwar nicht von der Stelle, aber Mena war nicht klein und konnte sich aus dem Griff der Schwestern losreißen.
»Was ist denn hier los?« Die fröhliche Stimme von Mr Leopold Burns hätte jeden Raum, den er betrat, mit Heiterkeit füllen können. Aber den Patienten des Belle-Glen-Irrenasyls brachte sein Erscheinen nur Finsternis. Der riesenhafte Pfleger war eher zwanzig als vierzig Jahre, aber eine unselige Kartoffelnase und dürres, blondes Haar ließen ihn beträchtlich älter wirken. »Sie wollen uns doch wohl keine Schwierigkeiten machen, Lady Benchley?« Angst schnürte Mena die Kehle zusammen, als Mr Burns sie jetzt anstelle der deutschen Schwester festhielt. »Jetzt erst mal runter mit den Kleidern.«
Mena wehrte sich. Sie hatte versucht, brav und fügsam zu sein. Ihr ganzes Leben war sie scheu, nachgiebig und nett gewesen, und es hatte immer zu demselben Ergebnis geführt. Diesmal wenigstens war sie nicht selbst beteiligt an ihrer Demütigung.
Sie wand sich und zappelte, als die geschickten Finger der Schwester die Knöpfe des einfachen Kleids öffneten und es ihr über Taille, Hüften und Beine hinunterrissen. Sie weinte und flehte, trat und schlug um sich, als sie ihr das Unterkleid auszog und – in einem Irrenhaus machte sich niemand die Mühe, ein Korsett zu tragen – vor den gierigen Blicken von Mr Burns und Dr. Rosenblatt ihre Brüste entblößte.
Die Männer sahen sich satt an ihr, und Mena fragte sich matt, wie die Schwestern, die doch Frauen waren, bei dieser offensichtlichen Perversion mithelfen konnten.
Tränen liefen ihr die Wangen hinab, aber das lag nicht nur an der Demütigung und Angst, sondern auch an dem beißenden, unerträglichen Gestank von Mr Burns Atem. Er riss sie rücklings an sich und hielt sie fest, angeblich, damit die Schwestern ihr die Unterhose ausziehen konnten. Dabei begrapschte er brutal ihre Brüste und presste seinen widerlichen Mund an ihr Ohr. »Je mehr Sie zappeln, Countess Feuermuschi, desto schwerer fällt es mir, meine Hände im Zaum zu halten.«
»Wann haben Sie sich je bemüht, Ihre Hände im Zaum zu halten«, klagte sie. Sie war jetzt völlig nackt, was ihr inzwischen allerdings deutlich weniger Sorgen machte, als Mr Burns härter werdende Erektion, die sich gegen ihren Rücken presste.
Er drückte mit seinen fleischigen Armen zu, bis ihr der Atem stockte. Sie spürte einen heftigen Schmerz in ihren Brüsten, und es stach in ihrer Lunge, als hätten sich die Rippen verschoben. Sie konnte nicht einmal mehr Luft holen, um zu schreien.
»Was für einen Blödsinn diese Irren reden«, sagte Mr Burns kopfschüttelnd. Dann hob er ihren erstarrten Körper über den Wannenrand. Die Schwestern nahmen die Beine.
Die Eissplitter trafen sie so plötzlich und scharf wie die Krallen einer Katze, und reflexartig wollte sie einen Arm oder ein Bein zurückziehen. Nur dass ihr ganzer Körper dieselbe Empfindung verspürte, und als sie mit dem Kopf wieder hochkam, war sie fast erschrocken, dass ihre Haut noch intakt war.
Verzweifelt tastete Mena nach dem Rand der Wanne, ihre Lungen hatten sich durch den Schock zusammengekrampft, und sie gab leise, wimmernde Laute von sich. Sie stützte sich auf, drückte sich hoch und konnte beinahe aus der Wanne springen, aber sechs kräftige Hände zwangen sie wieder nach unten. Sie pressten ihren Körper samt Kopf unter Wasser, und hielten sie dort fest.
Mena zappelte, warf sich hin und her und schlug nach ihren Peinigern, aber die Hände waren überall. Nach einer Weile verging die Panik, und sie wurde still. So sollte es also enden? Mit all den unglücklichen Irren des Empire gefangen in einer Anstalt, wo ein perverser Pfleger ihren Busen begrapschte, eine sadistische Krankenschwester ihr den Kopf unter Wasser hielt und ein kaltherziger Doktor dabei zusah?
Sie fragte sich, ob Lady Farah Blackwell, Countess Northwalk, ihren Brief erhalten hatte. Ob die Countess ihretwegen etwas unternommen oder ihre Bitte um Hilfe einfach ignoriert hatte. Dem Brennen in ihren Lungen nach zu urteilen, würde sie das wohl nicht mehr herausfinden.
Vielleicht war es das Beste so. Sie würde diese Welt umgeben von kaltem, unbarmherzigem Eis verlassen. Und so war auch das Leben gewesen, das sie die letzten fünf Jahre geführt hatte.
Konnte die Hölle wirklich schlimmer sein als das hier? War es möglich, dass sie einen Teil ihrer Sünden schon auf dieser grausamen Erde abgebüßt hatte? Vielleicht war der Herrgott gar nicht rachsüchtig, sondern nur gleichgültig. In diesem Fall könnte sie ihn vielleicht überreden, ihr einen winzigen, unbedeutenden Winkel im Himmel zu überlassen. Gern auch einen Winkel, den sonst niemand wollte. Ein verlassenes Plätzchen am Ende einer langen Gasse, wo sie allein und zurückgezogen existieren konnte. Ohne Erwartungen und ohne länger über ihr Scheitern nachzudenken. Wo die Wolken tief hingen wie ein Betthimmel und die Sonne durch sie hindurchfiel wie die Säulen aus Licht, die an einem Spätsommertag die Moore Südenglands beschienen, majestätisch und warm wie göttliche Vergebung.
Mena schloss die Augen. Gerade hatte sie den Mut gefunden, das kalte Wasser einzuatmen, als sie plötzlich hochzogen wurde und hustend an die Oberfläche kam. Sobald ihr Husten sich beruhigt hatte, konzentrierte sie sich darauf, ihre Lungen mit Luft zu füllen. Der flüchtige Moment des Friedens, den sie unter dem Eis gefunden hatte, war vorüber. Und um sich das Leben zu nehmen, war sie zu feige, das wusste sie.
Also setzte sie sich zitternd auf, zog die Knie an die Brust, bevor die Kälte ihre Glieder unbeweglich machte, und ergab sich in ihr Elend.
»Waschen Sie sie, dann beginnen wir«, befahl Rosenblatt.
Die Schwestern schrubbten sie brutal mit Seife ab und rieben ihr hämisch unter die Nase, dass dies ihr wöchentliches Bad ersetzen würde. Es vergingen ganze fünf Minuten, bis sie fertig waren, und Menas Haut fühlte sich an wie von tausend Nadeln misshandelt. Aber sie schob das Kinn vor. Sie würde tun, was sie tun musste, um der Kälte zu entkommen, die ihr jetzt bis in die Knochen drang.
»Ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen, Lady Benchley.« Dr. Rosenblatt trat ans Fußende der Wanne. »Wenn ich den Eindruck gewinne, dass Sie ehrlich geantwortet haben, holen wir Sie aus der Wanne. Haben Sie das verstanden?«
Mena nickte.
»Gut.« Er suchte etwas in den Papieren, fand es schließlich und legte es oben auf die Akte. »Wir verzichten auf die allgemeinen Formalitäten. Hören Sie nachts in Ihrem Zimmer Stimmen, Lady Benchley? Die Sie wach halten oder quälen?«
Mena blickte vor sich ins Wasser und antwortete ehrlich: »Nur die Schreie der Patientinnen. Und die Schwestern, die sie verspotten.«
Greta Schopf zwickte sie schmerzhaft in die Schulter, aber Mena zuckte nicht einmal zusammen.
»Aha.« Der Doktor sah nie von seinem Blatt auf. »Sehen Sie manchmal Dinge, merkwürdige Dinge, Erscheinungen, Geister oder Halluzinationen?«
Mena antwortete etwas lauter, denn sie wusste, Halluzinationen waren ein wirkliches Anzeichen für Wahnsinn. »Nie.« Sie schüttelte den Kopf.
»Jetzt noch ein paar Fragen für statistische Zwecke in Bezug auf Ihre Diagnose«, fuhr Rosenblatt fort.
Nach und nach verwirrte die Kälte Menas Gedanken. Das Blut in ihren Adern verlangsamte sich zu einem dünnen Rinnsal, und sie hatte so heftig zu zittern begonnen, dass sie ihre Worte durch die klappernden Zähne hervorstoßen musste. Aber sie kannte die Fragen, die kommen würden. Die Diagnose, für die ihr Mann und seine Mutter ihren Hausarzt bezahlt hatten, lautete psychosexuelle Hysterie und moralischer Schwachsinn, und der gute Dr. Rosenblatt genoss es sichtlich, sie dazu zu befragen.
»Sagen Sie mir noch einmal, wie häufig haben Sie und Lord Benchley eheliche Beziehungen gepflegt?«
Mena weigerte sich, die Frage vor Publikum zu beantworten. »Das habe ich schon gesagt.«
»Ja, Sie sagten, anfangs sei er fünf Mal die Woche zu Ihnen gekommen und dann kaum noch. Sobald er begriffen habe, dass Sie ihm keine Kinder gebären konnten, habe er die Gesellschaft anderer Frauen gesucht.« Dr. Rosenblatt beugte sich vor und suchte nach ihrem Blick, der sich vor Kälte zu trüben begann. »Außer wenn Sie ihn baten, Ihnen Gewalt anzutun. Er sagte mir, es hätte ihn angeekelt, vor allem, wenn Sie von ihm forderten, Ihre brutalen sexuellen Fantasien zu befriedigen, nicht wahr, Lady Benchley?«
Mena bemerkte, dass sie selbst in einem Eisbad vor Scham erglühen konnte. »Er … hat gelogen. Ich. Wollte. Nie …« Die Kälte leckte in ihre Brust und beraubte sie ihrer Stimme.
»Ich habe Sie gewarnt. Nur die Wahrheit wird Sie aus Ihrer jetzigen Lage befreien«, erinnerte Rosenblatt sie.
Die Wahrheit. Die Wahrheit war, dass ihr Mann genauso ein Sadist war wie Dr. Rosenblatt. Gordon St. Vincent fand mit großer Begeisterung heraus, was andere Menschen erschrecken ließ. Was sie wirklich fürchteten. Was sie an sich selbst hassten. Und er nutzte dieses Wissen zu seinem Vorteil.
Das Leben im Haushalt der St. Vincents war nach und nach zur Hölle geworden. Und sobald Gordon glaubte, sie gebrochen zu haben, als seine Sticheleien und sein Hohn keine Wirkung mehr auf sie hatten, war er gewalttätig geworden. Taten, die einen Mann ins Gefängnis brächten, wenn er sie auf offener Straße ausübte, waren völlig rechtens, solange seine Ehefrau das Opfer war.
In der gesamten Spanne von Raum und Zeit ist eine Viertelstunde nichts. Ein Sandkorn auf einem unendlichen Strand. Aber in der Wanne wurde sie zu einer Ewigkeit, die sich immer weiter von den warmen Strahlen der Sonne entfernte. Bis nur noch Kälte da war. Nur noch dieser weiße, weiße Raum und das Leiden.
Danach konnte Mena die Zeiger der Uhr nicht mehr erkennen. Ihre Muskeln verkrampften sich so schmerzhaft, dass sie unwillkürlich einen Klagelaut ausstieß. Gott, sie klang wirklich wie eine Verrückte.
Ihre Hände krümmten sich vor ihrer Brust, und merkwürdige Krämpfe schienen ihr Rückgrat zu erschüttern, während sie gleichzeitig das Gefühl hatte, als würde ihr Herz sich nur mühsam voranschleppen und bald ganz stehen bleiben.
Sie war müde. So müde.
Dann wurde sie aus dem Bad gezerrt, an den Ellbogen hochgehoben, die so steif geworden waren, dass sie ihr ganzes Gewicht trugen. Sie war zu Eis geworden, wahrhaft gefroren. Sie hatte nicht einmal mehr die Kraft, sich daran zu stören, dass Dr. Rosenblatt und Mr Burns zusahen, wie sie trocken gerieben wurde und man ihr ein grobes Baumwollhemd über den Kopf zog.
Alarmierende Taubheit strahlte von Menas Armen und Beinen nach innen aus. Sie hatte vorher noch nie länger als zehn Minuten in diesem Eisbad verbracht. Sie spürte kaum, wie eine Schwester ihr grob einen Kamm durch das lange Haar zog. Zwar versuchte sie wegzuwanken, aber die Knie versagten ihr den Dienst. Die Kälte hatte alle Kraft aus ihren Muskeln gesaugt. Mr Burns fing sie gerade noch auf, bevor sie sich verletzte, aber sie wäre lieber auf dem Boden gelandet.
»Sie ist zu schwer, wir können sie nicht tragen. Sie müssen Sie in ihr Zimmer bringen, Mr Burns«, befahl Schwester Schopf.
»Aber gern, Madam«, sagte Mr Burns gut gelaunt.
»Ich begleite Sie. Das Bad scheint ihre Hysterie beruhigt zu haben, und sie dürfte jetzt für eine ganze Weile fügsam sein.« Dr. Rosenblatt stieß sich von der Wand ab und klappte die Akte zu. »Bringen Sie das in mein Büro, Schwester Schopf, und sorgen Sie dafür, dass wir nicht gestört werden.«
Menas taube Füße machten schreckliche Geräusche auf dem blank geschrubbten Boden, als die beiden Männer sie über den Gang schleiften. Die Wände waren in diesem besonderen Weiß gestrichen, das solchen Anstalten vorbehalten war. Gaslampen hingen in präzisen Abständen zwischen den Türen, aber sie konnten die grelle Leere dieses Ortes nicht erwärmen. Selbst die Balken, Riegel und Vorhängeschlösser an den eisernen Türen waren weiß. Steril wie die Zimmer, ohne Wärme, Licht oder Farben. Rein wie die Nachthemden, hochgeschlossen und sittsam, nur dass man den Körper darunter sah.
Zitternde, wimmernde Laute drangen aus Menas Brust, sie wollte es nicht, aber sie konnte sie einfach nicht unterdrücken. Ihr Kiefer tat weh, weil sie ihn verkrampft und so heftig mit den Zähnen geklappert hatte. Sie spürte die nächtlichen Geräusche in dem Irrenasyl fast körperlich. Jedes irre Jammern kratzte ihr über die Haut wie lange Fingernägel. Bei dem Geräusch der schweren Stiefel drückten ein paar der Frauen ihre Gesichter an die Gitterstäbe vor den kleinen Fenstern zum Flur. Ihre Blicke stachen wie Nadeln – manche waren wahnsinnig, höhnisch oder auch schrecklich. Andere, Frauen wie sie, die nicht hinter diese Mauern gehörten, betrachteten sie voll Mitgefühl und manchmal mit Tränen in den Augen. Mena nahm keine von ihnen richtig wahr. Im Augenblick konnte sie nicht einmal den Kopf drehen.
»Es ist gut, dass sie sauber und gefügig ist«, stellte Mr Burns fest. »Aber ich habe keine große Lust, meinen Schwanz in einen Eisblock zu stecken.«
Seine Worte durchbohrten Mena wie ein Speer. Sie hatte sich oft gefragt, ob sie vorhatten, sie zu vergewaltigen. Sie wusste, dass der Arzt und der Pfleger das Irrenasyl als ihre persönliche Spielwiese betrachteten. Sie hatte so einige Langzeitpatientinnen schreien gehört, wenn sie mitten in der Nacht ein Kind zur Welt gebracht hatten. Sie hatte mit ihnen geweint und zum ersten Mal dem Himmel gedankt, dass sie zu groß und zu füllig war, um als wirklich begehrenswert zu gelten.
»Innen wird sie warm genug sein«, gab der Doktor zurück. »Und die Muskelkrämpfe machen die Sache sicher … interessanter.«
Furcht packte sie mächtiger als die grausamen Hände ihrer Peiniger.
»B-bitte«, stotterte sie und verstummte, als ihre Zähne wieder anfingen zu klappern. Wenn sie sich nur wehren könnte. Es würde nicht viel nützen, aber wenigstens hätte sie nicht dieses Gefühl, in ihrem eigenen Körper gefesselt zu sein. Der mutlose Zorn, den sie im Augenblick empfand, war zum großen Teil gegen ihre nutzlosen Glieder gerichtet.
»Oh ja, Mylady, Sie werden darum betteln«, sagte Mr Burns und genoss es offensichtlich, bevor er sich an den Doktor wandte. »Seit Monaten will ich meine Hände auf diese Titten legen, warum mussten wir so lange warten?«
»Das Belle Glen ist keine staatlich geführte Anstalt, Burns, mit wenig Aufsicht und zu vielen Insassen. Und das hier ist nicht irgendeine Frau. Sie ist eine Viscountess. Ich musste sicher sein können, dass ihre Familie keine Schwierigkeiten macht. Dass sie nicht schwach werden, es sich anders überlegen und sie nach Hause holen. Aber der Viscount Benchley hat mir gerade versichert, dass sie in jeder Hinsicht unserer Barmherzigkeit überantwortet sei.«
Mr Burns gab ein wollüstiges Grunzen von sich, bei dem Mena beinahe das wenige hochkam, das sie im Magen hatte. In dem Brot, das man ihr zum Abendessen gebracht hatte, war eine Spinne eingebacken gewesen, deshalb hatte sie nur die ranzige Brühe getrunken.
»Hab noch nie ’ne Adlige gevögelt«, sagte er.
»In der Tat.« Dr. Rosenblatt drehte sich zu Mena um. »Es freut Sie sicher zu hören, Lady Benchley, dass Ihr Mann Birch Haven Place verkauft hat, um unserer Institution hier eine großzügige Spende zukommen zu lassen. Sie werden … auf unbestimmte Zeit unser Gast sein.«
Bei dieser schrecklichen Nachricht entfuhr ihr ein Schluchzen, aber sie konnte nicht einmal weinen. Als wäre sie unfähig, Tränen zu produzieren.
Birch Haven Place war ihr Zuhause gewesen. Ihr einziger Zufluchtsort. Nun hatte sie wirklich alles verloren.
Der behäbige Dr. Rosenblatt war hörbar außer Atem, als sie vor ihrem Zimmer ankamen, doch vor allem der Pfleger hatte an ihr zu tragen gehabt.
»Zierlich ist sie ja nicht grade«, bemerkte Burns. »Na ja, ist wohl in Ordnung. Solche Titten wird man an einer zarten Lady kaum finden.«
Das Rasseln der Schlüssel, die der Doktor aus der Manteltasche zog, löste jetzt eine Art Panik in Mena aus, und das Herz pochte ihr gegen die Rippen. Ein Brennen begann auf ihrer Kopfhaut und rann das Rückgrat hinunter, bis ihr ganzer Körper in Säure getaucht zu sein schien.
Dr. Rosenblatts dicke Finger schienen vor Erregung unbeholfen, seine Wangen röteten sich unter dem grauen Backenbart. »Ich zuerst«, sagte er. »Ich weiß ja nicht, wo Sie Ihren schmutzigen Riemen schon überall reingesteckt haben.«
»Das wollen Sie auch nicht wissen«, witzelte Burns, und beide ließen ein Grunzen hören.
Endlich sammelten sich heiße Tränen in ihren Augen, und sie fühlten sich wirklicher an als die rauen Hände, die ihre tauben Arme und die Taille gepackt hielten. Insgeheim wünschte Mena sich, dass ihre Vulgarität sie noch schockieren würde. Dass sie nicht wüsste, wie es war, wenn ein Mann in sie eindrang, obwohl sie Nein gesagt hatte. Oder weinte. Oder sich wehrte. Aber dafür hatte ihr Mann schon gesorgt.
Als die schwere Tür zu ihrem Zimmer sich öffnete, konnte Mena ihre Finger bewegen. Das Blut und die Kraft kehrten in schmerzhaften Wellen in ihre Hände zurück.
Sie würde also kämpfen können – aber beide gleichzeitig abwehren?
Wahrscheinlich nicht. Es waren Unmenschen. Zwei Männer, die sich wegen ihrer Größe und Statur über sie lustig machten, obwohl Mr Burns Muskeln unter einer weichen Schicht lagen und Dr. Rosenblatt sogar schlichtweg fett war.
Sie würden sie überwältigen und dann … ein Würgen, das sie nicht zurückhalten konnte, nahm ihr den Atem.
»Dr. Rosenblatt!« Die Stimme von Schwester Schopf hallte durch den Gang wie Kanonendonner. »Doktor, Sie müssen sofort kommen!«
Sofort erhob sich das disharmonische Gezeter des Wahnsinns, als Patientinnen aufwachten, kreischten und ihre entsetzlichen Laute von sich gaben.
»Wir werden gestürmt!«, schrie die Schwester.
»Gestürmt?« Dr. Rosenblatt erbleichte sichtlich. »Von wem?«
»Von der Polizei!«
Rosenblatt verzog angewidert den Mund, machte eine hässliche Bemerkung und warf Mr Burns die Schlüssel zu. »Bringen Sie sie in ihr Zimmer und fixieren Sie sie, während ich mich um diese Sache kümmere.«
»Mit dem größten Vergnügen!« Burns riss Mena an sich und drängte sie in den Raum, in dem sie jede Nacht ihren Kampf mit dem Abgrund austrug.
»Nicht fixieren«, rief sie heiser. Die Verzweiflung brachte etwas von ihrer Stimme zurück. »Sie müssen das nicht tun. Bitte, lassen Sie mich einfach so.« Es lag eine besondere Angst darin, sich nicht bewegen zu können. Diese Angst erschuf ihren eigenen Wahnsinn, da der Geist arbeitete, während der Körper es nicht konnte. Mena hatte sich alle möglichen furchtbaren Dinge vorgestellt, die passieren konnten, während sie an Armen und Beinen auf dem harten Bett festgeschnallt war. Ein Feuer konnte ausbrechen, und sie würde nichts tun können, als darauf zu warten, dass es sie langsam verzehrte, Ratten konnten an ihren Füßen knabbern oder Spinnen über ihren Körper laufen.
Und jetzt war ein neuer Schrecken hinzugekommen. Ein Mann, zwei Männer hatten uneingeschränktem Zugang zu ihrem Körper, und sie würde nicht kämpfen, sich nicht wehren oder auch nur die Position verändern können, um den Schmerz beim Geschlechtsverkehr zu lindern.
Langsam kehrte wieder mehr Gefühl in Menas Glieder zurück. An den Stellen, wo Mr Burns ihren Körper berührte, fühlte es sich an, als bestünde seine Haut aus Rasierklingen und ihre aus Seide. Sie konnte das reißende Gefühl fast hören.
Und als auch ihre Bewegungsfähigkeit zurückkehrte, loderte Angst in ihr auf. Mena zappelte in dem eisernen Griff des Pflegers. Sie versuchte, sich loszureißen, aber sie war zu schwach. »Fixieren Sie mich nicht, ich flehe Sie an!« Sobald er einen Arm losließ, um nach dem ersten Fesselriemen zu greifen, schlug Mena wild um sich und erwischte ihn mit dem Ellbogen am Kinn.
Burns entblößte seine fauligen Zähne, als er sie herumriss. Er schlug ihr mit dem Rücken seiner riesigen Hand ins Gesicht und ließ sie gleichzeitig los, sodass Mena wie ein Häuflein kraftloser Glieder auf den harten Boden stürzte. Schmerz explodierte in ihrer Wange und strahlte in Augen, Ohren und Hals aus, aber zum Glück hatte sie sich mit den zitternden Händen abfangen können, und ihr Kopf war nicht auf dem Boden aufgeschlagen. Der Geschmack nach Kupfer und Salzwasser sickerte ihr in den Mund, wo die Zähne innen die Wange verletzt hatten.
Mr Burns ging neben ihr in die Hocke, und die freundliche, bescheidene Miene stand wieder auf seinem unseligen Gesicht. »Ich will Sie aus reiner Herzensgüte mal an was erinnern, Countess Feuermuschi.« Ihre Augen tränten vom üblen Gestank seines Atems. »Da draußen sind Sie vielleicht ’ne adlige Lady und erwarten, dass jeder Ihnen die Stiefel leckt. Aber hier drinnen sind Sie nichts weiter als eine durchgedrehte Muschi unter vielen, weggesperrt, weil keiner sie ausstehen kann. Ich sag Ihnen mal, was ich den anderen sage. Wenn Sie mich glücklich machen, kann ich Ihnen das Leben erleichtern. Wenn Sie schwierig sind, wird auch Ihr Leben schwierig, und niemand wird glauben, dass Sie sich die blauen Flecken, die ich Ihnen verpasse, nicht selbst beigebracht haben.«
Die größeren Muskeln in Menas Körper bebten und zitterten jetzt, als der Blutfluss mit voller Macht zurückkehrte. Ihre Haut brannte, obwohl sie gleichzeitig fror. Trotzdem empfand sie nur eine rohe dunkle Emotion, die schwarz und zerstörerisch in ihrer Seele aufstieg, als wäre einer der vielen Dämonen, gegen die sie ihr Leben lang gekämpft hatte, endlich freigekommen.
»Es heißt Viscountess Feuermuschi, Sie widerlicher Grobian«, schnappte sie und überraschte sich mit diesen Worten selbst fast mehr als Mr Burns. »Wenn schon alle darauf bestehen, mich mit diesem lächerlichen Spitznamen anzureden, dann können Sie wenigstens den korrekten Titel benutzen.« Um ihr Schicksal zu besiegeln, spuckte sie Blut in sein ekelhaftes Gesicht.
Er verhielt sich genau, wie sie erwartet hatte, und sein nächster Schlag schenkte ihr das ersehnte Vergessen.
Die Idee des Himmels war für Mena schwer zu verstehen. Und wann immer sie ihn sich vorstellte, beschwor sie stets nur ein Bild von zu Hause. Ihrem wirklichen Zuhause. Nicht Benchley Court, dem prächtigen Herrenhaus, in dem sie die letzten fünf entsetzlichen Jahre mit ihrem Mann gelebt hatte. Auch nicht dem Belle-Glen-Irrenasyl, wo sie jetzt blutend und schmerzerfüllt auf dem Steinboden lag.
Sondern Zuhause. Birch Haven Place, einem idyllischen Landsitz in Hampshire. Einem Ort, der so sehr Paradies war, wie diese Anstalt das Fegefeuer.
In den dunklen Tiefen ihres Unterbewusstseins spürte Mena die Sonne Südenglands auf ihrem Gesicht. Selbst wenn sie die Augen schloss, sah sie, wie Hell und Dunkel auf ihren Lidern spielten. Sie saß im Schatten des geliebten Birkenhains, wo sie im Sommer immer picknickte und las. Sie blickte über die Felder zum Haus, einem hübschen Gebäude im georgianischen Stil, zu groß, um es ein Cottage zu nennen, und zu klein für ein Herrenhaus, aus rotem Backstein mit weißen Fenstern und viel zu vielen Schornsteinen. Ihr Vater hatte einmal gemeint, dass er das Dach etwas überladen fand. Aber Mena hatte all die anscheinend unnötigen Giebel und Rauchfänge geliebt.
In der Kindheit waren die Gärten ihr Feenreich gewesen, wo sie ihrer Vorstellungskraft freien Lauf lassen konnte. Die Ställe wurden in ihrer Jugend ihr Zufluchtsort, denn sie durfte das Land so weit auf dem Pferderücken erkunden, bis die Felder ans Meer stießen. Im Winter war der große Kamin im bescheidenen großen Salon ihr warmer, tröstlicher Winkel. Dort steckten sie und ihr geliebter Vater über unzähligen Büchern die Köpfe zusammen und schlossen die Welt aus.
Ihr Vater war wundervoll gewesen. Zu niedrig geboren für die feine Gesellschaft, zu sanftmütig für den Kaufmannsberuf, ja, zu exzentrisch, um überhaupt irgendwo hineinzupassen, aber gleichzeitig zu wohlhabend, um ignoriert zu werden. Ihre Mutter war an Scharlach gestorben, als Mena noch ein Kind gewesen war, und Baron Phillip Houghton hatte seine einzige Tochter beschützt und verhätschelt. Hatte sie wie einen Jungen unterrichtet. Wie einen Schatz gehütet. Und in ihr die Liebe für Landwirtschaft und Geisteskultur geweckt.
Als die St. Vincents das stattliche Herrenhaus von Grandfield gekauft hatten, dessen Land an Birch Haven grenzte, hatte der Baron eine Möglichkeit gesehen, sein Kind vor einem Dasein als alte Jungfer zu bewahren.
Eine Krankheit hatte ihn befallen. Er hatte sie vor Philomena verheimlicht, bis er ihr nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit erlegen war und sie auf dieser Welt allein ließ – mit einem grausamen Ehemann und seiner verhassten Familie.
Und jetzt war Birch Haven verloren, ihr Vater seit Jahren tot. Und es gab keine Sonne, keine Wärme in dieser Welt.
Die Kälte durchdrang Mena, bevor ihr Bewusstsein ganz zurückkehrte, und sie wusste mit Sicherheit, dass sie nicht im Himmel war. Schon bevor sie blinzelnd die Augen öffnete und das Gesicht des Teufels sah, der – eine Augenklappe über dem grimmigen, aber merkwürdigerweise gut aussehenden Gesicht – ihren Namen rief.
»Bleiben Sie liegen, Lady Benchley, sagte der schwarzhaarige, schwarzäugige Mann, als er etwas über ihren zitternden Körper legte, etwas, das Wärme aus seinen schweren Falten freigab. Sein Mantel? »Sehen Sie nicht hin«, befahl er sanft.
Ein Mann schrie ganz in der Nähe. Mr Burns? Die Stimme rief Gänsehaut bei ihr hervor. Ihr Gesicht pochte schmerzhaft. Draußen im Gang hallten Freudenschreie und Schreie des Wahnsinns, dazwischen hörte man strenge Männerstimmen.
In der Nähe erklang ein widerliches Knirschen, und trotz der Befehle des Teufels – trotz ihres eigenen Entsetzens – sah Mena hin.
Mr Burns sackte zu Boden, als der rothaarige Auftragskiller ihn fallen ließ. Der Hals des Pflegers war in einem unmöglichen Winkel verdreht, und seine Augen starrten blind auf die kalten, weißen Wände. Mr Burns hatte in den letzten Momenten seines Lebens Angst gehabt, und Mena freute sich darüber.
»Er hätte die Finger von Ihnen lassen sollen«, sagte der Killer in seiner tonlosen, ungerührten Art.
»Mr Argent.« Ein blonder Mann in einem perfekt gebügelten Anzug blickte in die Zelle. Die hellen Augenbrauen waren in einer geradezu väterlichen Missbilligung zusammengezogen, auch wenn er nicht viel älter sein konnte als Dorian Blackwell und Christopher Argent. »Haben Sie diesen Mann gerade umgebracht?«
Argent stupste Burns mit der Schuhspitze an, seine kalten Züge waren eine glatte Maske der Unschuld. »Nein, Chief Inspector Morley, ich habe ihn so vorgefunden.«
Der Chief Inspector blickte von Christopher Argent zu Mena, und seine blauen Augen füllten sich mit Mitgefühl. Dann sah er den Teufel an, der sich über sie beugte. Der Mann war kein Idiot, und Mena konnte sehen, dass er die Lage in Sekunden richtig eingeschätzt hatte.
»Blackwell?«
»Der Mistkerl muss ausgerutscht sein, als er die Dame belästigen wollte.« Dorian Blackwell, das Schwarze Herz von Ben More, zuckte mit den Schultern, als er kurz zu Argent und dann wieder zu Morley hinüberblickte.
Ein angespannter und stummer Austausch entspann sich zwischen den drei Männern, und nach einem Augenblick, in dem selbst Mena zu atmen vergaß, ließ der Chief Inspector die Schultern sinken und nickte. »Ich lasse einen Arzt für die Viscountess kommen«, murmelte er zwischen zusammengebissenen Zähnen. »Einen richtigen Arzt. Den, der diese Anstalt leitet, möchte ich lieber am Galgen sehen.«
»Ich kümmere mich um den Abfall hier.« Argent packte Burns am Fußgelenk und zog den schlaffen, schmutzigen Leib des Pflegers aus dem Zimmer, als würde er nicht mehr wiegen als ein Jutesack.
Dorian wandte sich wieder Mena zu. Er neigte den Kopf und betrachtete sie aus seinem guten Auge. »Bleiben Sie noch einen Augenblick liegen, Lady Benchley«, sagte er so sanft, wie Mena es einem solchen Übeltäter eigentlich nicht zugetraut hätte. »Meine Frau, Lady Northwalk, wartet in der Kutsche. Sobald der Arzt erlaubt, dass wir Sie bewegen, bringen wir Sie von hier fort.«
Noch einmal verlor Mena das Bewusstsein, diesmal vor lauter Erleichterung.
2
Halluzinationen. Wahnvorstellungen. Wachträume. Sie alle waren Symptome des Wahnsinns.
Und doch wachte Mena nicht jedes Mal auf, wenn sie sich kniff. Das hier passierte tatsächlich.
Rasch blinzelte sie die Tränen der Dankbarkeit fort, als sie die beiden Damen ansah, die auf je einer Chaiselonge saßen und schon den zweiten Tag dabei zusahen, wie Madame Sandrine und ihre Helferinnen sie mit einer neuen Garderobe ausstatteten. Würde sie diese malen, wie sie jetzt vor ihr saßen, würde sie das Bild DerEngel und die Verführerin nennen.
Farah Leigh Blackwell, Countess Northwalk, saß rechts von Mena, ein Inbegriff femininer, engelsgleicher Vornehmheit, als sie aus einer zierlichen Tasse einen Schluck Tee trank. Ihr elfenbeinfarbenes Kleid aus Musselin und Spitze harmonierte mit den goldenen Strähnen in ihrem weißblonden Haar. Man würde nie im Leben darauf kommen, dass sie die Frau des berüchtigten Schwarzen Herzens von Ben More war, des Königs der Londoner Unterwelt.
Links von Mena hatte Millicent LeCour es sich auf der anderen Chaiselonge gemütlich gemacht. Sie trug Scharlachrot wie eine Abenteurerin und wickelte sich gerade eine schwarze Locke um den Finger. Dann kniff sie abwägend die katzenartigen Mitternachtsaugen zusammen und biss genüsslich in einen Schokoladentrüffel.
»Ich weiß, Sie sind unsicher wegen Ihrer breiten Schultern, meine Liebe, aber wenn Sie sie nach vorn ziehen, vermitteln Sie Unterwürfigkeit und Zweifel. Sie haben eine schöne, majestätische Figur, und die müssen Sie einfach zu Ihrem Vorteil nutzen. Bringen Sie die Schultern nach hinten und unten, weg vom Hals, als hätten Sie Engelsflügel, die sie einklappen müssten.« Millie stand auf, um das Gesagte zu illustrieren, und ihre Haltung war ein Musterbild von Selbstsicherheit und Autorität. »Und noch etwas: das Kinn immer parallel zum Boden. Wenn Sie jemandem nicht in die Augen blicken können, sehen Sie überall sonst hin, aber lassen Sie auf keinen Fall das Kinn sinken.«
Eine Lektion in Haltung von der berühmtesten Schauspielerin der Londoner Bühnen. Mena konnte es kaum glauben. Sie bemühte sich, Millies anmutige und königliche Haltung nachzuahmen, und prüfte das Ergebnis in den Spiegeln, die das Podest umgaben, auf dem sie stand.
Ihre Schultern wirkten würdig und Achtung gebietend. Ihr Busen reckte sich stolz in die Höhe, auch wenn das neue Korsett ihn kleiner wirken lassen sollte, und drängte gegen die schlichten, aber eleganten schwarzen Knöpfe des Tageskleids aus grün-goldenem Schottenkaro – die perfekte Uniform für ihre neue Anstellung als Gouvernante.
Nur ihr Gesicht machte die Wirkung zunichte.
Mena berührte mit der Zunge den verheilenden Riss in der Lippe. In den drei Tagen seit ihrer Rettung aus dem Belle Glen war die Schwellung schon sehr zurückgegangen. Das Auge hatte sich blau gefärbt und war völlig zugeschwollen. Aber Lady Northwalk hatte ihr kalte Umschläge gemacht, und langsam sah sie wieder aus wie sie selbst. Auch wenn die Farbe der Blutergüsse noch ziemlich hässlich war.
Mena musste kurz an den Mann denken, der sie ihr beigebracht hatte.
Millicent LeCours Verlobter, Christopher Argent, hatte Mr Burns einfach so das Genick gebrochen. Mena fragte sich, ob die Schauspielerin wusste, wozu ihr Zukünftiger fähig war. Aber das tat sie wohl, denn man musste Argent nur ansehen, um zu wissen, wie gefährlich er war. Die arktische Kälte in seinen eisblauen Augen schmolz nur für die Schauspielerin und ihren entzückenden Sohn Jakub. Mena würde dem Mann auf ewig dankbar sein, denn er hatte Mr Burns von ihrem bewusstlosen Körper weggerissen und sie vor den Demütigungen gerettet, die dieses Monster ihr hatte antun wollen.
Mena dachte, dass sie eigentlich entsetzter darüber sein müsste, zugesehen zu haben, wie ein Leben beendet worden war. Aber eigentlich war sie froh, sogar dankbar, dass Mr Burns nicht länger hilflose Opfer quälte. Und noch dankbarer war sie, dass diese beiden Frauen sie unter ihre Fittiche genommen hatten und sogar für eine völlig neue Garderobe von der begehrtesten Schneiderin in ganz London aufkommen wollten, inklusive Unterwäsche, Schuhe und Accessoires.
Sie nahm an, dass Madame Sandrine gleichzeitig Mieterin und Angestellte von Dorian Blackwell war, und daher wohl daran gewöhnt, Geheimnisse zu bewahren.
»Genau so«, ermutigte Millie sie. »Ich denke, das vermittelt die richtige Wirkung. Niemand würde an Ihrem Selbstvertrauen und Ihrer Autorität zweifeln.«
»Ich habe nie Autorität besessen … und auch nicht viel Selbstvertrauen, was das angeht.«
»Deshalb nennt man es Schauspielkunst«, sagte Millicent und trat zur Seite, als die kleine, dunkelhaarige Französin mit einem Korb voller Firlefanz hereinkam. Sie stellte ihn ab und prüfte den Saum des letzten Kleids für Menas neue Ausstattung. »Und ich denke, man kann sich oft genug selbst in die Irre führen und dann auch glauben zu sein, was man darstellt.«
»Millie hat recht, meine Liebe.« Farah stellte die Teetasse auf einem Beistelltischchen ab und erhob sich, um sich neben ihre Freundin zu stellen. »Wir müssen oft selbstbewusst wirken, und indem wir so tun als ob, kommt das Selbstbewusstsein wirklich zum Vorschein.« Ihre hellen grauen Augen betrachteten Menas Gesicht mit genau der richtigen Mischung aus Mitgefühl und Ermutigung.
»Ihre Wunden werden heilen«, versicherte Millie ihr. »Sie sehen schon besser aus. Und ich denke, wir haben uns eine gute Geschichte ausgedacht, um sie zu erklären.«
»Es ist insgesamt eine gute Geschichte«, stimmte Farah zu. »Und diese Anstellung ist nicht für immer. Dorian unternimmt bereits die ersten Schritte, um Ihre Entmündigung anzufechten, auch wenn so etwas eine Weile dauern kann.«
»Gehen wir es noch einmal durch.« Auch wenn sie wie eine Verführerin wirkte, hatte Millicent LeCour die unbeirrbare Arbeitsmoral eines Offiziers, der ein Regiment drillt. »Wie lautet Ihr Name?«
Mena atmete tief ein und versuchte, sich all die Fakten über den neuen Menschen ins Gedächtnis zu rufen, den Dorian Blackwell für sie erfunden hatte. »Ich bin Miss Philomena Lockhart.«
»Und woher kommen Sie?«
»Ursprünglich aus Bournemouth in Dorset, aber in den letzten Jahren war ich in London als Gouvernante angestellt.«
»Ich denke immer noch, wir sollten ihren Namen ganz ändern«, schlug Farah vor. »Warum nicht etwas Gängigeres wie Jane, Ann oder Mary?«
Millicent schüttelte nachdrücklich den Kopf. »Sie sieht nicht aus wie eine Frau mit einem solchen Namen, und ich weiß, dass man leichter den Überblick über eine Lüge behält, wenn ein Fünkchen Wahrheit darin steckt. Sie wird auf Philomena reagieren, weil es ihr eigener Name ist. Und er ist verbreitet genug. Wir haben Bournemouth gewählt, weil es in der Nähe von Hampshire liegt, wo sie aufgewachsen ist, und sie die Stadt kennt und sie sich ins Gedächtnis rufen kann, falls es notwendig sein sollte.«
Farah tippte sich nachdenklich mit dem Finger auf das Grübchen in ihrem Kinn. »Du hast natürlich recht.«
Miss LeCours Locken wippten um ihr erstaunlich hübsches Gesicht, als sie sich wieder zu Mena umdrehte. »Für wen haben Sie in London gearbeitet?«
»Für d-die Whitehalls, einen Reeder und seine Frau.«
»Ihre Namen?«
»George und Francesca.«
»Wie heißen ihre Kinder?«
»Sebastian, er ist jetzt in Eton, und Clara, sie ist jetzt verlobt.«
»Mit wem verlobt?«
Mena stockte. Ihre Augen weiteten sich, und sie zuckte zusammen, als der Bluterguss am Auge wehtat. »Ich … ich kann mich nicht erinnern, das gelernt zu haben.«
»Das haben Sie auch nicht.« Die Schauspielerin suchte sich mit der Geduld eines Schachweltmeisters eine weitere Trüffelpraline aus. »Ich wollte damit zeigen, dass Sie manchmal improvisieren müssen. Geben Sie einfach die erste plausible Antwort, die Ihnen in den Kopf kommt.«
»Mein Kopf ist in letzter Zeit beängstigend leer«, seufzte Mena.
Farah gab einen Laut des Mitgefühls von sich. »Sie haben so viel durchmachen müssen. Millie, vielleicht braucht sie eine Pause.«
»Nein.« Mena schüttelte den Kopf und erntete einen scharfen Blick von Madame Sandrine. Sofort nahm sie sich zusammen und stand wieder still. »Nein, ich werde mir mehr Mühe geben.«
»Wie heißt Claras Verlobter?«, fragte Millie.
»Ähm, George?« Das war der Name, der ihr in den Kopf kam.
»So heißt aber ihr Papa«, korrigierte Madame Sandrine sie von unten in ihrem starken französischen Akzent.
Ein hoffnungsloses Stöhnen entfuhr ihrer Kehle, selbst die Schneiderin konnte es besser als sie. »Ich war immer eine schlechte Lügnerin«, sorgte sich Mena und presste sich eine Hand an die Stirn. »Und ich kann niemals schauspielern! Wie soll ich das nur schaffen.«
»Unsinn!« Millie stützte die Fäuste auf ihre perfekten, in rote Seide gehüllten Hüften. »Sie sind stark, Mena. Und verglichen mit dem, was Sie schon überlebt haben, ist das gar nichts.«
Noch nie hatte jemand sie stark genannt. In der Tat war sie oft dafür gescholten worden, ein Mäuschen zu sein. Vielleicht war es nicht so sehr Stärke, als vielmehr Überlebenskunst. Und überlebt hatte sie schließlich. Dank der Güte dieser beiden außergewöhnlichen Wesen.
Plötzlich hatte Mena vor Rührung einen Kloß im Hals. »Ich weiß nicht, wie ich Ihnen beiden jemals danken soll. Nicht nur für meine Rettung, sondern auch für die Kleider, das neue Leben, die Arbeit, die Sie mir beschafft haben. Ich hoffe nur, ich enttäusche Sie nicht, und erinnere mich an alles, was wir uns überlegt haben.«
Millie warf die Locken zurück, und Funken glühten in ihren Augen. »Ich wünschte, Sie müssten das nicht tun, und wir müssten Sie nicht so weit fortschicken. Aber Ihr Mann und seine Eltern setzen alles in Bewegung, um Sie zu finden. Gott, es sind solche …«
Farah legte ihrer Freundin beruhigend die Hand auf den Arm, dann wandte sie sich aufmunternd an Mena. »Sie werden es ganz wunderbar machen.«
»Ich biete Ihnen immer noch an, dass Sie bei uns bleiben können«, sagte Millie. »Christopher hat ein Mitglied Ihrer Familie erschossen, um mein Leben zu retten. Unser Haus in Belgravia ist wirklich der letzte Ort, wo man nach Ihnen suchen würde.«
Mena kamen schon wieder die Tränen angesichts dieser grenzenlosen Großzügigkeit. »Sie können nicht ahnen, wie viel mir Ihr Angebot bedeutet, aber die Polizei weiß, dass ich die Verbrechen meiner Familie angezeigt habe, um Ihr Leben zu retten. Chief Inspector Morley weiß, dass wir uns nahestehen. Ich fürchte, ich würde die neue Position Ihres Verlobten gefährden.«
Millies Stirnrunzeln zeigte, wie frustriert sie war, aber sie wandte nichts dagegen ein. Christopher Argent war einmal der bestbezahlte Auftragsmörder im gesamten Empire gewesen. Jetzt, aus Liebe zu Millie, probierte er es mit einer Karriere in der Strafverfolgung. In Anbetracht dessen, was mit Mr Burns geschehen war, fragte Mena sich, ob das für den großen Mann wohl das Richtige war.
»Wir waren uns alle einig, dass es sicherer ist, Sie aus London wegzubringen, falls Ihr Ehemann oder Vertreter der Behörden hier nach Ihnen suchen«, rief ihr Farah freundlich in Erinnerung. »Und die Anstellung in Schottland ist fest abgemacht. Lord Ravencroft hat zugesagt, dass er Sie morgen Nachmittag vom Zug abholt.«
Mena wurde ganz flau im Magen. Sie war sich noch nicht sicher, wie sie sich in so kurzer Zeit von einer Viscountess und einer Gefangenen im Belle Glen in eine falsche altjüngferliche Gouvernante verwandeln sollte.
Madame Sandrine stand auf, die Augen der Schneiderin weiteten sich ungläubig. »Sie wollen für den ›Highlandteufel‹ arbeiten?«
»Den … was?«, keuchte Mena, und ihre Stimme zitterte verräterisch.
Farah wand sich, was Menas aufkommende Panik kaum beruhigen konnte.
Madame Sandrine fuhr fort, und ihr Gesicht leuchtete vor unheilvoller Dramatik. »Der Marquess of Ravencroft soll an einem Kreuzweg einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, damit er niemals im Kampf stirbt. Er reitet einfach so auf Kanonen und Gewehre zu, und die Kugeln fliegen an ihm vorbei. Er hat so viele Menschen getötet, dass man in der Hölle einen Knochenberg nach ihm benannt hat. Der brutalste Mann der Welt, das ist er. Angeblich kann er einen schon umbringen, indem er nur …«
»Madame Sandrine«, fiel Farah ihr ins Wort. »Das genügt.«
»Einen … Knochenberg?« Mena starrte die beiden ziemlich schuldbewusst aussehenden Frauen ungläubig an. »Wohin schicken Sie mich?«
Farah trat einen Schritt vor. »Gerade Sie sollten wissen, wie sehr die Zeitungen übertreiben. Ja, Lord Ravencroft war zwanzig Jahre lang Soldat und wurde für seinen außergewöhnlichen Mut in Asien und Indien ausgezeichnet. Seine Kinder sind fast erwachsen, er ist also älter geworden seitdem. Er hat sich vom Soldatenleben zurückgezogen und widmet sich nur noch seinen Aufgaben als Vater und Landwirt. Ich versichere Ihnen, es gibt keinen Grund, Angst zu haben.«
Aber Mena hatte natürlich Angst. In ihrem Magen rumorte es, und die Knie drohten ihr zu versagen. Wenn sie nun vom Regen in die Traufe kam? Wenn Farahs Blick durch ihre eigenen Umstände getrübt war? Schließlich war sie mit dem Schwarzen Herzen von Ben More verheiratet. Er war der König der Londoner Unterwelt, weil er Londons Straßen mit Blut überschwemmt hatte. Sie war mit einem so gefährlichen Mann verheiratet, da dachte sie vielleicht nicht zwei Mal darüber nach, Mena zum brutalsten … »Der brutalste Mann der Welt?«, fragte sie laut, als ein Angstschauer ihr den Atem nahm und eine Augenbraue unkontrolliert zu zucken begann. Mena sank auf dem Podest auf die Knie und schnappte nach Luft. »Ich glaube, ich kann das nicht.«
Farah setzte sich neben sie und rieb ihr mit ihrer warmen Hand über den Rücken. »Mena … ich weiß, Sie kennen mich nicht sehr gut, aber ich bin Ihre Freundin. Ich würde Sie niemals zu ihm schicken, wenn Sie dort in Gefahr wären.«
Mena schüttelte unaufhörlich ihren Kopf. Ihr Herz klopfte so heftig, dass sie nicht fähig war, Worte zu formen, und der Kloß im Hals drohte, sie zu ersticken.
Farah holte etwas aus ihrer Rocktasche und gab es Mena. Es war ein Brief mit einem aufgebrochenen Siegel. »Lesen Sie das«, bat Farah sie. »Und dann treffen Sie Ihre Entscheidung. Und bedenken Sie, indem ich Ihnen diesen Brief zeige, gebe ich Informationen preis, die nicht viele kennen.«
Millie setzte sich auf Menas andere Seite und nahm ihre Hand. »Vielleicht habe ich etwas über ausweglose Situationen gelernt, das Ihnen helfen könnte.«
Mena starrte auf den Brief und konzentrierte sich darauf, wieder zu Atem zu kommen. Auf dem dicken Papier stand Farahs Name in einer soliden, männlichen Schrift. Die Buchstaben hatten alle dieselbe Höhe und Breite. Sie waren aufgereiht wie kleine Soldaten.
»Was denn?«, flüsterte sie.
»In einer Zwangslage wie der Ihren«, Millies normalerweise fröhliche Stimme war tief und ernst, »ist man an der Seite eines gewalttätigen Mannes manchmal am sichersten.«
Liebe Lady Northwalk,
ich möchte Sie und Dorian mit diesem Schreiben informieren, dass ich mich vom aktiven Dienst zurückgezogen habe. Ich lebe jetzt auf Ravencroft Keep, beaufsichtige die Clanbauern und Pächter und betreibe die Brennerei.
Wie Sie vielleicht wissen, bin ich seit zehn Jahren Witwer. Meine Kinder sind kaum mehr als Waisen, da ich die meiste Zeit ihres Lebens im Dienst Ihrer Majestät im Ausland verbracht habe.
Ihre Erziehung wurde während meiner Abwesenheit katastrophal vernachlässigt.
Wenn ein Soldat das Glück hat, mein Alter zu erreichen, bedauert er vieles. In meinem Fall nicht nur die Gräuel des Krieges, sondern auch, was ich verlassen habe. Meine Kinder, aber auch Ihren Mann. Meinen Bruder.
Ich habe kein Recht dazu, aber ich frage mich, ob ich Sie nicht um einen Gefallen bitten könnte.
Ich bin kein Mann, der gewöhnt ist, sich auf die Güte anderer zu verlassen. Als ungebildeter Soldat bin ich jedoch nicht fähig, meine Kinder auf eine Welt vorzubereiten, in der man von ihnen erwartet, als Erben eines Marquess aufzutreten. Rhianna wird im nächsten Jahr in die Gesellschaft eingeführt werden, und Andrew wünscht, die Universität zu besuchen, wenn er alt genug ist. Sie brauchen eine wirklich erfahrene Gouvernante und Lehrerin, und ich möchte Sie bitten, eine zu finden. Und falls Sie es nicht mir zuliebe tun, dann tun Sie es für sie. Sie verdienen die beste Erziehung. Egal, was es kostet. Bitte informieren Sie die Dame, dass die Kosten für den Umzug erstattet werden, und sie soll ein Gehalt bekommen, das Sie für zufriedenstellend erachten.
Für Ihre Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Bitte richten Sie Ihrem Mann meine Grüße aus. In Dankbarkeit
Lt. Col. William Grant Ruaridh Mackenzie. Marquess Ravencroft.
Bealach na Bà-Pass, Wester Ross, Schottland, Herbst 1878.
Mena betrachtete es als eine Gnade Gottes, dass sich das Rad des Brougham erst gelöst hatte, als sie die tückische Straße durch die Berge hinter sich gelassen hatten und über die grüne Halbinsel Richtung Ravencroft Keep unterwegs waren. Andernfalls wäre die Kutsche sicherlich auf den schwarzen Felsen zerschellt, die überall in dem moosbedeckten Tal lagen.