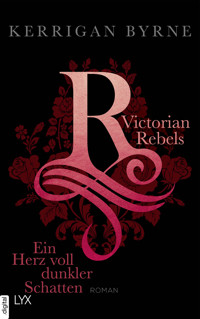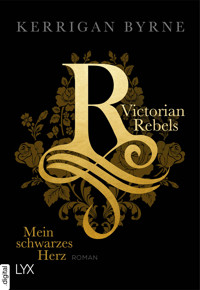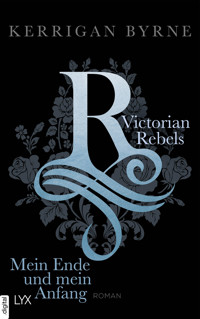
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: The Victorian Rebels
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt ...
Samantha Masters wird zur Gejagten, als sie ihren skrupellosen Ehemann erschießt, um der jungen Schottin Alison Ross das Leben zu retten. Diese bietet ihr jedoch eine einmalige Chance, ihrer Notlage zu entkommen: Sam soll sich als die junge Adlige ausgeben, um das Anwesen der Familie Ross zu retten, das sich der Highlander Gavin MacKenzie mit allen Mitteln aneignen will. Weder Drohungen noch Verführung können Sam beeindrucken, ganz gleich, wie sehr Gavin ihr Blut insgeheim in Wallung bringt. Doch als ihre Vergangenheit sie einholt, begreift sie, dass er ihr einziger Verbündeter sein könnte ...
"Kerrigan Byrne ist eine Naturgewalt des Genres!" Romantic Times
Band 5 der VICTORIAN REBELS
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Epilog
Danksagungen
Die Autorin
Die Romane von Kerrigan Byrne bei LYX
Impressum
KERRIGAN BYRNE
Victorian Rebels
Mein Ende und mein Anfang
Roman
Ins Deutsche übertragen von Inka Marter
Zu diesem Buch
Die Amerikanerin Samantha Masters wurde unfreiwillig zum Outlaw. Als ihr Ehemann bei einem Raubüberfall die junge Schottin Alison Ross kaltblütig erschießen will, drückt Sam kurzerhand selbst ab – und macht sich damit zur Witwe. Doch sie hat Glück im Unglück. Alison bietet ihr einen Handel an, der ihr Leben retten kann: Sam soll nach Schottland gehen und sich dort als Alison ausgeben, um das Anwesen der Familie Ross vor dem Zugriff des Highlanders Gavin MacKenzie zu retten. Schon bei der ersten Begegnung zwischen ihr und Gavin wird klar, dass Sam sich keine leichte Aufgabe aufgebürdet hat. Von Anfang an fliegen die Fetzen – und Funken – zwischen ihr und dem attraktiven Schotten. Aber trotz der magischen Anziehung zwischen ihnen können weder seine Verführungsversuche noch Drohungen Sam beeindrucken. Sie ist fest entschlossen, in Erradale zu bleiben. Doch so leicht entkommt sie ihrer Vergangenheit nicht, denn die Brüder ihres toten Ehemannes suchen Rache. Als Gavin ihr nach einem Angriff zur Hilfe kommt und ihr unerwartet anbietet, sie zu heiraten, begreift sie, dass er ihre einzige Chance sein könnte, ihr altes Leben wirklich hinter sich zu lassen. Aber was ist, wenn er herausfindet, dass sie nicht die Erbin von Erradale ist, sondern eine Hochstaplerin?
Für R. L. Merrill und Ellay Branton.
Was wäre dieses Buch ohne euch zwei?
Prolog
Ravencroft Keep, Wester Ross, Schottland.
Der Junge, den sie Thorne nannten, verlor seine Jungfräulichkeit mit fast sechzehn Jahren. Seine Unschuld hatte er lange vorher verloren. So früh jedenfalls, dass er sie nie vermisste.
Es war in der Nacht, in der sein Vater Tessa McGrath nach Ravencroft Keep geholt hatte. Er war nicht der Erste, der eine Prostituierte bezahlte, um seine Söhne zu Männern zu machen. Aber Thorne war damals zu jung gewesen, um zu erraten, dass Hamish Mackenzie gar nicht die Absicht hatte, seine Söhne in die Kunst der körperlichen Liebe einzuweihen.
Er wollte sie zu Monstern machen, wie er selbst eines war.
Das Mädchen war dafür bekannt, sich auf die dunklen Seiten der Erotik spezialisiert zu haben. Aber als sie das Angebot des Laird der Mackenzies angenommen hatte, hatte sie nicht geahnt, wie bodenlos tief seine Grausamkeit war.
Sie hatte vorsorglich eine Tasche mit Spielzeug mitgebracht. Weiche Peitschen, Lederriemen für Fesselspiele und andere originelle Gerätschaften, deren Anwendung sich selbst ein triebhafter Junge von Thornes Alter nicht vorstellen konnte.
Wobei er es versuchte, als er neben seinen älteren Brüdern stand und reglos und fasziniert dabei zusah, wie sein Vater die nackte, schnurrende Hure ans Bett fesselte. Er hob den Blick zu Liam und Hamish, suchte nach Hinweisen, was er erwarten oder fühlen sollte.
Hamish, der Jüngere, der Bastard, der den Namen seines Vaters trug, hatte einen lüsternen Glanz in seinen schwarzen Augen. Eine bösartige Vorfreude, die Thorne verwirrte. Er wusste, dass Hamish keine Jungfrau mehr war. Er war zwanzig und prahlte damit, dass sich ihm schon viele Frauen hingegeben hatten – freiwillig wie unfreiwillig.
Liam, Ravencrofts Erbe, würdigte die nackte Frau kaum eines Blickes. Stattdessen betrachtete er düster seinen Vater. Liam war zwischen Hamish und Thorne geboren. Seine Mutter war Laird Mackenzies erste Frau gewesen. Die gestorben war.
Von der alle sagten, ihr Vater habe sie umgebracht.
Thornes Blick sprang von Liam zum Laird und wieder zurück. Ihre Züge waren fast identisch. Langes Haar, so schwarz wie die Flügel eines Raben. Augen, dunkel wie die Nacht. Ein hartes, brutales Gesicht. Überrascht bemerkte Thorne, dass Liam schon fast so groß war wie ihr Vater. Wie die Eichen, die Inverthorne Forest beherrschten. Ob Liam eine Frau … oder Frauen … gehabt hatte, wusste er nicht. Sie redeten nicht mehr oft miteinander. Aber Thorne liebte seinen Bruder mit all der sanften Wildheit seiner Jugend.
Liam war mutig. Er war stark und ernst und beschützte ihn. Als Thorne noch sehr jung gewesen war, hatte Liam ihm manchmal gezeigt, wo er sich verstecken konnte, wenn der Laird wieder einen seiner Wutanfälle hatte – und ein paar Peitschenhiebe und Schläge kassiert, die eigentlich Thorne gegolten hatten.
Und dafür würde er seinen Bruder immer lieben. Was auch geschehen mochte.
Inzwischen war Thorne zu groß für die Verstecke und Schlupfwinkel in Ravencroft Keep, und deshalb suchte er draußen Zuflucht, wann immer es möglich war.
Tessa McGrath war schön gewesen in jener Nacht. Gertenschlank mit glatter, heller Haut und faszinierenden Schönheitsflecken an Stellen, die er vorher nie richtig gesehen, sich aber immer vorgestellt hatte. Die Unterseite der üppigen Brüste. Das Innere der Schenkel, und direkt darüber das weiche Haar zwischen ihren Beinen.
Die Hure hatte ihn erregt. Sie hatte sich gewunden und gebettelt, die Dinge, die Frauen sonst nur in seiner Fantasie sagten, wirklich gesagt.
Morgen würde er es Callum erzählen, dachte er, seinem besten Freund. Der Sohn des Stallmeisters war ein oder zwei Jahre jünger als er, aber seit Jahren trieben sie sich gemeinsam in Wester Ross herum, galoppierten über den Gresham Peak in die Freiheit der Moore von Erradale. In letzter Zeit stibitzten sie manchmal etwas von dem duftenden Tabak aus der Dose von Callums Vater und rauchten ihn hinter den Viehweiden der Ross’. Sie betrachteten die Wellen, die gegen die schwarzen Klippen schlugen, und lachten über die Possen der flauschigen, roten Hochlandkälber, während sie besonders über ein Thema ausführliche Vermutungen anstellten.
Wie sah eine nackte Frau aus? Wie fühlte sie sich an? Was würden sie eines Tages mit ihr machen, und was hofften sie, dass sie mit ihnen machen würde? Manchmal spionierten sie Ms Ross hinterher, einer hübschen, jungen, dunkelhaarigen Frau mit funkelnden, blauen Augen und einem Gang, der sie beide fesselte. Sie war eine kräftige und üppige Person mit einem Lachen, das weit über das Moor hallte und den Jungen jedes Mal ein Lächeln entlockte. Auch wenn sie die Frau eines Viehzüchters war, kleidete sie sich immer wie eine feine Dame.
An einem besonders sonnigen Tag hatten sie mit offenen Mündern über einen der zerklüfteten Felsen am Fuße des Gresham Peak gespäht, als James Ross seine hübsche Frau an der Wand der Scheune genommen hatte, vor Gott und dem ganzen Vieh. Sehr zur Enttäuschung der Jungen hatte sie ihr Kleid und alles noch angehabt, und die Details des Aktes waren unter endlosen Unterröcken verborgen geblieben. Die ganze Sache war schnell und laut vor sich gegangen, und im Anschluss hatte das Paar geseufzt und gelacht.
»So eine Frau könnte ich heiraten«, hatte Callum mit seinem auffälligen irischen Akzent verkündet.
»Aye«, hatte Thorne bereitwillig zugestimmt. Obwohl er sich nicht so sicher war … vielleicht wollte er lieber eine Frau wie seine Mutter. Die leise sprach, elegant war und immer freundlich. Ms Ross schrie ihren Mann manchmal an, und einmal hatte sie sogar einen Schuh nach ihm geworfen.
Sie hatte ihn direkt auf dem Hintern getroffen.
Was für eine Frau tat so etwas? Seine Mutter niemals.
Sein Vater würde sie umbringen, wenn sie auch nur die Stimme gegen ihn erheben würde, geschweige denn einen Schuh.
Gott, wie er seinen Vater hasste. Fast so sehr, wie er ihn fürchtete.
Warum war er nicht der Sohn von Leuten wie den Ross’? Einfache, glückliche Menschen. Sie waren wohlhabend, besaßen Land, so hatte er jedenfalls gehört, waren aber kein bisschen adlig. Sie lebten in ihrem eigenen grünen Königreich, das Thorne so oft besuchte, wie er seinem eigenen entfliehen konnte.
Wenn er und Callum sich das nächste Mal heimlich davonmachten, würde er damit prahlen, dass er in dieser Nacht ein Mann geworden war. Dass er all die Dinge getan hatte, die sie sich in ihrer kindlichen Fantasie vorgestellt hatten. Und noch einige mehr.
Manchmal hasste er Callum. Neidete ihm den knurrigen, aber gerechten und gütigen Vater und die endlosen Tage der Freiheit, an denen er jagen und sich herumtreiben konnte wie es ihm gefiel. Thorne war seit seinem siebten Lebensjahr Earl. Damals war der Onkel seiner Mutter gestorben und er der nächste männliche Erbe in der Linie der St. James’ gewesen. Seitdem gehörte ihm Inverthorne Keep im Norden, auch wenn sein Vater es als sein Vormund für ihn verwaltete.
Aber der Titel bedeutete Thorne nichts. Er freute sich nur, dass er klug war und mit Worten umgehen konnte, denn morgen würde er Callum seine Erfahrung mit Tessa McGrath in allen saftigen, Neid erregenden Details beschreiben.
Das war der letzte Gedanke, den er für längere Zeit an Callum richtete. Denn wie sollte er sich auf etwas anderes konzentrieren, als auf den Anblick des willfährigen Mädchens vor ihm.
Dann holte der Laird seine eigene Peitsche hervor, und Thornes Freude schrumpfte gleichzeitig mit seiner Erregung wie eine mit Salz bestreute Nacktschnecke.
Das liebste Instrument seines Vaters, um Angst und Schmerz zu erzeugen, stammte noch aus der Zeit der Römer. Der Legende nach hatte einer seiner piktischen Ahnen die Peitsche einem römischen Legionär entrissen, bevor er ihn damit erschlug.
Thorne wusste nicht, ob die Geschichte der Wahrheit entsprach. Aber er wusste, wie sehr die Hiebe schmerzten, denn bei so mancher Gelegenheit hatte sie Haut von seinem Rücken gerissen.
Ein verzweifeltes »Nein« löste sich von seinen Lippen, als der Laird mit der Peitsche über den Rücken der schnurrenden Hure strich. Sie wölbte den Rücken und stöhnte erwartungsvoll …
Dann zerrissen die ersten zwei Hiebe ihre perfekte Haut.
Thorne ließ die Schultern sinken, als sein Vater um das Bett herumging und seinen Söhnen die verhasste Peitsche hinhielt.
»Für jeden von euch zwei Hiebe«, befahl er.
»Das überlebt sie nicht«, hatte Thorne wider besseren Wissens protestiert. Er hasste seine hohe, sich überschlagende Stimme und die leichte Hysterie beim Anblick des Blutes, das auf dem zarten Rücken der Frau hervortrat.
Er hatte den Schlag seines Vaters nicht vorausgesehen, obwohl er zu erwarten gewesen war, wie er kühl überlegte, als er auf dem Rücken lag, die Sterne vor seinen Augen wegblinzelte und Blut in seinem Mund schmeckte.
»Für jeden. Zwei. Hiebe«, wiederholte der Laird. »Mir ist egal, wer von euch wie oft zuschlägt, aber sie wird erst losgebunden, wenn sie sechs weitere Hiebe erhalten hat.«
Keiner der Mackenzie-Jungen sprach. Sie atmeten kaum. Auch wenn Thorne zu Liam hinsah, der seinen Vater mit einem Hass anblickte, der sich mit seinem eigenen messen konnte.
»Ihr tut es«, befahl der Laird mit einem bösen Lächeln. »Sonst tue ich es selbst.«
Hamish, der Jüngere, hatte die Hand nach der Peitsche ausgestreckt, eine beängstigende Vorfreude zeigte sich unter der Angst in seinen noch nicht ganz so furchteinflößenden Zügen.
»Nay.« Liam war vorgetreten und hatte seinem Vater die Peitsche aus der Hand genommen, bevor Hamish eine Chance hatte. »Ich werde es tun.«
Sechs Hiebe. Sechs lange, höllische, mit Schreien erfüllte Ewigkeiten.
Thornes Wangen waren rau vom Salz seiner Tränen, als es vorbei war. Er weinte nicht nur um das arme Mädchen, sondern auch über die Dunkelheit, die sich über das Gesicht seines Bruders gesenkt hatte. Liam. Sein Held. Sein Retter. Der stärkste von ihnen schwang das Werkzeug des Zorns, das sie alle zu fürchten gelernt hatten. Er sah aus wie ein Teufel, als er dort im Kerzenlicht eine wehrlose Frau misshandelte.
Er sah aus wie ihr Vater.
Thorne würde diesen Anblick niemals vergessen.
Tief in seinem Inneren wusste er, dass Liam keine Wahl gehabt hatte. Dass sein Bruder dem Mädchen weniger wehgetan hatte als sein Vater. Dass er vielleicht nicht gewollt hatte, dass Hamish oder Thorne etwas so Schreckliches tun mussten.
Aber den Schmerz auf dem Gesicht dieser Frau würde er für den Rest seines Lebens in seinen Albträumen sehen. Diese Nacht hatte alles verändert.
Es war nach den Peitschenhieben nicht vorbei gewesen.
Es war auch nicht vorbei gewesen, nachdem der Laird sie eine Stunde lang gezwungen hatte, Tessa McGrath unaussprechliche Dinge anzutun.
Und es war nicht vorbei gewesen, als man sie hatte gehen lassen.
Nein, für Thorne hatte der Horror dann erst begonnen.
Dunkler Stolz und kranker Genuss flackerten in den Augen des Mackenzie-Lairds, als Liam die Frau hinausbrachte. Sie war so misshandelt worden, dass sie nicht mehr richtig gehen konnte, aber sie hatte gespuckt und gekämpft und Rache geschworen.
»Ein außergewöhnliches Mädchen«, sagte Hamish. »Hat sich nie unterworfen …«
Der Laird richtete seine kalte Aufmerksamkeit auf Thorne, der irgendwann an dem Abend verlernt hatte zu weinen.
Scham überkam ihn zusammen mit Selbsthass und dem Gefühl, schmutzig zu sein.
Thorne blickte auf seine Hände und wollte sie sich abhacken. Um sich davon abzuhalten, etwas Dummes zu tun, verschränkte er fest die Arme vor der Brust und wünschte sich von ganzem Herzen, wenigstens ein wenig von Liams sehniger Kraft zu besitzen. Oder wenigstens von Hamishs teigiger Körpermasse.
Er war noch ein Kind. Das wusste er. Nichts, was er heute getan hatte, gab ihm das Gefühl, ein Mann zu sein. Nichts von dem, was er Callum erzählen könnte, würde etwas anderes als Ekel hervorrufen. Oder, schlimmer noch, Mitleid.
»Schwäche ist langweilig und enttäuschend.« Der Laird blickte Thorne höhnisch an. »Du bist wie deine Mutter. Nun, wenigstens sind zwei meiner Söhne stark.« Er klopfte Hamish auf die Schulter.
»Die Hure wird reden, Vater«, hatte Hamish, der Jüngere, ihn gewarnt. »Sie könnte uns Ärger machen.«
»Nay. Es gibt Mittel und Wege, sie zum Schweigen zu bringen.«
Als sein Vater das sagte, wurde Thornes ganzer Körper von einem tiefen Zittern gepackt. Er wollte sich die Haut von seinem besudelten Körper reißen. Er wollte aus diesem Zimmer fliehen und niemals zurückkehren. Er wollte seinem Vater mit seinem eigenen Dolch die grausamen, dunklen Augen ausstechen, um sich und seine Mutter aus diesem Elend zu erlösen.
Aber er war noch zu klein. Sein Vater würde ihn vorher erledigen.
Noch nicht. Dieser Gedanke knurrte in seinem Innersten.
»In Gairloch ist heute noch was los, und ich bin in Hitze geraten.« Der Laird gähnte. »Ich denke, ich werde mich dort ein bisschen austoben.«
»Kann ich mitkommen, Vater?«, fragte Hamish.
»Aye. Da ist eine Frau, hinter der ich schon lange her bin, und heute wird sie mich nicht abweisen.«
Dann war Thorne allein. Nackt bis auf den Kilt und einen einzelnen Wollstrumpf.
Er wusste nicht, wie lange er dort im Dunkeln gestanden und zugesehen hatte, wie die flackernden Kerzen albtraumhaft aufs Neue aufleben ließen, was in diesem Zimmer geschehen war. Beim Anblick des Bettes wurde ihm übel. Da war Blut auf dem Laken. Oh Gott, er konnte nicht mehr hinsehen.
Irgendwann setzten sich seine Beine in Bewegung, und er lief durch die langen Gänge von Ravencroft Keep, bis er sich im Zimmer seiner Mutter wiederfand. Das Geräusch, als er den Riegel vorschob, weckte sie aus dem Schlaf, und dann erinnerte er sich nur noch daran, dass er neben ihr zusammenbrach und mit Augen voll von ungeweinten Tränen alles gestand. Betäubt fragte er sich, ob sie den Sex und die Schande an ihm riechen konnte. Ob sie ihn nicht mehr lieben würde. Ob sie jetzt Angst vor ihm hätte wie vor seinem Vater.
Als er alles erzählt hatte, hielt sie ihn nur lange in der Dunkelheit im Arm. Ihre Tränen tropften ihm heiß ins Haar. »Es tut mir leid«, flüsterte sie kläglich. »Es tut mir so leid, dass er dein Vater ist. Ich wünschte, ich hätte es gewusst. Ich wäre bis ans Ende der Welt geflohen, bevor ich ihn geheiratet hätte. Du musst verstehen, dass ich erst sechzehn war. Er und mein Vater hatten geschäftlich miteinander zu tun und … ich war einfach ahnungslos. Ich wusste nicht, wie er war. Wenn ich durch die Zeit greifen und alles ändern könnte, würde ich einen anderen Vater für dich wählen.«
Thorne fühlte sich doppelt schuldig, weil er sie so quälte. Weil er ihr seine Sünden beichtete. Aber er konnte sonst nirgendwo hin.
»Er will, dass wir werden wie er«, flüsterte er, und die Verzweiflung drohte, ihn in der Umarmung ihrer düstersten Finsternis zu ersticken. »Was soll ich nur tun?«
Die schmalen Hände seiner Mutter, die so häufig zitterten, umfingen mit überraschender Kraft sein Gesicht. Er spürte die Wärme ihres Atems. Es war fast, als könnte sie in dem verhangenen Raum mehr sehen als nur seine Umrisse.
»Sei nicht sein Sohn. Sei kein Mackenzie«, bat sie ihn flüsternd mit einer Inbrunst, die er nicht an ihr kannte. »Hamish ist sein Sohn. Liam ist sein Sohn und sein Erbe. Aber du, mein Herz, du bist mein. Es tut mir leid, dass ich dich nicht vor ihm beschützen kann, aber denke immer daran in den Jahren, die kommen. Du bist der Earl of Thorne. Der Herr von Inverthorne Keep. Du bist wunderschön, und du bist klug, und du bist gut. Versprich mir, gut zu bleiben. Eine Frau immer nur liebevoll zu berühren. Dich nie an Grausamkeiten zu erfreuen. Deinen eigenen Weg in dieser Welt zu gehen, weit weg von dieser verfluchten Burg und diesem Clan und dem besudelten Erbe deines Vaters.
»Ich schwöre es.« Thorne spürte, wie der Schwur sich in seiner Brust verankerte, sein Herz härter machte und die kalte Dunkelheit nährte, die in dieser Nacht ausgesät worden war. »Ich bin nicht sein Sohn. Ich bin kein Mackenzie.«
Thorne erlaubte seiner Mutter, sich an ihn zu schmiegen und seine Sünden mit ihren Tränen abzuwaschen. Er fühlte sich unmännlich dabei, aber es war ihm egal. Heute Nacht wog all die anderen Nächte auf, in denen er sie vor den Aufmerksamkeiten seines Vaters zu schützen versucht und es wegen seiner Körpergröße und seinem Alter nicht geschafft hatte. Es war der Ausgleich für all die Tränen, die sie mutig und vergeblich vor ihm zu verstecken versucht hatte. Jetzt waren sie ebenbürtig. Litten unter demselben Schmerz.
Trugen denselben Namen.
Er musste nicht Hamish Mackenzies Sohn sein.
Die Kelten hatten ihr Erbe auch schon früher über die mütterliche Linie weitergegeben. Er brauchte den Namen Mackenzie nicht, um seinen Weg zu machen. Er würde einen eigenen Namen haben. Eigenes Land. Sein eigenes Vermächtnis.
Denn er würde Kinder zeugen mit einer Frau, die er liebte. Er würde sie im Arm halten. Und sie beschützen.
Sie würden in Sicherheit aufwachsen. Würden keine Angst und keinen Hass kennen oder diese seelenzerstörende Schmach.
Sie wären stolz auf ihren Namen. Seinen Namen.
Thorne musste eingenickt sein, denn er erwachte, als er verzweifelt geschüttelt wurde und lautes Donnern erklang.
»Du musst dich verstecken.« Seine Mutter schluchzte. »Er wird die Tür eintreten.«
»Eleanor!« Eine der Angeln gab unter den mächtigen Stiefeln des Laird nach. »Du wagst es, mich in meinem eigenen Heim auszusperren? Muss ich dich daran erinnern, was letztes Mal passiert ist?«
Bei allen Göttern, er war betrunken. Man hörte es an der lallenden Stimme.
»Versteck dich«, bat seine Mutter wieder und schützte ihn mit ihrem Körper.
»Nay.« Thorne, inzwischen fast so groß wie seine zierliche Mutter, hatte beschlossen, sich nie wieder zu verstecken. Er war jetzt ein Mann und würde sie beschützen, und wenn er dabei sterben müsste.
Das erste, was er sah, als der Laird die Tür schließlich eingetreten hatte, war die Peitsche.
Er würde nie vergessen, wie sein Vater in jener Nacht aussah. Nicht zornig, nicht im Geringsten wütend. Er atmete nicht einmal schwer, obwohl er schon so viel Böses angerichtet hatte. Was erst Jahrzehnte später ans Tageslicht kommen sollte.
Es war eine grausame, triumphierende Heiterkeit, die in seinen kohlschwarzen Augen flackerte. Er sah aus wie ein marodierender Barbar, der gerade ein Dorf geplündert hatte und jetzt trunken war vor Mordlust und seiner eigenen Rücksichtslosigkeit.
»Ihr beiden, verdammt.« Er taumelte in das dunkle Zimmer, sein breiter Körper wurde von hinten von dem gedämpften Licht im Gang erhellt. »Wisst ihr, was ich denke?«, fragte er und packte Thorne so fest am Arm, dass dieser fürchtete, er würde ihm die Knochen brechen. »Du bist viel zu hübsch, um mein Sohn zu sein. Wenn du ein Mädchen wärst, würd ich’s wohl glauben, aber meine Söhne sind alle dunkel und kräftig wie ich. Du bist nicht größer als eine Kröte, und in einem Kleid würde dich jeder für ne verdammte Mieze halten.«
»Lass ihn in Ruhe«, flehte seine Mutter. »Hamish, bitte. Natürlich ist er dein Sohn.«
»Hattest du dir einen hübschen Liebhaber genommen, Eleanor?« Thorne hörte das Grinsen in der Stimme seines Vaters. Dieser wusste, welche Angst diese Frage hervorrief, und er genoss es.
»Niemals.« Seine Mutter schluchzte. »Ich würde nie wagen, dir untreu zu sein.«
»Ich glaub dir sogar«, schnaubte er. »Du hast nicht den Mut für so etwas, genauso wenig wie dein Sprössling hier. Ich werde einen Mann aus diesem verweichlichten Muttersöhnchen machen.«
Hamish fing an, mit der Peitsche auf ihn einzudreschen. Er schlug immer wieder zu, traf selbst im Dunkeln mit unausweichlicher Präzision.
Thorne wusste, dass es besser gewesen wäre, nicht zu schreien, aber er konnte es nicht unterdrücken. Sobald die Peitsche nass war von seinem Blut, wurde der Schmerz unvorstellbar. Die aufgerissene Haut seines Rückens fühlte sich so merkwürdig und schrecklich an, er würde das so schnell nicht vergessen. Nach einer Weile fragte er sich dunkel, ob die hohen Schreie von ihm oder von seiner Mutter kamen. Egal wie, es musste aufhören.
Jetzt.
Etwas Dunkles und Übernatürliches stieg in ihm auf, und mit einer einzigen Bewegung drehte Thorne sich um, fing die Peitsche bei ihrem nächsten Schlag ein und riss sie seinem Vater aus der Hand. Wahnsinn und Instinkt trieben ihn an, und er schlug zurück. Ein benommener Triumph legte sich über ihn, als die Peitsche die Haut seines Vaters traf.
Das absurde Siegesgefühl hielt nicht lange an, denn sein Vater stürzte sich auf ihn, riss das Fenster auf und warf ihn hinaus.
Er fiel aus dem ersten Stock, und der Sturz dauerte so kurz, dass Thorne nicht einmal anfangen konnte, um sein Leben zu fürchten. Der Gedanke kam ihm erst, als der Aufprall auf der frostigen Erde ihm den Atem raubte. Feuer strahlte von seiner Schulter in seinen Hals, und er konnte absolut nichts mehr hören, war in ein Leichentuch aus Schweigen, Schmerz und beißender Kälte gehüllt.
Dann durchbohrten die Schreie seiner Mutter die Nacht wie ein Breitschwert ein Kettenhemd. Und sie trafen ihn ebenso hart.
Als Thorne versuchte, sich aufzurichten, nahm der Schmerz in seiner Schulter auf solch erstaunliche Weise zu, dass er nicht wusste, ob er zuerst gegen seine Übelkeit ankämpfen sollte oder dagegen, das Bewusstsein zu verlieren.
Er konnte seinen Arm nicht mehr bewegen.
Er knirschte mit den Zähnen, bis er fürchtete, sie würden zersplittern, hielt sich mit der gesunden Hand an der moosigen Böschung fest und zog sich auf die Knie hoch.
Ein Krachen zerbrach die Stille der Nacht, dann erklang ein Schrei, der plötzlich verstummte.
»Mutter?«, rief er erschrocken.
Nichts.
»Mutter! Mutter – antworte mir!«
»Hast du also überlebt?« Der Kopf seines Vaters tauchte über ihm auf. »Härter im Nehmen, als ich gedacht hätte. Ruiniert natürlich den Effekt, gleich nach deiner Mutter zu schreien.«
»Was hast du getan?«, schrie Thorne.
»Ich hab sie zum Schweigen gebracht.« Das Lallen des Lairds wurde stärker. »Die Truhe habe ich erst gesehen, als ihr Kopf dagegen geknallt ist.«
»Ich bring dich um«, schwor Thorne der Nacht und verfluchte den Kiekser in seiner heranwachsenden Stimme. »Ich bring dich um, hast du mich gehört? Wenn sie tot ist, das schwöre ich bei Christus und allen alten Göttern, dann bist auch du ein toter Mann.«
Der Laird lachte, und was von Thornes Seele noch übrig war, verblutete. »Du bist kein Mörder.« Die Vorstellung schien den Mann in Heiterkeit zu versetzen. »Wenigstens wirst du diese Burg nicht wieder betreten, bis du einer bist. Das nächste Mal, du mickriger kleiner Scheißer, solltest du besser vorbereitet sein, wenn du mich herausforderst.«
Nicht einmal ein ganzes englisches Regiment hätte Ravencroft Keep so belagern können, wie Thorne es in dieser Nacht tat. Er warf sich wie ein Rasender gegen jede verriegelte Tür. Er zerschmetterte mit einem schweren Stein ein Fenster, zog sich in den Hecken darunter aber nur noch mehr Abschürfungen zu, weil er mit nur einer Hand nicht hochklettern konnte.
Thorne erfuhr nie, warum Callum plötzlich bei ihm war, oder wie viele Stunden er unter dem Fenster seiner Mutter unzusammenhängende Flüche geschrien hatte, bevor sein kleiner, verwilderter Freund seinen eiskalten Körper von dem gefrorenen Boden hochzog. Er nahm kaum wahr, dass die Kinross Mountains im Osten sich bereits in der Morgendämmerung silbern färbten.
Obwohl er sich vor Kälte nicht bewegen konnte und seine Stimme vor Stunden verloren hatte, schrie er immer noch.
Seine Seele schrie.
Und bevor er das Bewusstsein verlor, schwor er, als Mörder zurückzukehren.
Es war nicht die letzte Nacht, in der Thorne seine Mutter sah, aber es war die letzte, in der sie ihn sah.
1
Gairloch, Wester Ross, Schottland, Herbst 1880
Zwanzig Jahre später
»Es stimmt also. Der Earl of Thorne hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen.« Der unverwechselbare schottisch-irische Akzent fuhr durch die Nacht wie ein scharfer Dolch durch weiche Haut.
Sogar hier auf dem Sannda Mhòr, dem breiten Strandstreifen, der zur Strath Bay hinunterführte, hatte Gavin St. James den täuschend leichten Schritt des großen Mannes hinter ihm erkannt.
»Wäre nicht das erste Mal«, gab er verhalten zurück, als er zur Begrüßung Callum Monahans kräftigen Unterarm umfasste. »Und sicher auch nicht das letzte. Der Teufel ist mir in vielen Männern begegnet. Der hier ist nur einer mehr.«
Selbst im gedämpften Feuerschein und trotz der wollenen Kapuze stand Callums dunkle, sonnengegerbte Haut in so starkem Kontrast zu seinen goldenen Augen, dass sie eine außerweltliche Leuchtkraft zu besitzen schienen. Sie ähnelten den Augen des Falken, der auf seinem linken Unterarm saß und sie unter einer wollenen Haube hervor anblickte. »Bei allem, was wir zusammen erlebt haben – du siehst nicht aus wie ein Mann, der mit vielen Dämonen zu tun hatte.«
»Und doch …« Gavin setzte sein typisches verwegenes Grinsen auf und ließ die Andeutung in der Schwebe verharren. Callum wusste, dass Gavins Dämonen dunkler waren als die schwarzen Wasser zwischen der Isle of Longa und der Küste des Sannda Mhòr. Gavins Familie – alle waren Halbbrüder – bestand aus einem gehängten Verräter, dem König der Londoner Unterwelt und einem gewissen Mackenzie-Laird, der im gesamten Empire der »Highlandteufel« genannt wurde.
»Ravencroft könnte dich diesmal wirklich hängen lassen, wenn er uns auf die Schliche kommt.« Der Mann, den die Leute aus der Gegend den Mac Tíre nannten, blickte wie Gavin in die mondlose Nacht und horchte nach einem Hinweis auf die ankommende Fracht. Mac Tíre hieß in der alten Sprache Sohn der Erde. Herr der Tiere.
Gavin musste kurz an seinen Bruder denken. Liam. Jetzt Laird Ravencroft. Er hatte nicht nur den Titel seines Vaters geerbt, sondern auch seinen Jähzorn und seinen Hang zur Gewalt. »Einer von uns wird über kurz oder lang den anderen töten. Ist wohl das Schicksal der Mackenzie-Männer.« Gavin schnaubte ironisch und ging in die Hocke, um noch einen Scheit auf das Feuer zu legen. Er fragte sich träge, ob es dem Highlandteufel etwas ausmachen würde, noch einen Bruder am Ende eines Seils zappeln zu sehen. »Ravencroft kommt nie so weit nach Norden. Er macht einen weiten Bogen um Inverthorne Keep, Gairloch und die Strath Bay. Er mag der Laird der Mackenzies sein, aber dies ist mein Land. Und das weiß er.«
»Und das macht die Bucht so geeignet zum Schmuggeln.« Callums raubvogelartige Augen glänzten, als würde er sich auf die Sünde freuen, die er gleich begehen würde.
»Aye«, stimmte Gavin zu. »So ist es.«
In der unnatürlichen Stille der Nacht kündigte das unverwechselbare Geräusch von ins Wasser tauchenden Riemen die Ankunft eines großen Bootes an.
»Wenn man vom Teufel spricht.« Callum ging an den Rand des Wassers, trat fast aus dem Schein des Feuers. Ein sanfter Wind bewegte den dunklen Umhang und den Kilt wie Schatten um seinen Körper, bis er eher wie ein Geist wirkte als wie ein Mann. »Das muss die Krähe sein.«
»Wie er in solcher Dunkelheit durch diese zerklüftete Bucht steuern kann, übersteigt mein Vorstellungsvermögen«, bemerkte Gavin. »Die meisten benutzen wenigstens eine Laterne.«
Callum warf ihm über die Schulter einen geheimnisvollen Blick zu. »Das Land hat seine Dämonen, die See hat ihre.« Der Mac Tíre flüsterte seinem Falken etwas zu, und der stieg mit kräftigen Flügelschlägen in die Lüfte. »Ich gehe davon aus, dass Sannda Mhòr sicher ist, aber Manannan Mac Lir wird uns warnen, falls wir unwillkommene Gäste bekommen.«
Gavin nickte und trat neben seinen ältesten Freund. Die sanfte Gischt spülte ein wenig Sand unter seinen Stiefeln weg. Er hob die Laterne und signalisierte dem sich nähernden Boot ein Willkommen. »Allerdings begreife ich immer noch nicht, warum ein Eremit, der mit zwei Schafen in einer Höhle wohnt, Kontakt zum berüchtigtsten Piraten seit Sir Francis Drake hat.«
»Sag du mal Angus und Fergus, dass sie draußen schlafen sollen«, protestierte Callum. Nach einem komischen Blick von Gavin fuhr er fort. »Ich habe die Krähe vor einiger Zeit in Tanger getroffen. Ich habe ihm beim Transport einiger exotischer Tiere für einen wohlhabenden Warlord der Gegend geholfen, und im Gegenzug hat er mir … geholfen, etwas wiederzubeschaffen, das man mir genommen hatte.«
»Gut, dass du dich nicht unklar ausdrückst«, murmelte Gavin.
»Gut, dass du nicht dein Bruder bist.« Callum stieß ihn gegen die Schulter.
»Amen.«
Callum zog einen Flachmann aus seinem Umhang und kippte etwas von seinem Inhalt hinunter, bevor er ihn Gavin anbot. »Auf Gavin St. James, Earl of Thorne. Das lasterhafte schwarze Schaf des Mackenzie-Clans.«
Gavin nahm einen langen Schluck und genoss das Brennen des irischen Whiskeys, den Callum am liebsten trank, um die Kälte der See abzuwehren. Stumm dankte er den Göttern, dass es nicht Ravencrofts Scotch war. Davon hatte er bis an sein Lebensende genug. Er gab den Flachmann dem Mann zurück, den er kannte, seit sie sich als Kinder in den Hochlandmooren von Wester Ross herumgetrieben hatten. »Paradoxerweise muss man ein guter Mann sein, um in meiner Familie als schwarzes Schaf durchzugehen.«
»Wo sind hier gute Männer?« Eine dunkle und kultivierte englische Stimme, bedrohlicher als die sie umgebende Nacht, erklang über dem Geräusch des plätschernden Wassers, als die Strömung das Boot auf dem Sannda Mhòr absetzte.
»Sie werden keine hier finden«, gab Gavin zurück.
»Sehr gut, ich habe nämlich auch keine Verwendung für sie.«
Ein Schatten in einem langen, schwarzen Umhang sprang mit einer Handvoll Männern vom Bug und half Gavin und Callum, das schwere Boot höher auf den trockenen Sand zu ziehen. Sobald das erledigt war, stellten sie sich um das Feuer und redeten über ihr Geschäft.
Als Sohn eines Mannes, der für seine Gewalttätigkeit berüchtigt gewesen war, hatte Gavin seine Beobachtungsgabe und die Fähigkeit zu täuschen früh zur Perfektion gebracht. Er konnte jeden Mann in Sekundenschnelle einschätzen. Er konnte sagen, ob jemand gefährlich oder bewaffnet war, zu Ängstlichkeit oder Kompensation neigte, und wie viel Handlungsspielraum er hatte. Er wusste, welche Knöpfe er drücken musste, um einen Vulkanausbruch zu bewirken, und mit welchen Hebeln er Dampf ablassen und eine Situation entschärfen konnte.
Als er die kleine Versammlung von Gesetzesbrechern betrachtete, konzentrierte er sich ganz auf einen Mann.
Die Krähe.
Hier stand ein Mann, bei dem Gavins Hand unwillkürlich nach dem Dolch griff. Dabei war es gar nicht die Statur oder die Größe der Krähe, die ihn beunruhigten, da Gavin schnell merkte, dass er ihm ebenbürtig war. Es waren auch nicht die bedrohlichen Narben oder das Gefühl von Gefahr, das Schatten über das Feuer zu werfen schien.
Es waren seine Augen. Seine unheimlichen, schwarzen Augen.
Sie waren nicht so wild wie Callums und auch nicht so gespielt gefühllos wie seine eigenen. Sie verrieten keine Gier, keine Wut, keine Zustimmung und keine gesteigerte Aufmerksamkeit. Man sah kein teuflisches Glänzen darin und keine dämonische Heimtücke. Was Gavin in den Augen des Piraten las, ließ ihn seine Geschäfte mit dem Mann noch einmal überdenken.
Da war nichts.
Sie waren tot.
Gavin hatte den Eindruck, dass es die Augen eines Haifischs, nicht die eines Menschen waren.
Die Krähe war letztlich ein Geschöpf der Meere. Ein vollendeter Killer, bekannt für seine absolute, tödliche Präzision, und ohne natürliche Feinde. Die Armadas aller Staaten dieser Welt hatten versucht, ihn zu besiegen.
Und hier war er.
Gavin ahnte, dass er die, die jetzt vor ihm standen, nicht als Menschen sah, sondern als Beutetiere.
Ich sehe, wer du bist, dachte er. Ich durchschaue dich. Aber du siehst mich nicht.
Das tat niemand. Niemand sah ihn jemals. Niemand kannte ihn. Weder seine Ängste, noch seine Fehler. Seine Gedanken oder seine Bedürfnisse. Seine Motive oder seine Wünsche.
Dabei waren es unendlich viele.
Obwohl die leeren, starren Augen Gavin beunruhigten, war sein Blick unverwandt auf ihn gerichtet. Er wusste, dass der Pirat begriffen hatte, was er sagen wollte, bevor auch nur ein einziges Wort gefallen war.
Das hier ist Festland, mein Land, und du bist nicht der Anführer hier.
Das bin ich.
Nachdem sie sich einen Augenblick wie Titanen auf einem Schlachtfeld des Olymps gemustert hatten, sprach die Krähe ihn endlich an. »Der Earl of Thorne, nehme ich an?«
»Aye.« Gavin nickte. »Willkommen in Gairloch.«
»Sie haben ein hübsches Gesicht für einen barbarischen Lord.«
»Ich wünschte, ich könnte das Kompliment erwidern.« Callum sog beunruhigt die Luft ein, aber Gavin grinste nur. Die Krähe war offensichtlich kein eitler Mann, also war das weder eine Kritik noch eine Herausforderung. Es war eine Sprache, die Männer wie er fließend sprachen. Quid pro quo.
Gavin hätte den Piraten nicht unbedingt unansehnlich genannt. Die merkwürdige Entstellung, die von unterhalb des Kragens hinaufreichte, bedeckte einen guten Teil seiner rechten Gesichtshälfte, jedoch verbarg sie nicht die kräftigen, breiten Züge, die durch fast aristokratische Linien verfeinert wurden. Die Krähe hatte schwarzes Haar und ebensolche Augen.
In der Tat erinnerte er Gavin an einen Mackenzie.
Doch wenn Gavin gut aussehend und Callum wild war, so war die Krähe vor allem faszinierend. Markant. Ganz außerordentlich sogar, und die Narben trugen noch zu seiner Bedrohlichkeit bei und also zu seinem Ruf, der Schrecken der hohen See zu sein.
Ein Mundwinkel der Krähe zuckte leicht belustigt. »Ich muss sagen, Aristokraten stehen nur selten persönlich auf, um mich bei einer nächtlichen Eskapade zu treffen. In der Regel schicken sie einen Diener, um ihre dreißig Silberlinge zu kassieren.«
»Was auf meinem Land passiert, liegt in meiner Verantwortung. Und ich brauche Beweise dafür, dass die Fracht nicht aus Menschen besteht, denn damit will ich nichts zu tun haben.«
Die Krähe zog das schwere Segeltuch zurück und enthüllte mehrere nicht gekennzeichnete, quadratische Kisten, die zu klein waren, um einen Menschen zu enthalten, selbst ein Kind.
Gavin nickte beruhigt. »Hier entlang.«
Es war Knochenarbeit, die Fracht auf die Wagen zu verladen, und Gavin war beeindruckt, dass die Krähe sich Kiste für Kiste mit ihm messen konnte. Die dunkle Stille der mondlosen Nacht lag erdrückend über ihnen, als sie die alte Straße an den niedrigen Klippen vorbei nach Inverthorne nahmen und die Kisten in den alten Jesuitenhöhlen unter der Burg versteckten.
Als sie fertig waren, lehnte die Krähe Gavins Angebot ab, ihn und seine Männer zum Strand zurückzubringen. Er winkte mit einer Hand, und ein Mann seiner Crew trat vor und übergab Callum einen Beutel voller Münzen, dann Gavin einen zweiten, größeren, da die Kisten für eine bestimmte Zeit auf seinem Land gelagert bleiben sollten.
»Ich bin neu in der Piraterie, aber zahlt man immer noch in Dublonen? Ich hätte gedacht, die Währung hätte sich seit dem 18. Jahrhundert geändert.« Gavin schüttelte den schweren Beutel und fragte sich, ob die Krähe noch nichts von den leichteren Pfundnoten aus Papier gehört hatte.
Die Krähe zeigte sich weder beunruhigt noch amüsiert. »Sie halten reine, saubere Goldmünzen in den Händen. Sie können von keiner Regierung oder Handelsorganisation eingefordert und nicht einmal zu einer Mine zurückverfolgt werden. Sie sind an kein bestimmtes Wirtschaftssystem gebunden, und Sie müssen sich um keinen Wechselkurs sorgen.«
»Dann ist es mir ein Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen.« Gavin nickte.
»Ich komme in einem Jahr wieder, um meine Ladung abzuholen.«
Callum wandte sich Gavin zu. »Was wirst du mit deinem Anteil tun?«
Ein Schrei, der einem das Blut in den Adern gefrieren ließ, erklang aus der Höhe, bevor Manannan Mac Lir hinunterschoss und seinen Platz auf Callums Unterarm einnahm.
»Wir sind nicht allein.« Callum zog eine Pistole unter seinem wollenen Umhang hervor, als es in einem Gehölz aus Ulmen und Eschen in der Nähe raschelte.
Gavin zählte das Klicken von sieben Abzugshähnen hinter sich, die alle kurz nach seinem eigenen gespannt wurden. Er hoffte, dem unwürdigen Tod durch eine Kugel von der eigenen Seite zu entgehen.
»Zeig dich«, befahl er dem Eindringling, und ihm wurde sofort gehorcht.
Ein zotteliges Hochlandkalb trat geräuschvoll aus dem Unterholz und schnupperte mit gesenktem Kopf an zartem Klee.
Die Spannung löste sich sofort. Die Pistolen wurden wieder gesichert, und es folgte erleichtertes Grunzen und Lachen.
»Da ist deine Antwort.« Gavin lächelte. »Das werde ich mit meinem Anteil machen.«
»Hochlandrinder?« Callum schnaubte. »Sag mir, dass du Witze machst.«
»Nay. Ich werde meinen Anteil der Ravencroft-Brennerei an meinen Bruder verkaufen. Dann kaufe ich das verlassene Erradale-Grundstück samt Vieh von der Tochter der verstorbenen Ms Ross. Du weißt schon, die, die in Amerika ist.«
»Alison Ross?« Gavin spürte Callums Verblüffung mehr, als er sie in der Dunkelheit sehen konnte. »Das wird der größte Landkauf in den Highlands seit Jahrhunderten.«
»Ganz genau.«
»Aber … die Mackenzies haben nie Vieh gehalten.«
Gavin bemerkte, dass die Krähe und seine Männer schon mit der Nacht verschmolzen, und seine Hand schloss sich um das Gold.
»Nay«, stimmte er zu. »Die Mackenzies haben nie Vieh gehalten.«
Aber er würde so bald wie möglich kein Mackenzie mehr sein. Nicht nur besaß er den Namen St. James, einen Titel, der nie den Mackenzies gehört hatte, und ein eigenes Einkommen – sobald die Krone seinen Antrag genehmigt hatte, würde der größte Teil seines Landes auch nicht länger zur Gerichtsbarkeit des Laird der Mackenzies von Wester Ross gehören.
Dann wäre er ein für alle Mal frei von dem Clan der Mackenzies. Von all seinen zahlreichen Wünschen brannte dieser am hellsten.
2
Union Pacific Railway, Wyoming-Territorium, Herbst 1880
Samantha Masters drückte den Abzug und feuerte ihrem Ehemann eine Kugel zwischen die schönen braunen Augen.
Sie flüsterte seinen Namen. Bennett. Dann schrie sie ihn.
Aber als er zu Boden ging, griff sie nach der Frau, die er festgehalten hatte.
Obwohl sie sich seit gerade einmal zwanzig Minuten kannten, klammerte sie sich an Alison Ross, als wäre diese Frau ihr der liebste Mensch auf der ganzen Welt. Auch Alison hielt sich an ihr fest, und beide sanken auf die Knie, als die Kräfte sie verließen, und schluchzten in einer Symphonie aus Angst und Erschrecken und absoluter Erleichterung.
Was verdammt noch mal war passiert?
Vor nicht einmal zwanzig Minuten waren Samantha und Alison füreinander nicht mehr als liebenswürdige Mitreisende in dem Zug gewesen, der durch die Winterlandschaft des Wyoming-Territoriums nach Osten schnaufte.
Wer waren sie jetzt? Feindinnen? Überlebende?
»Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid«, schluchzte Samantha bei jedem Atemzug. Allerdings hätte sie nicht sagen können, bei wem sie sich eigentlich entschuldigte. Bei Alison? Bei Bennett? Bei den Menschen, die in den anderen Waggons erschossen worden waren?
Bei Gott?
Heute Morgen war sie noch die wütende, enttäuschte Gattin eines charmanten und gefährlichen Mannes gewesen. Ein unbedeutendes und unfreiwilliges Mitglied der gesetzlosen Masters-Bande.
Am Nachmittag war sie schon die neue Bekannte und Vertraute von Alison Ross – sie hatten über ihre Kindertage geklagt, die sie beide auf abgelegenen Rinderfarmen verbracht hatten.
Und heute Abend, weil sie gerade etwas getan hatte, weil sie alle gerade etwas getan hatten … standen die Chancen gut, dass man sie hängen würde.
Dieser Zugüberfall hätte genau wie all die anderen ablaufen sollen. Die Masters waren am letzten Bahnhof vor einer langen Strecke ohne Halt eingestiegen. Um keinen Verdacht zu erregen, hatten Bennett, Boyd und Bradley Masters sich getrennt voneinander in den Passagierwaggons einen Platz gesucht.
Samantha setzte sich in den meist eher leeren Waggon der ersten Klasse, da es dort am ungefährlichsten war. Sobald sie die Zivilisation hinter sich gelassen hatten, würde einer der Männer das Signal geben, und sie würden die Passagiere in einem einzigen Waggon zusammentreiben.
Das diente ebenso der Sicherheit der Passagiere wie ihrer eigenen, da die Bande in der Regel keine Leute ausraubte. Bargeld, Schmuck und persönliche Gegenstände waren nie so wertvoll wie die eigentliche Fracht. Die Union Pacific Railway transportierte nämlich nicht nur Personen über den weiten amerikanischen Kontinent. Sie transportierte Güter, Waren und oftmals … Bundesgelder.
Selbst in diesen modernen Zeiten wurde alles, von Gehaltsschecks von Unternehmen über Staatsanleihen bis hin zu Bargeld und wertvollen Metallen mit der transkontinentalen Eisenbahn transportiert.
Und so hatten die Masters-Brüder, aufstrebende Unternehmer, den Beschluss gefasst, wenn die Regierung ihnen schon kein Land und die Banken kein Darlehen gaben, dann …
Dann würden sie sich eben selbst nehmen, was sie brauchten.
Es sollte ihr fünfter und letzter Zugüberfall werden. Er hätte genauso ablaufen sollen wie immer.
Niemand würde verletzt oder ausgeraubt. Die Leute müssten nur ein paar Unannehmlichkeiten ertragen und wären hinterher ein wenig aufgewühlt. Die Masters-Brüder würden mit ein paar Säcken Geld fliehen, das die Regierung einfach neu drucken konnte, und einer »verängstigten« weiblichen Geisel, die Samantha selbst spielte, und die Zeitungen hätten am nächsten Tag eine aufregende Story zu erzählen.
Das Signal war stets ein an die Decke gefeuerter Schuss, dann wurde den Reisenden befohlen, die Waffen wegzulegen und sich in einen anderen Waggon zu begeben und ihnen sanft versprochen, dass alles schneller vorüber wäre, als sie glaubten. Samanthas Job war es, sich ganz normal zu verhalten und die Mitreisenden davon zu überzeugen, dass es klüger war zu gehorchen. Oder sie spielte die Geisel, um Gehorsam zu erzwingen.
»Menschen sind Schafe«, hatte Boyd immer gesagt. »Einem süßen Ding wie dir folgen sie auch in ihr Verderben.«
Diesmal hatte Samantha es besonders bequem gehabt. Um diese Zeit im Oktober, wenn der Winter schon Einzug hielt, aber Weihnachten noch lange hin war, hatten Amerikaner im Allgemeinen nicht gerade Reisen im Kopf.
In ihrem Waggon hatten außer ihr nur zwei Passagiere gesessen. Alison Ross, eine lebhafte, muntere Dame der Gesellschaft aus San Francisco, und ein gut gekleideter Geschäftsmann, der mehr an seiner Zeitung interessiert war als an Konversation.
Zuerst hatten Alisons freundliche Versuche, ein Gespräch anzufangen, Samantha irritiert. Es fiel ihr schwer, sich darauf zu konzentrieren, während sie gleichzeitig aufgeregt und ängstlich auf das Signal wartete. Aber es wäre verdächtig erschienen, sich nicht zu unterhalten, und schon nach kurzer Zeit hatte sie Freude an Alisons Gesellschaft gefunden.
Samantha kannte nicht viele Frauen in ihrem Alter, und ganz gewiss keine, die nett war. In einem anderen Leben hätten sie und Alison tatsächlich Freundinnen sein können.
Hätte sie nicht vorgehabt, den Zug auszurauben.
Wären nicht mehr Schüsse gefallen als geplant …
Wären Boyd und Bradley nicht schon mit dem Geld losgeritten und hätten Bennett zurückgelassen, der – das weiße Hemd und die dunkle Weste mit Blut bespritzt – noch schnell seine Frau hatte holen wollen.
Oh Gott. Was hatten sie nur getan?
Über ihren ohrenbetäubenden Herzschlag hinweg hatte Bennett etwas von U. S.-Marshals gesagt. Jemandem sei in die Schulter geschossen worden. Boyd? Es habe eine Schießerei gegeben.
In Samanthas Augen schwammen Tränen, als sie zu dem Geschäftsmann hinübergeblickt hatte, der blutete und mit totem Blick ins Nichts starrte.
Ihre Schuld. Alles ihre Schuld.
Bennett hatte ihn ohne ein Wort der Warnung erschossen. Dann hatte er sich Alison geschnappt und ihr die Pistole an die Schläfe gesetzt, weil er es gewusst hatte.
Er hatte in demselben Moment, in dem Samantha voller Entsetzen auf das Blut auf seinem Hemd gestarrt hatte, gewusst, dass sie nicht mit ihm gehen würde. Dass sie zwar mit einem Gesetzlosen verheiratet geblieben wäre, aber niemals einen Mörder lieben könnte.
»Komm mit mir, Sam«, hatte er ihr knapp befohlen. »Komm mit mir, und wir gehen nach Oregon.«
Samantha hatte gewusst, dass er log.
Sie hatten letzte Nacht gestritten, als er ihr erzählt hatte, dass Boyd nach Süden wollte, nach Texas oder ins New-Mexico-Territorium, anstatt Richtung Norden nach Oregon, wie sie es geplant hatten. Die Ölstädte dort waren der neue Goldrausch.
Sie hatte ihn beschimpft. Das war nicht das Leben, das er ihr versprochen hatte. Sie hatten eigentlich ans Meer gehen wollen und mit Bauholz Geld verdienen. Er würde ihr ein großes Haus auf einer Klippe bauen, und sie würden sich lieben, während die Stürme die Hintergrundmusik dazu lieferten. Sie waren dem öden Leben auf einer Ranch mitten in der Wüste gerade erst entkommen. Samantha wollte nicht zurück zu diesen trostlosen Tagen unter der grellen, unbarmherzigen Sonne. Sie wollte hübsche, grüne Hügel, Bäume und Wiesen. Sie wollte an einem Ort leben, wo sie sich in einen Schal hüllen und dem Regen lauschen konnte, der an ihre Fenster prasselte.
Gestern Nacht hatte sie ihn angeschrien, und Bennett hatte grausam reagiert.
Aber beim Aufwachen war er charmant gewesen wie eh und je und so scharf wie immer vor einem gefährlichen Job. Sie hatte unter ihm gelegen, als er in sie eingedrungen war, und hatte ihren Groll und ihre Sorgen nicht genügend unterdrücken können, um seine Liebesbezeugungen zu genießen.
Dann war es Zeit gewesen, sich zu waschen, anzuziehen und ein Verbrechen zu begehen.
Bennett hatte versprochen, dass sie noch einmal darüber reden würden. Damit sie wieder lächelte, damit sie die Hoffnung nicht aufgab.
Das Problem war, dass Samantha nicht mehr an Bennett Masters charmante Versprechungen glaubte. Ein Teil von ihr hatte akzeptiert, was sie lange befürchtet hatte. Bennett würde sich nie gegen seine Brüder stellen, so brutal und rückständig sie auch waren. Wenn Boyd erklärte, dass die Familie nach Süden gehen würde, um in stinkenden, trostlosen Ölstädten zu arbeiten, dann würde genau das geschehen.
Boyd hatte ihr einmal im Geheimen zugeflüstert, dass Bennett sie zwar liebe, ihn aber fürchte. Und Furcht sei immer mächtiger als Liebe.
»Er würde mich dich vögeln lassen, wenn ich das wollte«, hatte Boyd ihr gedroht, als sie aufmüpfig gewesen war. Er hatte ihr zwischen die Beine gegriffen und die Finger über der Hose schmerzhaft an ihr Geschlecht gepresst. »Das solltest du dir lieber merken.«
Sie hatte jenen Abend vor fünf Monaten nie vergessen. Denn sie hatte Bennett erzählt, was Boyd getan hatte.
Und Bennett hatte nichts unternommen. Genau wie Boyd es vorausgesagt hatte.
Und als Bennett nun die Waffe an den Kopf der hilflosen Frau gehalten und Samantha befohlen hatte, die Tür des Waggons zu öffnen, hatte sie dem Mann, mit dem sie seit vier Jahren verheiratet war, in die Augen gesehen.
Er war ein Fremder gewesen.
»Lass sie los«, hatte sie ruhig gesagt. »Lass sie los, und wir verschwinden von hier.«
Sie hatte die Tür geöffnet. Bradley hatte die Pferde neben dem Zug herlaufen lassen, der in der Kurve des McCreary Passes langsamer wurde. Sie hatte ihm gewunken, und er hatte sein Pferd angetrieben. Sie würden aussteigen, und sie wollte zuerst herausfinden, was eigentlich passiert war, bevor sie übereilte Entscheidungen traf.
»Sie hat uns gesehen.«
Bei Bennetts Worten hatte sie bemerkt, dass er sein Bandana nicht vor dem Gesicht trug, und ihr war das Blut in den Adern gefroren.
»Es haben uns früher schon Leute gesehen«, hatte sie über die Schulter gesagt.
»Nicht so, Sam. Wir können keine Zeugen hinterlassen. Sie muss sterben …«
Während er noch dabei war, den Hahn seiner großkalibrigen und etwas langsamen Smith & Wesson zu spannen, hatte Samantha ihren Colt Single Action gezogen, sich umgedreht und ihm zwischen die Augen geschossen.
Erst jetzt, während sie auf den Knien lag und eine Fremde umarmte, hatte sie Zeit darüber nachzudenken, was sie gerade getan hatte.
Sie hatte einen Mann getötet. Und nicht irgendeinen.
Ihren Mann.
»Danke«, sagte Alison inbrünstig an ihrem Ohr. »Danke. Ich weiß, er war Ihr Mann, aber ich wollte noch nicht sterben.«
Samantha löste sich von Alison und betrachtete den Abdruck, den Bennetts Waffe auf ihrer Schläfe hinterlassen hatte. Er hatte sicher früher schon getötet. Er hatte … diesen unschuldigen Mann gerade ermordet, als wäre nichts dabei. Er hatte nicht einmal gezögert. Und dass er überhaupt in Betracht gezogen hatte, eine zarte und schöne Frau wie Alison zu töten.
Vier Jahre war sie mit ihm verheiratet gewesen.
Hatte sie ihn überhaupt gekannt?
Eine Kugel ließ die hölzerne Täfelung über ihnen splittern. Alison schrie auf und bedeckte mit ihren Armen den grünen Seidenhut, der auf ihren üppigen, braunen Locken saß.
Bradley.
Samanthas drehte sich blitzschnell um und sah, dass er direkt neben ihrem Waggon her galoppierte und alles gesehen haben musste. Zum Glück war er ihr schlechtester Schütze und nur der zweitbeste Reiter.
Die beste Reiterin war natürlich sie.
Und Boyd war der Revolverheld.
Samantha erinnerte sich dunkel an Bennetts Worte. Boyd war verwundet worden. Mit etwas Glück waren die Wunden tödlich.
Bradley kam wieder näher, und Samantha begriff, dass er hinter ihr her war. Und falls er den Zug erreichte, würde nur einer von ihnen beiden die Begegnung überleben.
Sie fand ihren Revolver dort, wo sie ihn fallen gelassen hatte, aber Alison hielt sie auf. »Ich weiß, wie wir Ihren Hals vor der Schlinge retten können«, sagte sie, trotz der Tränen in ihren blauen Augen, mit einem überraschend festen Blick. »Aber wir werden … die Leiche loswerden müssen.«
Samanthas rasendes Herz zog sich zusammen, aber sie und Alison duckten sich und rollten Bennetts leblosen Körper bis zur Tür.
»Du bist tot, Sam!« Bradley konnte die Pistole nicht neu laden, während er ritt, also griff er nach dem Gewehr. Die Frauen durften nicht eine Sekunde zögern.
Zusammen stießen sie Bennett durch die Tür, und der Fahrtwind und der Schwung des Zuges ließen ihn seitlich die Stufen hinunterfallen. Das Geräusch, mit dem sein Körper auf dem Boden auftraf, brachte Samantha fast um, aber Alison knallte die Tür zu, gerade als Bradley sein Gewehr angelegt hatte.
Er traf nicht, und Sam wartete eine kleine Ewigkeit auf den zweiten Schuss.
Alison hob ihre vielen Röcke, kniete sich auf einen Sitz und blickte durch das Fenster. »Er ist zurückgeblieben.« Sie stieß sichtlich erleichtert den Atem aus. »Er ist bei Ihrem – bei dem Toten geblieben.«
Erst jetzt begann Samantha zu zittern. Es ging ihr durch Mark und Bein, alle Wärme sickerte aus ihr heraus, und sie ließ sich auf einen Sitz sinken, als sie merkte, dass ihre bebenden Glieder ihr Gewicht nicht länger tragen würden.
Resolut setzte Alison Ross sich ihr gegenüber. Ihre klaren schönen Züge waren nur durch Rouge und Lippenrot betont. Smaragde hingen funkelnd an ihren Ohren und fingen leicht schwingend das Licht ein, als sie sich zu Samantha vorbeugte.
»Er hat sie Sam genannt«, sagte sie mit einer sanften Stimme, die zu ihrem klaren Tonfall gar nicht so recht passen wollte. »Ist das Ihr Name?«
»S-S-Samantha«, brachte sie durch die klappernden Zähne hervor. »S-seine Brüder. S-sie werden mich umbringen. Ich lasse mich lieber hängen.«
»Sie haben erzählt, dass Sie auf einer Ranch aufgewachsen sind. Ist das die Wahrheit?«
Samantha nickte und fragte sich, ob sie je wieder würde atmen können. Überall sah sie Bennetts gut aussehendes Gesicht vor sich, entstellt durch ein perfektes rundes Loch zwischen den Augen.
»Sie können offensichtlich schießen. Können Sie auch reiten, Vieh treiben, mit Zahlen umgehen?«
Samantha nickte wieder, dann wurde ihr die Absurdität von Alisons Fragen bewusst. »W-warum sind Sie nett zu mir? Mein – mein Mann hätte Sie beinahe …« Sie brachte es nicht über sich, es auszusprechen. Es war zu entsetzlich.
Trotz allem zeigte sich ein leichtes Lächeln auf Alisons Lippen, als sie Samanthas Gesichtsausdruck sah. »Wo ich herkomme, in meinem Land, ist es nichts Geringes, wenn man jemandem das Leben rettet. Und in meinem wilden Teil der Welt gibt es ein Gesetz, das vor allen anderen gilt – es stammt aus der Zeit, als wir noch sehr, sehr jung waren. Tha an lagh comraich.«
»Comraich?« Samantha blinzelte die schöne und offensichtlich wohlhabende Frau an. Entweder hatte Sam den Verstand verloren, oder Alison redete in Zungen.
»Es bedeutet Zuflucht.«
Samantha schüttelte den Kopf und versuchte, die Frau zu verstehen. Das Wort hatte keine Bedeutung für sie. Was meinte Alison mit »ihrem Land«? Sie sah nicht aus wie eine Einwanderin und hörte sich auch überhaupt nicht so an. War sie keine Amerikanerin? Hatte sie nicht gesagt, dass ihr Verlobter in San Francisco sei? Dass ihre Eltern wohlhabende Rancher waren und sie nach Osten reisen müsse, um einen Streit um Land auszufechten?
»Ich weiß nicht, was Sie durchgemacht haben, oder was passieren musste, damit wir beide uns hier treffen, aber ich glaube fast, wir können uns gegenseitig helfen«, sagte die elegante Frau.
»Ich bin verloren«, waren die einzigen Worte, die Samantha herausbrachte. Ohne Hoffnung und absolut verloren. Hilflos. Am falschen Ort. In jeder denkbaren Hinsicht.
Alisons Blick wurde sanft. »Waren Sie jemals in Schottland, Samantha?«
3
Wester Ross, Highlands, Schottland, November 1880
Samantha hatte vieles befürchtet, nachdem sie sich auf diese Farce eingelassen hatte – aber sich so bald nach dem Tod ihres Mannes in den Armen eines anderen wiederzufinden, hatte nicht dazu gehört.
Aber wieso eigentlich?, fragte sie sich und rang nach Atem, als diese Arme – so unnachgiebig wie die Handschellen, vor denen sie geflohen war – sie an einen harten Körper drückten. Genau das hätte sie am meisten befürchten müssen: Die verräterische Reaktion ihres Körpers auf die Nähe eines starken und gefährlichen Mannes.
Sie hatte auch geglaubt, auf jede Eventualität, jede Stolperfalle vorbereitet zu sein. Aber natürlich hatte sie in dem Chaos der letzten Wochen nicht an die Heimtücke angemessener Frauenschuhe gedacht.
Hochhackige Stiefel waren eine Erfindung des Teufels … oder vielleicht eine der vielen Strafen, die ein zorniger Gott den modernen Nachfahrinnen von Eva auferlegt hatte.
Wenn Alison nicht darauf bestanden hätte, dass Sam diese verfluchten Dinger tragen sollte, wenn sie am Bahnhof in Strathcarron in den Highlands ankäme, hätte sie auf sicheren Füßen gestanden, als dieser verfluchte Bengel sich ihre Handtasche geschnappt hatte.
Und sie hätte auch nicht wie eine dämliche Idiotin diesen wilden, keltischen Barbaren angestarrt und sich gefragt, was er um diese Zeit – oder besser in dieser modernen Zeit – auf einem Bahnhof machte.
Jedenfalls war sie noch nicht einmal aus dem dampfenden, pfeifenden Zug auf den Bahnsteig getreten, als dieser kleine Racker ihr schon die Handtasche entrissen hatte. Und deshalb war sie mit einem sehr undamenhaften Kreischen von der obersten Stufe der wackligen Klapptreppe gestürzt und in den wie durch ein Wunder wartenden Armen des besagten Barbaren gelandet.
Ein Barbar … gekleidet wie ein Gentleman?
Nein, er konnte kein Gentleman sein, denn er hatte nichts Vornehmes an sich. Allein die Kraft, die ihr den Atem aus den Lungen presste, machte das ziemlich deutlich.
»Ich hab Sie.« Etwas an dem Akzent des Mannes ließ sie innerlich schmelzen. Selbst in dieser Situation war sein Bariton weich wie Seide auf nackter Haut.
Samantha wand sich in seinem Griff, löste sich so weit von ihm, dass sie ihm ins Gesicht blicken konnte, und änderte wieder ihre Meinung.
Er war kein Barbar. Und sicher kein Gentleman.
Er musste ein keltischer Gott sein.
Und trotzdem hatte der Anzug, der sich über diesen Schultern, so breit wie die Rocky Mountains, spannte, sicher unfassbar viel Geld gekostet.
Mehr als sie jemals …
»Meine Handtasche!« Sobald sie an das Geld dachte, wand sie sich wieder, überrascht, dass er sie nicht direkt absetzte. Das gesamte Bargeld, das sie auf der Welt besaß, befand sich in der hübschen, weinroten Tasche, neben anderen unbezahlbaren Dokumenten.
Ihren Ausweispapieren.
»Keine Sorge. Sie bekommen Ihre Handtasche zurück.«
Sie hätte ihn gern gefragt, wie zur Hölle er das anstellen wollte, wäre sie nicht beim Anblick seiner Augen verstummt. Samantha hatte noch nie in ihrem Leben etwas so Grünes und so faszinierend Schönes gesehen. Nicht die zitternden Blätter der kargen Espen auf dem Hof in Nevada, wo sie aufgewachsen war, und nicht das kurze Frühlingsgras, das unter der unbarmherzigen Wüstensonne so schnell zu Gold, dann zu Braun verblasste.
Nicht einmal die offensichtlich immer üppige Landschaft ihrer neuen Heimat. Schottland.
Wie kam ein Mann zu so unvorstellbar grünen Augen? Sie saßen wie kostbare Edelsteine in einem Gesicht, das von demselben Gott gemacht zu sein schien, der auch die heimtückische Sierra Nevada aus der wilden, eigensinnigen Erde hochgezogen hatte.
Und es war nicht nur seine spektakuläre Statur, die ihn aus der Menge heraushob – wenn man das überhaupt eine Menge nennen konnte nach den vielen Menschen in Charing Cross in London –, es war seine ungewöhnliche Herrlichkeit. Samantha versuchte, ein anderes Wort zu finden. Eines, das weniger dramatisch und pompös klang, aber ihr fiel einfach nichts ein.
Er war einfach … herrlich.
Obwohl sein Anzug so fein und elegant war – die Schultern, die kaum hineinpassten, waren alles andere als das.
Nachdem sie sich ihre ersten Kleider gerade in Chicago auf Alisons Kosten hatte anpassen lassen, fragte sich Samantha, ob sein Schneider ebenso viel Aufhebens von dem Umfang seiner Arme gemacht hatte wie ihre Näherin von ihrer eigenen ungewöhnlichen Körpergröße.
Samantha war unter rauen Männern aufgewachsen, die viele Muskeln hatten durch die langen Arbeitstage, und sie hatte durchaus Gefallen an ihnen gefunden.
Verdammt, sie war sogar mit einem von ihnen verheiratet gewesen.
Aber der Highlander, der sie festhielt, war mit mehr als seinem gerechten Anteil an körperlichen Vorzügen auf die Welt gekommen. So jemandem war sie noch nie begegnet.
»Danke«, hauchte sie, dann räusperte sie sich, um den verhassten Tonfall weiblicher Bewunderung loszuwerden.
»Amerikanerin?« Ein Blick, der gleichermaßen aus Bitterkeit und Verführung bestand, lauerte unter seiner arroganten Stirn, und sie hatte das Gefühl, er hatte es gewusst, noch bevor sie ein Wort gesagt hatte.
Sie nickte zur Bestätigung. »Sie können mich jetzt absetzen.«
Zu ihrem Kummer packte er sie noch fester, der Glanz in diesen unnatürlichen Augen war gleichzeitig anerkennend und frech. »Lieber nicht. Sie sind so leicht wie ein junges Küken und stehen wahrscheinlich ebenso sicher auf Ihren Beinen. Vielleicht ist es besser, ich halte Sie noch eine Weile.«
Samantha war sich plötzlich bewusst, dass es mit jeder Sekunde in seinen starken Armen gefährlicher für sie wurde. Und dann noch dieser verfluchte Akzent. Selbst ein hässlicher Schwachkopf konnte eine Frau verführen, wenn er so klang wie er.
Mist, fiel ihr ein. Ihre Pistolen waren ebenfalls in der Handtasche.
Plötzlich überkam sie die Ahnung, dass sie vielleicht eines Tages auf diesen Mann schießen müsste, und sie beschloss, nicht auf sein hübsches Gesicht zu zielen.
»Setzen. Sie. Mich. Ab«, befahl sie. »Oder ich schwöre bei Gott, ich schreie so laut, dass man es bis London hört.«
»Das würde Ihnen in dieser Gegend nicht viel helfen.«
Um die gleichen Teile Erregung und Verzagtheit zu unterdrücken, die seine Worte in ihr hervorriefen, sah Samantha sich um und bemerkte, dass sie bereits die volle Aufmerksamkeit der abendlichen Reisenden auf dem Bahnhof hatten, aber niemand geneigt schien, ihr seine Hilfe anzubieten.
Verflucht, niemand zuckte auch nur mit der Wimper über sein unverschämtes, unangemessenes Verhalten. Wobei es sie allerdings tröstete, dass auch niemand besorgt um sie zu sein schien.
Sie richtete ihren besten wütenden Blick auf ihn und öffnete den Mund zu einem Tadel so feurig wie die ungewollte Hitze, die auf der Haut ihrer Brust und ihres Halses prickelte und sich nach Süden ausbreitete. Aber es kam nicht dazu, weil er im selben Moment ihre Füße sanft auf dem Bahnsteig absetzte. »Ich gebe zu, ich habe schon viele Frauen zum Schreien gebracht, aber nie, weil sie sich bedrängt fühlten.«
Jede Erwiderung, die ihr einfiel, verlor sich in einem Keuchen, als sich unter ihrem Bauchnabel plötzlich etwas zusammenzog.
Er ließ sie nur zögernd los – das schien er deutlich weniger geübt zu haben als seinen dreisten Humor.
Samantha bemühte sich zu ignorieren, dass seine großen Hände prickelnde Empfindungen auf ihrer geschnürten Taille hinterließen, als sie so hastig von ihm zurücktrat, dass sie beinahe über die Schleppe ihres Kleides gestolpert wäre. Aber der eben gewonnene Abstand zwischen ihnen schuf ein neues Problem. Von Nahem war es unmöglich gewesen, das ganze Ausmaß seiner Schönheit zu begreifen.
Jetzt machte es sie sprachlos.
Samantha schloss die Augen und suchte nach einer Entschuldigung für diese unentschuldbare Anziehung. Sie war erschöpft, hungrig und unsagbar müde.
Und völlig allein.
Nach einer anstrengenden Zugreise durch die gesamten Vereinigten Staaten war sie in Philadelphia an Bord eines Schiffes gegangen, das bei der Abfahrt sehr viel leerer gewesen war als bei seiner Ankunft. Sie hatte den Atlantik mit Tränen der Trauer und des Schmerzes bereichert und auch mit fast jeder der köstlichen Mahlzeiten, die man der angeblichen schottischen Erbin Alison Ross, Passagierin der ersten Klasse, vorgesetzt hatte.