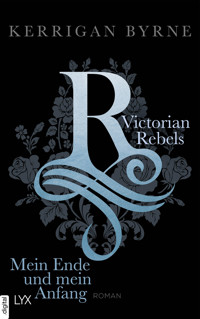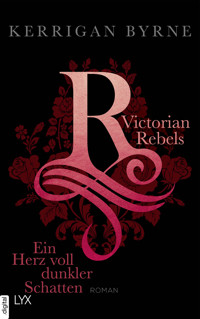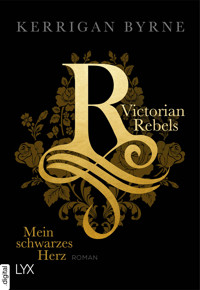
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: The Victorian Rebels
- Sprache: Deutsch
Wenn eine Liebe durch tiefste Dunkelheit geht ...
Farah Mackenzie will sich nie wieder an einen Mann binden. Zu schmerzhaft ist die Erinnerung an ihre erste Liebe Dougan. Als sie jedoch dem berüchtigten Verbrecher Dorian Blackwell begegnet, gerät ihr Leben erneut aus den Fugen. Blackwell, der sie beunruhigt, aber auch etwas tief in ihrem Innersten berührt, entführt Farah nach Schottland — angeblich zu ihrem Schutz. Doch jeder Moment, den sie mit dem scheinbar so eiskalten Mann verbringt, führt sie zu einer Wahrheit, die ihr erneut das Herz zu brechen droht ...
"Kerrigan Byrne hat ein untrügliches Gespür dafür, wie sie ihre Leser packen und an die Seiten fesseln kann." Romantic Times
Band 1 der Victorian Rebels
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmung12345678910111213141516171819202122232425EpilogDanksagungenDie AutorinKerrigan Byrne bei LYXImpressumKERRIGAN BYRNE
Victorian Rebels
Mein schwarzes Herz
Roman
Ins Deutsche übertragen von Inka Marter
Zu diesem Buch
Farah Mackenzie ist entschlossen, sich nie wieder an einen Mann zu binden. Zu schmerzhaft ist die Erinnerung an ihre erste Liebe Dougan. Siebzehn Jahre ist es her, dass er sich opferte, um sie zu beschützen. Inzwischen hat sich Farah ein neues, selbstständiges Leben aufgebaut, sie arbeitet für Scotland Yard und bleibt meist für sich. Doch dann begegnet sie dem berüchtigten Verbrecher Dorian Blackwell, dem mächtigsten Mann Londons, der innerhalb kürzester Zeit die gesamte Unterwelt der Stadt unter seine Kontrolle gebracht hat. Sein Herz sei schwarz wie die Hölle, sagt man, er kenne keine Gnade. Trotz dieses Wissens ist Farah vom ersten Moment an fasziniert von Blackwell, dessen Präsenz etwas tief in ihrem Inneren zu erwecken scheint. Völlig überraschend verschleppt er sie auf seine Burg in Schottland – angeblich, um sie vor Feinden zu beschützen, von denen sie bisher nichts wusste. Aber Farah spürt, dass hinter Dorians düsterer Fassade noch etwas anderes verborgen liegt. Sie ist fest entschlossen, herauszufinden, was das »Schwarze Herz von Ben More« ihr verschweigt. Doch die Wahrheit, die nach und nach ans Licht kommt, führt tief in ihre Vergangenheit und droht ihr Herz aufs Neue zu brechen …
Für Darlene Ainge
Nur deinetwegen hat er überlebt.
1
Schottische Highlands, Argyll, 1855
Blut lief über Dougan Mackenzies Unterarme, als er sich an die alte Steinmauer lehnte, die das Applecross Waisenhaus von den wilden Bergen trennte. Die anderen Kinder wagten sich nicht bis hierher. Im Schutz der Mauer ragten schiefe Grabsteine mit verwitterten Inschriften aus einem dichten Teppich aus Moos und Heide, der sich von den Gebeinen der Toten nährte.
Dougans Brust hob und senkte sich, und er wartete, bis er zu Atem gekommen war, bevor er an der Mauer hinunterrutschte, sich hinhockte und die dürren Beine an die Brust zog. Vorsichtig öffnete er die Hand so weit, wie die Risse auf der Handfläche es zuließen. Es tat jetzt sehr viel mehr weh als gerade eben noch, als die Rute ihn getroffen hatte.
Schwester Margaret hatte sich alle Mühe gegeben, seinen Willen zu brechen, aber seine Wut hatte ihn davon abgehalten, in Schmerzensschreie auszubrechen, und bis jetzt hatte er auch seine Tränen zurückhalten können. Er hatte der Nonne fest in die hellen, kalten Augen geblickt und doch jedes Mal blinzeln müssen, als die Rute wieder und immer wieder herabgefahren war, bis die Striemen auf seinen Handflächen schließlich aufgeplatzt waren und geblutet hatten.
»Sag, warum weinst du?«
Das dünne Stimmchen schien den unbändigen Wind zu zähmen, der die sanften Worte nun wie auf einem unsichtbar flatternden Band zu ihm hintrug.
Hinter den grauen Mauern von Applecross ragten zerklüftet die schwarzgrünen Gipfel der Highlands auf und bildeten einen vollkommenen Hintergrund für das Mädchen, das kaum einen Meter entfernt vor ihm stand. Es war stürmisch, aber der Wind peitschte nicht auf sie ein, sondern zupfte spielerisch an ihren blonden, fast silbrig weißen Locken. Als sie schüchtern lächelte, zeigten sich Grübchen in den runden, blassen Wangen, die durch die Kälte gerötet waren.
»Hau ab«, knurrte er, steckte die schmerzenden Hände unter die Achseln und trat gegen einen Erdklumpen, der auf ihrem sauberen schwarzen Kleid landete.
»Hast du auch keine Familie mehr?«, fragte sie, ihr Gesicht ganz Neugier und Unschuld.
Dougan starrte sie finster an. Er zuckte zusammen, als sie den Saum ihrer weißen Schürze an seine Wange hob, ließ aber zu, dass sie vorsichtig Tränen und Schmutz abwischte. Ihre Berührung war leicht wie ein Schmetterlingsflügel, und er war so gebannt, dass er aufhörte zu zittern. Dougan hatte keine Ahnung, was er sagen sollte. Er hatte noch nie zuvor mit einem Mädchen geredet. Aber ihre Frage konnte er wohl beantworten, dachte er. Er hatte seine Mutter verloren, aber er war keine Waise. Tatsächlich waren die meisten Waisen in Applecross nicht einfach Kinder, sondern erschütternde, gut gehütete Geheimnisse, verborgen und vergessen wie die schändlichen Verfehlungen, aus denen sie entstanden waren.
Wessen Geheimnis war sie?
»Ich habe gesehen, was Schwester Margaret mit dir gemacht hat«, sagte das Mädchen sanft, und ihre Augen glänzten vor Mitleid.
Ihr Mitleid brannte wie Feuer in Dougans Brust, er fühlte sich so gedemütigt und hilflos, dass er den Kopf zur Seite riss, um ihrer Berührung auszuweichen. »Ich hab gesagt, du sollst abhauen.«
Sie blinzelte. »Aber deine Hände …«
Mit einem wilden Knurren sprang Dougan auf. Er hob die Hand, um ihr das Mitleid aus dem Engelsgesichtchen zu treiben, und sie schrie auf, stolperte rückwärts und fiel hin. Ängstlich zog sie den Kopf vor ihm ein.
Dougan zögerte, sein Gesicht tat weh vor Anspannung. Er hatte wütend die Zähne gebleckt, und seine Hand war noch immer zum Schlag erhoben.
Das Mädchen sah nur hoch und starrte erschrocken auf die blutigen Striemen in seiner Handfläche.
»Geh weg«, knurrte er. Sie kroch rückwärts von ihm weg und kam taumelnd auf die Beine. Dann rannte sie in großem Bogen um die Grabsteine herum und verschwand im Waisenhaus.
Dougan ließ sich wieder an die Mauer sinken. Zitternd wischte er sich mit dem Handrücken über die Wangen. Dieses Mädchen war der erste Mensch gewesen, der ihn berührt hatte, ohne ihm wehtun zu wollen. Er hatte keine Ahnung, warum er so gemein zu ihr gewesen war.
Er schloss die Augen und legte die Stirn auf die Knie. Endlich hatte er seine Ruhe. Die feuchte Kälte in seinem brennenden Nacken fühlte sich gut an, und er versuchte, sich darauf zu konzentrieren und nicht an den stechenden Schmerz seiner Hände zu denken.
Nicht einmal fünf Minuten später tauchte zu seinen Füßen eine Schüssel mit sauberem Wasser auf. Daneben eine Tasse, die mit einer karamellfarbenen Flüssigkeit gefüllt war.
Überrascht hob Dougan den Kopf und sah wieder das Mädchen, das jetzt allerdings eine lange, gefährlich aussehende Schere in der Hand hielt und entschlossen die Stirn runzelte.
»Lass mich deine Hände sehen.«
Er hatte sie doch weggejagt! Misstrauisch beäugte Dougan die Schere, die in ihrer winzigen Hand riesig und scharf aussah. »Was willst du damit? Dich verteidigen? Rache nehmen?«
Auf seine Frage lächelte sie nur ihr zahnlückiges Lächeln, und sein Herz machte einen kleinen Hüpfer und landete in seiner Magengrube.
»Sei nicht albern«, tadelte sie ihn sanft, als sie die Schere zur Seite legte und nach seinen Händen griff.
Blitzschnell zog Dougan die Hände weg, versteckte sie hinter seinem Rücken und sah sie finster an.
»Komm schon«, redete sie ihm zu. »Zeig sie mir.«
»Nay.«
Sie runzelte die Stirn. »Wie soll ich deine Wunden verarzten, wenn du sie vor mir versteckst?«
»Du bist keine Ärztin«, fauchte Dougan. »Lass mich in Frieden.«
»Mein Vater war Hauptmann im Krimkrieg«, erklärte sie geduldig. »Er hat damals ein bisschen Erfahrung darin gesammelt, Schnittwunden zu behandeln, damit sie auf dem Schlachtfeld später nicht eiterten.«
Das erregte seine Aufmerksamkeit. »Hat er Menschen getötet?«, fragte Dougan unwillkürlich.
Sie dachte kurz nach. »Er hatte ganz viele Orden an seiner Uniformjacke, also hat er das wohl, auch wenn er es nie erzählt hat.«
»Ich wette, er hat ein Gewehr benutzt«, sagte Dougan, abgelenkt von Gedanken, die er für erwachsen und männlich hielt. Gedanken an Krieg und Ruhm.
»Und ein Bajonett«, ergänzte das Mädchen zuvorkommend. »Ich habe es einmal anfassend dürfen, als er am Kamin seine Waffe gereinigt hat.«
»Wie sah es aus?«, fragte er.
»Das erzähle ich dir nur, wenn ich deine Hände behandeln darf.« Ihre seesturmgrauen Augen funkelten ihn an.
»Aye, na gut.« Vorsichtig zog er die verletzten Hände hinter seinem Rücken hervor. »Aber du musst ganz von vorne anfangen.«
»Mache ich«, versprach sie mit einem feierlichen Nicken.
»Und nichts auslassen.«
»Bestimmt nicht.«
Dougan beugte sich vor und streckte ihr die geöffneten Hände hin.
Beim Anblick der aufgerissenen Haut zuckte sie zusammen, aber sie nahm vorsichtig seine Hand in ihre beiden Hände, als handelte es sich um ein zartes Vogeljunges. Dann hob sie mit einer Hand die Schüssel hoch und tröpfelte etwas Wasser über den Schnitt. Als er vor Schmerzen knurrte, fing sie an, ihm das Gewehr ihres Vaters zu beschreiben. Die kleinen Teilchen, die perfekt ineinanderpassten. Das Klicken von Abzug und Schloss. Der Gestank des glitzernden Schwarzpulvers.
Sie goss Alkohol über die Wunden, und Dougan sog zischend den Atem durch die Zähne ein. Er zitterte, so anstrengend war es, die Hand nicht wegzuziehen. Um sich von seinem Schmerz abzulenken, konzentrierte er seinen Blick auf die Regentropfen, die wie Diamanten in ihren vollen Locken hingen. Anstatt ihr Haar schwer und glatt werden zu lassen, schien der Regen es noch mehr zu locken und die silbrigen Strähnen mit dem dunkleren Glanz von gesponnenem Gold zu überziehen. Am liebsten hätte er die Locken angefasst, eine um den Finger gewickelt und daran gezogen, um zu sehen, ob sie wieder an ihren Platz zurückspringen würden. Aber er rührte sich nicht, während sie gewissenhaft Streifen aus ihrem Unterrock schnitt und um seine Hände wickelte.
»Sag mir, wie du heißt«, verlangte er mit einem heiseren Flüstern.
»Mein Name ist Farah.« Er erkannte, dass sie sich über die Frage freute, weil ein winziges Grübchen in ihrer Wange erschien. »Farah Leigh …« Abrupt brach sie ab und starrte stirnrunzelnd auf den Knoten, den sie gerade gemacht hatte.
»Aye?«, fragte er wachsam. »Farah Leigh und weiter?«
Ihre Augen sahen eher grau aus als grün, als sie ihn ansah. »Man hat mir verboten, meinen Familiennamen zu verraten«, sagte sie. »Sonst würden ich und die Person, der ich ihn sage, in große Schwierigkeiten geraten, und ich fürchte, noch mehr Schwierigkeiten brauchst du wirklich nicht.«
Dougan nickte. Das war nicht ungewöhnlich hier in Applecross. »Ich bin Dougan vom Clan Mackenzie«, verkündete er stolz. »Und ich bin elf Jahre alt.«
Sie sah gebührend beeindruckt aus, weshalb er sie noch mehr mochte.
»Ich bin acht«, sagte sie. »Was hast du denn Schlimmes angestellt?«
»Ich … ich habe einen Laib Brot aus der Küche gestohlen.«
Sie sah ihn entsetzt an.
»Ich hab immer so verdammten Hunger«, murmelte er, und ihm entging nicht, dass sie bei dem Schimpfwort zusammenzuckte. »Ich könnte das Moos auf diesen Steinen essen.«
Farah versorgte die Enden des zweiten Verbands und lehnte sich ein wenig zurück, um ihr Werk zu begutachten. »Das ist eine schlimme Strafe für einen einzigen Laib Brot«, stellte sie traurig fest. »Wahrscheinlich werden Narben zurückbleiben.«
»War nicht das erste Mal«, gab Dougan zu und zuckte unbekümmerter die Achseln, als ihm wirklich zumute war. »Meistens kriege ich den Hintern versohlt, und das ist mir auch lieber. Schwester Margaret sagt, ich sei ein Dämon.«
»Dougan, der Dämon.« Sie lächelte amüsiert.
»Besser als Farah, die Fee.« Er kicherte über seinen Einfall.
»Fee?« Ihre Augen glitzerten. »Wenn du willst, kannst du mich so nennen.«
»Aye, das mache ich.« Dougans Lippen fühlten sich merkwürdig an, und er merkte, dass er zum ersten Mal seit undenklichen Zeiten lächelte. »Und wie nennst du mich?«, fragte er.
»Meinen Freund«, sagte sie ohne zu zögern. Dann stand sie vom feuchten Boden auf und klopfte sich die Erde vom Rock, bevor sie die Schale und die Tasse aufhob.
Eine eigenartige Wärme schlich sich in Dougans Brust. Er wusste nicht, was er sagen sollte.
»Ich gehe lieber wieder rein.« Sie hielt ihr kleines Gesicht hoch in den Regen. »Sie suchen bestimmt nach mir.« Dann sah sie ihn wieder an. »Bleib nicht hier draußen im Regen«, sagte sie. »Du holst dir den Tod.«
Dougan sah ihr nach. Er war voller Neugier und Heiterkeit und genoss das Gefühl, etwas zu haben, das er nie zuvor gehabt hatte.
Eine Freundin.
»Dougan! Psst!« Das laute Flüstern hatte Dougan beinahe zu Tode erschreckt. Rasch wirbelte er herum und machte sich darauf gefasst, sich gegen einen der Jungen zur Wehr setzen zu müssen, als er die vollen, aus Mondlicht gesponnenen Locken entdeckte und in zwei strahlende Augen sah. Den Rest ihrer kleinen Gestalt hatte sie klugerweise hinter einem im Gang hängenden Wandteppich verborgen.
»Was machst du hier?«, fragte er. »Wenn sie uns schnappen, kriegen wir Prügel.«
»Du bist auch hier«, sagte sie herausfordernd.
»Aye … stimmt.« Dougan hatte versucht, seinen leeren Magen mit Wasser zu füllen. Nachdem er sich zwei Stunden im Bett herumgewälzt hatte, war der Plan irgendwie nach hinten losgegangen, denn jemand hatte blöderweise den Nachttopf versteckt, und er musste raus, um den Abort aufzusuchen.
»Ich habe etwas für dich.« Fröhlich kam sie hinter dem Wandteppich hervor und hakte sich bei ihm unter, ganz vorsichtig, um seine verbundenen Hände nicht zu berühren. »Komm mit.« Eine Tür am Ende des Flurs stand einen Spalt offen, und Farah schob Dougan hindurch und machte hinter ihnen die Tür zu.
Auf einem der vielen kleinen Tische flackerte eine einsame Kerze. Ihr Licht tanzte über die Wände, die ganz aus Bücherregalen bestanden. Dougan zog die Nase kraus. Die Bibliothek? Warum brachte sie ihn hierher? Er mied diesen Raum. Es war staubig hier und roch nach Schimmel und alten Leuten.
Farah zog ihn zu dem Tisch mit der Kerze und zeigte auf einen Stuhl vor einem aufgeschlagenen Buch. »Setz dich da hin!« Inzwischen zitterte sie geradezu vor Aufregung.
»Nay.« Finster blickte Dougan auf das Buch hinunter, seine Neugier war erloschen. »Ich geh ins Bett.«
»Aber …«
»Und du solltest das auch tun, bevor sie dich kriegen und dir das Fell über die Ohren ziehen.«
Farah griff in ihre Schürzentasche und holte ein Päckchen von der Größe einer Dose Schmalzfleisch hervor, das in eine Serviette eingewickelt war. Als sie es öffnete und auf dem Tisch ausbreitete, entdeckte er ein angeknabbertes Stück Käse, ein bisschen Trockenfleisch und einen Kanten Brot.
Dougan lief das Wasser im Mund zusammen, fast hätte er sich sofort daraufgestürzt.
»Ich habe mein Abendbrot nicht aufessen können«, sagte sie.
Da fiel Dougan über die Gabe her wie ein Wilder. Zuerst schnappte er sich das Brot, weil er wusste, dass es am meisten sättigte. Er konnte die Geräusche hören, die er machte, als er zu große Bissen kaute und hinunterschluckte, aber es war ihm egal.
Als sie wieder sprach, hörte er Tränen in ihrer Stimme. »Mein lieber Freund …« Sie legte ihre kleine Hand auf seinen gebeugten Rücken und tätschelte ihn tröstend. »Ich will dich nie wieder hungern lassen, das verspreche ich dir.«
Dougan sah, dass sie nach dem Buch griff, während er sich so viel von dem Fleisch auf einmal in den Mund stopfte, wie er konnte. »Waff iff daff?«, fragte er mit vollem Mund.
Vorsichtig strich sie die aufgeschlagene Seite mit ihren kleinen, blassen Händen glatt und schob ihm das Buch hin. »Es tat mir so leid, dass ich heute Nachmittag nicht viel über Gewehre wusste, deshalb habe ich den ganzen Abend gesucht, und sieh mal, was ich gefunden habe!« Sie deutete mit ihrem winzigen Finger auf das Bild eines Enfield-Gewehrs. Darunter befanden sich kleinere Bilder der einzelnen Teile der auseinandergenommenen Waffe.
»Das ist ein Minié-Gewehr Pattern 1851«, sagte sie. »Und guck mal hier! Das sind die Bajonette. Im nächsten Kapitel wird erklärt, wie sie hergestellt werden und wie man sie am … Was ist denn?« Sie hatte den Blick gehoben, und irgendetwas in seinen Augen ließ sie erröten.
Dougan hatte fast vergessen zu essen, sein ganzer Körper war mit dem tiefsten und herrlichsten Gefühl erfüllt, das er je gekannt hatte. Es war ein bisschen wie hungrig und ein bisschen wie satt sein. Es war Staunen und Ehrfurcht und Sehnsucht und Angst zugleich, verpackt in ein zartes Glücksgefühl. Seine Brust war voll damit, es drückte ihm auf die Lungen, und er bekam fast keine Luft mehr.
Er wünschte, es gäbe ein Wort dafür. Und vielleicht gab es eines, irgendwo in den zahllosen Büchern, mit denen er bisher nichts hatte anfangen können.
Sie blickte wieder auf die Seite und räusperte sich. »Die Namen der Teile stehen gleich hier unter den Bildern, siehst du?«
»Woher weißt du das?« Er starrte auf die Stelle, auf die sie zeigte, und sah die Zeichen unter den Bildern, aber für ihn hatten sie keine Bedeutung.
»Das steht da. Kannst du es nicht lesen?«
Dougan füllte die Stille, indem er ein Stück Käse abriss, sich in den Mund warf und wütend kaute.
»Hat es dir niemand beigebracht?«, fragte sie vorsichtig.
Er tat, als hätte er nichts gehört, und aß den letzten Bissen Brot, während er die Bilder anstarrte und unbedingt wissen wollte, was sie darstellten. »Kannst du … es mir vorlesen, Fee?«
»Natürlich.« Sie kniete sich auf den Stuhl – der Tisch war so hoch, dass sie nicht ins Buch hätte schauen können, wenn sie sich auf den klapprigen Stuhl gesetzt hätte. »Aber wenn wir uns morgen hier wieder treffen, bringe ich dir bei, es selbst zu lesen.«
Zum ersten Mal, seit Dougan sich erinnern konnte, fühlte er sich satt und zufrieden. Während er den letzten Käse langsam und mit viel Genuss verspeiste, zeigte er auf die Bilder, und Fee las ihm die Schrift darunter vor.
Als sie bei dem Kapitel über Bajonette ankamen, hatten sie sich vor dem Buch und der Kerze aneinandergeschmiegt, und Farahs Kopf lag auf seiner Schulter. Mit einem Finger zeigte er unermüdlich auf ein Bild nach dem anderen, mit einem anderen wickelte er eines ihrer Löckchen auf, zog es lang und ließ es wieder an seinen Platz zurückspringen.
»Ich hab mir überlegt«, sagte er einige Zeit später, als sie gähnend innehielt. »Da du ja keine Familie mehr hast, die du lieben kannst, könntest du mich lieben …« Er sah sie dabei nicht an, sondern betrachtete seine Hand, die im Kontrast zu dem reinen Weiß ihres Unterrockverbands nur noch schmutziger aussah. »Nur wenn du willst.«
Farah schmiegte ihr Gesicht an seinen Hals und seufzte. Jedes Mal, wenn sie blinzelte, kitzelten die Wimpern die weiche Haut. »Natürlich werde ich dich lieben, Dougan Mackenzie«, sagte sie leichthin. »Wer würde das sonst tun?«
»Niemand«, antwortete er ernst.
»Wirst du auch versuchen, mich zu lieben?«, fragte sie mit leiser Stimme.
Er dachte darüber nach. »Ich versuch’s, Fee, aber ich hab’s noch nie gemacht.«
»Das bringe ich dir auch bei«, versprach sie. »Direkt nach dem Lesen. Lieben ist so ähnlich wie Lesen, denke ich. Wenn man einmal weiß, wie es geht, kann man sich nicht mehr vorstellen, wie es ohne ist.«
Dougan nickte nur, denn seine Kehle brannte. Er legte den Arm um seine Fee und kostete das Gefühl aus, endlich etwas zu haben, das ihm niemand wegnehmen konnte.
Dougan lernte viel über sich in den zwei glücklichen Jahren mit Fee, aber vor allem eines. Wenn er liebte, tat er es absolut und bedingungslos. Fast obsessiv.
Sie erzählte ihm, dass ihr Vater sich bei dem Besuch eines Freundes in einem Militärhospital mit Cholera angesteckt und die Krankheit mit nach Hause gebracht hatte. Zuerst war Farah Leighs ältere Schwester Faye Marie gestorben, die Eltern waren ihr kurze Zeit später nachgefolgt.
Er erzählte ihr, dass seine Mutter als Magd bei einem Laird des Mackenzie-Clans gedient hatte. Dougan war einer der vielen Bastarde des Mannes, und er hatte vier Jahre bei seiner Mutter gelebt, bis sie durch die Hand eines anderen Liebhabers gewaltsam ums Leben gekommen war.
Dougan hatte eine besondere Eigenschaft, die ihn von anderen Menschen unterschied, das hatte er schon in sehr jungen Jahren begriffen. Und zwar konnte er sich an fast alles erinnern. Er kannte sogar noch genau den Inhalt der Gespräche, die er vor einem Jahr mit seiner Fee geführt hatte, und wenn er sie daran erinnerte, war sie erschrocken und erfreut zugleich.
»Das hatte ich vergessen!«, sagte sie dann.
»Ich vergesse nie etwas«, prahlte er.
Diese Fähigkeit erlaubte es ihm, schnell zu lernen, und bald konnte er besser lesen als sie. Trotzdem war er immer aufmerksam in ihrem Unterricht, auch wenn er manchmal keine Lust darauf hatte. Außerdem suchte sie Bücher aus, die ihn interessierten, über Schiffe und Kanonen und einen Haufen historischer Kriege von den Römern bis Napoleon. Am liebsten mochte er ein Buch über die Geschichte der Seeräuberei.
»Glaubst du, ich würde ein guter Pirat sein?«, fragte er einmal, während er an einem harten Kuchen kaute, den sie ihm als Überraschung mitgebracht hatte.
»Natürlich nicht«, antwortete sie geduldig. »Piraten sind gemeine Diebe und Mörder. Außerdem sind Mädchen auf Piratenschiffen nicht erlaubt.« Ihre Augen waren plötzlich feucht und erschrocken, als sie sich zu ihm umdrehte. »Würdest du mich verlassen, um Pirat zu werden?«
Fest zog er sie an sich. »Ich würde dich nie verlassen, Fee«, schwor er ungestüm.
»Wirklich?« Sie rückte von ihm ab und sah ihn mit Sturmwolkenaugen an, die Regen verhießen. »Nicht einmal, um Pirat zu werden?«
»Ich verspreche es.« Er biss ein weiteres Stück von dem Kuchen ab und lächelte sie mit vollen Backen an, bevor er sich wieder dem Buch zuwandte. »Aber vielleicht werde ich Straßenräuber. Die sind ähnlich wie Piraten, nur an Land.«
Nach kurzem Nachdenken nickte Farah. »Ja, ich denke, das Leben eines Straßenräubers würde viel besser zu dir passen«, stimmte sie zu.
»Aye, Fee, du wirst dich damit abfinden müssen, die Frau eines Straßenräubers zu sein.«
Sie klatschte in die Hände und sah ihn mit strahlenden Augen an. »Klingt wie ein Abenteuer!« Aber dann wurde sie plötzlich ernst, als wäre ihr etwas besonders Unangenehmes eingefallen.
»Was ist denn?«, fragte er unruhig.
»Es ist nur … ich glaube, ich soll eigentlich jemand anders heiraten.«
Knurrend packte Dougan sie an den schmalen Schultern und schüttelte sie. »Wen?«
»Mr Warrington.« Sie sprach schnell weiter, als sie die Wut und Verwirrung in seinen Augen sah. »Er hat für meinen Vater gearbeitet und mich hierher gebracht. Er hat gesagt, dass er mich holt, wenn ich eine Frau bin, und dass wir dann heiraten.«
Kalte Verzweiflung schlich sich in sein Herz. »Du kannst keinen anderen heiraten, Fee. Du gehörst mir. Nur mir.«
»Was sollen wir nur tun?«, fragte sie sorgenvoll.
Dougan überlegte fieberhaft, als sie sich in der kalten Bibliothek zitternd aneinanderschmiegten. Die Angst, sich irgendwann trennen zu müssen, brachte sie noch enger zusammen. Plötzlich hatte er eine geniale Idee.
»Geh ins Bett, Fee. Morgen Nacht treffen wir uns nicht hier in der Bibliothek, sondern in der Kapelle.«
Dougan hatte in der Kapelle auf sie gewartet, mit dem einzigen Andenken an seine Familie, das er je besessen hatte, einem Stück von einem Mackenzie-Plaid. Außerdem hatte er sich ordentlich abgeschrubbt und sich die Kletten aus dem Haar gekämmt, bevor er es mit einem Stück Schnur zurückgebunden hatte.
Farah steckte den wilden Lockenkopf durch die schweren Türen des Gotteshauses, und als sie ihn neben dem Altar entdeckte, nur von einer einsamen Kerze beleuchtet, war ihr strahlendes Lächeln schon zu ihm vorgelaufen. Sie trug das schlichte weiße Nachthemd, das er so mochte, und unter dem Saum schauten bei jedem Schritt ihre nackten Füße hervor.
Er reichte ihr die Hand, und sie nahm sie ohne zu zögern. »Du siehst sehr fein aus«, flüsterte sie. »Was tun wir hier, Dougan?«
»Ich bin hier, um dich zu heiraten«, murmelte er.
»Ja?« Sie sah sich neugierig um. »Ohne Pfarrer?«
»In den Highlands brauchen wir keine Priester«, sagte er ein wenig verächtlich. »Wir heiraten vor vielen Göttern, nicht nur vor einem. Und sie kommen, wenn wir sie bitten, nicht wenn ein Pfarrer es sagt.«
»Das klingt viel besser«, stimmte sie eifrig nickend zu.
Sie knieten einander zugewandt vor dem Altar nieder, und Dougan schlug das ausgeblichene Plaid um ihre umschlungenen Hände.
»Sprich mir einfach nach, was ich sage, Fee«, murmelte er.
»In Ordnung.« Sie sah mit leuchtenden Augen zu ihm auf, und Dougan empfand eine so starke, wilde Liebe zu ihr, dass er fast das Gefühl hatte, sie würde nicht in diesen heiligen Raum gehören.
Er sagte den Schwur, den er als kleiner Junge einmal versteckt hinter den Röcken seiner Mutter gehört hatte.
Ich gehe neben dir, wo du bist, will auch ich sein
Ich liege neben dir, mein Herz in deiner Hand
Ich gelobe meine Liebe, niemand bricht dieses Band
Selbst der Tod trennt uns nicht, du bist ewig mein
Er musste Farah ein bisschen helfen, damit sie sich an alle Worte erinnerte, aber sie sprach sie mit solcher Inbrunst, dass Dougan gerührt war.
Dann schob er ihr einen Ring aus der Ranke eines blühenden Weidenröschens auf den Finger und rezitierte dabei laut und klar den heiligen, alten gälischen Schwur. Dann übersetzte er ihn für sie.
Ich gelobe
unter dem heiligen Mond
dich zu lieben und zu ehren
mit allem, was ich besitze.
Mögen wir noch einmal leben
Mögen unsere Herzen sich wiedersehn
und erinnern, dass wir uns liebten.
Einen Augenblick sah sie verloren und verwirrt aus, dann sagte sie: »Ich auch.«
Das genügte. Sie gehörte ihm. Dougan seufzte erleichtert, als fiele ihm ein schwerer Stein vom Herzen, dann löste er das Plaid von ihren Händen und gab es ihr. »Nimm es und trag es an deinem Herzen.«
»Oh, Dougan, ich habe nichts, was ich dir geben könnte«, klagte sie.
»Doch, gib mir einen Kuss, Fee, dann gilt es.«
Sie fiel ihm um den Hals und gab ihm arglos mit gespitztem Mund einen Kuss. »Du bist der allerbeste Ehemann auf der ganzen Welt, Dougan Mackenzie«, verkündete sie. »Ich kenne keinen anderen Ehemann, der einen Frosch so hoch hüpfen lässt, der sich so kluge Namen für die Füchse ausdenkt, die unter den Mauern leben, und der über drei Steine auf einmal springen kann.«
»Wir dürfen es keinem sagen«, sagte Dougan, der von dem Kuss etwas durcheinander war. »Erst wenn wir erwachsen sind.«
Sie nickte. »Ich gehe jetzt zurück«, sagte sie zögernd.
Er stimmte zu und senkte den Kopf, um sie noch einmal sanft auf den Mund zu küssen. Es war schließlich sein Recht als Ehemann. »Ich liebe dich, meine Fee«, flüsterte er, als sie still wieder zur Tür ging, das Plaid fest in der Hand und den Finger mit den leuchtenden Blüten geschmückt.
»Ich liebe dich auch.«
In der nächsten Nacht wurde Dougan wach, als eine kleine Gestalt seine Bettdecke anhob und sich neben ihn auf die schmale Pritsche drängte. Er öffnete die Augen und sah im matten Mondlicht den silbernen Lockenkopf auf seiner Brust.
»Was tust du hier, Fee?«, flüsterte er schlaftrunken.
Sie antwortete nicht, klammerte sich nur mit ungekannter Verzweiflung an sein Nachthemd. Sie zitterte am ganzen Körper, und aus ihrer Kehle kam nur ein Wimmern.
Diffuse Angst drang ihm durch Mark und Bein, und instinktiv legte Dougan seine Arme um Farah und zog sie fest an sich. »Was ist passiert? Bist du verletzt?«
»N…nein«, stotterte sie an seiner Brust.
Er beruhigte sich etwas, erschrak jedoch, als er ihre Tränen spürte, die die Vorderseite seines alten, abgenutzten Nachthemds durchnässten. Er hob den Kopf, um festzustellen, ob Fee von einem der anderen etwa zwanzig Jungen in den nebeneinander stehenden Betten bemerkt worden war, aber so weit er erkennen konnte, war alles ruhig. Sie hatte so etwas nie zuvor getan, und was auch immer sie dazu veranlasst hatte, es musste einen ernsten Grund haben.
Als er sich etwas aufrichtete, um sie besser sehen zu können, entdeckte er etwas im silbrigen Licht des Mondes, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ.
Sie trug ihr schönes weißes Nachthemd, dasselbe, in dem sie ihn letzte Nacht geheiratet hatte, nur jetzt fehlte die Reihe der kleinen Knöpfe vom Bauchnabel bis zum Spitzenbesatz am Halsausschnitt. Mit einer Hand hielt sie das Nachthemd vorn zusammen, mit der anderen klammerte sie sich an ihn. Eine trostlose Ruhe überkam ihn, als er seine zehnjährige Ehefrau in seinen Armen wiegte.
»Erzähl es mir.« Mehr brachte er nicht aus der vor Kummer zugeschnürten Kehle heraus.
»Pater McLean. Er hat mich in sein Studierzimmer gezogen und so schreckliche Sachen gesagt«, flüsterte sie an seiner Brust. Sie war rot vor Scham und konnte ihm nicht ins Gesicht sehen. »Er hat gesagt, dass ich ihn in Versuchung führe, und dann hat er alles aufgezählt, wozu ich ihn verführen würde. Es war furchtbar und gemein und hat mir Angst gemacht. Dann hat er mich auf seinen Schoß gezogen und versucht mich zu küssen.«
»Versucht?« Dougans Fäuste, die auf ihrem Rücken lagen, zitterten vor Zorn.
»Ich … ich habe ihm einen Brieföffner in die Schulter gerammt und bin weggelaufen«, gestand sie. »Ich bin hierher gerannt. Zu dir. An den einzigen sicheren Ort, der mir einfiel. Oh, Dougan, er ist bestimmt hinter mir her!« Sie schluchzte, und ihr ganzer Körper bebte vor Anstrengung, die Laute zu unterdrücken.
Trotz allem zuckte es um Dougans Mundwinkel. Er war zufrieden mit seiner kleinen Frau. »Das hast du gut gemacht, Fee«, murmelte er und streichelte ihr Haar, während er im Stillen bedauerte, dass sie nur Pater McLeans Schulter verletzt hatte und nicht sein Auge.
Applecross war eine große, alte Steinfestung, und es gab viele Winkel, in denen man sich verstecken konnte, aber der alte Priester würde nicht lange überlegen müssen, bis er auf die Idee kam, im Jungenschlafraum nach ihr zu suchen.
»Ich weiß nicht, was ich tun soll«, hörte er die leise Stimme unter seiner Decke.
Licht drang unter der Tür des Schlafraums hervor, und Dougan erstarrte, legte ihr die Hand auf den Mund und hielt den Atem an, bis es vorbei war.
Dann stand er auf, öffnete leise seine Truhe und holte die zwei Hosen heraus, die er besaß. Eine warf er ihr zu, zusammen mit einem Hemd. »Zieh das an«, befahl er flüsternd. Sie nickte leise und zog sich unter der Bettdecke um. Dann stand sie auf, und Dougan half ihr, Beine und Ärmel hochzukrempeln, und nahm ein Stück Schnur, das er selbst als Gürtel benutzt hatte, um die Hose auf ihren nicht vorhandenen Hüften zu halten.
Er zog seine Stiefel mit den löchrigen Sohlen an und beschloss, der Köchin ein Paar Schuhe zu stehlen, wenn sie sich in der Küche Essen für ihre Reise holten. Sie konnten nicht riskieren, noch einmal in ihren Schlafsaal zu gehen, um ihre Sachen zu holen.
Ihre kleine Hand fühlte sich zerbrechlich, aber auch gewichtig an, als sie in der Dunkelheit zur Küche schlichen und dabei ständig stehen blieben und um die nächste Ecke spähten. Bis Russel am Loch Kishorn waren es beinahe zehn Meilen. Dort würden sie rasten und schlafen und sich an den Austernbänken bedienen, bevor sie nach Fort William weiterzogen. Dougan hoffte nur, dass seine kleine Fee kräftig genug war, um es bis dorthin zu schaffen.
Aber es war auch egal. Wenn nötig, würde er sie eben tragen.
In der Küche nahmen sie sich Brot, getrocknetes Schweinefleisch und etwas Käse und verloren wertvolle Sekunden damit, Tücher in die Schuhe der Köchin zu stopfen. Für eine Erwachsene hatte die Köchin zwar kleine Füße, aber Farahs waren noch kleiner.
Dougan war froh, dass seine Fee aufgehört hatte zu weinen. Ihre Miene war energisch und entschlossen und nur ein ganz kleines bisschen noch ängstlich.
Er zog ihr seine dünne Jacke über und fand es schrecklich, dass er nichts Wärmeres für sie hatte.
»Aber du wirst frieren«, protestierte sie.
»Ich habe mehr Fleisch auf den Rippen als du«, prahlte er. Dann öffnete er die Küchentür und zuckte zusammen, als die Angeln laut genug quietschten, um wenigstens die Hälfte der Toten auf dem Friedhof zum Leben zu erwecken. Der Tau, dessen erdiger Duft in der Luft lag, mahnte ihn, sich zu beeilen, da der Morgen nahte, aber er bedeutete auch, dass es nachts nicht mehr fror, und das war gut.
Er blickte suchend in die Dunkelheit und stellte fest, in welcher Richtung Osten lag. Sie mussten einfach nur so geradeaus gehen wie möglich und würden an den Ufern von Loch Kishorn landen. Er war sich dessen sicher.
Ihr ersticktes Wimmern hatte ihn kaum vorgewarnt, als ihm plötzlich ihre Hand entrissen wurde.
Dougan wirbelte herum und sah die riesige Schwester Margaret, die die zappelnde Farah gepackt hielt, während Pater McLean, gefolgt von zwei kräftigen Mönchen, schnaubend in die Küche trat.
»Nay«, krächzte Dougan, vor Schrecken wie gelähmt.
»Dougan, lauf!«, rief seine Fee. Pater McLean stand jetzt grinsend neben der Nonne und streckte seine knotige, blutbefleckte Hand aus, um mitzuhelfen, das sich heftig wehrende Mädchen festzuhalten…
»Rühren Sie sie nicht an!«, befahl Dougan. »Sie gehört zu mir.« Er zog das Messer hervor, das er in der Küche gestohlen hatte, und stieß damit warnend nach seinen Gegnern. »Sie wollen sicher nicht zwei Mal in einer Nacht gestochen werden.« Drohend machte er einen Schritt nach vorn, und Pater McLean entblößte seine spitzen, ungleichen Zähne. Sein kahler Kopf glänzte im Licht der Fackel, die einer der Mönche trug.
»Die hier ist viel zu wertvoll, um sie laufen zu lassen.« Schnell wie ein Falke hatte McLean seine langen, knochigen Finger um Farahs zarten Hals gelegt. »Du hättest dich lieber an einer anderen Prinzessin vergreifen sollen.«
Prinzessin? »Sie haben sich an ihr vergriffen, nicht ich!«, rief Dougan anklagend. Er konnte die Augen nicht von dem erschrockenen Blick seiner Fee abwenden, die sich wand und nach Luft schnappte. »Lassen Sie sie los. Sonst werden Sie es büßen.«
Farah gab einen erstickten Schluchzer von sich, als MacLean zudrückte und ihr die Luftzufuhr ganz abschnitt.
Dougan drehte durch. Er stürzte vorwärts und trat fest gegen Pater MacLeans krankes Knie. Mit einem gequälten Schrei ging der Mann zu Boden, und bevor Dougan richtig bewusst wurde, was er tat, hatte er dem Priester das Messer tief in die Brust gerammt.
Man hörte die Schreie einer Frau, aber die Stimme war zu tief, es war nicht Fee, obwohl er sicher war, auch sie weinen zu hören. Plötzlich kam alles in ihm hoch: die Prügel, der Hunger und der Wunsch, für seine Fee Vergeltung zu üben. Dougan zog das Messer gerade rechtzeitig wieder heraus, um damit einem der anrückenden Mönche zu drohen, der rasch zurücksprang. Er war so sehr auf den Mann vor ihm konzentriert, dass er nicht sah, wie der andere mit dem Schürhaken nach seinem Kopf schlug. Dann war es zu spät.
Das letzte, was er hörte, war seine Fee, seine Frau, die seinen Namen schrie. Sein letzter Gedanke war, dass er sie im Stich gelassen hatte. Er hatte sie für immer verloren.
2
London 1874Siebzehn Jahre später
Seit beinahe zehn Jahren war es Mrs Farah L. Mackenzies Gewohnheit, die eine Meile zu ihrer Arbeitsstätte zu Fuß zu gehen. Sie verließ ihre kleine, aber elegante Wohnung über einem der vielen Kaffeehäuser der Fetter Lane und ging die Fleet Street entlang, bis sie zur Strand wurde, zu Londons berühmt-berüchtigter Hauptstraße der Kunst und der Avantgarde-Theater. Mit der Temple Bar und dem Adelphi Theatre zur Linken und Covent Garden und Trafalgar Square zur Rechten ihres Wegs wurde jeder Morgen zwangsläufig zu einem Fest für die Sinne.
Häufig trank sie aber erst einmal einen Kaffee mit Mr Pierre de Gaule, ihrem Vermieter und dem Besitzer des Bookend Coffeehouse, und er erzählte ihr Geschichten über berühmte Dichter, Romanciers, Künstler, Schauspieler und Philosophen, die sein Café in den Abendstunden besuchten.
An diesem besonderen Morgen hatte sich das Gespräch um den sonderbaren Pariser Autor Jules Verne gedreht und einen Streit, den de Gaule einmal mit ihm über Alexandre Dumas gehabt hatte, einem vor nicht allzu langer Zeit gestorbenen gemeinsamen Bekannten.
Farah hatte das interessiert, da sie die Werke von Herrn Dumas sehr bewunderte, auch wenn sie etwas beschämt zugeben musste, von Herrn Verne bisher noch nichts gelesen zu haben, ihn jedoch auf ihre immer länger werdende Liste setzen wollte.
»Machen Sie sich nicht die Mühe«, schimpfte de Gaule mit seinem starken französischen Akzent, der nicht weniger geworden war, obwohl er die knapp zehn Jahre, die Farah ihn kannte, immer in London gelebt hatte. »Er ist nur noch ein anmaßender, deistischer Romanschriftsteller, der sich für einen Philosophen hält.«
Farah verabschiedete sich von Mr de Gaule mit einem Lächeln, gab ihm einen Kuss auf seine enorme Wange und überreichte ihm die Monatsmiete. Auf der überfüllten Strand knabberte sie ein Croissant, das sie als Frühstück mitgenommen hatte.
Die meisten der Gebäude auf ihrem Weg waren mit einer bunten Reihe von Schutzheiligen geschmückt; eine Ausnahme bildeten nur ein paar Freudenhäuser, die genau wie viele der dort angestellten Frauen nur nachts, bei vorteilhafterem Licht, verführerisch wirkten.
Farah fand ihren Morgenspaziergang heute enttäuschend langweilig, obwohl auf Londons berühmter Hauptstraße wie immer schillernde Betriebsamkeit herrschte. Zumindest bis sie vor Charing Cross in die Northumberland Street abbog, um zum Hintereingang von Whitehall Place Nr. 4 zu gelangen, in der gesamten englischen Gesellschaft als »Back Hall« des Hauptquartiers der London Metropolitan Police bekannt – oder auch als Scotland Yard.
Der Mob, der das Gebäude umringte, war größer und wütender als sonst und reichte fast bis an die nächste Straßenecke.
Vorsichtig näherte sich Farah der Menge und fragte sich, ob das Parlament eine weitere Änderung des Ehegesetzes erlassen hatte. Soweit sie sich erinnerte, war dies jedenfalls das letzte Mal der Anlass für einen solchen Tumult vor Scotland Yard gewesen. Die Polizei musste sich das Gebäude mit anderen Behörden teilen.
Als sie in der westlichen Ecke der wachsenden Menge Sergeant Charles Crompton auf seinem gescheckten Wallach Hugo entdeckte, drängte Farah sich vor zu ihm.
»Sergeant Crompton!«, rief sie und legte ihre Hand auf Hugos Zaumzeug. »Sergeant Crompton. Würden Sie mich hineinbegleiten?«
Crompton, ein korpulenter, etwa vierzigjähriger Mann mit einem borstigen Schnurrbart, dessen Enden weit über das durch den Riemen des Uniformhelms entstandene Doppelkinn hinabreichten, bedachte Farah mit einem strengen Blick. »Also Mrs Mackenzie, an einem solchen Tag sollten Sie aber auch nicht durch den Hintereingang kommen«, rief er von seinem unruhigen Ross hinunter. »Der Chief Inspector wird mir die Dienstmarke abreißen, ganz zu schweigen von meinem Kopf.«
»Was ist denn eigentlich hier los?«, fragte Farah.
Seine Antwort verlor sich in einem plötzlichen Lärm, der von den dicht gedrängten Menschen aufstieg. Farah drehte sich um und sah gerade noch den Schatten eines Mannes, der am Eingang des Hauptquartiers vorbei zur Kellertreppe geführt wurde. Sie konnte kaum Einzelheiten erkennen, sah nur das dunkle Haar, die beeindruckende Körpergröße und weit ausholende, selbstbewusste Schritte.
Allein dieser flüchtige Blick brachte die Menge dermaßen in Rage, dass das Fenster des Büros mit einem Stein zertrümmert wurde.
Ihres Büros.
Im Nu war Crompton abgesessen, ergriff sie am Ellbogen und führte sie von der Menge weg Richtung Whitehall Place, zur Vorderseite des Gebäudes. »Mit denen ist nicht zu spaßen!«, rief er. »Ich habe nach Bobbies aus der Bow Street und dem St. James Revier hergeschickt.«
»Wer war das?«, rief sie.
Aber sobald sie an der Ecke Newbury Street Whitehall Place waren, war Crompton wieder aufgesessen. Er hatte den Knüppel erhoben, falls es zu Gewalt kam, und lenkte das Pferd wieder zum Mob zurück.
Seufzend strich Farah die Uniformjacke aus schwarzer Wolle glatt, die sie über dem Kleid trug. Sie war wirklich froh, dass sie unter dem Rock keinen Reifrock trug. Modisch gekleidet hätte sie kaum in die ständig schrumpfenden Büros bei Scotland Yard hineingepasst.
Farah nickte dem Rezeptionisten der Behörde zu und begab sich zielstrebig durch das Flurlabyrinth zum Polizeihauptquartier, nur um festzustellen, dass im Inneren des Gebäudes ein fast ebenso wildes Durcheinander herrschte wie draußen.
Sie hatte solche Situationen schon früher erlebt. 1868 hatte es die irischen Aufstände gegeben, einmal war keinen Steinwurf entfernt vor dem Parlament eine Bombe explodiert, nicht zu vergessen der nicht abreißende Strom von Verbrechern, Dieben und Huren, der jeden Tag in Whitehall Place Nr. 4 hineinfloss. Und doch, während Farah sich einen Weg durch die Empfangshalle von Scotland Yard bahnte, konnte sie sich nicht erinnern, jemals ein solch starkes Gefühl drohenden Unheils in sich gespürt zu haben. Ein Schauder des Unbehagens ließ sie erzittern und störte ihre sonst unerschütterliche Gelassenheit.
»Mrs Mackenzie!« Sie hörte ihren Namen über dem Lärm der Konstabler, Journalisten, Verbrecher und Inspektoren, die sich alle in der Back Hall drängten. Farah drehte sich um und entdeckte den ersten Sekretär, David Beauchamp, in der Menge auf halbem Weg zum Büro. Er winkte ihr. Sein schmächtiger, drahtiger Körperbau hatte den Mindestanforderungen an einen Beamten der Metropolitan Police nicht genügt, und so war er zu seinem allergrößten Bedauern nur als Sekretär eingestellt worden.
Farah drängelte sich zu ihm durch, während sie zu beiden Seiten Entschuldigungen murmelte. »Mr Beauchamp.« Sie nahm den Arm, den er ihr anbot, und gemeinsam arbeiteten sie sich bis zur relativen Sicherheit des Flurs vor. »Können Sie mir bitte sagen, was hier los ist?«
»Er verlangt nach Ihnen«, informierte Beauchamp sie mit einem gebieterischen Stirnrunzeln.
Natürlich wusste Farah genau, auf wen Mr Beauchamp sich bezog. Ihren Arbeitgeber, Chief Inspector Sir Carlton Morley.
»Sofort«, gab sie zurück, während sie das Büro betrat, die Haube abnahm und auf ihren Schreibtisch warf. Sie zog eine Grimasse angesichts der Scherben auf dem Boden vor dem Fenster und hatte kurz ein schlechtes Gewissen, als sie erleichtert feststellte, dass der größte Schaden auf Mr Beauchamps Schreibtisch angerichtet worden war. Ihr eigener stand näher an der Tür. Errol Cartwright, der dritte Sekretär, war noch nicht da.
»Sie werden Ihre Schreibsachen brauchen«, erinnerte Beauchamp sie unnötigerweise. »Es geht um eine Vernehmung. Ich werde hierbleiben, mich um die Presse kümmern und die zusätzlich angeforderten Bobbies koordinieren.« Farah fand es extrem lächerlich, dass er den Spitznamen benutzte, mit dem die Londoner die Mitglieder der Metropolitan Police bedacht hatten.
»Natürlich«, sagte sie trocken, als sie sich Feder, Tintenfass und einen dicken Schreibblock nahm, auf dem sie Protokolle und Geständnisse notierte und für Verbrecher wie Polizisten gleichermaßen eidesstattliche Erklärungen entwarf. Man brauchte ziemlich gute Nerven, um den Lärm der Menge draußen und das zerbrochene Fenster zu ignorieren, aber sie schaffte es. Die Schreibstube lag so hoch, dass niemand ihren Kopf sehen und darauf zielen konnte, sie dagegen konnte auf ihre Köpfe hinuntersehen. »Könnte ich freundlicherweise endlich den Grund für dieses Affenspektakel erfahren?«, fragte sie wohl zum hundertsten Mal.
Mr Beauchamp war offensichtlich erfreut, ihr höchstpersönlich mitteilen zu können, was sie noch nicht selbst herausgefunden hatte, und rümpfte wichtigtuerisch die Nase. »Niemand anders als der Mann, dessen Verhaftung Sir Morleys Karriere entscheidend beeinflussen wird. Der ruchloseste Meisterverbrecher der jüngsten Geschichte.«
»Nein! Sie meinen doch nicht etwa …«
»Oh doch, Mrs Mackenzie. Ich meine natürlich Dorian Blackwell, das Schwarze Herz von Ben More.«
»Wirklich«, hauchte Farah, die plötzlich doch ein wenig Angst bekam, sich mit diesem Mann im selben Gebäude, und gar noch im selben Raum aufzuhalten.
»Bitte sagen Sie jetzt nicht, Sie leiden unter Hysterie oder einem ähnlichen Frauenleiden. Vielleicht haben Sie es noch nicht bemerkt, aber wir befinden uns mitten in einer Krise, und ich kann mir solche Zierereien nicht leisten.« Beauchamp warf ihr einen verdrießlichen Blick zu.
»Wann habe ich jemals unter Hysterie gelitten?«, fragte sie ungeduldig, als sie sich den Block unter den Arm klemmte. »Wirklich, Mr Beauchamp, nach all diesen Jahren!« Missbilligend runzelte sie die Stirn und rauschte mit wehenden Röcken an ihm vorbei. Er war zwar der ranghöhere erste Sekretär und sie nur zweite Sekretärin, aber vielleicht war es langsam an der Zeit, das zu ändern.
Aber eins nach dem anderen. Farah straffte die Schultern und raffte den Rock, um die Stufen ins Untergeschoss hinabzusteigen. Auch wenn sie nicht zu Hysterie neigte, spürte sie doch auf einmal die Enge des Korsetts, und ihr Herz fühlte sich an wie ein Spatz, der in ihrer Brust umherflatterte und einen Ausweg suchte.
Dorian Blackwell, das Schwarze Herz von Ben More.
Trotz ihrer Angst war sich Farah bewusst, dass sie Zeugin eines einmaligen Ereignisses sein würde. Gewiss war Blackwell schon einige Male verhaftet worden, aber irgendwie hatte er es immer wieder geschafft, dem Gefängnis und dem Galgen zu entkommen. Innerlich ging sie die Informationen durch, die sie über Dorian Blackwell hatte.
Sein übler Ruf war vor etwas über zehn Jahren begründet worden, als die Hälfte der von Scotland Yard gejagten Verbrecher auf beunruhigende und mysteriöse Weise verschwunden war. Nach ersten Ermittlungen war von den finsteren Gerüchten aus den elendsten und gewalttätigsten Gegenden der Stadt – Fleet Ditch, Whitechapel und das East End – ein Name übrig geblieben.
Das Schwarze Herz. Ein neuer Typus eines Verbrechers, der die Londoner Unterwelt auf skrupellose Weise unter seine Herrschaft gebracht hatte, bevor jemand auch nur geahnt hatte, was da vor sich ging. Er unterwanderte bestehende Organisationen und operierte mit Hilfe einer hervorragend ausgebildeten Miliz.
Eine unglaubliche Anzahl gesuchter Diebe, Zuhälter, Buchmacher, Drogenhändler und Slumlords sowie die führenden Köpfe bestehender krimineller Unternehmen waren entweder verschwunden oder oft auch als aufgedunsene Leichen in der Themse wieder aufgetaucht.
In East London hatte ein lautloser, verborgener Krieg gewütet, und die Polizei hatte überhaupt erst davon erfahren, als die Ströme von Blut versiegt waren. Den in zunehmendem Maße unzuverlässigen Quellen zufolge ersetzte das Schwarze Herz die verschwundenen Verbrecher mit Agenten, die ihm blind ergeben waren. Diejenigen, die auf ihren Positionen blieben, waren plötzlich reicher und für die Justiz nur schwer zu fassen.
Wäre der rätselhafte, »das Schwarze Herz« genannte Mann auf seiner Seite Londons geblieben, hätte die jämmerlich unterfinanzierte und überarbeitete Polizei ihn wahrscheinlich nie verfolgt. Aber sobald dieser Mann sich die absolute Macht über elende Kaschemmen und Spielhöllen verschafft hatte, war er aus dem Schatten des dreckigen und blutigen Unterweltkriegs herausgetreten.
Und plötzlich hatte das Schwarze Herz einen Namen. Dorian Blackwell. Und dieser Name wurde gleichbedeutend mit einer völlig anderen Art von Massaker. Der finanziellen Art. Immer noch suchte die Polizei nach Verbindungen zwischen den anscheinend beliebigen Personen, die Blackwell mit kaltblütiger, präziser Effizienz erhoben oder zerstört hatte. Seine Schlachtfelder waren Banken und Aufsichtsräte. Mit einem Federstrich oder einem Gerücht hatte er viele Männer der Londoner Elite ruiniert. Um der Panik entgegenzuwirken, die die Stadt angesichts dieser Veränderungen ergriffen hatte, begegnete er den schlimmsten Befürchtungen, indem er großzügige Summen an Waisenhäuser spendete, Künstler und Schauspieler förderte und die entstehende mittelständische Wirtschaft durch ein paar sehr vernünftige Investitionen unterstützte. In der Mittel- und Unterschicht hatte er fast den Ruf eines Robin Hood erlangt.
Man munkelte, er sei einer der reichsten Männer des British Empire. Er besaß ein Haus am Hyde Park, zahlreiche weitere Immobilien und Unternehmen, die er entweder gekauft oder durch aggressive Geschäftsabschlüsse erbeutet hatte, sowie eine recht berühmte Burg auf der Isle of Mull, von der der Rest seines Namens stammte.
Ben More Castle war ein abgeschiedener Ort in den schottischen Highlands, wo Blackwell Berichten zufolge viel Zeit verbrachte.
Kurz bevor Farah das feuchtkalte Untergeschoss betrat – unverputzte Ziegelwände und nackter Erdboden –, warf sie noch einen Blick durch ein vergittertes Fenster nach draußen und stellte besorgt fest, dass die Menschenmenge sich anscheinend verdoppelt hatte. Nicht lange, und sie würde bis Charing Cross reichen. Und dann?
Sie beschleunigte ihre Schritte und achtete nicht auf die lauten, aufgeregten Stimmen der zehn oder zwölf Inspektoren, die sich vor den Eisentüren zu Beweismittelräumen, Archiven und Lagern herumdrückten. All ihre Aufmerksamkeit war auf einen Punkt konzentriert. Auf die vergitterte Tür zur Vernehmungszelle, aus der eine Reihe von Flüchen und die unverwechselbaren Geräusche von Schlägen drangen.
Alle sprachen über Blackwell und keiner besonders freundlich.
Das Schwarze Herz von Ben More war eine rätselhafte Persönlichkeit, seine Geschäfte waren zwar häufig skrupellos, aber im Allgemeinen legal.
Wahrscheinlich hätte die Polizei ihn in Ruhe gelassen, wenn nicht eine ganz besondere Personengruppe auf geheimnisvolle Weise verschwunden wäre. Einige Gefängniswärter. Ein Sergeant der Polizei. Der Commissioner des Gefängnisses von Newgate. Und erst vor Kurzem sogar ein Richter des Hohen Gerichts, Lord Roland Phillip Cranmer III, einer der mächtigsten Richter des gesamten Vereinigten Königreichs.
Wenn Farah eines gelernt hatte, dann, dass nichts die Polizei mehr zum Handeln anspornte, als Gewalt gegen ihre eigenen Leute. Natürlich wusste sie, dass Sir Carlton Morley schon hinter Blackwell her gewesen war, seit man ihn vor etwa zehn Jahren zum Chief Inspector ernannt hatte. Die beiden Männer hatten sich in ein Katz-und-Maus-Spiel verstrickt, das schnell eskaliert war.
Der Chief Inspector hatte sogar einige Male Anklage gegen Blackwell erhoben, aber das war schon Jahre her, als er noch im Bezirk Whitechapel gearbeitet hatte. Auch jetzt noch schien ihr Arbeitgeber geradezu besessen zu sein vom Schwarzen Herz von Ben More, und Farah fragte sich, ob er den Mann diesmal würde festnageln können. Sie hoffte es wirklich. Ihre Gefühle für Carlton Morley waren in letzter Zeit undurchschaubar geworden. Vielleicht sogar kompliziert.
Der Geruch im Untergeschoss war eine komplexe Mischung aus angenehm und abstoßend. Über dem einladenden Duft nach Papier und kühler, fester Erde lagen die stärkeren Gerüche von Stein und dem Eisen der Zellen. Je weiter sie sich vorwagte, desto erdrückender war der Gestank nach Urin, Körperausdünstungen und anderem Unrat, den sie sich lieber nicht vorstellen wollte, und der wie jedes Mal ihre Sinne betäubte, bevor sie ihn gewohnheitsmäßig beiseiteschob, um ihrer Arbeit nachzugehen.
»Erstaunlich, dass Beauchamp Sie hier runtergelassen hat, Mrs Mackenzie.« Ewan McTavish, ein kleiner, kräftiger Schotte und langjähriger Inspektor, tippte sich an den Hut, als sie vor der Tür der Vernehmungszelle stehen blieb. Sie kamen gut miteinander aus, da bei Scotland Yard bekannt war, dass ihr verstorbener Mann tatsächlich Schotte gewesen war. »Wir haben nicht jeden Tag einen solch gefährlichen Mann wie das Schwarze Herz von Ben More hier unten. Er könnte vergessen, sich Ihnen gegenüber respektvoll zu verhalten.« Ein gefährliches Funkeln erschien in McTavishs blauen Augen.
»Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Mr McTavish, aber ich mache das hier schon sehr lange, und mich kann wirklich nichts mehr schrecken.« Farah schenkte dem gutaussehenden, rothaarigen Schotten ein zuversichtliches Lächeln, dann nahm sie die Schlüssel aus ihrer Rocktasche und schloss die Tür auf.
»Wir warten hier draußen, falls Sie in Gefahr sind oder etwas brauchen«, sagte McTavish ein bisschen zu laut, vielleicht damit die Personen in dem Vernehmungsraum es genauso hörten wie sie selbst.
»Danke, Inspektor, danke Ihnen allen.« Farah lächelte noch einmal und betrat den Raum.
In der abgeschlossenen Zelle wurde der Geruch intensiver, und bis die gewohnte leichte Übelkeit abklang, hielt Farah sich ein Spitzentaschentuch mit einem Tropfen Lavendelöl vor die Nase, das sie stets bei sich trug. Erst danach registrierte sie die Anwesenden.
Als sie den Blick hob, erstarrte sie bei dem Anblick, der sich ihr bot.
Chief Inspector Sir Carlton Morley trug kein Jackett und hatte die Hemdsärmel bis zu den Ellbogen hochgekrempelt. Er hatte die Hände in die Seiten gestemmt, und Farah sah Blut auf den Knöcheln seiner manikürten Hände. Das normalerweise sorgfältig frisierte Haar war zerzaust und unordentlich.
Auf einem Stuhl in der Mitte des Raums saß in trügerisch entspannter Haltung ein großer, dunkelhaariger Mann, die Hände auf dem Rücken gefesselt.
Beide Männer keuchten, schwitzten und bluteten, aber das war es gar nicht, was Farah so fassungslos machte. Es war der beinahe identische Ausdruck ihrer Gesichter, als sie sie ansahen, eine beunruhigende Mischung aus Überraschung und Reue mit einem Unterton von kaum gezügeltem … Verlangen.
Die Luft zwischen den beiden Männern vibrierte beinahe fühlbar vor Aggression, aber als der Gefangene auf dem Stuhl sie betrachtete, wurde es plötzlich außergewöhnlich still.
Farah hatte auf der Weltausstellung in Covent Garden einmal exotische Raubtiere gesehen – sie waren dort in großen Käfigen ausgestellt –, und sie hatten sie überaus fasziniert. Sie hatte etwas über die Tiere gelesen und erfahren, dass Großkatzen wie Löwen und Jaguare in übernatürlicher Reglosigkeit verharren konnten. So verbargen sie ihre Angst einflößenden, mächtigen Körper im Schatten, vor Bäumen und im hohen Gras, und ihre Beute lief vorüber, ohne zu bemerken, dass eine Bestie auf sie wartete, um ihr gleich die Kehle durchzubeißen.
Sie hatte diese Tiere gleichzeitig gefürchtet und bemitleidet. Denn gewiss konnte eine so lebendige und kräftige Kreatur in einem Käfig nichts tun als zu hassen, zu verkümmern und irgendwann zu sterben. Sie hatte einen besonders dunklen Jaguar dabei beobachtet, wie er gerade einmal vier Schritte hinter den Gitterstäben auf- und ablaufen konnte und wie seine wilden, gelben Augen sich auf die bunt gekleideten Massen gerichtet hatten, die gekommen waren, um ihn zu begaffen, und ihnen schmerzvolle Rache schworen. Farah und die Bestie hatten einander ins Auge gesehen, und das Tier hatte diese übernatürliche Reglosigkeit gezeigt und ihren Blick für eine Ewigkeit unverwandt festgehalten. Sie war wie gebannt gewesen von dem Raubtier, während ihr heiße Tränen über die Wangen liefen. In seinen Augen hatte sie das furchtbare Schicksal gesehen, das der Jaguar für sie vorgesehen hatte. Er hatte sie als Beute markiert, als einer der schwachen und begehrenswerten Leckerbissen in der Herde der sich dort tummelnden Menschen. Und in diesem Augenblick war sie dankbar für die verfluchten Gitter gewesen, die die Bestie in Schach hielten.
Exakt dasselbe beunruhigende Gefühl überkam sie jetzt, als sie Dorian Blackwell in die ungleichen Augen sah. Seine Gesichtszüge waren grausam und brutal. Sein eines, gutes Auge war von der Art des bernsteinfarbenen Jaguarblicks. Im flackernden Lampenlicht glühte es golden neben der gebräunten Haut. Ihre Aufmerksamkeit wurde jedoch von seinem anderen Auge gefesselt. Denn von der Braue bis zum Nasenrücken verlief eine böse, gezackte Narbe, nur unterbrochen durch das Auge selbst, aus dem durch die Verletzung und was immer sie verursacht hatte, alle Farben außer reinem Blau herausgewaschen waren. Und wirklich starrte er sie an wie ein Raubtier, das seine Leibspeise erkennt und sprungbereit auf der Lauer liegt, bis sie in seine verhängnisvolle Nähe kam. Seine Wange war aufgeplatzt und Blut lief über seine männlichen Züge. Ein zweites kleines Rinnsal Blut tropfte aus seinem rechten Nasenloch.
Farah atmete tief durch, riss sich von dem hypnotischen Blick des Gefangenen los und suchte mit den Augen die vertrauten und vornehmen Züge ihres gut aussehenden Arbeitgebers.
Sir Morley, ein im Allgemeinen beherrschter Mann, schien am Ende eines zerfransten Seils zu hängen und mit beiden Händen nach den restlichen Fasern der Kontrolle über seinen Zorn zu greifen. Es sah Morley nicht ähnlich, einen gefesselten Mann zu schlagen.
»Ich sehe, Sie sind vorbereitet«, sagte er und nickte. Sein knapper Tonfall strafte den Schimmer von Wärme und Sehnsucht Lügen, den sie in seinen Augen sah.
»Ja, Sir.« Farah nickte. Sie riss sich zusammen, als sie den Blick auf den Schreibtisch hinten im Raum richtete und ihre zitternden Beine zwang, sie den ganzen Weg bis dorthin zu tragen, ohne etwas fallen zu lassen oder gar Schlimmeres. Sie verbarg ihr Unbehagen hinter einer sorgfältig komponierten Maske aus Gelassenheit, während ihre Schritte laut von den Wänden des gepanzerten Raums widerhallten.
»Auch wenn ich Ihre neue Strategie gutheiße, Morley, es wird nicht die gewünschte Wirkung haben, mir so ein süßes Ding vor die Nase zu halten.« Blackwells Stimme erreichte sie wie die ersten, unliebsamen Tentakel des Frostes im Winter. Tief, glatt, beißend und bitterkalt. Trotz allem war sie erstaunlich kultiviert, auch wenn man noch heraushören konnte, dass das Schwarze Herz von Ben More wahrscheinlich nicht aus London stammte. Er drehte den Kopf über den mächtigen Schultern, um sie zu beobachten, als sie zu dem Schreibtisch ging, der schräg hinter ihm stand. Nicht eine Sekunde wandte er die verstörenden Augen von ihr ab, nicht einmal als er mit Morley sprach. »Ich muss Sie warnen. Brutalere Männer als Sie haben versucht, ein Geständnis aus mir herauszuprügeln, und schönere Frauen als diese Lady haben sich bemüht, mir Geheimnisse zu entlocken. Beide haben versagt.«
Der Schreibtischstuhl war schneller da als erwartet, als sie sich setzte, hätte sie fast ihre Utensilien fallen gelassen. Mit zitternder Hand strich sie den Block glatt, dann ergriff sie die Feder und schraubte das Tintenfass auf. Sie war unsagbar froh, dass sie hinter Blackwell saß und er ihre Unsicherheit nicht sehen konnte.
»Sie werden noch merken, dass es keine brutaleren Männer als mich gibt, Blackwell.« Morley feixte.
»Sagte die Fliege zur Spinne.«
»Wenn ich die Fliege bin, warum sind Sie dann in meinem Netz gefangen?« Morley ging um Blackwell herum und riss einmal brutal an den Handfesseln.
»Sind Sie sicher, dass das stimmt, Chief Inspector? Sind Sie wirklich sicher, dass Sie mich in der Hand haben?« Blackwell verhielt sich weiterhin unbeeindruckt, aber Farah bemerkte, dass die Schultern unter der feinen, maßgeschneiderten Jacke angespannt waren, und kleine Schweißbäche an den Schläfen und im Nacken hinabrannen.
»Ich weiß sogar, dass es so ist«, sagte Morley.
Der hohle, belustigte Laut, den Blackwell von sich gab, erinnerte Farah wieder an den Jaguar. »Wahres Wissen ist, das eigene Unwissen zu kennen.«
Der Mann zitierte Konfuzius? Wie ungerecht, dass ausgerechnet ein Mann wie er klug, gefährlich, reich und mächtig und noch dazu belesen war. Farah unterdrückte ein Seufzen und richtete sich dann, erschrocken über ihre Reaktion, entschlossen auf, nahm die Feder zur Hand und machte sich bereit, das Papier mit der effizienten Kurzschrift zu füllen.
»Genug.« Morley kam zu ihr herüber. »Sind Sie bereit, können wir mit der Vernehmung beginnen, Mrs Mackenzie?«
Ihr Name schien wie ein verirrtes Insekt durch den Raum zu schwirren, von Stahl und Steinen abzuprallen und bei dem gefesselten Mann in der Mitte anzukommen.
Mackenzie. Farah war nicht sicher, aber sie hatte das Gefühl, dass Blackwell den Namen gehört und dann ausgesprochen hatte. Als sie durch die halbgeöffneten Lider den finster blickenden Morley ansah, stellte sie fest, dass er es anscheinend nicht bemerkt hatte.
»Natürlich«, murmelte sie und tauchte die Feder demonstrativ in die Tinte.
Morley ging wieder zu Blackwell, sein kantiges Gesicht verriet grimmige Entschlossenheit. »Sagen Sie mir, was Sie mit Richter Cranmer gemacht haben. Und versuchen Sie gar nicht erst zu leugnen. Ich weiß, dass er Sie vor fünfzehn Jahren zu einer Gefängnisstrafe in Newgate verurteilt hat.«
»Das hat er.« Blackwell bewegte keinen Muskel.
Newgate vor fünfzehn Jahren? Farahs Kopf fuhr hoch, ihre Feder kratzte laut über den Tisch. Er war doch nicht etwa zur selben Zeit dort gewesen wie …
»Und die vermissten Wärter«, fuhr Morley fort, seine Stimme war lauter geworden und wirkte verzweifelter. »Während Ihrer Zeit dort waren sie Ihrem Trakt zugeteilt.«
»Wirklich?«
»Sie wissen verdammt noch mal, dass es so ist!«
Blackwell zuckte mit der Achsel, eine hilflose Geste, die zu sagen schien, ich würde Ihnen ja helfen, wenn ich könnte, woraufhin Morley umso wütender wurde. »Ihr Bobbies seht für mich alle gleich aus. Die lächerlichen Schnurrbärte, diese albernen Hüte. Es ist kaum möglich, Euch auseinanderzuhalten, selbst wenn man wollte.«
»Das sind etwas zu viele Zufälle, das Gericht wird so etwas nicht ignorieren!«, sagte Morley siegessicher. »Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie in Newgate am Ende eines Stricks zappeln, in demselben Loch, aus dem Sie hervorgekrochen sind.«
»Liefern Sie mir auch nur den geringsten Beweis.« Blackwells leise Drohung war mit Stahl überzogen. »Oder besser noch, rufen Sie einen Zeugen auf, der es wagt, gegen mich auszusagen.«
Morley ignorierte diese Behauptung. »Ganz London kennt Ihren Hang zu prompter und erbitterter Rache. Ich kann mir einen beliebigen Trottel von der Straße suchen, und er würde seine Hand erheben und bei Gott schwören, dass Sie den Richter erledigt haben, der Sie zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt hat.«
»Ach, Morley, wir wissen beide, dass es mehr braucht als einen schlechten Ruf und Hörensagen, um jemanden zu überführen«, spottete Blackwell. Er drehte den Kopf, um Farah mit seinem guten Auge anzusehen, und sprach sie direkt an, worauf ihr Magen sich zusammenkrampfte, und ihre Hände noch mehr zitterten. »Mrs Mackenzie, nehmen Sie bitte mein feierliches, offizielles Geständnis zu Protokoll und notieren Sie, dass ich schwöre, die Wahrheit zu sagen.«
Farah schwieg. Wie immer bewies sie dem Gefangenen ihre Professionalität, indem sie ihn nicht beachtete. Natürlich hatte er in Wirklichkeit ihre absolute und ungeteilte Aufmerksamkeit. Dieses Gesicht. Dieses wilde, maskuline Gesicht. Gut aussehend, wären da nicht die Narbe und das schockierend blaue Auge gewesen, beides abstoßend und fesselnd zugleich.
»Ich, Dorian Everett Blackwell, hegte niemals eine Abneigung gegenüber dem Richter des Hohen Gerichts, Lord Roland Phillip Cranmer III. Ich war des Gelegenheitsdiebstahls schuldig, wofür er mich zu sieben Jahren im Gefängnis von Newgate verurteilt hat, und ich schwöre feierlich, dass ich meine Lektion gelernt habe.« Natürlich sagte er das so ironisch, dass man bei jedem Wort an seinem Wahrheitsgehalt zweifelte.
Farah starrte ihn nur völlig gebannt an und versuchte die Nachricht zu entschlüsseln, die in seinem guten Auge mit einer fremdartigen und beängstigenden Verzweiflung glühte. Sie hatte das Gefühl, als würde der Teufel selbst mit ihr spielen und sie doch gleichzeitig warnen wollen. »Das verstehen Sie doch, Mrs Mackenzie?«, murmelte Blackwell. Sein harter Mund bewegte sich kaum, während sein eindringlicher Blick sie auf ihren Stuhl drückte. »Die Fehltritte eines leichtsinnigen jungen Mannes.«
Ein Schauder überlief ihren Rücken.
»Beschissener Schwachsinn!«, brüllte Morley.
Dorian drehte sich wieder zu ihm um, und als Farah sich plötzlich von dem dunklen Bann erlöst sah, den er über sie gelegt hatte, ließ sie den Atem los, den sie unbewusst angehalten hatte.
»Schämen Sie sich, Morley«, sagte Blackwell spöttisch. »Solche Worte vor einer Lady.«
»Sie ist meine Angestellte«, zischte Sir Morley durch die zusammengebissenen Zähne. »Und ich wäre Ihnen dankbar, sich nicht weiter den Kopf über sie zu zerbrechen, wenn Sie nicht auch noch die Sehkraft des anderen Auges verlieren wollen.«
»Ich kann kaum dagegen an. Sie ist so ein süßes, appetitliches Ding.«
»Halten. Sie. Sich. Zurück.«