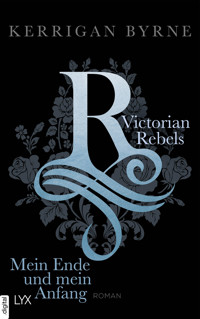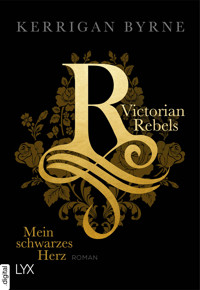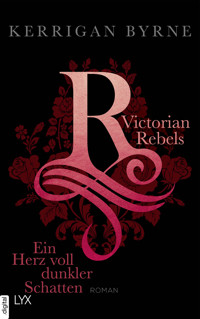
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: The Victorian Rebels
- Sprache: Deutsch
Ein Licht in seiner Dunkelheit
Christopher Argent ist ein Auftragskiller, geboren und aufgewachsen im berüchtigten Newgate Prison in London. Seit er als Junge mit ansehen musste, wie seine Mutter ermordet wurde, sind ihm menschliche Empfindungen fremd. Seine Aufträge erfüllt er unbeirrt und mit kalter Präzision. Doch dann soll er die Schauspielerin Millie LeCour eliminieren. Zum ersten Mal kann er einen Auftrag nicht vollenden - denn Millie erweckt Gefühle in ihm, die ihn in tiefste Verwirrung stürzen. Er, der ihr Mörder sein sollte, wird zu ihrem Beschützer. Doch kann die Leidenschaft, die zwischen ihnen brennt, die Finsternis seiner Seele wirklich vertreiben?
"Emotional, gewaltig, ein Buch, das man nicht mehr weglegen kann!" Romantic Times
Band 2 der Victorian Rebels
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungZitatProlog12345678910111213141516171819202122232425262728293031DanksagungenDie AutorinDie Romane von Kerrigan Byrne bei LYX ImpressumKERRIGAN BYRNE
Victorian Rebels
Ein Herz voll dunkler Schatten
Roman
Ins Deutsche übertragen von Inka Marter
Zu diesem Buch
Christopher Argent ist ein Auftragskiller, geboren und aufgewachsen im berüchtigten Newgate Prison in London. Seit er als Junge mit ansehen musste, wie seine Mutter ermordet wurde, scheint er jegliche Fähigkeit zu menschlichen Gefühlen verloren zu haben. Er ist ein Jäger, der sein Ziel niemals aus den Augen verliert. Doch dann soll er die gefeierte Schauspielerin Millie LeCour eliminieren. Zum ersten Mal in seiner Laufbahn kann er den Auftrag nicht vollenden. Denn als er Millie auf der Bühne sieht und sie nur für ihn zu spielen scheint, rührt sich in seinem Innern etwas, das ihn in tiefste Verwirrung stürzt. Ihre erste Begegnung entfacht ein Feuer, das ihn von innen zu verzehren droht. Statt Millies Leben zu beenden, wird er zu ihrem Beschützer. Christopher ist fest entschlossen, die Gefahr für die junge Frau und ihren kleinen Sohn aus der Welt zu schaffen und dann für immer aus ihrem Leben zu verschwinden. Doch er hat nicht damit gerechnet, dass Millie ihn ebenso begehrt wie er sie und dass sie sich selbst durch die grausame Wahrheit über seine Taten nicht davon abschrecken lässt, mehr als ein gefühlloses Monster in ihm zu sehen. Doch kann ein Mann wie er die Gefühle zulassen, die sie in ihm erweckt, oder wird er sie mit sich in den Abgrund ziehen?
Für Janet Snell
Ohne dich hätte ich es nie geschafft.
Ich küsste dich,
eh’ ich dir Tod gab – nun sei dies der Schluss:
Mich selber tötend sterb’ ich so im Kuss.
– William Shakespeare, Othello
Prolog
Newgate Gefängnis, London 1855
Es war eine einzige Folter.
Christopher Argents Muskeln bebten vor Anstrengung. Schweiß mischte sich mit dem eiskalten Regen und rann in kleinen Bächen an ihm herab. Es machte ihn wahnsinnig. Es war, als würden kleine Würmer über seinen zitternden Körper kriechen. Er würde seine Seele dafür hergeben, sie wegwischen zu können. Aber obwohl Christopher die Zähne zusammenbiss, bis ihm der Kiefer schmerzte, versuchte er keine Gefühlsregung zu zeigen – aus Furcht vor den Konsequenzen.
Er beobachtete aufmerksam den Mann neben sich und ahmte die Bewegungen seines Shifu akkurat nach. Es war schwierig ihnen zu folgen oder, besser gesagt, die fließenden Bewegungen, die Meister Wu Ping ihm mit übernatürlicher Präzision vormachte, mit derselben, unglaublichen Langsamkeit auszuführen.
»Du weißt, warum wir das Siu lim tao im Regen üben, Junge?«, fragte Meister Ping mit seinem starken chinesischen Akzent, ohne die Übung zu unterbrechen. Es waren die ersten Worte, die er zu Christopher sagte, seit sie heute mit dem Unterricht begonnen hatten.
Christopher fiel es sehr viel schwerer, die Bewegungen korrekt auszuführen, während er sprach, er brauchte seine ganze Konzentration für die Form. Aber er versuchte es.
»Zur Strafe«, sagte er. »Weil ich John und Harry verprügelt habe …«
»Und?«
Christopher holte tief Luft, um seine Schande einzugestehen, aber er musste seine Bewegung unterbrechen und sich neu sammeln, um dem Rhythmus des Shifu zu folgen.
»Und Hugh«, murmelte er.
Meister Ping schwieg eine Weile, man hörte nur seinen Atem, während er die flache Hand nach oben geöffnet von sich fort bewegte und dann senkrecht, in Verlängerung des Brustbeins, vor den Körper zurückführte. »Ich bin dein Shifu, Junge. Was bedeutet das Wort in deiner Sprache?«
Das wusste Christopher. »Es bedeutet Lehrer.«
Wu Ping nickte kurz. »Also steht es mir nicht zu, dich zu bestrafen. Meine Aufgabe ist es, zu lehren.«
Die Stille dehnte sich zu einer gefühlten Ewigkeit, während sie die präzisen Bewegungsabfolgen ausführten, die Christopher inzwischen seit beinahe zwei Jahren übte. Jetzt mit elf war er fast so groß wie der Lehrer, der ihn unter seine Fittiche genommen hatte.
»Heute, Junge, ich dir zeigen, wie Wasser sein.« Master Ping hatte ihn immer nur »Junge« genannt.
Christopher lauschte aufmerksam, während er vor sich auf den nassen, grauen Hof des Newgate Gefängnisses blickte. Der alte Mann hatte schon früher über Wasser gesprochen, aber Christopher musste zugeben, dass er nicht zugehört hatte. Aber jetzt würde er es tun. Er war so durchnässt von dem feuchten Element, er war so erschöpft und zitterte so sehr, dass es einen ziemlichen Eindruck auf ihn machte.
»Wasser ist flüssig, wandelbar«, begann Ping. »Ist weich. Nimmt die Form an, die es enthält. Findet die tiefsten Orte und nimmt den Weg des geringsten Widerstandes. Es erhält Leben. Wird leicht umgeleitet zum Nutzen anderer. Du verstehst?«
»Ja, Shifu.« Er verstand gar nichts, aber das würde er schon noch, wenn Meister Ping fertig war.
»Aber Wasser auch tödlich«, fuhr der Lehrer fort. »Nicht einmal Stein widersteht seiner Kraft. Wasser überflutet. Ertränkt. Zerstört alles auf seinem Weg ohne Denken. Ohne Gnade. Ohne Reue.«
Der alte Mann hielt inne in seiner Bewegung und drehte sich zu Christopher um, der seine zitternden Arme erleichtert sinken ließ und den kleinen Chinesen ansah. Früher hatte er gefunden, dass Meister Ping wie eine Wurst aussah, rund und krumm und in straffe Haut gehüllt. Dabei war der kleine, freundliche Fremde der gefährlichste Mann im ganzen Gefängnis.
»Was sind die fünf Reaktionen auf einen Konflikt?«, fragte Ping.
Christopher zählte sie aus dem Gedächtnis auf. »Vermeidung, Entgegenkommen, Kooperation, Kompromiss und Angriff.«
Wieder nickte Ping kurz. »Fäuste und Kraft sind nur nötig einmal von fünf. Weißt du, warum das so ist?«
Christopher sah auf die schmierigen Pflastersteine des Hofes und folgte einem dunklen, schmutzigen Rinnsal mit den Augen, das auf einen Abfluss zulief. »Weil ich mich nicht prügeln soll«, murmelte er.
»Falsch«, schimpfte Ping, aber er war sanft, als er Christophers Kinn hob und ihm in die Augen blickte. »Weil unser Kung Fu ist nicht zum Kämpfen. Nur zum Töten. Du nicht benutzen, nur um ein Leben zu nehmen, dich zu verteidigen oder jemand zu beschützen.«
Wieder biss Christopher die Zähne zusammen, aber diesmal nicht vor Kälte oder Erschöpfung, sondern weil eine vertraute Hitze in ihm aufstieg. Er konnte den Trotz in seinen Augen nicht verbergen. »Sie haben nicht gehört, was die über meine Mutter gesagt haben.«
»Stimmt, was sie gesagt haben?«, fragte Ping.
»Nein.«
»Warum dann wichtig?« Der Shifu zuckte mit den Schultern.
Es war aus so vielen Gründen wichtig, aber Christopher konnte sie nicht benennen und schwieg wütend.
Pings schwarze Augen wurden weich, und um die Augenwinkel erschienen winzige Fältchen – näher war er einem Lächeln noch nie gekommen. »Du schon sein wie Wasser, nur deine Gefühle zu tief. Zu stark. Wie Ozean. Du musst Gefühle zur Ruhe bringen, Wut, Hass, Angst …« Ping legte Christopher die Hand auf die Schulter, ein ungewöhnliches Zeichen der Zuneigung. »Liebe.«
»Wie?«, flüsterte Christopher.
»Leite um, wie ein Bauer, der einen Fluss umleitet, um seine Felder zu bewässern. Du musst verwandeln in Geduld, Logik, Rücksichtslosigkeit. Nur dann fließt Tod von deinen Händen mit der zerstörerischen Macht der Flut.« Meister Ping wandte sich von ihm ab, nahm die Grundposition ein und schlug mit der flachen Hand gegen die Gefängnismauer. Der Stein bröckelte unter seinem Schlag, und es bildeten sich strahlenförmige Risse.
Christopher starrte mit offenem Mund darauf und schmeckte den Regen auf der Zunge. »Wie … wie haben Sie das gemacht?«
Ping zwinkerte ihm zu. »Ich zeige dir morgen. Du schlägst nicht auf das Ziel, sondern hindurch, dann wird Kraft übertragen, und Ziel fällt.«
»Können Sie es mir jetzt zeigen?«, fragte Christopher hoffnungsvoll.
Ping schüttelte den Kopf. »Deine Mutter wartet auf dich in der Zelle. Fast Zeit zu essen.«
»Woher …«
Die Uhr schlug. Christopher drehte sich so rasch zu dem Wachturm um, dass Wassertropfen in den Regen wirbelten. Anscheinend wusste der geheimnisvolle alte Mann selbst an Tagen, an denen die Sonne nicht zu sehen war, wie spät es war.
Als Christopher sich wieder zu Meister Ping umdrehte, stand er allein im Hof.
Jetzt mehr vor Aufregung als vor Kälte zitternd, lief Christopher durch den Regen zum DeadMan’sWalk, einem Gang, dessen Dach nur aus einem rostigen Gitter bestand und durch den man die Todgeweihten zum Galgen führte. Er grüßte ein paar bekannte Gesichter, als er durch die Katakomben des Gefängnisses ging und klopfte dann an die Eisentür, die den Bereich der Männer von dem der Frauen trennte.
»Wer ist da?« Eine Stimme mit starkem schottischem Akzent drang durch das vergitterte Fenster in der Tür, dann zeigte sich das runde Gesicht des jungen Ewan McTavish, der auf ihn hinunterblickte. »Aye, Kleiner, du bist es! Du hast Glück, dass du vor dem Wachwechsel zurück bist. Wenn Treadwell dich auf der falschen Seite der Tür entdeckt, lässt er dich die ganze Nacht da hocken und du bist den üblen Kerlen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, kapiert?«
Christopher war in diesen Mauern geboren worden. Er wusste besser als McTavish, in welche Hölle sich Newgate bei Einbruch der Nacht verwandelte. Das Rasseln der Ketten war sein Schlaflied gewesen, das Schreien und Wimmern der Schwachen und die widerstrebenden Schritte der Verurteilten, die sich den langen, übergitterten Gang entlangschleppten und nie zurückkehrten. Seine Mutter weinte manchmal um die Gehängten, aber Christopher tat das nie. Ein toter Gefangener hieß manchmal Schuhe oder einen Gürtel.
Die rostige Eisentür schrappte mit ohrenbetäubendem Lärm über den Steinboden, als McTavish sie weit genug öffnete, damit der schmale Junge hindurchschlüpfen konnte. Dann stieß er sie wieder zu und schob den Riegel vor.
»Mum schickt mich immer raus, wenn neue Vorräte gebracht werden.« Christopher hüpfte von einem nackten Fuß auf den anderen, um sich warm zu halten. Er mochte McTavish, und an Tagen, an denen er nichts anderes zu tun hatte, folgte er dem stämmigen, dunkelhaarigen Wärter manchmal auf seiner Runde.
McTavishs Augen passten zu dem schicken Dunkelblau seiner Uniform. Es lag Mitleid darin, als er nickte. »Aye, Bursche. Ich weiß.«
»Die Wärter wollen nicht, dass ich da bin, wenn sie Feuerholz oder Konserven bringen. Mum sagt, ich bin nur im Weg.«
McTavish wich Christophers Blick aus und starrte in den feuchtkalten Gang, der mit eisernen Gitterstäben flankiert war. »Sie sind fertig«, murmelte er. »Lauf los zu deiner Mutter, damit sie nicht mit dem Essen warten muss.«
Christopher, der sich schon richtig auf das Feuer freute, rannte einen Gang hinauf, den nächsten hinunter und drückte sich flach an eine Wand, als zwei Wärter sich näherten. Einer machte gerade seinen Gürtel zu. Hier in Newgate musste man wissen, welchen Wärtern man besser aus dem Weg ging – und welchen Gefangenen.
McTavish hatte recht mit Treadwell. Der große, blonde Rohling hatte ihn schon öfter als er zählen konnte geohrfeigt, geschubst oder mit einem Stock geschlagen.
»Das Miststück sollte dankbar sein«, murmelte Treadwell zu seinem Begleiter, als sie vorbeigingen. »Ich sollte ihr ein paar echte Rohlinge vorbeischicken, damit die Schlampe den Unterschied begreift. Soll froh sein, dass ich es bin, der es ihr besorgt.«
»Wir sollten ihren sommersprossigen Bastard in den Todestrakt stecken, dann kann sie zusehen, wie die Bestien ihn in Stücke reißen«, schlug der andere vor.
Christopher rieb sich in der Dunkelheit die Wangen, als könnte er die Sommersprossen dadurch loswerden.
»Tja, inzwischen werden die nutzlosen Gören registriert, die im Knast geboren werden«, schimpfte Treadwell. »Wir müssten erklären, wo er abgeblieben ist … Außerdem ärgert mich nicht der Bengel, sondern die großmäulige Hure, die er Mutter nennt.«
Besorgt griff sich Christopher an sein wild klopfendes Herz. Reglos blieb er stehen, während sich unter ihm das Wasser sammelte, das aus seinen nassen, zu großen Kleidern tropfte. Sobald die beiden Wärter um die Ecke gebogen waren, rannte er los zu der Zelle, die schon sein ganzes Leben sein Zuhause war.
Christine Argent legte gerade einen Holzscheit auf das brennende Feuer.
Durch das vergitterte Loch hoch oben in der Mauer drang noch etwas Licht. Man konnte es kaum ein Fenster nennen, und obwohl es im Winter die Kälte und im Sommer die Hitze hereinließ, waren Christopher und seine Mutter froh, die Öffnung von der Größe eines Bullauges zu haben. So kam wenigstens ein wenig frische Luft in den kleinen Raum. Ein bisschen Durchzug war Gold wert in einer Zelle, die schon an einem milden Tag schlecht roch.
»Mum?« Christopher ging auf Zehenspitzen durch die offene Gittertür und kniete sich neben sie auf den Boden. In der Hitze des Feuers fingen seine Arme und Beine sofort an zu kribbeln.
Seine Mutter hatte ihr lockiges, rotes Haar heute Morgen gebürstet und geflochten, jetzt hing es wirr herab und verbarg ihr Gesicht vor seinem Blick.
»Du bist es, Spatz.« Das Lächeln in ihrer Stimme hörte sich gezwungen an, und sie wischte sich über die Augen, die hinter ihrem Haar verborgen waren. Rasch stand sie auf, und bevor er sie richtig sehen konnte, drehte sie sich zu dem Kalender um, den sie mit einem Stein in die Wand geritzt hatten. »Ich dachte, du bist draußen bei Mister Ping.« Sie hob die zerschlissene Schürze, um sich über das Gesicht zu wischen.
»Er heißt Meister Ping«, sagte Christopher leise und starrte in die jämmerlichen Flammen. Es war nicht viel Holz diesmal. Es würde kaum eine Woche halten, und die Vorräte wurden nur einmal im Monat erneuert.
»Ach ja«, sagte sie fröhlich und überspielte ein Schniefen. »Das weiß ich natürlich.« Mit einem Stück Schiefer ritzte sie die Markierung ein, die einen weiteren Monat in Newgate voll machte. Ihre Bewegungen waren steif, fast als hätte sie Schmerzen. Der Strich, den sie mit ihrer merkwürdig zittrigen Hand machte, war tiefer und breiter als die anderen. »War es …« Sie räusperte sich. »Hattest du eine schöne Zeit bei Meister Ping?«
»Ja«, sagte er nach einer Weile. »Mum. Sieh mich an.«
Sie ließ die Hand, die noch das Schieferstück hielt, fallen, aber sie machte keine Anstalten sich umzudrehen, sondern zog sich das fadenscheinige, graue Umhängetuch nur fester um die Schultern. »Nur noch achtundvierzig Monate, Spatz, kannst du das glauben?« Die aufgesetzte Fröhlichkeit in ihrer sonst leisen Stimme machte ihm Angst. »Noch vier Jahre, und wir sind frei. Dann können wir tun, was wir wollen. Ich suche mir eine Arbeit als Näherin und stelle wieder meine wunderschönen Spitzen für feine Damen her. Ich war einmal berühmt für meine Spitzenarbeiten, das weißt du doch?«
»Ich weiß, Mum«, flüsterte Christopher und war jetzt sehr besorgt. Sie hatte ihm das schon früher erzählt, aber es hatte keine Bedeutung für ihn, da er noch niemals Spitze gesehen hatte und die Beschreibung nicht verstand. »Lass mich dein Gesicht sehen.«
»Und du kannst als Lehrling bei einem Handwerker anfangen. Vielleicht arbeitet Mr Dockery noch auf den Werften. Wir nehmen uns eine eigene kleine Wohnung mit einem Holzofen und einem Kamin. Wir werden nie wieder frieren.«
Christopher stand auf. Er entfernte sich von der Wärme des Feuers und trat zu seiner Mutter. Er wollte die Arme um ihre Taille schlingen, aber er tat es nicht, weil er noch nass war und ihr kalt werden würde. Stattdessen stellte er sich zwischen sie und die Wand und strich ihr das Haar aus dem Gesicht.
Es war nicht so schlimm, wie er befürchtet hatte. Ihre Unterlippe war aufgeplatzt, blutete aber nicht.
Einen kurzen Moment schloss Christopher die Augen. Er war elf, alt genug um zu wissen, dass es nicht die sichtbaren Wunden waren, die ihr Schmerzen bereiteten. Es hatte mit dem zu tun, was die Wärter mit ihr machten, wenn er nicht da war. Was sie mit sich machen ließ. Damit man ihnen ein paar mehr Konserven und Feuerholz gab.
Sie war blass, und ihre Augen waren rot vom Weinen, aber sie war immer noch seine Mutter. Seine große, schöne, kräftige Mutter. Die Frau, von der er alles hatte: den robusten Körperbau, die guten Zähne und das Haar von der Farbe verrosteter Türangeln. Und sie gab ihm auch ihren letzten Bissen Essen und das Lächeln, das in ihrer grauen Welt das einzig Schöne war.
Ein wohlbekannter Hass stieg in ihm auf. »Du darfst sie nicht mehr hereinlassen, Mum«, knurrte er. »Ich kann auf Feuer verzichten.«
Ihre Augen, vom selben hellen Blau wie seine eigenen, waren feucht, und sie blinzelte rasch, als sie ihm das nasse Haar aus der Stirn strich. »Natürlich kannst du nicht auf Feuer verzichten, Spatz«, sagte sie sanft. »Sieh dich doch an. Klitschnass wie eine Kanalratte.« Sie packte ihn mit ihren starken, geschickten Händen und zog ihm das Hemd aus. »Komm und wärm dich auf, bevor du dir den Tod holst. Ich kümmere mich ums Abendessen.«
Er bemerkte, dass sie leicht hinkte, und in hilfloser Verzweiflung biss er die Zähne zusammen. Aber sie war stur, und wenn sie so war wie jetzt, konnte man nicht vernünftig mit ihr reden.
Sie aßen schweigend und starrten in die Flammen. Christine noch benommen und leicht zerstreut, Christopher angefüllt mit schwelender Wut.
Wu Ping hatte keine Ahnung. Er verstand überhaupt nichts. Wie sollte er seine Liebe zu ihr zur Ruhe bringen? Wie konnte er die Männer, die seiner Mutter Schmerzen zufügten, nicht hassen? Oder keine Angst davor haben, was sie als Nächstes taten?
Es war unmöglich, Gefühle zu beherrschen.
Das würde er dem alten Narren sagen, wenn er ihn das nächste Mal sah.
»Christopher«, flüsterte seine Mutter, und er sah auf. Nur selten nannte sie ihn anders als Spatz, das war ihr Kosename für ihn. »Christopher, du musst wissen, dass es mir gut geht. Ich tue das alles, weil ich es verdient habe, und weil du etwas Besseres verdienst.«
»Das ist verdammter Unsinn, Mum, du verdienst nicht, zu … sie dürfen nicht … nicht meinetwegen.« Er brachte die Worte nicht über die Lippen, aber seine Wangen brannten vor Scham.
»Du sollst nicht fluchen«, sagte sie fest, aber dann wurde sie wieder sanft. »Mein Sohn, du weißt nicht, wie die Welt hinter diesen Mauern aussieht. Wie merkwürdig und wunderbar. Schön und schrecklich. Du kennst das wirkliche Leben nicht. Du hast noch nie einen richtigen Sonnenuntergang gesehen oder eine frische Mahlzeit gegessen.« Wieder traten ihr Tränen in die Augen. »Und das ist meine Schuld. Weil ich eine Verbrecherin bin.«
»Es macht nichts«, sagte er, aber sie unterbrach ihn.
»Eines Tages wirst du es sehen, Spatz. Du wirst sehen, was man dir vorenthalten hat, und vielleicht wirst du mich dafür hassen.«
»Ich könnte dich niemals hassen«, entgegnete er heftig. Er rutschte zu ihr und lehnte sich an sie, und sie schlang ihr Umhängetuch um seine nackten Schultern.
»Das hoffe ich, mein Sohn.« Sie legte das Kinn auf seinem Kopf ab. »Aber man weiß nie, wozu man fähig ist, bis …«
»Bis was?«
Zitternd atmete sie aus, stand auf und befühlte das Hemd, das an einem rostigen Nagel an der Wand hing. Es war unmöglich, in der feuchten Zelle etwas trocken zu bekommen, nicht mit einem so armseligen Feuer. Aber sie gab es ihm trotzdem, und die Kälte brannte fast auf der Haut, als er es anzog.
»Schlafenszeit, Spatz.« Zur Nacht wurde alles abgeschlossen, und das Dröhnen von eisernen Riegeln und schweren Türen hing über den lauten Rufen der Wärter und Geräuschen der anderen Gefangenen. Eine untersetzte, sauertöpfische Frau kam zur Gefangenenzählung vorbei und machte die Zelle zu. Dann legten Christopher und seine Mutter sich auf ihre Pritschen.
Früher hatten sie wegen der Wärme beieinander geschlafen, erinnerte sich Christopher sehnsüchtig. Sie hatte ihren Körper an ihn geschmiegt und ihm Lieder vorgesungen, um die schrecklichen Geräusche der Nacht zu übertönen.
Jetzt nicht mehr. Nicht seit die Träume angefangen hatten und er mit einer seltsam brennenden Lust aufwachte, die in seinen Lenden zog und sich in seine Hose ergoss.
Sie hatte bestimmt, dass sie getrennt schliefen und fast wehmütig gelacht, als sie ihm mit roten Wangen zu erklären versucht hatte, dass er zu einem Mann wurde.
Christopher wollte kein Mann sein, dachte er niedergeschlagen. Er wollte sich weder in ein unmenschliches Monster wie Treadwell noch in einen alten Narren wie Meister Ping verwandeln.
Er wollte einfach nur in den Arm genommen werden.
Was als leichter Regen begonnen hatte, wurde ein Gewitter. Donner ließ die alten Mauern von Newgate erzittern, und Blitze warfen geheimnisvolle Schatten durch das winzige Fenster.
»Wollen wir etwas singen?«, fragte seine Mutter, und Christopher lächelte in die Dunkelheit hinein. Er hatte heimlich gehofft, dass sie das fragen würde. Das Gewitter machte ihm Angst, und die nächtlichen Geräusche waren heute besonders unheimlich.
»Was sollen wir singen?«, fragte er.
»Wie wäre es mit meinem Lieblingslied?«
Sie sangen.
Ganz leise, schlaf ein,
den Traum lass herein.
Von Freiheit und Liebe
und ewigem Frieden.
Du lächelst im Schlaf,
und ich halte Wacht.
Jetzt schlaf bis zum Morgen
ohne Tränen und Sorgen …
Ein schreckliches, schrappendes Geräusch hallte durch das steinerne Gemäuer und riss Christopher so abrupt aus seinem warmen Traum, dass er auf den kalten Boden fiel. Er setzte sich auf und blinzelte in die Dunkelheit. Draußen tobte noch immer das Gewitter, und ein Blitz erhellte seine schlafende Mutter. Den Donner hörte er gleich danach. Kurz glaubte er, er sei von dem Donner aufgewacht, aber das Geräusch, das er gehört hatte, war einzigartig. Er wusste genau, woher es kam.
Die schwere Eisentür, die den Männertrakt vom Frauentrakt trennte.
Jetzt hörte er tiefe Stimmen im Gang. Männerstimmen. Es waren keine Wärter. Die Geräusche der Wärter kannte er. Ihre Schritte waren laut, weil sie schwere Stiefel mit harten Sohlen trugen. Christopher legte sein Ohr auf den Boden. Diese Schritte klangen anders. Schritte von nackten Füßen.
Angst durchzuckte ihn, als der Blitz bedrohliche Schatten an die Wand warf. Aber diese Schatten waren keine Illusion.
Sie gehörten zu den Männern, die jetzt in die Zelle traten.
Es waren keine Wärter, so viel konnte er bereits nach dem ersten Blick sagen. Sie waren schmutzig, selbst für Gefangene. Beängstigend. Lauerten. Knurrten.
Christopher kämpfte wie ein Wilder, als er schmerzhaft gepackt wurde. Die Panik ließ ihn alle Lehren von Meister Ping vergessen. Er fand seine Mittelachse nicht. Konnte keine Faust machen. Und er konnte den Mann nicht abschütteln, der dreimal so schwer war wie er, auch wenn er es noch so sehr versuchte.
»Christopher!« Seine Mutter rief seinen Namen in der Dunkelheit. »Christopher, lauf!« Die Angst lähmte ihn mindestens so sehr wie der Riese, der ihm ein Knie in den Rücken drückte.
Treadwell hatte seine Drohung wahrgemacht.
»Bitte, tun Sie meinem Sohn nichts«, flehte seine Mutter.
»Wegen des Jungen sind wir nicht hier«, sagte einer höhnisch. »Aber ein Laut, und er ist fällig. Und? Welcher von uns soll dich zuerst rannehmen?«
Christopher kämpfte, bis sein Peiniger ihm brutal den Kopf auf den Boden presste. Er lag direkt neben dem Feuer und sah nur zuckende Schatten hinter der orangefarbenen Glut. Aber der heulende Sturm übertönte nicht das Grunzen der Männer, das Stöhnen …
Das Wimmern seiner Mutter.
Zuerst fürchtete er die Blitze. Er wollte kein Licht, wollte die Schlechtigkeit und Gewalt nicht sehen, die diese Männer dem Menschen antaten, der ihm alles bedeutete. Seine Tränen flossen auf den schmutzigen Boden. Sein armseliges Abendessen kroch ihm die Kehle hoch und drohte ihn zu ersticken. Er wollte wegsehen. Sich auflösen. Er wollte sterben. Töten.
»Sieh nicht hin, Spatz«, keuchte seine Mutter.
Aber jetzt sah er hin. Er sah, wie die Männer sie festhielten. Achtete bei jedem Blitz auf die Gesichter der grinsenden und brünstig grunzenden Widerlinge und prägte sie sich ein. Vier waren es.
Zorn hielt ihn gepackt, verstärkt durch die Angst, seine Jugend und die Hilflosigkeit. Seine Seele tobte wie draußen das Gewitter.
Als der Mann, der ihn festhielt, von einem anderen abgelöst wurde, weil er an der Reihe war, riss Christopher sich los. Er stürzte vor, packte den Mistkerl an der Kehle und schlug immer wieder zu, bis der Mann umkippte.
Dann hörte er den schwachen, heiseren Schrei seiner Mutter, ein furchtbarer Schmerz explodierte hinter seinen Augen, und er fiel betäubt zu Boden.
Die Welt drehte sich und schwankte so sehr, dass er sich irgendwo festhalten wollte. Schatten erhoben sich und fielen, verdoppelten sich und legten sich übereinander. Er hörte Donner – oder war es die Tür?
Dann war der Sturm, der heulend am Gebäude zerrte, das einzige Geräusch in seinem pochenden Kopf.
Mutter. Wo war seine Mutter? War sie …
»Christopher?«
Mit übermenschlicher Anstrengung drehte er den Kopf und sah ihren Schatten auf der anderen Seite des verglühenden Feuers. Sie kroch auf den Ellbogen auf ihn zu, schien es aber nicht um die Feuerstelle herum zu schaffen.
Die Angst verjagte das Schwindelgefühl, und mit all seiner Kraft rappelte er sich auf.
»Mum«, krächzte er und stolperte die paar Schritte zu der Stelle hin, wo sie liegen geblieben war.
»Christopher.« In ihrer Stimme, die kaum ein Flüstern war, spiegelte sich sein Entsetzen. »Haben Sie dir wehgetan?«
»Nein, es geht mir gut. Mum, beweg dich nicht. Ich rufe die Wärter.« Er kniete sich neben sie, hatte aber Angst, sie zu berühren.
»Da war ein Messer, Spatz, haben sie …« Sie keuchte ein wenig, als müsste sie zu Atem kommen. »Haben sie dich verletzt?« Ihre Hände, sonst so stark und sicher, huschten leicht wie Federn über sein Gesicht, seine Schultern und den Rest seines Körpers.
»Ein Messer?« Er schüttelte den Kopf. Er konnte noch immer nicht klar denken. »Ich bin nicht verletzt …«
Er spürte etwas Warmes und Klebriges an seinem Knie und fragte sich, ob er nicht doch irgendwo getroffen war. Aber da war kein Schmerz, kein Schnitt. »Sie haben mich nicht verletzt.
Langsam stieg eine furchtbare Erkenntnis in ihm auf.
»Leg noch einen Scheit aufs Feuer, Spatz, es ist so kalt.«
Die warme Flüssigkeit lief an seinem Unterschenkel hinunter, als er rasch zwei kleine Scheite holte und auf die Glut legte. Bevor das Holz Feuer fing, leuchtete noch ein Blitz auf und zeigte ihm den schrecklichsten Anblick der ganzen entsetzlichen Nacht.
Blut. Neben seiner am Boden liegenden Mutter hatte sich eine Lache gebildet. Er schrie um Hilfe, klammerte sich an die Gitterstäbe und starrte in den Gang. Er rief nach jemandem, irgendjemandem. Frauenstimmen antworteten aus der Dunkelheit. Manche besorgt, manche wütend.
Aber niemand erschien.
Der Atem kam stoßweise aus seiner schmalen Brust, als er sich zu seiner geliebten Mutter umdrehte, die nun in den goldenen Schimmer des armseligen Feuers getaucht war.
»Mum.« Er kniete sich auf die Seite, auf der noch kein Blut war, entdeckte aber voller Panik, wie schnell die Lache größer wurde. »Was soll ich tun?«, stöhnte er, heiße Tränen trübten seinen Blick. »Sag mir, was ich tun soll.«
»Oh Spatz, du kannst … nichts tun.« Tränen liefen ihr aus den Augen, aber sie konnte nicht länger die Arme heben, um ihn zu berühren. Sie klang ängstlich, und das schürte seine Verzweiflung noch mehr. Er drückte ihren Kopf an seine Brust, presste sie an sich, als könnte er sie am Leben erhalten, wenn er sie nur fest genug umarmte.
»Geh nicht weg«, bettelte er. Ihm war egal, dass er sich anhörte wie ein kleines Kind. »Es tut mir leid, dass ich nicht still gewesen bin. Es tut mir leid. Ich war so wütend. Ich wusste nichts von dem Messer. Bleib bei mir. Es tut mir leid!«
»Sing mir das Schlaflied, Spatz«, flüsterte sie. »Ich kann dich nicht mehr sehen.«
Seine Kehle war wie zugeschnürt, aber er presste die Worte hervor.
Ganz leise, schlaf ein,
den Traum lass herein.
Von Freiheit und Liebe
und ewigem Frieden.
Seine Mutter lächelte, obwohl ihr jetzt Blut aus dem Mundwinkel lief. Ihre Haut war so kalt. Wächsern. Nur das Blut, in dem er jetzt kniete, war warm. Es umhüllte sie beide.
Du lächelst im Schlaf
und ich halte Wacht …
Seine Stimme stockte, und er schluchzte. Dann wieder. Er konnte nicht weitersingen. Aber das musste er auch nicht.
Sie hustete. Ihre Brust hob und senkte sich wieder. Der letzte Atem fuhr aus ihr heraus und traf heiß auf seine Wange, wie die Worte, die sie nicht mehr sagen konnte. Dann war sie ganz still.
Christopher konnte nichts hören. Jemand schrie. Laute, lange, ohrenbetäubende Schreie der Verzweiflung. Als würde er die Seele aus sich herausschreien. Laut genug, um die Götter zu wecken. Laut genug, um die Missklänge dieses grauenvollen Ortes zu übertönen, den er Zuhause genannt hatte. Lauter als der Sturm und der Donner und das Schweigen seiner toten Mutter.
Christopher wünschte, das Schreien würde aufhören. Aber das tat es nicht. Eine lange Zeit.
Irgendwann erlosch das Feuer. Das Blut auf dem Steinboden wurde kalt, kalt wie Eis. Auch die sterbliche Hülle seiner Mutter wurde kalt. Als die Wärme ihren Körper verließ und sie in seinen zitternden Armen steif und schwer wurde, verließ ihn auch sonst alles Warme. Es war merkwürdig, aber er fühlte dabei nur eine leichte Neugier.
Es fühlte sich an wie … Wasser. Als säße er in einer Pfütze aus Wasser. Da war nur Wasser. Um ihn herum. Unter ihm. Verkrustet auf seiner Haut. Es lief in die Risse im Boden. Nahm die Form an, die es enthielt.
Wasser. Jetzt verstand er es. Er hatte die Lektion gelernt, die Meister Ping ihm hatte beibringen wollen. Hier in der Dunkelheit des Gewitters lernte er wie Wasser zu sein. Geduldig. Rücksichtslos.
Er legte seine Mutter behutsam auf den Boden und stand auf, seine Knie waren weich, als hätte er keine Knochen. Als würde er nicht in seinem Körper wohnen. Sondern außerhalb. Um ihn herum. Wie Wasser.
So viel Wasser auf dem Boden.
Er stand mit dem Gesicht zur Tür, mit einer Miene wie aus Stein, und begann mit den Formen, die sie heute im Regen geübt hatten. Sobald sich die Tür öffnete, würde er zu Meister Ping gehen. Er würde ihm sagen, dass er ihn verstanden habe. Dass er wie Wasser war.
Jetzt konnte Tod von seinen Händen fließen.
1
London 187722 Jahre später
»Ich töte keine Kinder«, teilte Christopher Argent dem Anwalt mit, der ihn anscheinend zu diesem Zweck anheuern wollte. »Und ich liefere sie auch nicht dem Tod aus.«
Sir Gerald Dashforth, Esquire, saß nervös im Sessel an seinem Schreibtisch und sah ständig zu der geschlossenen Tür, als rechnete er jeden Augenblick damit, um Hilfe rufen zu müssen. Der Mann passte zu den teuren Möbeln in seinem Büro in Westminster. Er war zierlich auf eine fast weibliche Art, und sein Gesicht war unangenehm rot. Er betrachtete Argent durch eine Nickelbrille, deren Bügel hinter den für seinen Kopf deutlich zu großen Ohren klemmten.
Argent machte im Geist eine schnelle Bestandsaufnahme dessen, was ihm in der kurzen Zeit, seit er das Büro des Anwalts betreten hatte, aufgefallen war. Der Mann wurde hervorragend bezahlt, gab jedoch mehr aus, als er verdiente. Und er führte seine Geschäfte mit der skrupellosen Verzweiflung eines Mannes, der weit über seine Verhältnisse lebte. Er war anspruchsvoll, eitel, intelligent und gierig bis zur Sittenwidrigkeit. Er hatte sich darauf spezialisiert, Klienten von der Last ihrer heimtückischen Missetaten zu befreien, egal mit welchen Mitteln.
Zum Beispiel, indem er den teuersten Auftragskiller des British Empire anheuerte.
»Ich habe drei unumstößliche Grundsätze, die meine Kunden kennen sollten.« Argent zählte sie an seinen Fingern auf. »Erstens werde ich niemanden bedrohen, verstümmeln, vergewaltigen oder foltern. Ich töte. Nichts weiter. Zweitens lasse ich keine Nachrichten, Hinweise oder Spötteleien für die Polizei oder sonst jemanden zurück, seien sie handgeschrieben oder anderer Natur. Und drittens töte ich keine Kinder.«
Einen Augenblick lang vergaß Dashforth, dass er eigentlich Angst hatte, und seine dünnen, trockenen Lippen verzogen sich zu einem Grinsen. »Ein Auftragsmörder mit Ehrenkodex! Wie drollig.«
»Nicht ganz so drollig wie ein eingefleischter Junggeselle, der Geld bezahlt, um sich an ausländischen kleinen Jungen zu vergehen.« Argent verließ sich keineswegs nur auf seine Menschenkenntnis.
»Wie können Sie es wagen, das zu …«
Argent erhob sich, und dem Anwalt stockte so plötzlich der Atem, dass er sich an seinem eigenen Speichel verschluckte. Es war nicht nur Argents ungewöhnliche Größe, die ihn wieder an seine Angst erinnerte. Es war vor allem sein verwirrendes Erscheinungsbild. Der teure und tadellos sitzende Anzug passte nicht zu der ungehobelten Breite seines Körpers. Die mehrfach gebrochene Nase passte nicht zu den aristokratischen Gesichtszügen. Und die goldenen, mit Diamanten besetzten Manschettenknöpfe schienen unvereinbar mit Händen, die nach jahrelanger Zwangsarbeit so vernarbt und schwielig waren, dass sie unmöglich einem Gentleman gehören konnten.
»Es wird dunkel, Sir Dashforth«, stellte Argent ruhig fest, während der Angesprochene noch immer mit seinem Hustenanfall kämpfte. »Und ich arbeite in der Regel im Dunkeln.« Er wandte sich ab und machte ein paar Schritte auf die Tür zu.
»Warten Sie!«, keuchte Dashforth. Argent drehte sich um. Der Mann presste sich seine zitternde Hand aufs Herz, als wollte er es zwingen, langsamer zu schlagen. »Warten Sie«, wiederholte er. »Mein Auftraggeber will dem Kind nicht schaden, das schwöre ich … Sie müssten nur diese unsägliche Mutter … beseitigen und ihr ein Dokument abnehmen.«
Argent blickte Dashforth an, der sich jetzt hinter vorgehaltener Hand räusperte und sein Halstuch lockerte. »Fahren Sie fort.«
»Solange der Junge nicht zu seinem Vater zurückverfolgt werden kann, ist es nicht von Belang, ob er lebt oder stirbt.«
Argent schloss kurz die Augen. Es war nicht ungewöhnlich, dass ein Mann von Adel versuchte, einen Bastard loszuwerden. Da musste man nur Dorian Blackwell fragen, seinen Arbeitgeber. »Und die Frau?«, fragte er. »Wodurch hat sie den Zorn Ihres Klienten auf sich gezogen?«
»Ist das von Bedeutung?«
»Eigentlich nicht.« Argent schlenderte gelassen zu seinem Platz zurück und setzte sich wieder vorsichtig hin, unsicher, ob der zierliche Stuhl einen Mann seiner Größe wirklich tragen konnte. »Es ist eher von Bedeutung, wie viel Sie mir für diesen Auftrag zahlen.«
Dashforth beugte sich vor, tauchte umständlich seine Feder ein und schrieb eine bemerkenswerte Summe auf ein Blatt Papier. »Das ist mein Auftraggeber zu zahlen bereit.«
Hätte Christopher Argent einen Hang zu Gefühlen oder anderen Regungen gehabt, dann hätte seine Miene jetzt wohl Überraschung ausgedrückt. In der Tat fragte er sich, ob sie das vielleicht tun sollte, und sei es nur, um die menschlichen Gesichtsausdrücke zu benutzen, die er geübt hatte.
»Das ist eine beachtliche Summe«, sagte er ausdruckslos. »Wen soll ich für Ihren Auftraggeber ermorden? Die Queen?«
Dashforths Augen weiteten sich hinter den Brillengläsern. Zuerst bei dem Wort »ermorden«, dann noch etwas mehr bei der Erwähnung der Monarchin und demzufolge der Andeutung von Hochverrat. »Haben Sie von Millicent LeCour gehört?«, fragte er hastig.
»Wer hat das nicht?«
»London mag sie lieben, aber sie ist eine verräterische Schlange.«
»Ist das so?«, fragte Argent zerstreut, während er auf die vielen Nullen blickte und ein paar schnelle Rechnungen anstellte.
»Millie LeCour ist nicht nur auf der Bühne eine Schauspielerin«, fuhr Dashforth fort. »Sie ist eine Diebin, eine Prostituierte und eine Erpresserin, und das zwingt meinen Klienten zum Handeln.«
Argent stand wieder auf, zerknüllte das Blatt und warf es ins Feuer. »Ich bekomme die Hälfte der Bezahlung im Voraus. Sobald der Auftrag erledigt ist, komme ich wieder und hole mir den Rest.«
Dashforth erhob sich ebenfalls und stützte sich kurz auf den Schreibtisch, bevor er sich zu dem Tresor in einer Ecke des Raums begab. Obwohl die goldene Einstellscheibe glänzte und der Tresor teuer und neu war, wirkte das klobige Möbelstück in dem verspielt eingerichteten Raum so fehl am Platz wie Argent.
Der Anwalt entnahm dem Tresor eine lederne Tasche, kehrte zum Schreibtisch zurück und schob sie Argent zu. »Das ist mehr als die Hälfte. Millie LeCour spielt übermorgen die Desdemona in einer Vorstellung von Othello in Covent Garden.«
»Ich weiß.« Argent öffnete die Tasche, holte die Banknoten heraus und zählte sie.
»Sie ist ständig von Menschen umgeben«, fuhr der Anwalt fort. »Aber wir wissen, dass sie in der Bow Street, nicht weit vom Theater, eine Wohnung hat. Dort ist auch das Kind.«
Dashforth fuhr zusammen, als Argent den Verschluss der Tasche zuschnappen ließ. »Ich führe meine Erkundungen selbst durch. In drei Tagen, wenn der Auftrag ausgeführt ist, setze ich mich wieder mit Ihnen in Verbindung.«
»Sehr gut.« Dashforth hielt ihm die Hand hin, aber Argent betrachtete sie nur, bevor er mit großen Schritten zur Tür ging und seinen Mantel vom Garderobenständer nahm.
»Lassen Sie sich nicht von ihr täuschen«, rief der Anwalt ihm nach. »Nicht ohne Grund ist sie die beste Schauspielerin Londons. Diese Gossenhure ist auf ihrem Weg an die Spitze über Leichen gegangen. Die Frau verdient den schnellen Tod nicht, den sie durch Ihre Hände finden wird, und – machen Sie keinen Fehler. Sie mag unfassbar schön sein, aber sie ist völlig gefühllos und kennt keine Skrupel.«
»Anscheinend habe ich einiges mit ihr gemeinsam«, gab Christopher zurück. »Nur dass ich wahrscheinlich über deutlich mehr Leichen gegangen bin.«
Millie LeCour kniff leicht die Augen zusammen, um ihn hinter der Bühnenbeleuchtung im Zuschauerraum zu entdecken. Er war nicht schwer zu finden. Zwar war er in das Halbdunkel gehüllt, das das Publikum umgab, aber sie konnte seine geheimnisvolle und starke Anziehungskraft spüren.
Es gab zweitausendzweihundertsechsundzwanzig Plätze in Covent Garden, und jeder einzelne war besetzt. Aber sobald Millie den ungehobelt aussehenden Gentleman in dem makellosen Anzug entdeckt hatte, hätte er genauso gut der einzige Mensch im Publikum sein können. Eigentlich fand sie, dass er eher wie eine Figur aus einer von Shakespeares gewaltsameren Tragödien wirkte, als wie ein kultivierter Theatergast. Irgendetwas an seiner Gegenwart erregte sie und machte sie gleichzeitig nervös.
Die Scheinwerfer wurden jetzt von einem Bühnengehilfen so reguliert, dass nur noch Jago und Rodrigo im Licht standen, die sich auf der Bühne über ihre angebliche Verfehlung ausließen. Wenn sie den karminroten Vorhang nur ein wenig zur Seite schob, konnte sie die ersten drei Logen in jedem Rang erkennen, ohne dass sie selbst zu sehen war.
»Nervös?« Jane Grenn, die die Emilia spielte, legte das Kinn auf Millies Schulter und blickte in die Menge. Es kitzelte, als ihre goldenen Locken sich mit Millies dunklen mischten.
»Nein.« Millie hakte sich bei ihrer Freundin unter, wandte den Blick aber nicht ab von dem faszinierenden Mann im Halbdunkel, der sich die ganze Zeit, in der sie ihn beobachtet hatte, kein bisschen bewegt hatte.
»Wirklich? Nicht einmal bei deiner Premiere in Covent Garden?«
»Na gut, ich bin gelähmt vor Angst«, gab sie flüsternd zu. »Das ist der wichtigste Abend meines Lebens, und das Publikum wirkt so ruhig. Und wenn es ein Reinfall wird?«
Jane schlang die Arme um Millies Taille und drückte sie aufmunternd. »Sie warten nur atemlos darauf, dass die großartige Millie LeCour endlich die Bühne betritt.«
»Ach, komm.« Millie winkte bescheiden ab. »Sie sind hier, um ein Shakespeare-Stück zu sehen.«
Janes nicht sehr damenhaftes Schnauben kitzelte sie im Ohr. »Othello ist sonst nie ausverkauft, vertrau mir. Sie sind nur wegen Desdemona hier.«
»Vielleicht wollen sie aber auch Rynd als Othello sehen.« Millie deutete auf den kräftigen Schauspieler mit der kaffeebraunen Haut, dessen tiefe Stimme jede Dame im Publikum erschaudern ließ – ob sie es zugeben mochte oder nicht. Das goldene Licht schimmerte auf seinen ausgeprägten Wangenknochen und erhellte seine blendend weißen Zähne. Er strahlte etwas so Sinnlich-Exotisches aus, als wäre er der Mohr von Venedig höchstpersönlich, und wenn sie mit ihm auf der Bühne stand, reagierte selbst ihr Körper auf das unverschämte Funkeln in seinen dunklen Augen.
»Alle wollen unbedingt wissen, ob er so gut bestückt ist, wie man allgemein behauptet. Ist er es?«
Millie schlug sich entsetzt die Hand vor den Mund und trat rasch vom Vorhang zurück. Das Publikum durfte sie auf keinen Fall so sehen. »Woher soll ich das wissen!«, flüsterte sie Jane zu und schlug mit gespielter Empörung nach ihr.
»Jetzt zier dich nicht so.« Jane kicherte. »Jeder weiß, dass du mit ihm ins Bett gehst. Warum sonst hättest du Lord Phillip Eastons Angebot, dich auszuhalten, ausschlagen sollen.«
»Sei bloß still«, warnte Millie sie. »Es gibt genügend andere Gründe, Lord Eastons Angebot nicht anzunehmen, und die gehen dich nichts an. Außerdem ist Rynd mit dieser wundervollen Frau verheiratet. Ming.«
Jane zog die Nase kraus. »Verheiratet zu sein, hält kaum jemanden davon ab, auch mal an fremde Türen zu klopfen. Und Ming ist zwar ein Schatz, aber ich habe gehört, mit denen stimmt da unten etwas nicht.« Sie deutete diskret zwischen ihre Beine. »Es liegt quer oder so.«
»Das ist doch nur böses Geschwätz«, sagte Millie. »Also wirklich, Jane.«
»Woher willst du das wissen? Hast du je eine gesehen?«
»Nein, aber es sind Menschen. Und wir sind alle ziemlich gleich gebaut. Ich werde das nicht weiter mit dir erörtern.« Millie schlich sich so nah, wie sie wagte, an den Vorhang heran und passte gut auf, keinem der Schauspieler, die das nachgestellte Venedig bevölkerten, beim Auftritt oder Abgang im Weg zu sein.
»Für wen spielst du heute?«, fragte Jane. Sie legte ihr Kinn wieder auf Millies Schulter und blickte in die Dunkelheit des Zuschauerraums. Damit meinte sie Millies Gewohnheit, sich jemanden in der Menge zu suchen und ihren Text nur für diese Person zu sprechen. Natürlich spielte sie für das gesamte Publikum, aber durch die Vorstellung, mit einem ausgewählten Zuschauer besonders verbunden zu sein, konnte sie irgendwie mehr Gefühl und Leidenschaft in ihr Spiel legen. Es half ihr sogar, sich wieder zurechtzufinden, wenn sie einmal den Faden verlor. Sie schrieb ihren Erfolg zu einem großen Teil dieser Technik zu und vergaß niemals, sich einen besonderen Zuschauer auszusuchen, bevor die Vorstellung begann.
»Siehst du den Mann in der zweiten Loge im zweiten Rang?« Sie deutete auf die einsame Gestalt.
»Mein Gott, er muss ein Riese sein«, staunte Jane. »Den findet man in jeder Menge wieder.«
»In der Tat, und seine Augen sind so unglaublich blau, dass ich sie von der Bühne aus sehen konnte, als das Licht im Zuschauerraum noch nicht abgedunkelt war.«
»Er macht Rynd also Konkurrenz!« Jane stieß ihr mit dem Ellbogen in die Rippen.
Millie stieß zurück. »Unsinn. Vor allem, nachdem wir gerade festgestellt haben, dass zwischen mir und Rynd rein gar nichts läuft.«
Jane strich sich das Haar glatt und zwinkerte Millie zu. »Von wegen. Man muss euch nur zusammen auf der Bühne sehen und weiß genau, wie heiß es bei euch im Bett zugeht, du Glückliche.« Jetzt kam Janes Einsatz, und sie betrat die Bühne, bevor Millie etwas erwidern konnte.
»Man nennt es schauspielern!«, murmelte Millie leise. Rynd war ein unglaublich gut aussehender Mann und immer nett, das stimmte, aber er war auch selbstverliebt und aufgeblasen. Wahrscheinlich würde ihr das niemand glauben, aber Millie mochte lieber ruhige und höfliche Männer. Zurückhaltend und klug. Nachsichtig. Geduldig. Gutmütig.
Ungefährlich.
Sie blickte wieder zu ihrem Schattenmann hinüber. Obwohl er den Hut abgesetzt hatte, war er größer als die meisten. Und still. Unwahrscheinlich reglos. Plötzlich überkam sie ein merkwürdiges Gefühl, und die feinen Härchen in ihrem Nacken stellten sich auf. Sie fragte sich, ob diese Augen – hell und kalt wie ein Winterhimmel – sie gerade ansahen. Allein die Vorstellung weckte eine sündhafte Regung in ihrem Unterleib, begleitet von einer köstlichen Unruhe.
Sie wusste ja nichts von ihm, aber irgendwie schien er ihr weder zurückhaltend noch ungefährlich zu sein. Diese konzentrierte Regungslosigkeit hatte etwas Beängstigendes. Unwillkürlich trat sie einen Schritt zurück und musste gleichzeitig daran denken, dass ihr Bett mit mitternachtsblauem Satin bezogen war und diese Augen darin leuchten würden wie kristallklare Sterne in einer dunklen Nacht.
Ihr stockte der Atem, und sie erschauderte, dann unterdrückte sie die Empfindung. Sie durfte sich so etwas noch nicht einmal vorstellen, anderen Menschen auf keinen Fall zu nah kommen, mit einer Ausnahme. Eine Ehe, selbst eine Affäre, war völlig ausgeschlossen.
Ihr Geheimnis war einfach zu gefährlich.
2
Erkundungen,beantwortete Argent seine eigene Frage, was er um Mitternacht in diesem Club wollte. Er stellte Erkundungen an. Der Sapphire Room war eigentlich nur ein Labyrinth aus dunklen Nischen und Privatzimmern, die um einen Ballsaal herum gruppiert waren, und alle Räume waren vollgestellt mit Polstermöbeln, auf denen die Gäste sich niederlassen konnten.
Die Stimmen der schon ziemlich alkoholisierten Gäste, die sich unter den Kristalllüstern drängelten, übertönten beinahe die Musik. Alles glitzerte. Von den Kleidern der tanzenden Damen über ihre komplizierten Frisuren bis hin zum Champagner, alles funkelte und blitzte wie Sternschnuppen in dem neuen elektrischen Licht des Sapphire Room.
Christopher musste eine Grimasse unterdrücken, als das hohe, gekünstelte Lachen einer Frau fast sein Trommelfell durchbohrte. Er hatte nie verstanden, warum Menschen Heiterkeit oder Vergnügen vortäuschten. Als könnten sie das Glück erzwingen, wenn sie nur laut genug lachten. Als wäre ihr unwürdiges Leben weniger bedeutungslos, wenn sie die Stille ihrer leeren Existenz in genügend Champagner und Gelächter ertränkten.
Was für Narren.
In Augenblicken wie diesem schätzte Christopher seine ungewöhnliche Größe, da er die Menge problemlos überblicken konnte, um sein Opfer darin zu erspähen. Es dürfte nicht schwierig sein, Millie LeCour hier zu finden. Ihr Haar hatte einen ungewöhnlichen Ebenholzton. Und ihre Augen, obwohl auch sie fast schwarz waren, leuchteten mit einer Lebendigkeit, die ihn an geschliffenen Obsidian erinnerten.
Diese Augen. Er hatte das Leben aus ihnen entweichen sehen, als Othello sie mit seinen großen, dunklen Händen erwürgt hatte. Hoch oben, allein in seiner Loge, hatte Argent den Atem angehalten, als das Licht, das die Szene beleuchtete, die ganz London fesselte, schwand und schließlich erlosch und tosender Applaus einsetzte.
Dann hatte er das Geländer der Loge gepackt und sich vorgebeugt. Er hatte ihr stumm befohlen, aufzuwachen. Fragte sich wirklich, ob er nicht gerade zugesehen hatte, wie jemand anders seinen Mordauftrag ausgeführt hatte, vor einem Publikum von Hunderten von Menschen.
Argent hatte den echten Tod unzählige Male gesehen, aber diese Frau hatte das Verlöschen des Lebens so überzeugend dargestellt, dass er erst aufatmete, als sich der Vorhang zum Applaus hob. Da war sie, mit einem Lächeln, das strahlender war als die kristallenen Lüster des Theaters.
Erst dann hatte er sich wieder in den Sessel sinken lassen.
Millie LeCour hatte sich ihm zugewandt, die Hände zusammengelegt und auf das Anmutigste geknickst. Ihre Augen hatten vor ungeweinten Tränen geglänzt. Lebendig. Mehr als lebendig. Voller Leben. Berstend vor Leben. Sie warf eine Kusshand in die Menge. Und dann, er hätte es schwören können, warf sie auch ihm eine zu.
Sie war glücklich gewesen. Er hatte genügend menschliche Regungen beobachtet, um das Gefühl zu erkennen. Ein wahrhaft erhabenes Leuchten. Und als sie zu den Logen hinaufwinkte, seiner Loge, und ihm dieses frohe, strahlende Lächeln schenkte, hatte er den merkwürdigen Impuls empfunden, es zu erwidern.
Das hatte ihn beunruhigt. Er war verwirrt und hatte den abwegigen Drang verspürt, sich zu bewegen. Er hatte die Hände zu Fäusten geballt und wieder ausgestreckt. Hatte die Kiefer zusammengepresst. Sein Herzschlag hatte sich ebenso wie sein Atem beschleunigt. Und es lag ein Druck auf seiner Brust, der immer schwerer wurde.
Zuerst hatte er einen Gehirnschlag in Betracht gezogen. Doch nun war er davon überzeugt, dass es sich um etwas völlig anderes handelte.
Er … er hatte etwas gefühlt. Und nicht nur das – das Phänomen hatte nicht nachgelassen.
Zum ersten Mal seit über zwanzig Jahren war er das Opfer eines Gefühls geworden. Obwohl er geglaubt hatte, es für immer hinter sich gelassen zu haben.
Selbst jetzt noch durchforschte er die Menge nach ihrem Anblick mit einem überwältigenden Gefühl von … er konnte es nur Vorfreude nennen. Nicht auf den Akt der Gewalt, die er ihr antun würde, sondern auf einen Blick aus ihren dunklen, faszinierenden Augen.
Kopfschüttelnd verzog er das Gesicht. Er nahm schweigend seinen Posten am hinteren Ende des Raums ein und hoffte, die merkwürdige Empfindung würde verfliegen. Es war unmöglich, dass sie eine solche Wirkung auf ihn hatte. Was war sie für ein Mensch? Dashforth zufolge war Millie LeCour eitel und eine Blenderin. Eine Lügnerin und Erpresserin, deren letzte Stunde geschlagen hatte. Und sie hatte private Zimmer in der Bow Street. Mehr brauchte Argent für seinen Auftrag nicht zu wissen.
Oder?
Warum lungerte er dann hier mitten unter diesen gewöhnlichen Menschen herum wie eine Schlange in einem Mäusekäfig?
Ach ja. Erkundungen. Das sollte er lieber nicht vergessen.
Ein Murmeln des Entzückens ging durch die Menge, gefolgt von Applaus. Alle blickten zum Eingang.
Im ersten Moment dachte Argent, dass Millie LeCours Teint auch im Tod nicht heller und durchscheinender aussehen könnte. Sein zweiter Gedanke war, dass das rot-weiß gestreifte Kleid ihre Blässe so sehr betonte, dass man unwillkürlich an Gräfin Bathory denken musste – eine Dame, die berühmt dafür war, im Blut jungfräulicher Bauerntöchter zu baden, um das jugendlich frische Aussehen ihrer Haut zu erhalten.
Ihr Lächeln strahlte im wahrsten Sinne des Wortes, und Argent ertappte sich dabei, dass er eine Hand auf die Brust presste. Da war es wieder. Dieser merkwürdig kleine Ruck hinter seinen Rippen. Genau den hatte er gespürt, als sie ihm von der Bühne aus zugelächelt hatte. Ein Schreck. Eine Wahrnehmung, die warm und vielleicht mit einem Hauch von Erregung durch seine Nervenbahnen unter der Haut fuhr.
Wenn sie diese Gräfin Bathory war, dann war er heute Nacht vielleicht Drakula, der Untote, der nur durch seinen unstillbaren Hunger nach Blut nicht starb. Zwar brauchte er den roten Saft nicht, um seinen Körper zu nähren wie der Vampir, aber er war trotzdem lebensnotwendig für ihn.
Er verdiente sein Brot durch Blutvergießen.
Lächelnd ließ Millie LeCour ihren geckenhaften Begleiter los und versank in einen Knicks oben auf der Treppe, bevor sie zu ihrem jubelnden Publikum hinabstieg. Sie spitzte die roten Lippen, um eine ganze Flut von Luftküssen zu empfangen und zu erwidern.
Sie strahlte heller als alle Juwelen, die im Sapphire Room zur Schau gestellt wurden. Christopher hatte schon häufiger erlebt, dass Männer ihrer weiblichen Begleitung abgegriffene Komplimente machten. So sagten sie auch, sie würde den Raum zum Leuchten bringen. Bisher hatte es ihn irritiert, dass man einen so albernen Gedanken als schmeichelhaft auffassen könnte.
Aber jetzt …
Der Raum, der eben noch zu warm gewesen war und stickig von den Ausdünstungen der gedrängt stehenden und sich der Genusssucht hingebenden Menschen, erglühte jetzt in dem Strahlen, das von ihrer fast durchscheinenden Haut ausging.
Objektiv gesehen war es ein Jammer, der Welt eine solche Schönheit zu rauben. Ein solches Talent. Auch wenn ihr Lächeln vielleicht nur eine Illusion war und ihre Liebenswürdigkeit nichts weiter als ein Trick. Durch ihren Verlust würde die Menschheit der Mittelmäßigkeit ein ganzes Stück näher kommen.
Er würde sich trotzdem nicht aufhalten lassen. Wenn er seinen Auftrag ausführte, würde sie den nächsten Tag nicht mehr erleben. Wahrscheinlich konnte er es sogar hier erledigen. Er musste sie nur in einen Winkel lotsen, ihr den hübschen Hals umdrehen, den leblosen Körper auf einer Chaiselongue drapieren und verschwinden, bevor Alarm geschlagen wurde.
Er würde mit ihr flirten müssen. Sie in die Dunkelheit locken, in sein Reich. Als ein Geschöpf des Scheinwerferlichts wäre sie dort verletzlich. Wehrlos.
Das hätte ihn eigentlich nicht erregen dürfen, aber er musste zugeben, dass die Vorstellung, Millie LeCour in einer dunklen Ecke für sich allein zu haben, ein ganz anderes Verlangen weckte, als das, sie zu töten.
Ein gefährliches Verlangen. Für ihn gefährlich.
Obwohl er von vielen Menschen umgeben war, sah Millie ihn sofort. Ihr Kopf fuhr hoch, als hätten seine Gedanken das Raunen der Menge übertönt.
Allerdings war Argent sich sicher, dass sie nichts von seinen Absichten ahnte. Ihre Augen waren warm und voller Freude, als sie ihn bemerkte.
Sie entschuldigte sich bei ihren Bewunderern und drängelte sich durch die Menge, während das Orchester wieder zu spielen begann. Direkt vor ihm blieb sie stehen. Aller Augen waren auf sie gerichtet, aber entweder nahm sie es gar nicht wahr, oder es war ihr egal.
»Ich habe Sie tatsächlich gefunden«, sagte sie und lächelte kokett.
Argent hatte keine Ahnung, wovon sie sprach. Wusste sie, weshalb er hier war? Hatte jemand sie gewarnt, dass ihr Leben in Gefahr war? Vielleicht war sie so furcht- und gefühllos wie er selbst. Frei und ohne emotionale Fesseln.
Es änderte trotzdem nichts.
»Aber ich bin es doch, der Sie gefunden hat, Miss LeCour.«
Und ich bin es, der Sie töten wird.
Millie konnte ihr Glück kaum fassen. Hier war er, ihr auserwählter Zuschauer. Bisher hatte sie nie das Vergnügen gehabt, einen von ihnen kennenzulernen. Und gerade diesen Mann kennenzulernen, war ein besonders unerwartetes Vergnügen. Hatte auch er die sonderbare, spannungsgeladene Verbindung gespürt, die sie von der Bühne aus wahrgenommen hatte?
Das wäre so unglaublich romantisch!
»Ich dachte, dies sei eine private Feier, Mr …« Erwartungsvoll sah sie ihn an und hielt ihm die Hand hin.
»Drummle«, antwortete er, nahm ihre Hand und beugte sich darüber, küsste sie jedoch nicht. »Bentley Drummle.«
Millie konnte ein kurzes Lachen nicht unterdrücken.
»Mein Name amüsiert Sie?«
Alles an ihm amüsierte sie.
»Nein, gar nicht«, sagte sie rasch. »Sie sehen nur gar nicht aus wie ein Bentley.«
»Nein? Und welchen Namen würden Sie für angemessen halten?«
Millie betrachtete ihn mit wachsendem Interesse, konnte seine Frage aber aus irgendeinem Grund nicht beantworten. Er sah nicht so aus, als trüge er einen normalen englischen Namen. Er war so ganz anders als die schlanken, eleganten und modisch gekleideten Salonlöwen, denen sie sonst auf diesen Partys vorgestellt wurde. Nein, mit seinen vollen Locken in diesem ungewöhnlichen Rot, den erstaunlich blauen Augen und dem beeindruckenden Körperbau schien er auf ein keltisches Schlachtfeld zu gehören, wo er sein Breitschwert gegen angelsächsische Eindringlinge schwang. Obwohl sein anziehendes Gesicht entspannt war und er freundlich wirkte, schien ihn etwas Gefährliches zu umgeben. Etwas … sie konnte es nicht genau sagen. Es war keine Brutalität oder Wut. Und es war auch nicht falsch oder unausgewogen. Lag es vielleicht daran, dass sein Lächeln nicht bis zu den blauen Augen vordrang?
Diese Augen betrachtete sie jetzt forschend, und ein wenig verblasste ihr eigenes Lächeln dabei. Seine Augen waren wie Eis, und das lag nicht nur an der Farbe. Die Kälte eines Gletschers ging von ihnen aus. Charme und Liebenswürdigkeit zeigten sich warm im leichten Lächeln des harten Mundes, aber in diese Augen zu blicken war, als starrte man über die weite, arktische Tundra. Trostlos und leer.
Plötzlich wurde sie nervös und, um ehrlich zu sein, mehr als nur etwas neugierig. »Ich fürchte, mir fällt im Moment nichts ein«, gab sie zu, überrascht, wie atemlos sie klang, als sie ihm ihre Hand entzog.
Er schien fast drohend über ihr aufzuragen, obwohl er sich absichtlich harmlos gab. Ein Wolf im Schafspelz? Trotz seiner hellen Haut und Augen ging etwas Dunkles von ihm aus. Als habe er seine Schatten immer dabei, falls er ihren Schutz brauchte.
Wobei es wohl eher so war, dass andere vor ihm Schutz suchen mussten. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken, obwohl ihr an anderen Stellen ziemlich heiß wurde. Stellen, die sie geflissentlich zu ignorieren versuchte.
»Wie kam es noch gleich, dass Sie hier sind?«, fragte sie.
Jetzt wirkte er verlegen, was zu dem harten Gesicht nicht recht zu passen schien. »Die Freundin eines Freundes hat mich eingeladen. Ich habe ihren Namen vergessen. Eher groß, blond. Jünger als sie aussieht, aber älter als sie behauptet.« Er zwinkerte ihr zu, um seine Augen bildeten sich liebenswerte Fältchen. Noch kein Lächeln, aber die Verheißung eines Lächelns.
»Ah, meinen Sie Gertrude?«, fragte sie.
»Genau.« Er nickte, dann blickte er in die Menge, als würde er sich nach der besagten Dame umsehen. »Wir haben einen gemeinsamen Bekannten namens Richard Swiveller, kennen Sie ihn vielleicht?«
Millie schüttelte den Kopf. »Ich fürchte nein.«
Er hob die gigantische Schulter, die in einem teuren Abendjackett steckte. »Das macht nichts. Diese privaten Partys sind nie sehr intim, nicht wahr?«
Millie sah sich kurz um und betrachtete die etwa hundert Gäste in ihren verschiedenen Stadien der Trunkenheit. »Das hängt wahrscheinlich davon ab, was Sie darunter verstehen«, bemerkte sie trocken.
Da war wieder dieser belustigte Ton. Es kam tief aus seiner breiten Brust und passte eher in einen Dschungel als in einen englischen Ballsaal.
»Würden Sie einen Walzer mit mir tanzen, Miss LeCour?« Er trat näher, fast zu nah, und überragte sie wie eine Mauer aus Hitze und Muskeln.
Millie zögerte. Nicht weil sie Angst hatte, sondern weil sie nicht glaubte, dass ein Mann dieser Statur und – sie blickte nach unten – mit so großen Füßen einen halbwegs anständigen Walzer aufs Parkett legen konnte.
Es stand zu befürchten, dass er ihr die Füße brach, wenn er nur ein einziges Mal darauf trat.
»Ich werde vorsichtig sein«, murmelte er. Anscheinend hatte er ihre Gedanken gelesen.
Sie hob den Kopf und sah in diese beunruhigenden Augen. Da. Vielleicht kein ganzes Gefühl, keine wirkliche Emotion, aber doch ein Schimmer davon. Von Freude … oder Bedauern, sie war sich nicht sicher.
Himmel, dieser Mann war wirklich faszinierend.
»Das sollten Sie«, neckte sie ihn. »Wenn ich nicht laufen kann, kann ich auch nicht spielen, Mr Drummle. Ich fürchte, ich bin Ihnen hilflos ausgeliefert.«
»Das sind Sie.« Er nahm ihre behandschuhte Hand in seine – sie verschwand fast darin – und führte sie auf die Tanzfläche. Sie wartete auf eine Lücke zwischen den sich drehenden Paaren und erschrak beinah, als er sie plötzlich mit sich zog und in seinen mächtigen Armen herumwirbelte.
Ihr war sofort klar, dass ihre Befürchtungen hinsichtlich seiner Tanzkünste völlig unbegründet gewesen waren. Er war wahrscheinlich der anmutigste und gewandteste Tänzer im ganzen Saal – und vielleicht sogar in jedem Ballsaal der Stadt. Er hatte sie sehr eng an sich gezogen, skandalös eng, und die Hand auf ihrem Rücken war wie eine eiserne Klammer. Sie spürte die Wärme dieser Hand durch das Kleid und das Korsett, als würde er sie brandmarken. Die andere Hand, mit der er ihre Rechte hielt, war sanft, aber ebenso warm.
Die Muskeln unter seinem Jackett waren noch härter, als sie gedacht hatte. Millie spürte die Bewegungen dieser Muskeln und war wie verzaubert. So sehr, dass sie stolperte und bei einer Umdrehung den Halt verlor.
Rasch zog er sie noch enger an sich, und sie fand problemlos wieder in die Schrittfolge hinein, während er sie mit der Kraft seines unglaublichen Körpers stützte. Als sie wieder im Takt war, warf sie ihm einen dankbaren Blick zu.
»Ich hätte mir wohl eher über meine Füße Gedanken machen müssen, Miss LeCour.«
Sie musste lachen und legte kurz die Stirn an seine Schulter. Ihr Herz schlug schneller im Tempo des Walzers, und sie spürte die Aufregung, die sie durchströmte. Vielleicht waren ihre Bedenken ihm gegenüber ebenso unbegründet, wie ihre Sorge über seine Tanzkünste.
»Womit beschäftigen Sie sich denn so, Mr Drummle?«
»Ich bin Partner in einem Unternehmen«, gab er zurück.
»Habe ich davon gehört?«
»Höchstwahrscheinlich. Meine Partner kümmern sich um das tägliche Geschäft, Besprechungen, Käufe, Zusammenschlüsse und so weiter. Ich habe mit Verträgen, Schadensfällen und … Personalfragen zu tun.«
»Oh«, flirtete sie. »Es klingt, als seien Sie ein wichtiger Mann. Erzählen Sie mir mehr darüber.« Sie griff oft auf diesen Trick zurück. Männer redeten so gern über sich selbst. Diesmal war sie allerdings wirklich neugierig. Wollte wissen, wie er seine Tage verbrachte. Seine Nächte.
Und mit wem.
»Es ist langweilig und alltäglich im Vergleich zu dem, was Sie tun.« Millie spürte mehr, als sie sah, dass er den Kopf zu ihr herabbeugte. Der Lärm, die ganze Atmosphäre des Sapphire Room waren plötzlich ausgeblendet. Alles schien dunkler zu werden. Näher zu kommen. Ihre Füße tanzten auf Schatten, und ihre Körper verschmolzen in einem perfekten Rhythmus, der sich sinnlich anfühlte. Sündig fast.
Sein Duft umhüllte sie, ein warmer, männlicher Duft nach Zedernholz, Rasierseife und etwas Dunklem, Wildem. Er roch nach Gefahr und Sex. Nach Sex, der einen für immer zeichnete. In Ekstase gestöhnte Obszönitäten, Kopfbretter von Betten, die gegen dünne Wände schlugen, wie sie es damals gehört hatte, bevor sie sich eigene Räume hatte leisten können.
Sie legte den Kopf zurück und wollte ihm einladend in die Augen sehen, aber ihr Blick kam nicht so weit. Er blieb an seinen Lippen hängen. So weiche Lippen in dem so harten, maskulinen Gesicht.
Diese Lippen würden sie in der Tat zeichnen. Die rötlichen Bartstoppeln würden über ihre Haut kratzen und über jeden Teil ihres Körpers, den sie vor ihm entblößte.
»Ich glaube«, flüsterte sie, zum zweiten Mal in seiner Gegenwart atemlos. »Ich glaube, Sie wollen mich küssen, Mr Drummle.«
Als Antwort kam nicht die geistreiche Bemerkung, mit der sie gerechnet hatte. So schnell er sie auf die Tanzfläche befördert hatte, so schnell holte er sie auch wieder herunter. Die Menge wich vor ihnen zurück, Künstler und Schauspieler mischten sich mit niederem Adel und wohlhabenden Händlern. Menschen, die Geld, Macht und Einfluss besaßen, aber nicht von der strengen gesellschaftlichen Moral der oberen Schichten eingeschränkt wurden.
Alle blickten ihnen nach, als sie den Saal verließen. Millie war daran gewöhnt. Seit sie so berühmt war, starrte man sie überall an, diesmal allerdings hatte sie das merkwürdige Gefühl, dass nicht sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand.
Je tiefer sie sich in die Räumlichkeiten zurückzogen, desto dunkler und zwielichtiger wurde es. In einem düsteren Winkel des Flurs umarmten sich zwei Frauen voller Leidenschaft, eine hatte den schönen Kopf an den Hals der anderen gepresst. Es lag Verzweiflung in ihrer Leidenschaft, geboren aus dem ungestillten Verlangen, das ihnen zu lange verwehrt worden war.