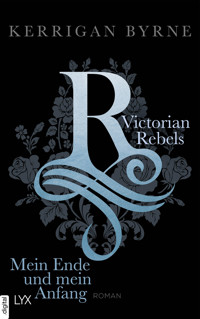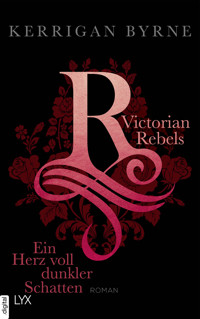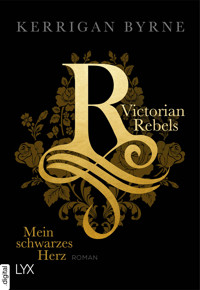4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Victorian Devils
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein gefährlicher Duke und eine Lady, die es gerne mit ihm aufnimmt …
Die Victorian Romance von Kerrigan Byrne voller Leidenschaft und Intrigen
Lady Alexandra Lane ist eine starke, unabhängige und kluge junge Frau. Doch als ein Erpresser droht, ihr dunkles Geheimnis zu lüften, ist Alex gezwungen, diesen für sein Schweigen zu bezahlen. Nun steht ihre Familie kurz vor dem Bankrott. Um den bevorstehenden Ruin zu verhindern, trifft Alex eine Entscheidung: Sie wird den wohlhabenden und in Verruf geratenen Duke of Redmayne heiraten.
Piers Gedrick Atherton, der Duke of Redmayne, hat nur eines im Sinn: Rache an seiner ehemaligen Verlobten. Doch dann tritt die schöne Alexandra in sein Leben, und obwohl dem Duke bewusst ist, dass diese nur ihre eigenen Ziele verfolgt, ist er der willensstarken Lady vom ersten Moment an verfallen. Werden die beiden zueinander finden oder steht ihnen ihre tragische Vergangenheit im Weg?
Erste Leser:innenstimmen
„Romantisch und spannend zugleich, eine höchst fesselnde Mischung!“
„Vor allem die starken Charaktere und die leidenschaftliche Liebesgeschichte haben mich überzeugt.“
„Tiefgründiger, bewegender, aber durch und durch unterhaltsamer historischer Liebesroman.“
„Fans von Regency und Victorian Romances werden auf ihre Kosten kommen!“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 649
Ähnliche
Über dieses E-Book
Lady Alexandra Lane ist eine starke, unabhängige und kluge junge Frau. Doch als ein Erpresser droht, ihr dunkles Geheimnis zu lüften, ist Alex gezwungen, diesen für sein Schweigen zu bezahlen. Nun steht ihre Familie kurz vor dem Bankrott. Um den bevorstehenden Ruin zu verhindern, trifft Alex eine Entscheidung: Sie wird den wohlhabenden und in Verruf geratenen Duke of Redmayne heiraten.
Piers Gedrick Atherton, der Duke of Redmayne, hat nur eines im Sinn: Rache an seiner ehemaligen Verlobten. Doch dann tritt die schöne Alexandra in sein Leben, und obwohl dem Duke bewusst ist, dass diese nur ihre eigenen Ziele verfolgt, ist er der willensstarken Lady vom ersten Moment an verfallen. Werden die beiden zueinander finden oder steht ihnen ihre tragische Vergangenheit im Weg?
Impressum
Deutsche Erstausgabe April 2022
Copyright © 2023 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-98637-510-2
Copyright © 2019 by Kerrigan Byrne Titel des englischen Originals: How to Love a Duke in Ten Days
Published by arrangement with St. Martin’s Publishing Group. All rights reserved.
Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Publishing Group durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.
Übersetzt von: Nadine Erler Covergestaltung: Anne Gebhardt unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com: © Phatthanit stock.adobe.com: © pozdeevvs , © Lotharingia periodimages.com: © Maria Chronis, VJ Dunraven Productions, PeriodImages.com Korrektorat: Susanne Meier
E-Book-Version 27.02.2023, 15:00:17.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
YouTube
Gefährliches Spiel mit dem Duke
Für alle Überlebenden
#metoo
Danksagung
Seit ich angefangen habe, meinen Traum von einem Leben als Schriftstellerin zu verwirklichen, hatte ich das Glück, einen Stamm von wahrhaft unglaublichen Frauen um mich zu haben, die mich auf diesem Weg begleiten. Früher dachte ich immer, dass diese felsenfesten, wunderbaren Freundschaften unter Frauen selten und kostbar seien. Und sie sind kostbar, aber ich lag falsch, als ich dachte, sie seien selten.
Im Laufe der Geschichte haben Frauen einander unterstützt, erhöht, beschützt und geliebt. Unsere genaue Definition des Wortes Stamm hat sich vielleicht geändert, doch nicht das, was wir damit verbinden. Wir brauchen unseren Stamm, um zu überleben. Und wenn ich die wunderbaren Veränderungen sehe, die durch und für Frauen geschehen, bin ich froh, eine Augenzeugin all dessen zu sein.
Danke, meine Damen, dass ihr mir helft zu überleben.
Danke, Cynthia St. Aubin, für deine unermüdliche Ermutigung, deine Zuversicht und Tapferkeit angesichts unvorstellbarer Widrigkeiten. Du bist mein Licht im Dunkeln und mein sicherer Hafen. Ich fand es herrlich, dieses verrückte Jahr mit dir zu erleben. Mein Fels in der Brandung.
Danke, Staci Hart, für dein riesiges offenes Herz und deine wertvollen Gaben, mit denen du so großzügig umgehst: deine Zeit, deine Kraft und deine vielen tollen Fähigkeiten. Deine Großzügigkeit und deine Freundschaft sind Geschenke, die ich mehr schätze, als ich in Worte fassen kann. Dieses ganze Projekt hätte sich ohne dich in Rauch aufgelöst.
Danke, Christine, für die unzähligen Stunden, die du mir gewidmet hast. Ich bewundere dich grenzenlos und verdanke dir alles.
Danke an Monique und das Team von St. Martin’s Publishing Group für euren Glauben und eure Geduld – und dafür, dass ihr die treibende Kraft seid, die meine Geschichten in die Welt bringen.
Danke, Janna Macgregor, für den Zickenkrieg und das Brainstorming.
Danke, Claire Marti, Kimberly Rocha, RL Merrill, Ellay Branton, Eva Moore, Kimberlie Faye, Dawn Winter, Janet Snell, Lori Foster, Penny Reid, E.V. Echols, Nikita Navalkar, Maida Malby, Martha DelVecchio, Marielle Browne, Cindy Nielsen, Kelli Zimmerman und ihr vielen anderen, die ihr immer zur Stelle seid – mit einem schnellen Lesen, einer Meinung, einem Wort der Ermutigung, einem Ausrufezeichen per Mail, einer Umarmung auf einer Konferenz und ein paar wunderbaren Worten, die ich zum Vergnügen lesen darf.
Einfach … danke.
Prolog
L’École de Chardonne
Mont Pèlerin, Genfer See, Schweiz, 1880
„Wissen Sie, warum ich Sie zu so später Stunde in mein Arbeitszimmer kommen lasse, Lady Alexandra?“ Direktor Maurice de Marchand ließ die Hand hinter seinem gewaltigen Schreibtisch verschwinden, als sie näher kam, doch Alexandra sah es nicht, weil sie nicht wagte, den Blick zu senken. Sie wollte sich auch gar nicht vorstellen, was er mit seinen Händen machte.
Außerdem schauten Lügner nach unten. Und sie würde lügen.
Sie hatte sein Zimmer immer gehasst. Die übertriebene Pracht. Überall Damast in grellen Farben – Rot, Orange und Kanariengelb. Selbst in diesem Moment hätte sie bei dem Anblick am liebsten die Augen zugekniffen.
„Nein, Sir, das weiß ich nicht.“ Sie rief sich jede Lehre in Täuschung und Frechheit ins Gedächtnis, die sie sich in vier Jahren von der Countess of Mont Claire abgeschaut hatte, und begegnete dem scharfen Blick des Direktors mit – wie sie hoffte – Unschuldsmiene.
Bei nüchterner Betrachtung verstand sie, warum ihn so viele Mädchen auf de Chardonne attraktiv fanden. Mit seinen aristokratischen Wangenknochen und dem eckigen Kinn verkörperte er die Sorte Eleganz, die man in Frauenromanen antraf. Alexandra fand seinen Hals zu lang für die breiten Schultern und das winzige Kinn verstärkte diese Wirkung noch.
Ihre Freundin Julia hatte einmal von seinen schwelenden dunklen Augen geschwärmt und ihre Farbe mit einem Croatian Imperial Stout verglichen. Doch Alexandra war schon vor langer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass Julia immer nur Unsinn redete. Und wenn sie selbst seine Augen mit irgendetwas vergleichen würde, dann mit dem Zeug, mit dem der Gärtner Jean-Yves seine Treibhaus-Orchideen düngte.
Julia hatte offenbar seine Neigung vergessen, die Mädchen mit Schlägen auf die Handfläche zu bestrafen, wenn sie sich falsch verhielten. Sie sah dann keine Güte in seinen Augen. Sondern etwas anderes. Etwas Finsteres.
Er wollte sie zum Weinen bringen. Er befeuchtete seine Lippen mit der Zunge, wenn er ihre Tränen sah.
De Marchands Hand kam wieder unter dem Tisch hervor, er faltete die Hände und legte die Fingerspitzen an die Lippen. Die weiten Ärmel seines schwarzen Direktorenanzugs breiteten sich auf dem gewaltigen Tisch aus, als er die Ellbogen aufstützte.
Über diesem Tisch hingen die Schatten vieler solcher Männer; er war wie Zepter und Krone an jeden neuen Schlossherrn weitergereicht worden. Schlossherr? Alexandra konnte es sich gerade noch verkneifen, mit den Augen zu rollen. Herr kleiner Mädchen? Wie armselig!
„Kommen Sie schon“, stichelte er. Sein französischer Akzent ließ seine Worte auf eine süßliche Art vibrieren. „Sie sind vielleicht das klügste Mädchen, das wir je hier auf de Chardonne unterrichtet haben.“
Alexandra stellte sich Generationen kluger Mädchen vor, die geübter darin – oder eher bereit dazu – gewesen waren, ihre Intelligenz zu verbergen. „Sie schmeicheln mir, Sir. Doch ich gestehe, dass ich keine Ahnung habe, warum Sie mich zu so später Stunde in Ihr Arbeitszimmer gerufen haben.“
Seine Lider senkten sich, als sei er schläfrig, und seine Augen verfinsterten sich so, dass sie geradezu feindselig dreinblickten. „Immer so höflich“, murmelte er und ordnete die Sachen auf seinem Schreibtisch. Er nahm einen Briefbeschwerer aus Marmor von einem Stapel Papier und schob die Blätter wieder in ihren Lederordner. „So ordentlich und umsichtig.“ Den Füller ohne Kappe legte er ganz nach links. „Ausgezeichnete Noten. Tadelloses Verhalten.“ Er legte seinen Brieföffner ganz nach rechts, ebenso weit an den Rand wie den Füller. „Die vollkommene Schülerin … die vollkommene Frau.“
„Ich bin noch keine Frau.“ Die Erinnerung erschien notwendig. Sie würde in ein paar Tagen ihren Abschluss machen, aber mit siebzehn war sie die Jüngste in ihrem Jahrgang und würde es auch noch ein paar Monate bleiben. „Und ich bin mir meiner Schwächen bewusst, Sir.“
Manchmal dachte sie an nichts anderes. De Marchand sagte nichts; er sah sie über den Tisch hinweg an, bis Alexandra unruhig wurde. Ihr Magen rebellierte gegen etwas, das sie nicht klar erkennen konnte. Etwas Unanständiges. Eine unheilige Vorahnung, die ihr hätte Angst machen sollen.
Stattdessen richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf sein Haar. Es hatte die funkelnde Farbe von nassem Sand bei Ebbe. Dunkler als Gold, heller als Braun. Eine unauffällige Farbe für einen so überheblichen und mächtigen Mann.
„Glauben Sie, Lady Alexandra, wenn Sie tagsüber perfekt sind, würde niemand merken, was Sie im Dunkeln machen?“
Alexandras Hände ballten sich in den Falten ihres Kleides zu Fäusten. Ihr Atem stach ihr in die Lunge wie ein kalter Eisennagel. Sie kämpfte tapfer gegen den Impuls an, zu fliehen. „Ich versichere Ihnen, Sir, dass ich nicht weiß, was Sie meinen.“
Er spreizte die Finger auf dem Schreibtisch, stand auf und kam ihr für einen Augenblick riesig vor. Seine Miene zeigte eine gehässige Siegesgewissheit. Er ging zu dem Schrank neben dem Fenster mit Aussicht auf den Genfer See. Der zunehmende Mond warf einen silbernen Schein auf die Berge und die Stadt im Tal schickte ihr metallisch-goldenes Licht ins Rennen. „Kluge Menschen haben eine höchst unangenehme Angewohnheit. Sie überschätzen sich selbst so sehr, dass sie alle anderen unterschätzen.“
Alexandra runzelte die Stirn und verzog den Mund. „Sir, wenn ich jemanden gekränkt habe, dann …“
„Möchten Sie einen Schluck Wein?“ De Marchand holte eine geschliffene Kristallkaraffe und zwei Gläser aus dem gleichen Material aus dem Schrank.
Bei dem Anblick fühlte sich Alexandras Zunge an wie Schmirgelpapier. Genau diese Karaffe hatte sie ihm vor nicht einmal zwei Jahren gestohlen – und eine Flasche Portwein aus seiner riesigen Sammlung.
Das hieß … er wusste es.
Er hatte die Höhle entdeckt.
De Chardonne war im elften Jahrhundert von einem fränkischen Adligen in die Seite des Mont Pèlerin gebaut worden – damals eine strategisch geschickte Mischung aus Schloss und Festung, heute eine Schule für Mädchen. In seinen Tiefen ratterte und dröhnte der Heizkessel und auf einer nächtlichen Erkundungstour vor vier Jahren hatte Alexandra zufällig einen verschlungenen Weg entdeckt. Sie war den Weg kühn gegangen und er wurde immer mehr zu einer Höhle, bis er vor einer Wand aus Efeu und Dornbüschen jäh endete.
Hier hatten sie und ihre besten Freundinnen, Francesca Cavendish und Cecelia Teague, einen Schlupfwinkel für ihre Red Rogues Society eingerichtet. Red, weil sie alle rote Haare in verschiedenen Schattierungen hatten. Rogues, weil sie jeden Augenblick, den sie von ihrer sogenannten Erziehung für junge Damen abzweigen konnten, damit verbrachten, Dinge zu lernen, die ihrem Geschlecht verboten waren. Sie lasen Poe und Dumas, Kriegsberichte und schlüpfrige Gedichte. Sie brachten sich selbst Latein und Algebra bei. Sie hatten sich sogar männliche Spitznamen gegeben, die sie bei ihren Treffen und in Briefen verwendeten: Frank, Cecil und Alexander.
Im Laufe der Jahre waren sie zu leichtsinnig geworden. Das begriff Alexandra, als sie die Karaffe in der Hand des Direktors sah. In ihrem Bestreben, männliche Freuden und Zeitvertreibe kennenzulernen und zu genießen, die nicht für Damen gedacht waren, hatten sie den wenigen männlichen Bewohnern und Mitarbeitern von de Chardonne dann und wann ein paar Sachen gestohlen. Unwichtige Dinge, die nie jemand vermissen würde.
Darunter auch eine der vielen Dutzend Karaffen, die dem Direktor gehörten.
„Eigentlich bietet man Damen keinen Portwein an“, fing er an. „Aber ich glaube, Sie haben Geschmack an verbotenen Früchten gefunden, nicht wahr?“ De Marchands Stimme triefte vor Genugtuung, als er ihr das Glas reichte. „Eine Lust auf Freuden, die nur Männern zustehen.“
Alexandra war wie betäubt und konnte nichts anderes tun, als den Wein mit weißen, zitternden Fingern anzunehmen. Sie wagte nicht daran zu nippen. Sie hätte nicht schlucken können, wenn sie es versucht hätte.
„Sie dachten, in all den Jahren hätte niemand von Ihrer kleinen Gesellschaft gewusst?“, spottete er milde. „Sie Rotschopf-Trio! Die Dicke mit Reichtum, aber ohne Titel. Die dürre, unverschämte Gräfin.“
Empörung wallte in ihr auf und löste ihr die Zunge. „Ich finde, das ist keine passende Beschreibung von …“
„Und Sie“, sagte er mit unangenehmer, fast anklagender Heftigkeit. „Die makellose Mischung aus beidem. Schlank und geschmeidig. Zart und begehrenswert.“
Alexandra drehte sich der Magen um.
De Marchand ging wieder hinter seinen Schreibtisch und öffnete eine Schublade.
„Es gehört sich nicht, dass Sie solche Sachen sagen, Sir. Mein Vater wäre nicht einverstanden …“
Beim Anblick des Rasiermessers mit dem Perlengriff stockte ihr der Atem und als de Marchand anfing die Sammlung zu präsentieren, die sie und ihre Freundinnen sich im Laufe der Jahre angeeignet hatten, war sie wie gelähmt.
Ein Paar Hosenträger, ein Zylinder, Manschettenknöpfe, Hemden und andere Sachen. Nicht alles gehörte ihm; vieles war weggeworfen worden.
Trotzdem.
Es war ihr zuwider, dass er in ihrer Höhle gewesen war, dass er ihr Heiligtum mit seiner scheußlichen Anwesenheit entweiht hatte. Sie verabscheute ihn dafür, dass er Dinge anfasste, die ihr nicht gehörten, für sie jedoch Schätze geworden waren.
Schätze, die die Red Rogues bei ihrem Abschluss auf jeden Fall hatten zurückgeben wollen.
„Vier Jahre.“ Die Zahl schien ihn zu beeindrucken. Er reihte die Sachen bedeutsam und gemessen am Rand seines Schreibtischs auf. „Sie haben mich bestohlen, wenn Sie sich unbeobachtet glaubten. Sie sind in meine Privatsphäre eingedrungen. Auf verbotenes Gelände.“
Ekel stieg in ihr auf und schnürte ihr schmerzhaft die Brust zu.
Er schüttelte kaum merklich den Kopf. „Wir sind uns ähnlicher, als Sie sich vorstellen können, Lady Alexandra. Auch ich habe eine Vorliebe für verbotene Dinge.“
Verboten.
So verboten wie das, was in seinen aufmerksamen dunklen Augen auf sie lauerte.
Sein ständiges Starren flößte ihr schon lange eisiges Unbehagen ein. Und dieses Frösteln ließ sie kerzengerade dastehen. Es machte sie bereit für den Rückzug.
„So klug“, wiederholte er. „Aber nicht klug genug, um mitzubekommen, dass ich Sie beobachtet habe.“
„Doch, ich weiß, dass Sie mich beobachten, Sir.“ Sie hatte es schon gemerkt, als sie noch zu jung gewesen war, um zu begreifen, was eigentlich in seinen Augen glomm. Ein Begehren, das nicht nur verboten war, sondern kriminell. „Mehr, als anständig ist. Mehr, als richtig ist.“
„Halten wir uns nicht damit auf, was richtig oder falsch ist.“ Er ging auf die gestohlenen Sachen zu. „Ich habe gemerkt, dass auch Sie nach mir Ausschau halten.“
Sie schnappte ungläubig nach Luft. „Aber nur so, wie ein Kaninchen nach einem Adler am Himmel Ausschau hält.“
„Sie halten mich also für ein Raubtier?“
Empörung flammte in ihr auf. Er wollte, dass sie Angst vor ihm hatte. „Ich halte Sie für gar nichts, Sir.“
Seine Attraktivität verwandelte sich im Schein des Feuers in unleugbare Scheußlichkeit. Er zog das Weinglas weg und stellte es neben sein zurückerlangtes Eigentum.
Alexandra gestand ihre Schuld ein. Sie war als Diebin entlarvt worden. Doch seine Sünden übertrafen ihre bei Weitem – das wusste sie instinktiv, sie spürte es mit jeder Faser ihres Körpers.
„Was mache ich nun mit Ihnen dreien?“ Er sah sie übertrieben fragend an. „Wenn ich übermäßig rachsüchtig wäre, würde ich die Polizei rufen. Wenn ich grausam wäre, würde ich Sie hinauswerfen.“
„Nein!“, keuchte Alexandra. Als Frau würde es für sie schwierig genug werden, von einer Universität angenommen zu werden. Wenn sie nicht die Empfehlung von de Chardonne bekam, mit der sie fest rechnete, hatte sie gar keine Chance. „Bitte, Sir. Es war doch nur ein harmloser Spaß. Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass wir Ihre Sachen genommen haben. Wir wollten sie nur ausleihen. Ich verspreche, dass ich Wiedergutmachung leiste, wenn Sie nur …“
Er bückte sich und nahm etwas aus einer anderen Schublade seines Schreibtisches – einen langen, schmalen Riemen, den alle Mädchen auf de Chardonne fürchten und verachten gelernt hatten. Der Anblick schnürte ihr wieder die Kehle zu, sodass sie kein Wort hervorbrachte.
„Ab heute Abend werden Sie an mich denken, bevor Sie wieder etwas anstellen.“
Alexandra stellte ihr eigenes Glas ab. Ihre Finger waren so kalt und steif, dass sie es nicht länger halten konnte, als er um den Tisch herum ging und turmhoch vor ihr stand. Ihre Nasenflügel bebten vor Hass, doch sie überwand ihre Angst und hielt ihm die Handflächen hin. Sie war noch nie geschlagen worden; sie hatte nie etwas getan, auf das die Prügelstrafe stand. Doch sie hatte im Unterricht gesehen, wie ungehorsame Mädchen mit dem Riemen gezüchtigt worden waren. Ihr war aufgefallen, dass sie sich wochenlang nur noch steif bewegt hatten.
„Es ist meine Schuld, Monsieur de Marchand. Bestrafen Sie mich, aber bitte verschonen Sie Francesca und Cecelia. Ich bin die Anstifterin – nur ich verdiene es.“
„Wie Sie wünschen.“ Er starrte ihre dargebotenen Handflächen an; sie waren farblos und zitterten wie Espenlaub.
Er hob den Riemen und sie zog unwillkürlich den Kopf ein, als sie sich auf den Schlag gefasst machte.
Den Schlag, der nicht kam.
Sie atmete aus und wagte es, ihn anzusehen. Sie bereute es sofort.
Eine Idee verdüsterte sein Gesicht, als er seinen Arm senkte. „Nein.“ Er legte den Riemen auf den Tisch. „Nein, Ihre Strafe soll der Tat angemessen sein.“
Sie schaute verständnislos auf die blanke Tischplatte. „Was meinen Sie?“
„Sie wünschen sich seit vier Jahren, wie die Jungen auf le Radon behandelt zu werden?“ Er packte sie am Ellbogen und zog sie zum Schreibtisch. „Dann werden Sie auch wie ein solcher bestraft.“
„Ich – ich verstehe nicht.“
Seine Zähne funkelten glänzend weiß, sogar in dem dämmerigen Licht des Feuers. „Bücken Sie sich.“
Alexandras Augen weiteten sich, sie wich zurück und versuchte sich loszureißen. Sie wusste genau, wo er sie schlagen wollte.
„Nein“, flüsterte sie und überlegte fieberhaft, wie sie entkommen konnte.
Francesca hätte gewusst, was zu tun war. Zumindest hätte sie ihren Einfluss als Gräfin ausgenutzt, um den Direktor zur Besinnung zu bringen. Sogar Cecelia konnte ihren Reichtum als Druckmittel einsetzen. Niemand wagte, die Einkünfte aufs Spiel zu setzen, die sie der Schule brachte.
Welchen Ausweg gab es für Alexandra?
„Mein Vater, der Earl of Bentham, wird das nicht hinnehmen.“ Sie drückte die Fersen in den Teppich, aber es brachte nichts. „Wenn er hört, wie Sie mich behandelt haben, wird er Sie ruinieren.“
De Marchands Gesicht kam ihrem bedrohlich nahe. „Jeder weiß, dass Ihr Vater nicht einmal eine geschminkte Hure ruinieren könnte, geschweige denn einen Mann von meinem Einfluss.“
Er ließ Alexandra nicht die Zeit, über seine Worte nachzudenken, sondern stieß sie gegen den Tisch. Er legte seine starke Hand zwischen ihre Schulterblätter und drückte ihre Brust auf die Tischplatte.
Sie stieß einen Schmerzensschrei aus, als sich die scharfe Kante in ihre Hüften bohrte.
„Breiten Sie die Arme aus“, befahl er.
Alexandra war so benommen vom Schmerz und der ungewohnten Brutalität, dass sie gehorchte und die Finger auf das kühle Mahagoni legte. Sie schloss die Augen und zählte die Unterröcke unter ihrem schweren Rock. Die würden die Schläge zumindest abmildern. Mit angehaltenem Atem machte sie sich auf den ersten Hieb gefasst.
Stattdessen spürte sie einen kalten Lufthauch an ihren Knien, die in Strümpfen steckten.
Ihr entfuhr ein heiseres „Nein!“, sie wich zurück und versuchte sich so gut wie möglich herauszuwinden.
Seine Hand umschloss ihren Nacken und er stieß sie mit solcher Wucht über den Tisch, dass sie mit der Wange auf das Holz schlug.
Die Angst war schlimmer als der Schmerz. Das war nicht einfach nur eine Strafe. Kein Zorn, der Vergeltung wollte.
Es lagen Schwingungen von etwas Wütenderem, Hässlicherem in der Luft. Was hatte sie getan, um so eine erniedrigende Behandlung zu verdienen? Wie konnte sie es ungeschehen machen??
„Bitte.“ Sie versuchte, Ruhe zu bewahren und den Kopf zu heben. „Lassen Sie mich. Sie tun mir weh.“
„Glauben Sie, die Jungen zappeln und betteln so schön?“ Seine Stimme klang, als käme sie zwischen den Zähnen hervor. Wenn sie so weit zur Seite schaute wie möglich, sah sie nur seinen Schatten über sich. „Nun?“
„Ich – ich …“ Hilflosigkeit verschlug ihr die Sprache. Raubte ihr den Verstand.
„Nein, Lady Alexandra, sie akzeptieren einfach die Prügel.“
Die unwillkommene Hitze seines Atems auf ihrer Wange hätte sie warnen sollen. Aber sie hatte keine Ahnung von Männern und hätte sich nicht träumen lassen, dass sie als Nächstes seine Zunge spüren würde.
Der feuchte Streifen, den er auf ihrer Wange hinterließ, erregte solchen Ekel in ihr, dass sie nicht dazu kam, zu reagieren. Und schon verhedderten sich ihre Arme in den Röcken, die er bis über ihre Taille hochgezogen hatte.
Sie war betäubt und überlegte verzweifelt, was sie tun sollte. Sich wehren? Schreien, in der Hoffnung, dass einer der Lehrer aufwachen und ihr zu Hilfe eilen würde? Würden sie sie beschützen? Oder sie von der Schule werfen? Sollte sie ihn um Gnade bitten? Oder den Tränen freien Lauf lassen, die ihr in den Augen und der Nase brannten, und hoffen, dass es ihn besänftigte? Oder sich die Schläge gefallen lassen und es hinter sich bringen?
„Dünn genug, um den Schatz darunter zu sehen“, murmelte er und brachte sie vollends durcheinander. „Die kannst du anbehalten.“
Ihre panischen Gedanken erfassten gerade, dass er ihre weiße Merino-Unterhose meinte, als der erste Schlag ihr zartes Gesäß traf.
Wenn er den Riemen genommen hätte, hätte sie vielleicht demütig stillgehalten. Weil sie Strafe verdient hatte. Um ihre Ziele zu wahren und ihre besten Freundinnen zu schützen.
Sie hätte die Prügel ertragen wie ein Mann.
Doch der Abdruck seiner Finger auf ihrem Gesäß – der Klang von seinem Fleisch auf ihrem, der Schmerz, die absolute Erniedrigung – trieb sie zu einer heftigen Reaktion, die sie sich nicht zugetraut hätte.
Er schaffte drei Schläge, dann widersetzte sie sich so wild, dass er sie nicht mehr mit einem Arm bändigen konnte. Danach presste er sie mit seinem Körper gegen den Tisch. Drückte sich an sie. Oberkörper an Oberkörper, Hüfte an Hüfte.
„Halte still“, keuchte er und seine Schlangenstimme bebte noch mehr als vorher. „Sonst bin ich nicht verantwortlich für das, zu dem du mich treibst.“
„Sie werden sich verantworten“, zischte sie. „Ich werde dafür sorgen, dass Sie vor Gericht kommen.“
Sein schreckliches Lachen hallte im Zimmer wider. „Was glaubst du, wem man glauben wird, Alexandra? Dem angesehenen Schulleiter, dessen Familie schon vor Urzeiten Könige erzogen hat, oder der verwöhnten kleinen Diebin, die verrückte Behauptungen aufstellt, um ihren Ruf zu retten?“
Seine Frage ließ sie innehalten.
Ja, wem? In England gehörte sie zum Adel. Aber hier, so weit weg von zu Hause … was konnte sie da schon tun?
„Lassen Sie mich los.“ Es sollte fordernd klingen, hörte sich jedoch an wie eine Bitte. „Lassen Sie mich, oder ich ruiniere Sie.“
„Nicht, wenn ich dich zuerst ruiniere“, knurrte er ihr ins Ohr und drückte sie noch fester gegen den Tisch.
Das, was sie an ihrem Gesäß spürte, jagte ihr neuen Schrecken ein. Gab ihr Kraft. Und Entschlossenheit.
Sie gebärdete sich wie ein wildes Tier, das sich gegen ihn aufbäumte.
Verzweifelte Laute, die eigentlich Worte sein sollten, entrangen sich ihrer Kehle. Sie wollte ihm befehlen aufzuhören. Dann wollte sie betteln. Doch zu ihrem Entsetzen waren die Geräusche, die sie machte, nur verschiedene Formen des Wortes „Nein“.
Sie sagte es in jeder Sprache, die sie kannte. Sie kreischte es, als er an seiner Hose herumfingerte.
„Wehr dich nur, so viel du willst“, raunte er ihr ins Ohr, als er die passende Öffnung in ihrer Unterhose fand. „Es wird nicht lange dauern.“
Das tat es auch nicht.
Alexandra sah zu, wie ihre Atemzüge einen Hauch auf der glänzenden Tischplatte hinterließen, der bei jedem schmerzhaften Luftholen wieder verschwand. Vielleicht konnte sie einfach aufhören zu atmen.
Es wird nicht lange dauern. Es brauchte nicht lange zu dauern.
Zeit, dachte sie, spielte eigentlich keine Rolle. Man konnte in einer Sekunde alles verlieren. Seine Jungfräulichkeit. Seine Würde. Sein Vertrauen. Das Gefühl der Sicherheit. Den Verstand. Sich selbst.
Ihr Blick schweifte umher und sie sah all das Unwichtige – die Maserung des Holzes, die Bücher im Regal, die blutroten Gardinen, einen Funken Mondlicht. Der Gedanke an Francesca, die etwas aus der Tasche zog, schoss ihr durch den Kopf.
Ein Griff aus Perlen.
Das Erste, was sie ihm gestohlen hatten. Der Grund, aus dem er ihr jetzt ihre Unschuld nahm.
Das Rasiermesser fühlte sich in ihrer Hand kühl und glatt an, aber wann hatte sie danach gegriffen? Es würde ihn aufhalten. Es musste ihn aufhalten.
Sie fuhr jäh herum und schnitt ihm mit der scharfen Klinge die Kehle durch.
Die Geräusche, die er jetzt machte, klangen wie das Grunzen und Stöhnen von vorhin. Und dann wurden sie wässriger. Leiser. Wirres Gestammel.
Er taumelte zurück. Weg von ihr. Aus ihr heraus. Hinein in den Schatten. Er griff sich mit beiden Händen an die Kehle, als könnte er sie zusammenhalten. Sein Mund formte Worte, die seine Stimme nicht mehr aussprechen konnte. Das Blut versickerte im Kragen seines schwarzen Direktorenanzugs. Ihr Rock raschelte auf dem Boden, als sie wegging, das Rasiermesser immer noch fest umklammert. Er griff nach ihr, machte einen Schritt auf sie zu und fiel vornüber auf den Teppich.
Alexandra schloss leise die Tür hinter sich. Sie huschte wie ein Gespenst durch die Schatten, die nur von den langen Kreuzen unterbrochen wurden, den Fenstern, durch die der Mond schien. Sie stieg die Treppe zu dem Turm hinauf, in dem sie und die Red Rogues ein prächtiges Zimmer bewohnten.
Die Geräusche, die er gemacht hatte, übertönten alles andere, sogar ihre Stimme, als sie ihr Geständnis flüsterte.
„Ich habe ihn umgebracht.“
Die Red Rogues standen keuchend vor Erschöpfung unter einem mondhellen Himmel und sahen zu wie Jean-Yves, der Hausmeister von de Chardonne, eine Menge Mohn pflanzte.
Es war so spät, dass es schon wieder früh war, und selbst um diese Zeit leuchteten die Blumen in den Farben des Sonnenuntergangs. Er legte kein ordentliches kleines Beet an, sondern arrangierte die Blüten so, dass es eine Mischung aus natürlichem Durcheinander und kultivierter Gleichmäßigkeit wurde.
„De Marchand war immer ein Misthaufen“, spie er in kehligem Französisch aus. „Jetzt wird er wenigstens nützlicher Mist – als Blumendünger.“ Er nahm seine Mütze ab und wischte sich seine beginnende Glatze ab. Dabei schaute er Alexandra mit so tiefem Kummer an, dass sie beinahe die Fassung verlor.
Die Tränensäcke unter seinen Augen waren schwerer denn je. Alexandra sah zu, wie seine wilden Haarzotteln in der leichten Brise flatterten, die vom See kam. „Er konnte sich zu lange alles erlauben, niemand hat ihm Einhalt geboten. Ich habe immer gesagt, dass de Marchand sich eines Tages vergessen würde und … niemand hat auf mich gehört.“
Alexandra schlug die Augen nieder. Sie hatte noch keine Träne vergossen. Nicht als Francesca in ihrem langen blauen Morgenmantel und mit den glatten karottenroten Zöpfen de Marchand das Rasiermesser in die Tasche gesteckt hatte. Auch nicht als die getreue Cecelia, deren herzförmiges Gesicht wilde Entschlossenheit zeigte, die Leiche in den blutbefleckten Teppich eingerollt und Jean-Yves geholfen hatte, sie in den Garten zu schleifen.
Nicht einmal als die drei anfingen, seine graue Haut mit schwarzer Erde zu bedecken, floss eine einzige Träne. Die Rogues ließen Alexandra nur die Laterne halten, was sie gut gemacht hatte, wie sie fand. Sie hatte dagestanden wie eine Statue und das Licht hochgehalten, auch als ihre Schulter vor Müdigkeit zittrig geworden war. Auch als sie schmerzte. Auch als sie brannte.
Sogar noch, als ihr etwas Flüssiges und Unvorstellbares die Beine heruntergelaufen war.
Sie hatte sich nicht gerührt.
Ein Teil von ihr fürchtete, sie sei so kalt geworden. So leer. So hart wie Stein.
Damit es ihnen nicht gelingen würde, ihr die Laterne zu entreißen. Wenn die Polizei kam, was sie sicher tun würde, würde sie ihnen einfach zeigen, wo die Leiche vergraben war. Sie könnte sie alle verurteilen.
„Ich mache jetzt Schluss und dann sorge ich dafür, dass das Arbeitszimmer gesäubert wird.“ Jean-Yves ging auf Alexandra zu, sprach aber Cecelia an. „Sie nehmen sie mit und kümmern sich um sie wie abgesprochen. Comprenez-vous?“
Cecelia nickte und legte dem Mann die Hand auf die Schulter. „Wir reden morgen darüber.“ Er küsste sie zärtlich auf die Schläfe und ging wieder an seine Arbeit. Die Mädchen waren entlassen.
Alexandra hatte die Laterne erst losgelassen, als Francesca ihre verkrampften Finger aufbog und ihr die Laterne abnahm. Sie spürte nichts. Nichts als den Boden unter ihren Füßen, als sie sie zurückführten. Den kühlen Tau im Gras. Die glitschigen Fliesen der hinteren Küchen. Die weichen Teppiche waren eine Wohltat für ihre geplagten Sohlen.
Für ihre geplagte Seele.
Und dann stand sie im Turmzimmer und starrte in die Kohlen im Kamin. Ihre Freundinnen wuselten schweigend um sie herum. Sie merkte nicht, dass sie nackt war, bis das lauwarme Wasser an ihren Füßen sie in die Gegenwart zurückholte.
Eine Flamme loderte empor, als zwei schmutzige Nachthemden, Morgenmäntel und Alexandras gelbes Lieblingskleid, Strümpfe und Unterwäsche ins Feuer flogen.
Francesca warf ein paar Holzscheite hinterher und Cecelia setzte Alexandra in die Wanne und badete sie behutsam.
Alexandra starrte auf ihre brennende Unterwäsche.
De Marchand hatte sie ihr gar nicht erst vom Leib gerissen. Der Schlitz, der für die menschlichen Bedürfnisse da war, war auch für Männer praktisch. Das hatte sie noch nie bedacht. Hatte es überhaupt schon jemand bedacht? Plötzlich wollte sie jede Frau auf der Welt warnen.
„Bist du sicher, dass wir Jean-Yves vertrauen können?“, brach Francesca das Schweigen. Sie stand vor dem Kleiderschrank, splitternackt, und holte saubere Nachthemden und schwere, warme Umhänge heraus. „Es gefällt mir nicht, dass er es weiß.“
Alexandra musterte den mageren Körper ihrer Freundin eingehend.
De Marchand hatte sich geirrt. Francesca war schlank, aber nicht dürr. Sie war lang und schlaksig wie die Vollblüter, die sie so gern ritt. Hatte magere Muskeln, die sie schnell und beweglich machten. Ihr Geist war ebenso rege, die Zunge scharf und ihr Charakter untadelig.
Wie Alexandra sie darum beneidete. Vielleicht wäre es ihr gelungen, zu entkommen, bevor …
„Jean-Yves ist der einzige Mann, dem ich je vertraut habe“, beharrte Cecelia und rückte ihre Brille zurecht. „Er wird unser Geheimnis wahren, daran habe ich keinen Zweifel.“
Francesca blieb mit einer neuen weißen Unterhose in der Hand stehen. In ihren grünen Katzenaugen funkelte eine Mischung aus boshafter Spekulation und milder Neugier. „Dein Vater lebt doch noch? Ist er nicht Pfarrer?“
„Ja.“ Cecelias rundes, immer freundliches Gesicht verfinsterte sich.
„Und Jean-Yves ist der einzige Mann, dem du vertraust?“
„Das habe ich gesagt.“ Ihre saphirblauen Augen funkelten Francesca an, als Letztere sich ein Nachthemd mit Rüschen über den Kopf zog.
„Ich weiß, dass er dir wichtig ist, Cecil, aber wir müssen bedenken …“
„Jean-Yves und ich haben schon lange eine Abmachung“, unterbrach Cecelia. Sie griff nach einer Kanne und ließ Alexandra den Kopf nach hinten legen, um ihr die Haare zu waschen. „Ich nehme ihn mit, wenn wir von hier weggehen, und stelle ihn in meinem Haushalt ein.“
„Aber …“
„Wir reden morgen darüber.“ Cecelia wiederholte Jean-Yvesʼ Worte mit einer Heftigkeit, wie Alexandra sie noch nie bei ihr erlebt hatte. Zum ersten Mal in ihren jungen Leben sorgte ihr Ton nicht für Widerspruch. Nicht einmal von Francesca.
Meine Schuld.
Die brennenden, schmerzenden Tränen kamen endlich heiß wie das Feuer der Hölle. Ihre Freundinnen stritten sich und alles nur ihretwegen. Sie hatte den guten alten Jean-Yves in Gefahr gebracht, ganz zu schweigen von Cecelia und Francesca.
Meine Schuld. Meine Schuld. Meine Schuld.
Diese Worte hallten in ihrem Kopf wider wie Pistolenschüsse in einem schrecklichen, immer schneller werdenden Rhythmus. Wie der Klang von Haut gegen Haut. Sie konnte hinterher nicht mehr sagen, wie lange Cecelia und Francesca sie gebadet hatten und wie sie das Badewasser entsorgt hatten. Sie erinnerte sich nicht daran, dass sie sie angezogen hatten. Ihr das Haar geflochten hatten. Sie wusste auch nicht, wann sie endlich ins Bett gekommen war.
Doch schließlich drang Francescas energische Stimme durch den grauen Nebel, der sie die ganze Nacht umhüllt hatte. „Alexandra!“
„Meine Schuld!“ Ihre Gefühle kamen in einem Schrei zum Ausdruck, bei dem sie ihre Stimme nicht wiedererkannte. „Es ist alles meine Schuld.“
„Lieber Gott, nein!“ Francesca setzte sich unter dem Baldachin neben Alexandra und legte den Kopf an ihre Schulter. „Nichts von dem, was heute Nacht passiert ist, ist deine Schuld.“
„I-ihr seid jetzt meine Komplizinnen“, klagte sie und spreizte die Finger. „Ich hätte euch nicht in diese Sache hineinziehen dürfen. Es könnte euer ganzes Leben ruinieren. Ihr solltet kein solches Geheimnis mit euch herumschleppen müssen.“
Cecelia legte den Kopf an ihre andere Schulter, zog die Decke hoch und ließ Alexandra die Wärme ihrer weichen Brust spüren. „Wir haben alle Geheimnisse, Alexander. Solche, die uns ruinieren könnten.“
Alexandra schüttelte den Kopf und starrte zu dem weißen Baldachin empor. Sie hasste die Farbe der Reinheit fast so sehr wie sich selbst. „Nicht solche. Ich – ich habe einen Mann ermordet.“ „Deinen Vergewaltiger.“ Francesca stopfte Alexandra die Überdecke unter das Kinn. „Wir hätten vielleicht alle dasselbe getan, wenn …“ Sie beendete den Satz nicht. So empfindlich war sie nur selten.
„Wir haben alle Geheimnisse?“ Alexandra wandte sich an Cecilia, deren Worte ihre Stumpfheit durchdrungen hatten. „Ich kenne dich jetzt seit vier Jahren … Du hast nie etwas von einem Geheimnis gesagt, das dich ruinieren könnte.“
Cecelia wurde ernst und wirkte plötzlich viel jünger als achtzehn. „Ich möchte es eigentlich nicht teilen, aber …“ Sie zögerte. „Ich möchte nicht, dass du dich allein fühlst.“
Francesca sah Alexandra in die Augen und ihr Elfengesicht war so blass, wie Alexandra es nur bei einer Leiche für möglich gehalten hätte. „Wir sollten alle ein Geheimnis teilen, dann tragen wir eine gemeinsame Last und das wird ein Band des Vertrauens schmieden, das nicht reißen kann.“
Diese Geste berührte Alexandra zutiefst. „Erzählt es mir“, flüsterte sie. Ihr war alles recht, um sich von dem Schrecken dessen abzulenken, was sie für den Rest ihres Lebens jeden Tag verfolgen würde.
Cecelia atmete endlos lange tief durch, bis sie endlich den Mut fand, zu sprechen. Und dann war ihre Stimme heiser vor Aufregung. „Ich bin ein Bastard. Meine Mutter hatte einen Geliebten. Sie starb bei meiner Geburt und mein Vater … der Mann, der mich großgezogen hat … hat mir unmissverständlich klargemacht, dass er mich unmöglich gezeugt haben kann. Er hat mir mein Leben lang eingebläut, dass meine Mutter wegen ihrer Untreue gestorben sei.“
Francesca nickte und stieß einen Atemzug aus. Es klang ausgelaugt, als sie sich die Last von so viel Kummer vorstellte. „Oh, Liebling, ist er grausam zu dir?“
„Unsagbar“, flüsterte Cecelia. Sie blinzelte eine unwillkommene Erinnerung weg.
„Kennst du deinen richtigen Vater?“, fragte Alexandra und kuschelte sich an Cecelia. „Ist es dieser geheimnisvolle Wohltäter, der für deine Erziehung bezahlt?“
Cecelia schüttelte den Kopf und zuckte die Achseln. Die Scham ließ sie noch tiefer erröten. „Ich wünschte, ich wüsste es. Manchmal bin ich sicher, dass er es ist. Ich habe so viele Jahre allein auf de Chardonne verbracht. Bevor ich mich mit euch angefreundet habe, war Jean-Yves der einzige Kamerad, den ich je hatte. Und das auch nur, weil ich mich als Kind oft in seinen Gärten versteckt habe und ihm so oft mit Bitten in den Ohren lag, dass er sich schließlich auf meine Seite schlug.“
„Ich komme mir so dumm vor“, klagte Francesca. „Wenn du ihm vertraust, sollten wir es auch.“
„Je mehr Leute von einem Geheimnis wissen, desto gefährlicher ist es. Es ist besser, wenn wir alle vorsichtig sind.“ Cecelia wischte sich ein paar verirrte Tränen von ihrer Pfirsichhaut. „Und du, Frank? Hast du ein Geheimnis?“
Francesca sah Alexandra an. „Ich bin eine Hochstaplerin. Ich heiße nicht Francesca Cavendish, sondern Pippa. Pippa Hargrave.“
Vor Schreck blieb ihren Freundinnen der Mund sperrangelweit offen.
Francescas Smaragdaugen funkelten im Licht des Feuers. Sie strahlte eine dunkle Aufrichtigkeit aus, die Alexandra von ihrem Schmerz ablenkte, wenn auch nur für einen Moment.
„Ich wurde als Tochter von Charles und Hattie Hargrave in Yorkshire geboren. Sie arbeiteten als Köchin und Diener für William und Theresa Cavendish, der Earl und die Countess of Mont Claire. Ich wuchs mit ihren Kindern Fernand und Francesca im Paradies auf.“
Cecelia runzelte die Stirn. „Ich dachte, die Cavendishs seien alle bei einem Brand ums Leben gekommen, bis auf …“
„Niemand ist bei dem Brand ums Leben gekommen.“
Alexandra blinzelte und fragte sich, ob ihr schreckliches Erlebnis sie um den Verstand gebracht hatte. „Was? Was sagst du da?“
Francescas Miene verdüsterte sich, als sie in eine Vergangenheit blickte, die so schrecklich war, dass sie erschauerte und ängstlich die Schultern hochzog. „Hast du jemals von einem Brand gehört, der am helllichten Tag auf einem Anwesen mit beinahe hundert Bewohnern ausbrach, ohne dass eine Menschenseele mit dem Leben davonkam?“
„Das klingt ganz unmöglich, es sei denn …“ Cecelia ließ den Satz in der Luft hängen und wand sich. Sie und Alexandra wechselten einen Blick voller Vermutungen.
Francescas nächsten Worte bestätigten, was sie befürchteten. „Es sei denn, alle Bewohner waren schon gestorben.“ Sie zupfte an einer losen Naht im Saum ihres Umhangs. „Nicht einfach gestorben“, korrigierte sie sich. „Massakriert. Männer auf Pferden kamen zur Teezeit. Ich war acht Jahre alt und hielt sie für eine Armee, aber jetzt bin ich überzeugt, dass es nur ungefähr ein Dutzend gewesen sein können. Sie schlachteten alle ab. Den Grafen und die Gräfin, die Haushälterin, den Butler, die Gärtner, Dienstmädchen, die Kinder … und meine Eltern.“ Sie hielt einen Moment atemlos inne und fasste sich wieder. „Ich rannte mit Francesca davon, doch sie erwischten sie. Entrissen sie mir, als ich sie festhalten wollte. Ich sah zu, wie sie sie … sie … Sie hatte nicht einmal mehr Zeit zu schreien.“ Sie griff sich an die Kehle und man konnte leicht erraten, wie Francesca gestorben war.
Alexandra hasste sich dafür, dass die Erzählung ein Balsam für ihre Wunden war. Es sprach nicht für sie, dass sie Trost in den Geheimnissen ihrer Freundinnen fand. In deren Schmerz.
Denn das hieß, dass sie nicht ganz allein war. Dass sie nicht das einzige Mädchen im Zimmer war, das mit einer heimlichen Schande lebte.
„Oh, Frank.“ Cecelia legte ihre andere warme Hand auf den Stapel. „Wie konntest du weiterleben?“
Für einen Moment wurde Francescas Miene weicher. „Declan Chandler fand mich und wir versteckten uns in einer Nische in einem Schornstein. Wir dachten, wir seien in Sicherheit, bis das Feuer ausbrach. Wir warteten so lange wie möglich, bis wir glaubten, die Männer seien davongeritten, bis der Rauch so dicht geworden war, dass wir ihm entfliehen mussten. Declan Chandler schaffte mich aus dem Haus und wir rannten auf den Wald zu. Da sah uns ein Mann, der zurückgeblieben war, um sicherzugehen, dass das Feuer alle Spuren des Verbrechens beseitigen würde. Dass nur die Asche der Toten übrig bleiben würde – von dem großen glücklichen Haus, das dort stand, seit die weiße Rose von York über dem Thron von England prangte.“
Francesca nahm das Taschentuch, das Cecelia ihr geholt hatte, wischte sich die Augen und putzte sich geräuschvoll die Nase. „Der Mann verfolgte uns bis in den Wald und Declan – er war ein Held – lenkte ihn ab.“
„Hat Declan … überlebt?“
Francesca schüttelte lange den Kopf und ihr Kinn zitterte vor unterdrücktem Schluchzen. „Ich habe überall nach ihm gesucht, aber es gibt keine Spuren davon, dass Declan Chandler jemals geboren wurde. Er war schließlich Waisenkind und wenn seine Mutter seine Geburt nie gemeldet hatte, dann … wurde er auch nicht vermisst. Was, wenn sein armer kleiner Körper irgendwo im Wald liegen gelassen wurde, oder vielleicht in einem Sumpf oder See? Ich habe die schreckliche Vorstellung, dass ich der einzige noch lebende Mensch bin, der noch weiß, dass es ihn gab.“ Ein paar Schluchzer entrangen sich ihrer schmalen Kehle, heisere kleine Laute. Sie verrieten, dass ihr Schmerz ebenso groß war wie der in Alexandras Herzen.
„Du hast ihn geliebt“, erkannte Alexandra.
„Pippa liebte ihn“, schniefte sie. „Und er liebte Francesca. Und Fernand liebte Pippa. Wenn wir uns nicht gerade stritten, war es die schönste Kindheit, die man sich vorstellen kann.“
Sie schwiegen für einen tränenreichen Augenblick und versuchten, das Ausmaß der Tragödie zu verdauen, bis schließlich Alexandra die unvermeidliche Frage stellte. „Wann bist du Francesca geworden? Oder vielleicht sollte ich fragen, warum wurdest du zu ihr?“
„Der Mont-Claire-Titel konnte nicht nur auf männliche Nachkommen übergehen. Das hieß, wenn eines der Cavendish-Kinder überlebt hätte, Junge oder Mädchen, hätte es den ganzen Besitz geerbt. Und so nahm mich das fahrende Volk, das auf dem Anwesen leben durfte, bei sich auf, färbte mir die Haare mit Henna rot, und als alle Formalitäten erledigt, die Treuhänder und Beamten bestochen und meine ‚Paten‘ beurkundet waren, wurde ich Francesca Cavendish. Man stellte mich bei Hofe vor und dann wurde beschlossen, dass ich auf ein Internat im Ausland gehen sollte.“
„Warum hat sich das fahrende Volk solche Mühe gemacht?“, fragte sich Cecelia. „Wegen des Mont-Claire-Geldes?“
„Nein“, beharrte Francesca. „Nein, Geld bedeutet diesen Menschen nichts. Sie taten es aus dem gleichen Grund, aus dem ich bis heute in dieser Farce ausharre …“ Sie wandte sich wieder Alexandra zu und das Feuer spiegelte sich in ihren Augen.
Alexandra nickte. Es schnürte ihr die Kehle zu. „Rache.“
„Genau.“ Francesca küsste Alexandra auf die Wange. Aus ihrem Blick sprach eine Mischung aus Wildheit und schmerzlicher Güte. „Alexander. Ich werde das Geheimnis um diesen Mord in unserer Vergangenheit wahren, wenn du das Geheimnis des Mordes in meiner Zukunft wahrst. Denn wenn ich herausfinde, wer für den Tod meiner Familie verantwortlich ist …“ Sie beendete den Satz nicht. Das war auch nicht nötig.
Alexandra erwiderte den Kuss und schmeckte das Salz ihrer Tränen, die sich mischten.
Francesca sah Cecelia an, die sich die Wangen abwischte. „Ihr tut mir beide so leid.“ Sie unterdrückte einen Schluchzer.
Alexandra richtete sich auf und klammerte sich an die beiden. „Ihr beide seid meine Familie“, schwor sie. „Ich will keinen Mann und auch keine Kinder. Kein Mann würde mich wollen und … und ich will auch keinen. Nie. Ich will nie wieder berührt werden.“
„Ich auch nicht“, fauchte Francesca. „Männer sind bösartige, fordernde, gewalttätige Schwachköpfe. Wir sind ohne sie besser dran.“
„Das denke ich auch“, flüsterte Cecelia. „Ich habe noch nie gehört, dass die Ehe glücklich macht. Das Leben wird uns noch an viele Orte führen, aber wir können immer zueinander zurückkehren. Um Urlaub zu machen. Um sich aufeinander zu verlassen. Wir sind jetzt durch Blut verbunden, so fest wie eine richtige Familie.“
Alexandra ließ sich wieder zurücksinken und legte sich die Hand aufs Herz. Sie legte Francescas Hand auf ihre und Cecelia folgte ihrem Beispiel. „Wir sind für immer verbunden“, wiederholte sie. „Durch Geheimnisse, Blut und Schmerz.“
„Und durch Vertrauen, Leidenschaft und Rache“, fügte Francesca düster hinzu.
„Und durch Freundschaft, Liebe und …“ Cecelia schniefte und drückte ihre Hand auf die der anderen, als könne sie das Herz darunter berühren. „Und Hoffnung. Denn ohne all das – welchen Grund hätten wir dann noch weiterzuleben?“
Die Ungeheuerlichkeit der Nacht schlug wie eine Brandung über Alexandra zusammen und ertränkte sie beinahe in Verzweiflung. Als ihre Freundinnen zurückweichen wollten, klammerte sie sich an sie. Ohne ein weiteres Wort scharten sie sich um sie und bildeten ein Nest aus Körpern und Dunkelheit. In diesem Augenblick gab es auf der ganzen Welt nur sie drei.
Aber so war es nicht. Der Morgen würde kommen und alle würden es erfahren. Oder nicht? Man würde merken, dass der Direktor nicht da war. Das Brennen zwischen ihren Beinen, das immer heftiger wurde, würde vielleicht noch schlimmer sein. Und sie fühlte sich schon wieder schmutzig. Sehnte sich nach noch einem Bad.
Sie musste lernen, zu verbergen, wer sie war. Was er aus ihr gemacht hatte.
Eine Mörderin.
Gott. Was, wenn sie dieses düstere Geheimnis nicht für sich behalten konnte?
Panik überwältigte sie, bis Cecelia näher an sie heranrückte und ihre Lippen im Dunkeln Alexandras Ohr streiften. „Diese Nacht wird dich ewig verfolgen“, flüsterte sie mit einer Qual, die niemand in ihrem Alter erleiden sollte. „Was dir genommen wurde, wird dir immer fehlen. Aber dein Körper wird heilen, Alexander, und du wirst stärker werden.“
Francesca lehnte die Stirn an Alexandras Schläfe und küsste eine Träne weg. „Dein Herz wird wieder schlagen lernen. Bis dahin beschütze ich dich. Das verspreche ich dir.“
Sie würden einander beschützen, schwor sich Alexandra.
Koste es, was es wolle.
1. Kapitel
Maynemouth, Devonshire, 1890
Zehn Jahre später.
Alexander,
nimm die Einladung nach Schloss Redmayne an. Ich bin in Gefahr. Ich brauche Dich.
Frank.
Aus zwei Gründen hatte Alexandra Lane sich während der ganzen Zugfahrt von London nach Devonshire diese sechzehn Worte durch den Kopf gehen lassen.
Erstens hatte sie sich Sorgen um Francesca gemacht, die sonst immer mehr erzählte als nötig. Die Kürze und Unbestimmtheit der Nachricht, die Alexandra jetzt in den Händen hielt, war beunruhigender als der Inhalt.
Zweitens konnte sie sich kein Einzelabteil erster Klasse mehr leisten und hatte in den letzten Stunden voller Anspannung einem stämmigen Mann mit groben Zügen gegenübergesessen, dessen Schultern für schwere Arbeit geschaffen waren.
Allein.
Er hatte es anfangs mit höflicher Konversation versucht, doch sie hatte ihn – ebenso höflich – abblitzen lassen und so getan, als sei sie in ihre Korrespondenz vertieft. Doch nun herrschte peinliche Stille, weil ihnen beiden bewusst war, dass sie nicht vier Zugstationen brauchte, um zwei Briefe zu lesen.
Es war furchtbar schlechtes Benehmen, das wusste sie. Sie hatte ihre Reisetasche die ganze Zeit über krampfhaft festgehalten und ab und zu die Hand in deren Tiefen wandern lassen, um nach der winzigen Pistole zu tasten, die sie immer bei sich trug. Die Geräusche der anderen Passagiere in angrenzenden Abteilen sorgten nicht per se dafür, dass sie sich sicherer fühlte. Doch sie wusste, dass sie sie schreien hören würden, und das verschaffte ihr etwas Erleichterung.
Sie hatte einen großen Teil der letzten zehn Jahre in der Gesellschaft von Männern verbracht und hatte gedacht, dass diese schmerzhaften Momente inzwischen nicht mehr so schlimm sein würden.
Ach, sie war mittlerweile eine Meisterin darin, eine Situation so zu manipulieren. Selbst wenn sie männliche Gesellschaft ertragen musste, ohne dass eine Frau dabei war, sorgte sie dafür, dass mehrere Männer anwesend waren. In den Kreisen, in denen sie verkehrte, benahmen sich die Leute, wenn sie unter Menschen waren.
Bisher hatte es funktioniert.
Alexandra hielt sich gut fest, während der Zug bremste, und hauchte ein stilles Gebet der Erleichterung, als sie endlich am Ziel waren. Sie hatte nicht gewagt, aufzusehen, um nicht gezwungen zu sein, mit ihrem unerwünschten Begleiter Konversation zu machen.
Regen lief wie Tränenströme am Fenster des Abteils hinunter und warf unheilvolle Schatten auf die widersprüchlichen Papiere in ihren Händen. Eins war eine Einladung zur Hochzeit, das andere Francescas erschreckender Brief.
Vor einem Monat hätte sie ihr gesamtes Erbe darauf verwettet, dass Francesca Cavendish die Erste der Red Rogues sein würde, die sich dem Bund der Ehe unterwarf.
Vor einem Monat hatte sie auch gedacht, dass sie ein Erbe zu verwetten hätte.
Es hatte ausgesehen, als würde ihre kleine Gesellschaft das Versprechen einhalten, das sie einander in ihrer Jugend gegeben hatten – desillusionierte Mädchen, die nie heiraten würden.
Bis zu der Einladung zu einem Maskenball anlässlich einer Verlobung – Gastgeber war der Duke of Redmayne –, die am gleichen Tag eingetroffen war wie die rätselhafte, alarmierende Nachricht ihrer Freundin.
Die Einladung hatte ebenso zwiespältig geklungen. Die zukünftige Duchess of Redmayne würde auf dem Ball entschleiert werden. Alexandras Umschlag mit der Einladung enthielt eine Bitte an sie, Brautjungfer zu sein.
Der nachfolgende Hilferuf von Francesca – Frank – hatte in einem winzigen Kuvert gesteckt, verschlossen mit dem Siegel der Red Rogue Society, das sie sich vor ein paar Jahren zugelegt hatten.
Alexandra hatte nicht einmal gewusst, dass Francesca von ihren Abenteuern auf dem Kontinent zurückgekehrt war. Als sie das letzte Mal von ihr gehört hatte, war die Gräfin als Missionarin in Marokko gewesen. Mit keiner Silbe hatte sie in ihren Briefen einen Verehrer erwähnt.
Jedenfalls keinen, mit dem es ernst war. Und ganz bestimmt keinen Herzog. Francesca hatte ein Talent dafür, in Schwierigkeiten zu geraten, und neigte dazu, Gefahr für ein Abenteuer zu halten.
Was konnte ihrer furchtlosen Freundin also Angst einjagen? Die Ehe offenbar, dachte Alexandra mit einem Grinsen.
Zweifellos ein riskantes Unterfangen.
Und gefährlich.
Alexandra glättete die Röcke ihres Reisekleides, dessen eleganter Tweed jedes Jahr schäbiger und abgetragener aussah. Sie hätte besser darauf achtgeben sollen. Sie hätte nicht damit rechnen sollen, dass ihr Vater ihr ständig neue kaufen könnte.
Der Zug trudelte holprig in den Bahnhof von Maynemouth ein und die Aktentasche des Mannes fiel von dem Sitz neben ihm. Sie landete zu ihren Füßen und rutschte halb unter ihren Rock.
„Verzeihung, Madam“, sagte er mit starkem Akzent, der ihn als Bewohner des Kontinents auswies, beugte sich vor und griff nach der Aktentasche, die unter ihr lag. „Ich will nur …“
Alexandra sprang auf und taumelte zur Tür des Abteils. Sie stürmte auf den schmalen Gang und stützte sich an der dunklen Holzvertäfelung ab, als sie an den vernünftigeren Reisenden vorbeiging, die warteten, bis der Zug endgültig hielt, und erst dann aufstanden. Hätte sie sich noch verrückter benehmen können? Ja. Und sie hatte es auch schon getan – oft! Sie klammerte sich an den Türrahmen, als der Zug hielt, und sobald der Kofferträger die Tür öffnete, war sie mit einem Satz in der Meeresbrise von Devon. Sie würde diesen Zwischenfall vergessen, sagte sie sich, als sie sich unter dem Unterstand versteckte, um auf ihr Gepäck zu warten. Das tat sie immer. Peinlichkeiten waren nichts gegen Sicherheit.
Eine halbe Stunde später stand Alexandra in den Qualm der Lok und den Nebel der See eingehüllt auf dem Bahnsteig und kaute nervös auf ihrer Unterlippe. Sie war bereit für den Aufbruch zum berüchtigten Schloss Redmayne. Falls Cecelia überhaupt auftauchte. Die Kutsche hätte vor einer Viertelstunde kommen sollen, doch Alexandra hätte wissen müssen, dass sich ihre liebe zerstreute Freundin verspäten würde. So gut sich die Frau auf Zahlen verstand, etwas Einfaches wie die Zeit überforderte sie. Deswegen hinkte Cecelia der restlichen Welt immer eine halbe Stunde hinterher.
„Haben Sie eine Begleitung, Miss?“ Der liebenswert junge, schlaksige Kofferträger mit dem anscheinend aufgemalten Schnurrbart musterte sie unverschämt. „Smythe“ hieß er laut seinem glänzenden Namensschild. „Ich habe zu tun, verstehen Sie, aber ich möchte Sie ungern allein lassen. Bei uns summt es wie in einem Bienenstock, jetzt, da all die hohen Tiere zu der großen Hochzeit kommen. Und … Nehmen Sie es mir nicht übel, Miss, aber meine Mutter ist krank und ich möchte mir lieber kein Trinkgeld entgehen lassen, indem ich herumstehe.“
Indem ich neben einer verarmten Jungfer stehe, sagte er nicht.
Das war auch nicht nötig.
„Natürlich.“ Alexandra hielt sich nicht damit auf, zu erklären, dass sie eine der Brautjungfern bei der erwähnten großen Hochzeit sein würde. Sie sagte auch nicht, dass sie zu den „hohen Tieren“ gehörte, von denen er gesprochen hatte. Als Tochter eines Grafen hätte sie verlangen können, dass er sie „Mylady“ nannte und nicht „Miss“.
Stattdessen nahm sie einen kostbaren halben Penny aus der Reisetasche, die sie in Kairo gekauft hatte, und drückte ihn dem jungen Mann in die behandschuhte Rechte. „Es kommt gleich jemand und holt mich ab. Danke.“
Sie war erleichtert, als der Kofferträger davoneilte, um sich auf die Suche nach adligen Reisenden zu machen. Und es stiegen eine Menge von ihnen aus dem Zug. Das erkannte sie, auch wenn sie ihnen möglichst aus dem Weg gegangen war, für den Fall, dass sie sie in der zweiten Klasse gesehen hatten. Für den Fall, dass sie von dem finanziellen Absturz ihrer Familie gehört hatten und unbedingt etwas zu der unverheirateten Tochter sagen mussten, die jetzt zu alt und zu intelligent war, um noch einen Mann abzubekommen.
Wenn sie die Wahrheit wüssten, was würden sie sagen? Es war schon schwer gewesen, eine Schande mit sich herumzuschleppen. Sie hatte unterschätzt, was die Last eines zweiten Skandals mit ihr machen würde.
Bald ist alles aus, dachte sie. Die Nachricht vom finanziellen Ruin ihrer Familie würde nicht lange ein Geheimnis bleiben. Und wenn ihr letztes Geld verbraucht war, würde sofort ans Licht kommen, was sie vor langer Zeit getan hatte.
Denn wenn man nicht einmal mehr seine Rechnungen bezahlen konnte, konnte man seinen Erpresser erst recht nicht mehr bezahlen.
Es war gut, dass Francesca jetzt heiratete, denn so hatte sie sich die Position einer Herzogin gesichert, wenn der Skandal losbrach. Und die gute Cecelia hatte weder die Verantwortung, die ein Titel mit sich brachte, noch den Schutz, den er bot.
Ihr Ruf bedeutete ihr nur wenig, vor allem, da sie außerhalb ihres akademischen Kreises nur wenig bekannt war. Doch ein ruinierter Ruf war nichts gegen die Schlinge des Henkers … und die drohte ihnen vielleicht allen.
Alexandra drückte die Hand auf den Bauch, der vor Angst schmerzte, und versteckte sich hinter ihrem niedrigen Gepäckhügel. „Hügel“ deshalb, weil die Unmengen an Koffern, Hutschachteln und Kleidertaschen, die gerade aus dem Zug geladen wurden, dagegen richtige Berge waren, die im Nebel emporragten.
Der Earl und die Countess of Bevelstoke eilten vorbei, eingehüllt in ihre Pelze und Umhänge, und ein Heer aus Dienern und Kofferträgern – darunter Smythe – brachte ihre Sachen zu einer prächtigen Kutsche.
Lord und Lady Bevelstoke hatten zu den engsten Freunden ihrer Eltern gehört. Bis vor Kurzem.
Glücklicherweise stieß der Zug wieder eine Rauchwolke aus, die sie einhüllte und vor neugierigen Blicken schützte.
„Alexandra? Lady Alexandra Lane? Bist das wirklich du?“
Alexandra fuhr zusammen, als sie ihren Namen hörte, doch als sie sah, wer hinter ihr stand, war ihr Lächeln echt. „Julia? Julia Throckmorton?“, begrüßte sie sie.
Sie umarmten sich mit dem Überschwang alter Freundinnen, die sich lange nicht gesehen haben, und wichen dann zurück, um zu sehen, was die Jahre beim Gegenüber bewirkt hatten. Sie hatten Julia besser behandelt als sie, denn ihre alte Schulfreundin war mit mehr Perlen und Saphiren geschmückt, als für Reisekleidung nötig war.
„Wie lange ist es her?“, fragte Alexandra.
Julia schob eine widerspenstige goldene Locke unter ihre modische Mütze und kniff die Lippen zusammen. „Mindestens sechs Jahre“, sagte sie. „Das letzte Mal haben wir uns in dem Café in Boston getroffen, in dem Sommer, als mein Mann und ich unsere große Reise durch New England gemacht haben. Und davor war es auf de Chardonne. Kannst du glauben, dass es zehn Jahre her ist?“
„Nein“, antwortete Alexandra ehrlich. Es kam ihr vor wie gestern – und dennoch war es eine Ewigkeit her.
„Wo ist Lord Throckmorton? Ihr kommt doch beide zur Hochzeit, nehme ich an?“
Der Glanz in Julias Augen erlosch ebenso wie ihr Lächeln. „Natürlich – du hast nicht davon gehört. Du warst ja in Griechenland, als mein Mann vor zwei Jahren gestorben ist.“
Alexandra griff nach ihrer Hand. „Oh, Julia, es tut mir so leid. Ich hatte nichts davon gehört, und wenn ich unterwegs bin, lese ich nie Zeitung. Ich bin eine hoffnungslose Briefeschreiberin. Verzeih mir.“
„Mach dir keine Gedanken deswegen.“ Julia lächelte wieder, aber nicht mehr so strahlend wie zuvor. „Ich weiß, dass du genug eigene Sorgen hast, du Ärmste.“ Sie tätschelte Alexandra beinahe herablassend die Hand, als wolle sie sie an ihre geänderten Verhältnisse erinnern, aber nicht so taktlos sein, es auszusprechen.
O ja – darum hatten sie Julia, die sie allgemein als Freundin betrachteten, nie in den Kreis der Red Rogues aufgenommen. Es hatte nicht daran gelegen, dass sie keine roten Haare gehabt hatte, sondern an ihrer Neigung, etwas hochnäsig zu sein. Dabei hatte sie keinen Grund, sich überlegen zu fühlen. Sie war mit Lord Walther Throckmorton, dem Viscount Leighton, verheiratet worden, einem Mann, der zwanzig Jahre älter war als sie und doppelt so viel wog, weil er so maßlos trank.
„Kannst du dir das vorstellen – in meinem Alter schon Witwe zu sein? Obwohl Lord Throckmorton mir ein unanständig großes Vermögen hinterlassen hat“, flüsterte Julia. Dass sie es erwähnte, machte es noch unanständiger. „Und jetzt genieße ich es, mit Lord und Lady Bevelstoke durch die christlichen Länder zu reisen.“
„Wie schön für dich.“ Alexandra hoffte, dass sie aufrichtig klang.
Falls Julia es merkte, sagte sie nichts davon. „Dieser Duke of Redmayne ist so geheimnisvoll. Ich habe gehört, er sei ein Ekel. Hast du eine Ahnung, mit wem er verlobt ist?“
„Ich kann es dir nicht sagen.“ Alexandra seufzte, sie hatte den Klatsch jetzt schon satt. Aber sie musste sich eingestehen, dass sie sich auf Julias entgeistertes Gesicht freute, wenn Francesca als Braut entschleiert wurde. Die beiden hatten sich nie verstanden.
„Lady Throckmorton“, rief Lady Bevelstoke aus der Kutsche und übertönte den heftiger werdenden Sturm. „Wir sollten wirklich aufbrechen – es warten wichtige Leute auf uns.“
Die leichte Betonung von „wichtige“ entging Alexandra nicht.
„Dann beeilen wir uns besser.“ Julia küsste sie auf die Wangen und vergrub sich tiefer in ihren Pelz. Ein Diener begleitete sie derweil zur Kutsche und hielt die ganze Zeit einen Schirm über sie. „Au revoir.“
Beim Knall der Peitsche sauste die Kutsche der Bevelstokes in Richtung einer der ältesten und vielleicht großartigsten Festungen, die es noch auf britischem Boden gab. Schloss Redmayne.
Alexandra beobachtete den Sturm und fragte sich, ob das Schloss – oder das Meer – an einem klaren Tag von hier aus sichtbar war. Das Wetter war merkwürdig und unheilvoll. Die abendliche Dunkelheit brach viel früher an als sonst. Die Wolken waren so schwer vom Regen, dass sie beinahe schwarz erschienen. Blitze zuckten im Sturm, und dennoch hing ein dunstiger Nebel über dem Boden, der sich vom Regen nicht vertreiben ließ. Die vorbeihastenden Reisenden wirbelten ihn auf und er hüllte sie ein und verlieh dem Durcheinander eine gewisse Eleganz.
Das kleine Dorf Maynemouth lag in der Nähe. Bezaubernde Straßen, gesäumt von Geschäften, nahe an den Schienen. Die schöneren Höfe, Cottages und Herrenhäuser thronten weiter oben auf dem Hügel, sodass der Lärm der Züge und der Lärm der Industrie ihre berüchtigte Ruhe des Südens nicht störten.
Eine heftige, plötzliche Windböe ließ ihr die Regentropfen wie Nadeln ins Gesicht prasseln. Als Alexandra mit ihren Sachen unter dem Vordach stand, taten sich Wind, Sturm und die vorbeieilenden Passagiere zusammen, um ihr fadenscheiniges Reisekleid mit vereinten Kräften zu durchweichen.
Beeil dich, Cecelia, drängte sie in Gedanken und spannte ihren Schirm gegen die Attacke des Regens auf, die ebenso schnell vorüberging, wie sie gekommen war.
Ein Blitz zerriss die Wolken am Himmel und schoss grell und ungebändigt auf den Zug zu.
Alle Anwesenden am Bahnhof schienen stillzustehen und den Atem anzuhalten. Ehrfürchtig warteten sie den Donner ab, bevor sie ihre Tätigkeiten wieder aufnahmen.
Das nächste Poltern war so gewaltig, dass Alexandra sicher war: Man hätte den Zusammenprall der Wolken gesehen, wenn das Vordach nicht den Himmel verborgen hätte.
Jetzt, da die meisten Passagiere zu ihren eigentlichen Zielen aufgebrochen waren, schwappte eine Welle aus durchnässten Kaufleuten und ihre Arbeiter auf den Zug zu. Auf den rostigen Schienen wurden die Waggontüren aufgerissen. Raue Stimmen brüllten Befehle und Flüche, Waren wurden ausgeladen und auf dem Bahnsteig deponiert.
Eine Rampe wurde zur Tür eines Viehwagens verlegt und eine Gruppe von Arbeitern führte vier unruhige Vollblutpferde an Stricken hinunter und zu einer wartenden Kutsche.
Eine Stimme übertönte den Lärm und ließ die ungehobelten Männer ebenso aufhorchen wie der Donner. Alexandra blinzelte über den Bahnsteig, bewunderte die Pferde und hoffte zu erkennen, welchem Mann die Stimme gehörte. Sie hatte einen gewissen Nachhall. Etwas Klangvolles und Gebieterisches. Sie brachte in ihr die gleichen Saiten zum Schwingen wie die alten Glocken einer Kathedrale.
„Er ist zu unruhig“, rief die Stimme aus dem Innern des Viehwagens. Jemand warf zwei Führstricke hinaus. „Ihr zwei da – haltet das Seil gespannt, bis ich ihm die Augen verbunden habe!“
Als der Adel verschwunden war – mit Ausnahme von Alexandra –, schlüpfte Smythe zwischen den verbliebenen Reisenden hindurch und huschte auf den Viehwagen zu, als befinde sich darin das achte Weltwunder. Was weckte solche Neugier? Das Tier oder der Mann?
Smythe schnappte sich den Strick und zog vorsichtig daran, bis er nicht mehr durchhing. Seine Entschlossenheit machte seinen Mangel an Statur fast wett, als er sich das Seil mehrmals den Unterarm und das Handgelenk wickelte, bevor er es fest in die Hand nahm. Alexandra war zu weit weg, um ihn vor diesem Wahnsinn zu warnen, und hoffte inständig, dass jemand anders aufmerksam sein und es tun würde.
Vergeblich.
Ein kräftiger Lakai bückte sich, um das Seil auf der gegenüberliegenden Seite der Planke zu ergreifen, doch bevor er es sichern konnte, blendete ein weiterer Blitz alle.
Ein unmenschlicher Schrei zerriss den Sturm und dann sprang der größte Hengst, den Alexandra je gesehen hatte, mit einem anmutigen Satz aus dem Waggon und ließ die Rampe hinter sich. Als er mit den Hufen auf dem Boden landete, vollführte er einen wilden, graziösen Tanz. Die Hölle brach los, denn der schwarze Hengst schlug aus und traf jeden, der das Pech hatte, im Weg zu sein. Mehrere Männer gingen zu Boden. Es ging so schnell, dass sie nicht sicher war, ob sie gestürzt waren, einen Tritt abbekommen hatten oder einfach nur beiseite gesprungen waren.