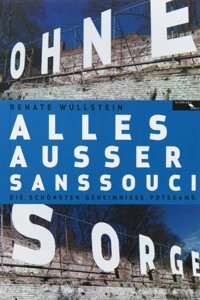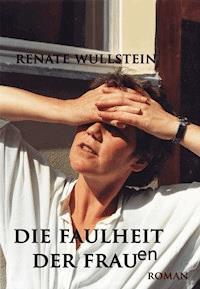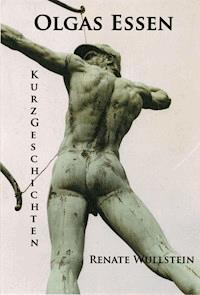Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist ja ein sehr spezieller Blick auf die alte DDR, "speziell" durch die Vita der Erzählerin und auch durch ihre große Offenheit, das ist schon spannend. Die Sprache ist ohne Fettpolster und Schweißtropfen, sie ist sauber, treffend, ohne Verrenkung, ohne Gesinnungsdruck, ohne jede Peinlichkeit. Ihre Sprache will nicht dauernd furchtbar gut sein, sondern ist meist nur klar und richtig und erfreut dennoch in regelmäßigen und zuverlässigen Abständen mit poesie-nahen "Hits". Meist entstehen diese Edelsteine durch Verknappung. Respekt! Sten Nadolny (Auszug aus dem privaten E-Mail-Briefwechsel) Die Entscheidung, aus dem Hinterhof im Berliner Prenzlauer Berg wegzuziehen, damit das zukünftige Kind nicht neben einem Kohlenhof aufwachsen würde, fiel 1981. Während einer Reportage-Arbeit im Havelland fand die junge Autorin Renate Wullstein den Bauernhof in Paretz, der zum Verkauf stand. Aufs Land, ein alter Traum erfüllt sich. In Tagebüchern und Briefen dokumentiert sie den Alltag, nicht ahnend, dass es die letzten Jahre der DDR sein würden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Renate Wullstein
Stadt Land Flucht
Das ungewöhnliche Leben in der herrlich tristen DDR
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Wildnis
1983, Oktober
Die Einladung
Schreibverbot
Der Vater und die Genossen
Anhang
Antrag auf Erlassung der Staatsbürgerschaft der DDR
Literaturzentren in der DDR
Impressum neobooks
Wildnis
Haus und Hof und Garten waren verwildert. Um das Haus herum wuchs ein Meer von Brennnesseln. Die Scheune fiel fast ein und der Stall war voll mit rostigen Gerätschaften, vertrocknetem Mist und Stroh. Milchkannen, Bierflaschen mit Schnappverschlüssen, Futtertröge und Kaninchenkisten. Der Teich hinter dem Stall war vom Schilf fast zugewachsen. Im Keller stand das Wasser knöchelhoch. Das Haus war seit Jahren unbewohnt. Die Eltern der Besitzerin waren darin gestorben, und niemand hatte es ausgeräumt. Berge von Wäsche, Möbel aus den dreißiger oder vierziger oder fünfziger Jahren. Hausrat, Emaille-Schüsseln, Wäscheklammern, Kannen und Töpfe. Fünf kleine Zimmer und eine Küche mit einem Feuerherd. So fand ich es 1981 vor.
Das Bauerngehöft sah aus einiger Entfernung wirklich verloddert aus. Noch wohnte ich in Berlin, arbeitete im Friesenstadion als Schwimmeisterin, war fast 30 Jahre alt und alle Voraussetzungen waren erfüllt. Ich konnte schwanger werden, und mein Kind würde nicht auf einem Hinterhof im Prenzlauer Berg aufwachsen, sondern hier, in Paretz. Und 1982 war es soweit.
Ich wollte außer Aufräumen am Haus nichts ändern. Die Bücher, eine Essecke, ein Bett und ein Kinderzimmer, das würde genügen. Aber es kam anders.
Wolfgang machte sich ans Werk. Der Rasen im Hof war gemäht. Zwei große Oleander in Töpfen standen links und rechts der Steintreppe. Jeden Morgen hielt er sich im Garten auf. Ein großes Beet mit Astern, die noch nicht zu blühen begonnen hatten und noch nicht den herben Duft, den ich so liebte, verströmten. Der Rosenkohl würde in diesem Winter eine gute Ernte liefern. Wolfgang begutachtete die Gemüsebeete, zupfte hier und da Unkraut aus der Erde und erntete einige Sellerie-Knollen.
Ich lag noch im Bett, eiferte dem Vorbild der Königin Luise nach, von der es hieß, sie habe in der Regel bis elf Uhr vormittags geschlafen, und als Wolfgang hereinkam, warf ich einen kurzen, sehr missmutigen Blick auf den Sellerie, schloss jedoch die Augen wieder. Da war Hannes, unser Sohn, fast ein Jahr alt, stand in seinem Bett, die Händchen an die Gitterstäbe geheftet und sah aus dem Fenster. Auf dem Teppich lag meine aktuelle Lektüre: Die „Briefe der Königin Luise“.
Paretz, den 10. September 1799
An Friedrich Wilhelm III.
Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König und Herr!
Unter den vielen Bittschriften, die Ihre Königliche Majestät täglich bekommen, möge doch der Herr wollen, daß diese mit einem gnädigen Blick beleuchtet werde, damit meine alleruntertänigste, demütigste, wehmütigste Bitte nicht unbefriedigt bleibe. Hierbei liegende Strümpfe sollen als Probe meiner Geschicklichkeit in der Strickerkunst zum Beweise dienen und mir hoffentlich mein Gesuch zu erlangen helfen, es besteht nämlich darin: “Daß Ihro Majestäten die Gnade für mich hätten und mir zukünftig alle dero Strümpfe stricken ließen und mir dabei den Titel als wirkliche Hofstrickerin allergnädigst erteilen ließen.”
Diese hohe Gnade würde ich all mein Leben in tiefster Untertänigkeit erkennen und mit dankbarem Herzen ersterben. Ew Königl. Majestät als alleruntertänigste Magd und Untertanin.
Luise
Untertänigstes Postskriptum
Ist noch zu bemerken, daß jede Masche, so ich knütten würde, von Dankbarkeit durchdrungen wäre.
Voilà.
1983, Oktober
Am frühen Morgen ist es genauso wie in Berlin. Ich liege im Bett und schlafe. Aber dann geht’s schon los, denn in Berlin wohne ich nicht mit Wolfgang zusammen, aber hier. Er steht halb sieben auf und kommt in die Küche, die an mein Zimmer grenzt. Die Tür dazwischen hat er entfernt. Er hat alle Türen entfernt. Bis auf die kleine Bibliothek hinten gibt es keinen Raum, in dem ich unbeobachtet schreiben könnte, da steht nun allerdings der Fernseher. Am liebsten schreibe ich in der Küche. Hannes schläft im Kinderbett in meinem Zimmer, daneben mein Schreibtisch mit Schreibmaschine. Wenn Wolfgang morgens kommt, steht Hannes im Bett und guckt aus dem Fenster. Ich tue, als ob ich schlafe. Wenn der Tee fertig ist stehe ich auf, manchmal bleibe ich auch liegen.
Wir wohnen am Rand des Dorfes; hinter uns nur noch die Apfelplantagen. Gelbe Köstliche. Wolfgang fährt mit dem Sieben-Uhr-Fünfzehn-Bus nach Potsdam zur Arbeit.
Nachdem ich aufgestanden bin, fahre ich mit dem Rad zum Konsum und zur Post, um Milch und Zeitungen zu holen (und Post?). Ich heize oben unterm Dach mein Zimmer, mein zukünftiges Zimmer. Es muss renoviert werden. Die anderen Räume hat Wolfgang schon geheizt. Es sind hohe weiße Öfen aus dem 19. Jahrhundert, in die man riesige Holzkloben stecken kann. Der Rauch von glimmenden, knackenden und knisternden Scheiten schwebt unter der niedrigen Decke. Meine Aufgabe ist es, die Öfen zuzuschrauben.
Hannes spielt im Bett, schläft oder singt oder schüttelt den Kopf. Ungefähr um zwölf frühstücke ich und lese Zeitungen. Der Junge bekommt einen Pamps aus Kartoffeln, Mohrrüben und Fleisch. Seine großen blonden Locken sind leicht wie Federn. Im Dezember wird er ein Jahr alt.
Mir fehlt die Lust auf Hausarbeit, aufräumen, saubermachen. Am Nachmittag schreibe ich wieder. Später höre ich Radio und Schallplatten. Sonst tue ich nichts. Wenn Wolfgang gegen vier Uhr kommt, unterhalten wir uns. Danach geht er auf den Hof. Er gestaltet das Grundstück um. Er mäht das Gras, pflanzt Blumen und südländische Sträucher. Im Sommer müht er sich wieder, den Oleander zum Blühen zu bringen. Er will einen Springbrunnen bauen. Ein Springbrunnen aus Sandstein mit Putten im Zentrum des Hofes. Aus ästhetischen Gründen. An einem Wasserleitungssystem tüftelt er seit einigen Monaten. Er will keinen Strom dafür benutzen. Der Teich hinter dem Stall ist die Quelle. Wie hatten die Römer ihre Springbrunnen zum Sprudeln gebracht? Das ist eine der Fragen, mit denen Wolfgang sich beschäftigt. Im Haus gibt es kein Wasser, nur die Pumpe auf dem Hof. Paul erzählt in Berlin herum, in Paretz gäbe es fließendes Wasser. Aber nur im Keller. Das stimmt. Weil der Graben vom Teich zu den Erdlöchern zugeschüttet wurde, drückt das Grundwasser regelmäßig ins Gebäude. Paul kritisiert bei jeder Gelegenheit den Weggang seines besten Freundes aus der Stadt. Dahinter stecke immer eine Frau. Das stimmt auch. War aber anders gedacht. Ich wollte flüchten. Ein Haus gekauft für mich und das Baby. Lange gesucht.
„Wenn du diese Hütte kaufst, sind wir geschiedene Leute“, sagte Wolfgang. Er wollte kein Kind. Ich war aber schon dreißig.
„Du bist wahrscheinlich nicht der Vater“, sagte ich. „Wir werden uns trennen.“
So fing es an.
Kaum war Hannes geboren, hielt Wolfgang ihn im Arm.
Hanna warnte mich: „Das erste Jahr ist das schlimmste.“
Sie meinte das Baby. Das sind die Sprüche.
Früher beherbergte das Gehöft einen Kolonialwarenladen. Die Inschrift an der Hauswand ist schon halb verschwunden.
Wir sammeln bei unserem Nachbarn Armin heimlich die Haselnüsse auf, weil seine Frau bis zur Scheidung in Berlin lebt und Armin meistens blau ist. Außerdem wachsen auf seiner Schafswiese Tintlinge, die wir zum Abendbrot essen. Im Augenblick haben wir keine Kohlen und kein Geld. Im Garten wächst aber Spinat. Letztens sammelten wir Äpfel. Ein Freund transportierte zwei Hänger voll zur Mosterei, und wir bekommen 50 Flaschen Saft und 50 Flaschen Wein (er auch). Ich sammle mit dem Handwagen Holz, und wir warten auf Wolfgangs Mutter, die einen fertigen Braten mitbringt. Nächste Woche fahre ich zum Schriftstellertreffen nach Petzow und esse mich satt.
Und Wolfgang freut sich, wenn er mal mit Hannes allein sein kann.
22. Oktober
Der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Ich dachte bisher der Sommer (Frühling kann ja jeder sagen). Der Sommer ist es aber nicht, sondern der Herbst. Es zieht mich raus. Sogar wenn Nebel ist. Besonders bei Nebel. Als ich mit Hannes, er im Kinderwagen, ein Stück gegangen war, kam plötzlich die Sonne raus und der Nebel verschwand. Da sahen wir eine große Wiese mit Kühen. Wir gingen hinterm Dorf entlang, wo man die Scheunen und Ställe sieht, und die Hühner. Ich wollte nachsehen, ob es in unserer Gegend wirklich keine Pilze gibt, wollte wenigstens ein paar Tintlinge finden, sah sie am Wegesrand, aber die waren schon zu Tinte geworden. Klein sind sie weiß und riechen essbar, später sind sie schwarz und matschig. Wir saßen an der Havel und schauten aufs Wasser. Das heißt, Hannes blickte nur hin, wenn ein Lastkahn vorbeischwamm und tutete, und wenn hinterher die Wellen ans Ufer schwappten. Die Havel ist hier so breit wie ein See. Am Strand konnte ich durch das Wasser bis auf den Grund sehen. Im Sommer nicht. Im Sommer ist das Wasser trübe. Ich bewunderte das klare Wasser und fischte Muscheln für Hannes. Er betrachtete sie und spielte eine Weile damit. Mir wird klar, dass man dem Kind alles gibt, was man früher selbst behielt. Also sammelte ich welche für mich dazu. In Zukunft werde ich auch eine Banane essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Zurück gingen wir mitten durch das Dorf. Der Konsum war geschlossen. Wir trafen Leute und grüßten, obwohl wir sie nicht kennen. Das Grüßen macht Spaß. Am meisten freuen sich die ganz alten Leute. Manchmal passiert es mir mitten in Berlin: Ich grüße aus Gewohnheit fremde Leute.
Heute Nachmittag fragte Wolfgang, was ich eigentlich den ganzen Tag lang tue, hier auf dem Dorf.
„Nichts“, sagte ich. Ich schreibe nur alles auf.
Sein Fleiß macht mir Sorgen. Wenn er von der Arbeit kommt, geht er auf den Hof, verbrennt Laub und pflanzt Rosen. Er mischt Zement, hat dann einen Klotz, aus dem er eine Putte hauen wird, einen zusammen gekauerten dicken Engel in Lebensgröße. Ursprünglich wollte Wolfgang auch deshalb nicht mit aufs Land ziehen, weil er meinte, hier keine schönen Frauen zu treffen. Außerdem gibt es keine Kaffeehäuser, wo man Kontakte knüpfen könnte. Deshalb fährt er regelmäßig nach Berlin. Zurzeit ärgert er sich über den Herbst, weil es so früh dunkel wird. Heute Morgen merkte er erst an der Bushaltestelle, dass sein Fahrgeld nicht reichte. Aber die Busfahrer kennen uns. Der von heute, der ältere mit den schneeweißen Haaren hat ihm die Fahrt geschenkt. Einmal ist früh der Bus ausgefallen, dann vermissten wir wochenlang den einen Busfahrer, der kam jedoch wieder. Ich freue mich auf den Winter, da bleibe ich die ganze Zeit im Haus.
Noch Oktober
Armins neue Freundin heißt Heide. Sie erträumt sich eine Kommune in Paretz, dann lohne sich wenigstens das Einwecken von Obst und das Herstellen von Chutney. Mit ihrem Wartburg fuhren wir alle zusammen am Sonntag in die Pilze. Auf dem Rückweg stahlen wir Tomaten vom Anhänger eines Traktors, der direkt vor unserem Haus stand. Und am selben Abend wurde alles verarbeitet.
Zuerst die Pilze. Dann die Tomaten.
Armin hat eine riesige Küche.
“Gib mir mal einen ganz großen Topf”, sage ich zu ihm.
Er verschwindet, kommt zurück, läuft in der Küche umher, verschwindet wieder. Aber wo ist der Topf.
”Armin”, sage ich, “du schneidest die Pilze.“ Der Hausherr ist unfähig, auf einem Platz zu verharren. Er rennt erneut durch die Gegend, auf den Hof, in den Keller. Wir schreiben ihn ab. Wolfgang säubert die Pilze und bereitet sie zum Trocknen vor. Heide pellt die Tomaten so gut es geht. Sie sagt, wir hätten sie vorher abbrühen sollen. Ich schmore eine Portion Pilze zum Abendbrot. Wir stellen fest, in diesem Haushalt gibt es keinen großen Topf wie wir ihn für das Chutney brauchen. Ich nehme einen Wassereimer aus Blech, säubere ihn und stelle ihn auf den Gasherd. Die geschnippelten Tomaten rein geschüttet. Es wird nach Rezept gearbeitet, nur reichlicher von allem, mehr Knoblauch und Petersilie. Gebratene Senfkörner, die aus der Pfanne springen und leise knallen. Zwiebeln. Peperoni aus unserem Garten. Es kocht und kocht; sieht blass aus und wässrig. Gar nicht nach Chutney. Wir müssen dringend pürieren. Niemand von uns hat elektrische Küchengeräte.
“Armin, bring mal die Bohrmaschine!” ruft Wolfgang.
“Sofort”, kommt die Antwort.
Nach ungefähr einer halben Stunde sage ich: ”Wenn jetzt nicht augenblicklich die Bohrmaschine eingesetzt wird, können wir Gemüsesuppe essen.”
Die Bohrmaschine kommt.
Wolfgang hält sie in den Tomaten-Eimer. Ich verlasse die Küche. Es klingt, als würde das Gerät jeden Moment explodieren. Durch einen Spalt blinzle ich zur Tür hinein. “Guck mal”, ruft Wolfgang begeistert. “Die ganze restliche Pelle bleibt am Bohrer hängen.”
Es wird ein gut aussehender dicker Brei. Heide füllt das Chutney in Schraubgläser. Jede Partei erhält vier große und 1½ kleine. Jetzt noch die Pilze waschen, die zum Sauer-Einlegen gedacht sind. Ich schäle Zwiebeln und suche im Küchenschrank Einlegegewürze. Der Zucker ist alle. Beim Chutney draufgegangen. Essig ist drüben in unserem Haus, kein Zucker. Armin reicht mir Würfelzucker, den löse ich auf.
Wir sind alle zufrieden, aber erledigt. Heide wollte im Fernsehen die Chinesische Oper gucken. Sie schläft jedoch ein.
Die Einladung
Verlag Neues Leben Berlin
vom 25. bis 28.10.83 findet unsere diesjährige Prosa-Werkstatt statt, zu der wir Sie hiermit herzlich einladen. Hauptsächlich werden wir wieder neue Texte zur Diskussion stellen.
Bitte teilen Sie uns auf beiliegender Karte mit, ob Sie teilnehmen und ob Sie lesen werden.
Die Werkstatt findet im Schriftstellerheim „Friedrich Wolf“ in Petzow statt. Man fährt mit dem Schnellverkehr von Berlin-Karlshorst oder Schönefeld bis Potsdam-Hauptbahnhof. Von dort mit dem Bus bis Petzow, Holländer Mühle. Die Anreise sollte möglichst bis 12.00 Uhr erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
Walter Lewerenz
Cheflektor