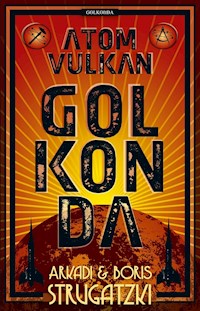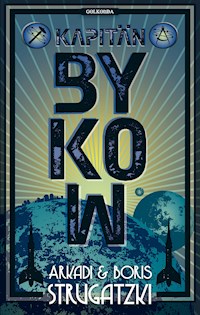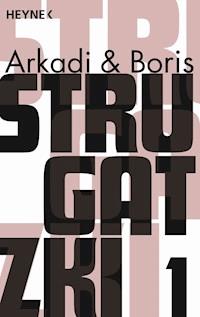9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das legendäre Meisterwerk jetzt neu übersetzt
Red Shewhart ist ein Stalker, ein Glücksritter, der illegal immer wieder in die Sperrzone eindringt, in der einst die Aliens gelandet sind. Dort spürt er die Hinterlassenschaften der Außerirdischen auf, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Niemand weiß, wie diese Artefakte funktionieren und wozu sie einmal gedient haben. Manche von ihnen bergen tödliche Gefahren, während andere die Unsterblichkeit versprechen. Red und sein Freund Kirill suchen nach einem ganz besonderen Gegenstand, der sie so reich machen wird, dass sich die Stalker nie wieder ins Sperrgebiet wagen müssen. Doch die Zone gibt ihre Geheimnisse nicht so einfach preis ...
Die Romanvorlage zum gleichnamigen Film-Klassiker von Andrei Tarkowski, neu übersetzt und mit umfangreichem Bonusmaterial!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Dreizehn Jahre sind vergangen, seit Außerirdische die Erde besucht und uns Menschen dabei nicht einmal bemerkt haben. Wie bei einem Picknick am Wegesrand haben sie auf unserem Planeten kurz halt gemacht und sind dann wieder weiterzogen. Aber sie haben ihren »Müll« zurückgelassen – mysteriöse Objekte, die von Wissenschaftlern untersucht werden, nachdem Laborassistenten wie Redrick Shewhart sie aus der Zone, dem Gebiet, in dem die Außerirdischen gelandet sind, herausgeholt haben. Aber Redrick führt ein Doppelleben: Er ist auch ein Stalker, ein Glücksritter, der immer wieder heimlich in die Zone eindringt und dann seine Funde auf dem Schwarzmarkt verkauft. Redrick ist von der Zone regelrecht besessen, denn er will unbedingt die mysteriöse »Goldene Kugel« finden, von der es heißt, dass sie die geheimsten Wünsche in Erfüllung gehen lässt ...
Die Autoren
Die Brüder Arkadi (1925–1991) und Boris(1933 –2012) Strugatzki zählen zu den wichtigsten und erfolgreichsten russischen Autoren der Nachkriegszeit. Ihre Romane sind nicht nur faszinierende Parabeln über die Stellung des Menschen im Universum, sondern auch schonungslose Abrechnungen mit Ideologiegläubigkeit und Personenkult. Etliche ihrer Texte durften in der Sowjetunion nicht erscheinen. Inzwischen hat die Gesamtauflage ihrer Werke die fünfzig Millionen überschritten, sie wurden in über dreißig Sprachen übersetzt, und viele ihrer Romane wurden verfilmt – Andrei Tarkowskis Adaption von Picknick am Wegesrand unter dem Titel Stalker zählt zu den bedeutendsten Filmen des zwanzigsten Jahrhunderts.
Mehr über die Autoren erfahren Sie auf: diezukunft.de
Arkadi und Boris
Strugatzki
Stalker
Roman
Aus dem Russischen vonDavid Drevs
Mit einem Vorwort vonWladimir Kaminer
Wilhelm Heyne VerlagMünchen
Titel der Originalausgaben:
Пикник на обочине (Picknick am Wegesrand)
Машина желаний (Die Wunschmaschine)
Aus dem Russischen von David Drevs
Der Kommentar von Boris Strugatzki wurde von Erik Simon übersetzt.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Ausgabe 12/2021
Copyright © 1972 by Arkadi und Boris Strugatzki
Copyright © 2010 des Kommentars by Boris Strugatzki
Copyright © 2021 des Vorworts by Wladimir Kaminer
Copyright © 2021 dieser Ausgabe und der deutschen Übersetzungen by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München, unter Verwendung eines Filmmotivs aus Andrei Tarkowskis Stalker, © FSUE Mosfilm Cinema Concern
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-26078-1V003
www.diezukunft.de
Inhalt
Vorwort von Wladimir Kaminer
Stalker
Anhang
Kommentar von Boris Strugatzki
Aus dem Arbeitstagebuch der Brüder Strugatzki
Die Wunschmaschine
Stalker: Ein multimediales Phänomen
VorwortWladimir Kaminer
Die Aufzeichnungen eines Stalkers:Die Beschreibung einer fantastischen Landschaft
Der Stalker ist ein Mensch, der über Kenntnisse von anomalen Territorien und Gebäuden verfügt und diese Territorien und Gebäude permanent besucht, um ein ästhetisches und psychisches Wohlbehagen zu erlangen.
– aus der russischsprachigen Wikipedia
In vielen Bereichen glich meine Heimat, die Sowjetunion, einem Wunderland. Nehmen wir zum Beispiel die Literatur. Als ich das lesefähige Alter erreichte, zählte der Schriftstellerverband der Sowjetunion zehntausend Mitglieder und ein paar Zerquetschte. Um in diesen Verband aufgenommen zu werden, musste man nach damals geltenden Regeln mindestens zwei Bücher veröffentlicht haben und eine von drei Kollegen unterschriebene Bestätigung vorweisen können, dass man auch, wie sie, Schriftsteller sei. Nach diesem Konzept hätten sich die Bücherregale in der Sowjetunion unter der Last der zeitgenössischen Literatur krumm biegen müssen. Sie waren aber leer.
Es war nicht eindeutig klar, welche Rolle die Schriftsteller in unserer Gesellschaft spielten, welche geheime Aufgabe sie zu erfüllen hatten. Aber der sowjetische Staat kümmerte sich sehr um die Mitglieder des Schriftstellerverbandes. Die sowjetischen Schriftsteller waren eine privilegierte Kaste; viele von ihnen lebten in den speziellen »Häusern der Schriftsteller«, sie hatten ein eigenes Literarisches Institut, eigene Restaurants und Sanatorien, die nur für Mitglieder zugänglich waren; ja, ganze Dörfer wurden in »Schriftstellerdörfer« verwandelt. In meiner Fantasie lebten diese Schriftsteller immer spartanisch, gingen einander abends besuchen, und anstatt einen Nachbarn mit »Hallo« zu begrüßen, sagten sie: »Na, was schreibst du denn gerade?«
In der Nähe meines Studienortes am Leningrader Prospekt hinter der Metrostation Aeroport befand sich ein solches Haus der Schriftsteller, an allen Ecken mit Gedenktafeln geschmückt, auf denen die Namen von großen Autoren der Vergangenheit standen, die wir im Schulunterricht auswendig zu lernen hatten. Ich bin damals jeden Tag in der Mittagspause an diesem Haus zum Pelmeni-Essen in die Pelmeni-Kantine vorbeigegangen und habe jedes Mal neugierig geguckt, ob ein Schriftsteller aus der Tür tritt. In Tücher gewickelte Omas saßen auf einer Bank vor dem Treppenhaus; ein südländisch aussehender Mann in Trainingshosen ging mit seinem Hund spazieren; einmal kam ein Mädchen auf dem Fahrrad direkt aus der Tür rausgefahren; junge Mütter mit Kinderwagen trafen sich – allesamt äußerst unliterarisch aussehende Bürgerinnen und Bürger.
Ich habe in den fünf Jahren meines Studiums keinen einzigen richtigen Schriftsteller mit Bart und Brille vor diesem Haus gesehen. Dabei konnte man bei uns in jedem Bezirk, ach was, fast auf jeder Straße eine große Buchhandlung finden. In der Regel trugen die sozialistischen Geschäfte die Namen der Waren, die sie anboten. Sie hießen schlicht und einfach »Obst und Gemüse«, »Milch« oder »Brot«. In unserem Bezirk gab es einen sehr großen Laden, der »Streichhölzer« hieß. Anders bei den Buchhandlungen. Diese trugen oft Namen, die nichts über den Inhalt der Läden verrieten. Sie hießen »Sonnenaufgang«, »Horizont« und »Fortschritt«. Zum Sortiment dieser Buchhandlungen zählten vor allem Postkarten und Schulbedarf: Hefte, Kugelschreiber, geografische Karten und ein Globus, auf dem unsere Heimat, immerhin das größte Land der Erde, wie ein riesiger roter Tintenfleck die halbe Kugel bedeckte, darum herum ein unruhiges Meer aus Farben, braun, grün und blau, die unser rotes Vaterland umschlangen, dazu die unerreichbaren Ozeane und die beiden Amerikas.
Im Buchladen Sonnenaufgang in der Straße der Jungen Partisanen neben meiner Schule hing noch eine alte Weltkarte an der Wand. Auf dieser Karte lag die Erde auf dem Rücken von vier Elefanten, die wiederum auf einer Schildkröte standen. Jedes Mal, wenn wir die Schule schwänzten, kauften wir im Eis-Kiosk die superleckeren Waffelröhrchen mit Milchmädchencreme und gingen in den Buchladen. Dort brach unvermeidlich die Diskussion über den Sinn der Elefanten aus. Welche Rolle haben die Elefanten im Weltverständnis unserer Vorfahren gespielt? Die einfachste Erklärung wäre, dass die Elefanten verhindern, dass die flache Erde runterkracht. Dafür würde aber die Schildkröte allein schon vollkommen ausreichen. Einige meiner Schulkameraden vertraten die These, die Elefanten würden mit ihren Rüsseln dafür sorgen, dass sich die Erde durch ihre eigene Schwerkraft nicht verkrümmt und in ein Waffelröhrchen verwandelt, sondern weiter brav und flach wie ein Pfannkuchen daliegt. Das ergab Sinn, denn sonst würden sich alle Länderfarben auf unserem Planeten vermischen und wir hätten in diesem Röhrchen überhaupt keine Heimat mehr.
Wahrscheinlich hatten die sowjetischen Schriftsteller eine ähnliche Aufgabe wie die Elefanten in der Scheibenwelt: Sie sollten unsere Gesellschaft flach halten, damit sie sich nicht krümmt. Ob sie dafür Bücher schrieben, an bestimmten Ritualen teilnahmen oder nur vor sich hin lebten, ist aus heutiger Sicht schwer zu sagen.
Zu behaupten, es habe gar keine Bücher in den sowjetischen Buchläden gegeben, wäre eine Übertreibung. Wir hatten in unserem Sonnenaufgang ein Buchtauschregal mit russischen Ausgaben interessanter ausländischer Autoren, die man jedoch nicht erwerben, sondern nur gegen noch interessantere Ausgaben tauschen konnte. Zum freien Erwerb wurden eine Sammlung der ausgewählten Texte von W. I. Lenin, vor allem sein schmales Büchlein mit dem Titel Materialismus und Empiriokritizismus, zwei Romane des damaligen Generalsekretärs L. I. Breschnew und zwei Bildbände angeboten: Die Errungenschaften des elften Fünfjahresplans und Sibiriens berühmte Baustellen.
Uns war schon damals klar, dass unser Generalsekretär, der kaum auf den Beinen stehen, geschweige denn sprechen konnte, seine Romane nicht selbstständig verfasste. Sicherlich hatten ihm ein paar zerquetschte Schriftsteller aus dem Verband dabei geholfen. Dass alle zehntausend daran geschrieben hatten, war schwer vorstellbar.
W. I. Lenin hingegen hatte seine Abhandlungen bestimmt selbst geschrieben; sie waren in meiner Jugend nicht nur in der Buchhandlung, sondern überall präsent. Materialismus und Empiriokritizismus zum Beispiel lag auch im Warteraum des Friseurs auf dem Tisch. Dieses Büchlein hatte, wie gesagt, nur wenige Seiten, und ich habe es sehr oft in der Hand gehabt, aber nie zu Ende gelesen. Interessanterweise lag Materialismus und Empiriokritizismus auch in der Poliklinik beim Zahnarzt vor der Tür, so wie heute in der uns vertrauten Welt beim herkömmlichen Zahnarzt im Wartezimmer beruhigende Lektüre auf dem Tischchen ausgelegt wird, die Zeitschrift Barbara etwa oder ADAC Motorwelt, die den Warteraum in eine Komfortzone verwandeln, den Patienten beruhigen und ihn möglicherweise von seinem Schmerz ablenken. Diese Rolle spielte in meiner Heimat Lenins Buch.
Bei vielen meiner Landsleute ist diese Lektüre mit ihrer inneren Komfortzone zusammengewachsen. Ich kenne Menschen, die diese Abhandlung später in die Migration mitnahmen. Ich selbst suche manchmal unbewusst danach, wenn ich mich unsicher und verlassen auf fremdem Terrain fühle. Und trotzdem bezweifle ich sehr, dass jemand von uns Materialismus und Empiriokritizismus zu Ende gelesen hat – außer W. I. Lenin.
Aber gut, wir haben uns verplaudert und sind vom Thema abgekommen. Es gab also keine Bücher in den Geschäften und keine Autoren zum Anfassen. Gleichzeitig waren wir »das belesenste Land der Welt«. Alle hatten zu Hause große Bibliotheken. Die Bücher erreichten ihre Leser an den Ladentheken vorbei. Sie wurden in den unzähligen Büros, Instituten und Betrieben als spezielle »Bestellungen zu den Feiertagen« verteilt, sie wurden gegen zwanzig Kilogramm Altpapier in den »Sammelpunkten der sekundären Ressourcen« getauscht, sie wurden in den Hauslotterien verlost, auf dem Schwarzmarkt gekauft und in eigener Produktion zu Hause hergestellt.
Manchmal ergab sich die Möglichkeit, ein begehrtes Buch »mit Zugabe« zu erwerben: Man war verpflichtet, neben der Wunschlektüre noch zwei Exemplare von Sibiriens berühmte Baustellen zu kaufen. Die konnte man wiederum später an den Sammelpunkten für sekundäre Ressourcen gegen Die drei Musketiere von Alexandre Dumas tauschen. Manche Bücher hatten einen sehr langen Weg kreuz und quer durch das ganze Land, bis sie ihre Leser erreichten.
Die sowjetische Planwirtschaft belieferte alle Buchläden gleichermaßen spärlich, und wenn die Bücher in den Großstädten innerhalb von Sekunden aus den Regalen verschwanden, so konnten sie in von den Metropolen weit entfernten Regionen noch eine Zeit lang in den Buchläden stehen, als wäre nichts geschehen. In Mittelasien, im Kaukasus oder in den kleinen lettischen Dörfern konnten nicht alle Menschen Russisch lesen, und viele wollten es auch gar nicht. Also fuhren die Großstädter in die Provinz – je weiter, desto besser –, besuchten dort die Buchläden und schleppten die Bücher nach Hause.
Komischerweise wurde die DDR von der sowjetischen Planwirtschaft sehr großzügig mit russischsprachigen Büchern beliefert, vermutlich in der Hoffnung, dass alle Ostdeutschen dadurch besser Russisch lernen würden. Die Ostdeutschen hatten alle Russisch in der Schule, aber die meisten haben nur ein Wort gelernt: Dostoprimetschatelnosti – Sehenswürdigkeiten. Das ist ein langes Wort, aber doch zu kurz, um auf Russisch Bücher lesen zu können. Wenn sowjetische Touristen in die DDR kamen, kauften sie die russischen Bücher und brachten sie in die Heimat zurück.
Der einfachste Weg, dem die meisten russischen Familien folgten, um an gute Literatur zu gelangen, war, ein Abonnement für eine Zeitschrift abzuschließen. Zusätzlich zu dem Abo bekam man die Möglichkeit, einen Vertrag für eine sogenannte »Bibliothek« zu unterschreiben. Jede Zeitschrift druckte nebenbei Bücher, die Band für Band jeden Monat (oder manchmal auch nur einmal im Jahr) an die Abonnenten verschickt wurden. Meine Mutter besaß ein Abo der Zeitschrift Feuerchen. Die Zeitschrift schickte uns regelmäßig wertvolle Ausgaben der Feuerchen-Bibliothek, jede Menge russische Klassik, vierzehn Bände Guy de Maupassant, der mir sehr gut half, munter durch die Pubertät zu kommen, fünfzehn Bände von H. G. Wells, daneben Romane von John Galsworthy, Jack London und Sir Arthur Conan Doyle, den mein Vater vergötterte.
Die neuen Bände von Conan Doyle ließen allerdings immer länger auf sich warten, irgendetwas war in unserem Wunderland kaputtgegangen. 1990 wanderte ich nach Deutschland aus, und meine Mutter folgte mir nach, ohne den letzten Band von Conan Doyle bekommen zu haben. Kurz danach löste sich die Sowjetunion auf. Mein Vater verkaufte unsere Moskauer Wohnung und packte die restlichen Sachen zusammen, um ebenfalls zu uns nach Berlin zu ziehen. Am letzten Tag vor seiner Abreise bekam er die Benachrichtigung: »Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der letzte Band von Conan Doyle gerade zu Ihnen unterwegs ist.« Mein Vater stand vor einem Dilemma: Auf das Buch warten oder losfahren? Es war eine schwierige Entscheidung. Er hat sich nach längerem Zögern für die zweite Variante entschieden und ist nach Berlin gefahren, wo er nach vielen Jahren verstarb, ohne seine russische Conan-Doyle-Sammlung vervollständigt zu haben. Der letzte Band ist wahrscheinlich noch immer unterwegs.
Die zeitgenössische Literatur führte im Wunderland ein spannendes, anstrengendes Leben zwischen Augenzwinkern und Illegalität, sie tanzte ein seltsames Ballett auf den Lippen des Leviathans. Eine besondere herausragende Rolle spielte die Science-Fiction, auf Russisch »wissenschaftliche Fantastik« genannt. Sie war bei der Bevölkerung besonders beliebt. Weil diese Romane alle jenseits unseres Landes, auf einem anderen Planeten, in einer anderen Galaxie oder in einer anderen Zeit spielten, hatten sie bessere Chancen, an der staatlichen Zensur vorbei das Leben auf unserem Planeten, in unserem Land, in unserer Zeit zu thematisieren. Und die ungekrönten Könige der sowjetischen Fantasten waren die Brüder Strugatzki.
Eines ihrer bekanntesten Themen ist die plötzliche Veränderung eines Erdteils – wenn auf einem begrenzten Territorium die physischen und mentalen Gesetze durch einen historischen Kataklysmus oder einen Besuch von Außerirdischen verändert werden und eine Zone entsteht. Die Menschen, die um die Zone herum leben, wissen nicht genau, wofür die Zone gut ist, aber sie verbinden mit der Zauberkraft der Zone ihre Hoffnungen, ihre geheimen Wünsche und Träume, ihre Zukunft.
Unter Lebensgefahr gehen sogenannte Stalker in diese Zone, um dort nach den besonderen Dingen zu suchen, die unser Leben zum Positiven verändern könnten. Angeblich sei dort irgendwo eine Kugel versteckt, die alle Wünsche wahr werden lässt. Um an diese Kugel zu kommen, muss man einen Menschen opfern. Und das Glück, das mit einem solchen Preis erkauft werden muss, erweist sich als …
Ich möchte den Inhalt von Stalker, wie der Roman in der neuen Übersetzung heißt, jetzt nicht weiter verraten. Schließlich kann jeder das Buch selbst kaufen und lesen. Picknick am Wegesrand, so die Übersetzung des russischen Titels, wurde 1971, also vor genau fünfzig Jahren, geschrieben und ein Jahr später in einer Literaturzeitschrift veröffentlicht. Gleich danach wurde die Zeitschrift eingestellt und das Buch acht Jahre lang nicht mehr verlegt. Die sowjetische Zensur hatte sehr feine Antennen, und obwohl alle Helden des Romans ausländische Namen tragen, hat die Zensur in der Zone etwas gerochen – etwas zum Schreien Bekanntes.
Ich habe dieses Buch als Kind von meinem Onkel bekommen und es in einer Nacht verschlungen. Mein Onkel Stanislaw war ein begnadeter Handwerker. Neben seinem Job im Medizinischen Institut, wo er neue, festere Glasfaserstrukturen für irgendwelche Beatmungsgeräte entwarf, wartete er die Technik der kubanischen Botschaft in Moskau. Und in der kubanischen Botschaft standen Kopiergeräte. Stanislaw baute zu Hause eine portative Buchbinderei. Er vervielfältigte die Zeitschriftenausgabe von Picknick am Wegesrand in der kubanischen Botschaft und produzierte zu Hause ein schönes Hardcover aus sowjetischer Glasfaser. Mit der Zeit hatte Stanislaw eine Strugatzki-Gesamtausgabe aus eigener Herstellung. Er verlieh die Bücher aus seiner Bibliothek gerne an seine zahlreichen Freunde und Verwandte, so habe ich das Buch über den Stalker für zwei Nächte bekommen und es in einer Nacht durchgelesen. Diese Glasfaserbücher machten auf mich den Eindruck, als wären sie ebenfalls aus der Zone gekommen. Es waren Bücher aus einer Zukunft, die unsere Vergangenheit geworden ist. Krass, oder?
Die Sowjetunion war als Zukunftsprojekt entstanden. Das erklärte Ziel war es, im Kommunismus zu landen, in einer Gesellschaft der Glücklichen, in der jeder nach seinen Möglichkeiten gibt und nach seinen Bedürfnissen bekommt. Das Land war ziemlich verwahrlost, aber das reale Leid störte nicht. Was hatte es für einen Sinn, sich um das tägliche Brot zu kümmern, wenn wir kurz davorstanden, den Kommunismus zu erreichen, wo sich alle Probleme von allein lösen werden? »Unsere Kinder werden im Kommunismus leben«, hat W. I. Lenin gesagt.
Die Führer des Landes, unsere Stalker, wussten, was noch fehlte, sie gaben klare und unmissverständliche Anweisungen. »Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes.« Gesagt, getan, das Land wurde elektrifiziert, nichts geschah. »Wir brauchen hunderttausend Traktoren, das Stahlpferd wird die alten Zossen der Bauern ersetzen und uns in den Kommunismus fahren«, hieß es in den Zeiten der Industrialisierung unter I. W. Stalin.
Nikita Chruschtschow hat später die leninsche Formel ausgeweitet: »Der Kommunismus kommt nach der vollständigen Elektrifizierung und Chemisierung des Landes«, sagte er. Er wollte unbedingt, dass bis nach Sibirien überall Mais wächst. »Aber spätestens 1980«, fügte er hinzu. Das ganze Land strengte sich an, um den Traum endlich Realität werden zu lassen, doch nichts geschah; das widerliche Schwein des Lebens holte uns immer wieder ein. Die ersten Zweifel kamen auf, sie wurden in der »wissenschaftlichen Fantastik« ausgedrückt. Was ist, wenn die Zone nur verspricht und nichts erfüllt, wenn es gar keine Abkürzung zum Glück gibt?
Ich habe das Gefühl, dieses Buch lebt. Seine Geschichte ändert sich alle sieben Jahre und wird mit der Zeit permanent fortgeschrieben. Damals, als ich die verbotene Variante auf dem Papier der kubanischen Botschaft von meinem Onkel ausgeliehen bekam, habe ich mich und meine Umgebung mit der Zone und deren Bewohnern verglichen. Im Buch werden sie nicht eindeutig beschrieben, aber nachts hört man aus der Zone seltsame zähneknirschende Geräusche. Außerdem kommen die verstorbenen Verwandten immer wieder aus der Zone in ihre alten Häuser zurück, sie können sich bewegen, essen und sogar trinken, sind aber Fälschungen, künstlich erzeugte Kopien von den echten Menschen, die nicht mehr leben. In unserem sozialistischen Alltag wimmelte es nur von solchen nachgemachten Figuren. Auch die Außerirdischen im Roman, wenn sie es denn wirklich gab, haben es gar nicht ernst mit uns gemeint. Sie haben hier eigentlich nur gefrühstückt. Ich fühlte mich auf einmal wie ein Teil des großen Experiments, wie ein Versuchskaninchen. Alles war bloß Schein.
Sieben Jahre nach dem Erscheinen von Picknick am Wegesrand kam der Film Stalker in die Kinos, der dem Regisseur Andrei Tarkowski zum Weltruhm verhalf und ihn gleichzeitig tötete. Es hat sehr lange gedauert, bis sich die Brüder Strugatzki und der Filmregisseur auf eine Drehbuchversion einigen konnten.
Tarkowski machte einen Film über das Scheitern der Zivilisation; darüber, was bleibt, wenn nichts mehr da ist. Eine lange Kameraeinstellung zeigt, wie am Grund eines Baches die übrig gebliebenen Teile einer Zivilisation liegen: alte Fotos, Uhren, Papierfetzen. Der Film begeisterte damals alle Cineasten (und tut das bis heute).
Für den Dreh suchte Tarkowski eine passende Landschaft und fand sie in der Nähe von Tallinn, auf dem Gelände eines geschlossenen Stromkraftwerks neben einem Chemiekombinat, dessen regenbogenfarbene Abfälle direkt in den See flossen. Dem Regisseur hat es sehr gefallen, dass die Wasseroberfläche dort in allen Farben leuchtete und sich sogar die Luft manchmal hellrosa färbte. Angeblich haben sich Tarkowski und seine Frau bei diesen Dreharbeiten Lungenkrebs geholt. Sie starben sieben Jahre später. Auch der Kameramann und etliche Schauspieler hatten nach dem Dreh mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.
Im selben Jahr, in dem Andrei Tarkowski starb, explodierte der Atomreaktor in Tschernobyl. Das Unglück erschuf eine Zone – als würde das Leben dem Buch und dem Film nacheifern. Einige Jahre später kamen die ersten Stalker; Menschen, die in die Sperrzone von Tschernobyl eindrangen, um die verseuchten Raritäten herauszuholen. Der radioaktive Tourismus hat von Anfang an viele Anhänger, damals munkelte man schon, dass Radioaktivität in kleinen Dosen durchaus gut für die Gesundheit sein kann und bei bestimmten Menschen sogar übernatürliche Fähigkeiten, Telepathie oder Dauererektion hervorruft. Die realen Gaben der Tschernobyl-Zone, die vierköpfigen Pusteblumen, schleimige gelbe Pilze oder gigantische Welse, die Tauben fraßen, waren bei Weitem nicht so spannend wie die Gaben der Zone in Stalker.
Sieben Jahre nach der Reaktorkatastrophe nahm ich den Roman der Strugatzkis noch einmal in die Hand und stellte fest, dass sich meine Heimat dieses Buch offenbar zu einer Art »Roadmap« auserkoren hat. Die Strugatzkis waren die meistgelesenen Autoren in der Sowjetunion; auch nach dem Untergang des großen Landes wurden sie oft verlegt. Stalker ist der bekannteste ihrer Romane, die Gesamtauflage ihrer Bücher liegt bei um die vierzig Millionen Exemplare, und wenn man die ungezählten, von Lesern wie meinem Onkel Stanislaw in eigener Produktion hergestellten Ausgaben dazurechnet, müssten alle lesefähigen Russen ihre Geschichten gelesen haben. Und wenn ein ganzes Land das Gleiche gelesen hat, wird das Volk zum Autor der Fortsetzung. Noch heute spinnt Russland diese Geschichte der Schriftstellerbrüder weiter fort.
Inzwischen ist meine Heimat, die Sowjetunion, seit dreißig Jahren weg. Aber unsichtbar verfolgt sie uns weiter. Sie hat sich in eine große Zone verwandelt. Wie in einer Grube sind dort die schönsten und tollsten und zauberhaftesten Träume vergraben – von einem neuen Menschen, vom Land der Wunder und vom Glück für alle. Wie die Stalker gehen wir immer wieder hin, oft unter Lebensgefahr, um uns die seltsamen unerklärlichen Artefakte zu holen, um Kreativität und Lebenslust zu tanken und Dinge mitzunehmen, die wir nie richtig einsetzen können. Ich tue das auch. Ich tauche ab und zu in der Zone unter, um einen genialen Roman zu finden, der die Menschen zittern und lachen lässt, komme aber höchstens mit einem Vorwort wieder zurück.
STALKER
»Du musst das Gute aus dem Schlechten machen. Du hast ja nichts anderes, woraus du es machen kannst.«
Robert Penn Warren
Aus dem Interview des Sonderkorrespondenten von Radio Harmont mit Dr. Valentin Pillman nach dessen Auszeichnung mit dem Physik-Nobelpreis des Jahres 19...
»Ihre erste bedeutende Entdeckung, Dr. Pillman, war wohl der sogenannte Pillman-Radiant?«
»Das glaube ich nicht. Der Pillman-Radiant war weder die erste noch eine bedeutende, ja eigentlich überhaupt keine Entdeckung. Und auch nicht wirklich von mir.«
»Sie belieben zu scherzen. Den Pillman-Radianten kennt jedes Schulkind.«
»Kein Wunder, der Pillman-Radiant wurde ja auch zuerst von einem Schüler entdeckt. An dessen Namen erinnere ich mich leider nicht mehr. Schauen Sie bei Stetson in seiner Geschichte des Besuchs nach – dort ist das alles genau erklärt. Der Erstentdecker des Radianten war ein Schüler, seine Koordinaten wurden erstmals von einem Studenten veröffentlicht, aber benannt hat man ihn aus irgendeinem Grund nach mir.«
»Ja, mit Entdeckungen geschehen manchmal die seltsamsten Dinge. Dr. Pillman, erklären Sie unseren Hörern doch bitte …«
»Hören Sie, Herr Kollege, das mit dem Pillman-Radianten ist doch ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie drehen einen großen Globus und feuern dann mit einem Revolver darauf. Die Einschusslöcher im Globus bilden eine gleichmäßige Kurve. Die Quintessenz dessen, was Sie meine erste bedeutende Entdeckung nennen, ist eine ganz einfache Tatsache: Alle sechs Besuchszonen sind auf der Oberfläche unseres Planeten so angeordnet, als hätte jemand sechs Schüsse aus einer Pistole darauf abgegeben, die sich irgendwo auf einer Linie zwischen der Erde und Deneb befindet. Deneb ist der Hauptstern im Schwan, und der Punkt am Firmament, von dem aus ›geschossen‹ wurde, das ist der Pillman-Radiant.«
»Besten Dank. Liebe Harmonter! Endlich eine verständliche Erklärung des Pillman-Radianten! Apropos: Erst vorgestern hat sich der Besuch zum dreizehnten Mal gejährt. Dr. Pillman, vielleicht wollen Sie aus diesem Anlass ein paar Worte an Ihre Landsleute richten?«
»Was soll ich denn sagen? Bedenken Sie, dass ich damals nicht in Harmont war …«
»Umso interessanter wäre es zu hören, was Sie dachten, als ausgerechnet Ihre Heimatstadt zum Schauplatz der Invasion einer außerirdischen Superzivilisation wurde.«
»Offen gesagt, dachte ich erst, das Ganze wäre eine Ente. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass sich ausgerechnet in unserem kleinen, alten Harmont etwas Derartiges zugetragen hatte. Ostsibirien, Uganda, der Südatlantik, das ging ja noch, aber Harmont!«
»Schlussendlich mussten Sie es aber doch glauben.«
»Schlussendlich ja.«
»Und?«
»Plötzlich erkannte ich, dass Harmont und die anderen fünf Besuchszonen … Pardon, mein Fehler, damals waren ja nur vier bekannt … dass sie alle auf einer sehr gleichmäßigen Kurve liegen. Ich errechnete die Koordinaten des Radianten und schickte sie an Nature.«
»Das Schicksal Ihrer Heimatstadt hat Sie nicht weiter interessiert?«
»Schauen Sie, dass ein Besuch stattgefunden hatte, davon war ich damals bereits überzeugt, aber all die panischen Presseberichte von brennenden Stadtvierteln, von menschenfressenden Monstern, die es vor allem auf Alte und Kinder abgesehen hatten, und von blutigen Gefechten zwischen unverwundbaren Außerirdischen und höchst verwundbaren, aber heldenhaft bis zuletzt kämpfenden Panzereinheiten der Krone – daran konnte ich einfach nicht glauben.«
»Und Sie sollten recht behalten. Ich weiß noch, dass die lieben Kollegen von der Tagespresse damals eine Menge durcheinanderbrachten … Aber zurück zur Wissenschaft. Die Entdeckung des Pillman-Radianten war Ihr erster, aber wahrscheinlich nicht Ihr letzter Beitrag zur Erforschung des Besuchs?«
»Doch, der erste und der letzte.«
»Aber zweifellos haben Sie den Verlauf der internationalen Forschung in den Besuchszonen aufmerksam verfolgt?«
»Ja … von Zeit zu Zeit blättere ich die Berichte durch.«
»Sie meinen die Berichte desInternationalen Instituts für außerirdische Kulturen?«
»Ja.«
»Welches ist denn Ihrer Ansicht nach die wichtigste Entdeckung dieser ganzen dreizehn Jahre?«
»Die Tatsache des Besuchs.«
»Wie bitte?«
»Die Tatsache des Besuchs ist die wichtigste Entdeckung nicht nur der vergangenen dreizehn Jahre, sondern seit die Menschheit existiert. Es ist nicht so wichtig, wer diese Außerirdischen waren. Nicht, woher sie kamen, was sie hier wollten, warum sie nur so kurz blieben und wohin sie anschließend verschwanden. Wichtig ist, dass die Menschheit jetzt ein für alle Mal weiß: Sie ist nicht allein im Universum. Ich fürchte, eine grundlegendere Entdeckung wird das Institut für außerirdische Kulturen nicht mehr machen.«
»Das ist furchtbar interessant, Dr. Pillman, aber ich meinte eher Entdeckungen technologischer Art. Entdeckungen, die sich unsere irdische Wissenschaft und Technik zunutze machen könnten. Schließlich gehen einige sehr angesehene Wissenschaftler davon aus, dass die Funde in den Besuchszonen geeignet sind, den gesamten Verlauf unserer Geschichte zu verändern.«
»Nun, da bin ich anderer Meinung. Und was die konkreten Funde angeht, so bin ich da kein Experte.«
»Aber Sie sind doch schon seit zwei Jahren Berater der UN-Kommission zu Fragen des Besuchs …«
»Ja, aber mit der Erforschung extraterrestrischer Kulturen habe ich nichts zu tun. In der UNCQV vertreten meine Kollegen und ich die internationale Wissenschaftsgemeinschaft. Es geht darum, die Umsetzung des UN-Beschlusses zur Internationalisierung der Besuchszonen zu kontrollieren. Wir sorgen dafür, dass all die außerirdischen Wunderdinge, die in den Zonen entdeckt werden, ausschließlich dem Internationalen Institut zur Verfügung stehen.«
»Verfügt denn sonst noch jemand darüber?«
»Ja.«
»Sie meinen die Stalker?«
»Ich weiß nicht, was das ist.«
»So nennt man bei uns in Harmont diese todesmutigen jungen Männer, die auf eigene Gefahr in die Zone eindringen und alles herausholen, was sie dort finden können. Ein völlig neuer Beruf.«
»Verstehe. Nein, für die sind wir nicht zuständig.«
»Das wäre ja noch schöner! Die sind Sache der Polizei. Aber mich würde schon interessieren, wofür die Kommission dann zuständig ist, Dr. Pillman.«
»Ständig verschwinden Materialien aus den Besuchszonen und geraten in die Hände skrupelloser Personen und Organisationen. Wir befassen uns mit den Folgen dieses Verschwindens.«
»Geht das etwas konkreter?«
»Lassen Sie uns doch lieber über Kunst reden. Interessieren sich Ihre Hörer denn gar nicht dafür, was ich von der unvergleichlichen Gwadi Mueller halte?«
»Aber natürlich! Zunächst würde ich aber gern das Thema Wissenschaft abschließen. Fühlen Sie sich als Forscher nicht versucht, sich selbst mit diesen extraterrestrischen Wundern zu befassen?«
»Was soll ich sagen … durchaus.«
»Wir können also darauf hoffen, dass die Harmonter ihren berühmten Landsmann eines schönen Tages auf den Straßen seiner Heimatstadt erblicken werden?«
»Das schließe ich nicht aus.«
1
Redrick Shewhart, 23 Jahre, Junggeselle, Laborant der Harmonter Filiale des Internationalen Instituts für außerirdische Kulturen
Am Abend davor stehen wir zwei im Magazin – es ist schon spät, nur noch schnell die Anzüge abwerfen, dann geht’s ab ins Borczch, um uns ein paar Tröpfchen Hochprozentiges zu Gemüte zu führen. Ich steh nur so da, mach die Wandstütze, hab mein Teil erledigt und die Zigarette schon bereit, brauch dringend ein paar Züge – zwei Stunden lang hab ich nicht geraucht –, aber er ist immer noch mit seinen Schätzen beschäftigt: Einen ganzen Safe hat er schon vollgestopft, verschlossen und versiegelt, jetzt füllt er den anderen, nimmt seine »Leerteile« vom Transporter, inspiziert jedes einzelne von allen Seiten (nur so nebenbei: die sind sechseinhalb Kilo schwer, die Biester) und hievt es dann ächzend und mit allergrößter Vorsicht ins Regal.
Wie lang er mit diesen »Leerteilen« rummacht! Und der Menschheit bringt es überhaupt nichts. Finde ich zumindest. An seiner Stelle hätte ich längst drauf gepfiffen und mir für dasselbe Geld was anderes vorgenommen. Andererseits, wenn man drüber nachdenkt: So ein »Leerteil« ist schon geheimnisvoll und, na ja, irgendwie merkwürdig. Wie viele davon hab ich selber schon rausgeschleppt, und trotzdem: Jedes Mal, wenn ich eins sehe, bin ich platt vor Staunen. Es sind ja nur zwei Kupferscheiben, jede so groß wie eine Untertasse, etwa fünf Millimeter dick, der Abstand dazwischen vielleicht vierhundert Millimeter, und außer diesem Abstand ist da nichts dazwischen. Also wirklich gar nichts, nur Leere. Du kannst deine Hand hineinstecken, selbst deinen Kopf, wenn du’s drauf anlegst – nichts als Leere und Luft. Obwohl irgendeine Kraft zwischen den beiden ja wirken muss, wenn ich das richtig verstehe. Bisher hat ja keiner geschafft, sie zusammenzudrücken, diese Scheiben, oder sie auseinanderzuziehen.
Leute, es ist wirklich schwer, so ein Teil jemandem zu beschreiben, der’s noch nicht gesehen hat. Es sieht zu einfach aus, besonders wenn du’s dir näher ansiehst und dich davon überzeugst, dass es echt ist. Als würdest du jemandem einen Becher beschreiben wollen oder, schlimmer noch, ein Schnapsglas: Du fuchtelst nur mit deinen Fingern herum und fluchst, weil du’s einfach nicht hinkriegst. Na gut, gehen wir mal davon aus, dass ihr’s alle kapiert habt, und wer nicht, der soll sich die Berichte vom Institut vornehmen, da gibt’s in jeder Nummer Artikel über diese »Leerteile«, mit Fotos.
Jedenfalls schlägt sich Kirill mit diesen »Leerteilen« schon fast ein Jahr lang herum. Ich hab das von Anfang an miterlebt, aber immer noch nicht kapiert, was er damit vorhat. Ehrlich gesagt, interessiert es mich auch nicht besonders. Wenn er irgendwann mal draufkommt, lass ich’s mir vielleicht von ihm verklickern. Vorerst klar ist jedenfalls: Er will unbedingt eines dieser »Leerteile« auseinandernehmen, es mit Säure behandeln, mit einer Presse plattmachen, in einem Ofen einschmelzen. Wenn er das Rätsel erst mal gelöst hat, erntet er sicher eine Menge Ruhm und Ehre, und die Fachwelt wird begeistert sein. Aber bis dahin ist es, soweit ich verstehe, noch ein weiter Weg. Noch hat er gar nichts erreicht, sich nur völlig totgearbeitet. Grau geworden ist er, schweigsam, schaut einen an wie ein kranker Hund mit Tränen in den Augen. Wär es nicht Kirill, ich würd ihn erst mal abfüllen und einem feschen Mädel vorstellen, das ihn wieder auf Touren bringt, und am nächsten Morgen würd ich ihn wieder abfüllen und noch mal zu einem Mädchen, diesmal einer anderen. Nach einer Woche wär er wieder ganz der Alte, die Ohren spitz, der Schwanz schnurgerade. Nur dass diese Medizin bei Kirill eben nicht wirkt – völlig zwecklos, er ist nicht der Typ dafür.
Wir stehen also im Magazin, ich schau ihn an, seh, was aus ihm geworden ist, mit seinen trüben Augen, und plötzlich tut er mir leid – ich weiß gar nicht, warum. Und da wage ich es. Das heißt, nicht ich wage es, sondern irgendwer scheint meine Lippen zu bewegen.
»Hör mal«, sag ich, »Kirill …«
Er steht da, das letzte »Leerteil« in der Hand. Macht ein Gesicht, als würde er am liebsten hineinkriechen.
»Hör zu, Kirill«, sag ich. »Was, wenn du mal ein volles ›Leerteil‹ hättest, hm?«
»Ein volles ›Leerteil‹?«, fragt er zurück und runzelt die Stirn, als hätte ich irgendein Kauderwelsch geredet.
»Genau«, sag ich. »Deine hydromagnetische Falle, wie war noch mal die Objektnummer? … 77-b. Nur mit so blauem Zeugs drin.«
Allmählich dämmert es ihm. Er hebt den Blick, sieht mich an, kneift die Augen zusammen, und irgendwo da, hinter seinen Hundetränen, ist plötzlich ein Silberstreif der Vernunft zu erkennen, wie er selbst zu sagen pflegt.
»Warte mal«, sagt er. »Ein volles Teil? So eins, aber voll?«
»Ja, genau.«
»Wo?«
Und schon ist mein Kirill wieder gesund. Die Ohren spitz, der Schwanz schnurgerade.
»Gehen wir eine rauchen«, sag ich.
Flink steckt er das »Leerteil« in den Safe, schlägt die Tür zu, verschließt sie mit dreieinhalb Umdrehungen, dann gehen wir beide ins Labor zurück. Für ein leeres »Leerteil« zahlt Ernest vierhundert Geld in bar, für ein volles könnte ich diesem Hurensohn sein ganzes verdorbenes Blut aussaugen, aber, ob ihr’s glaubt oder nicht, darum geht es mir jetzt gar nicht, denn auf einmal ist Kirill wieder zum Leben erwacht, gespannt wie eine Gitarrensaite, so sehr in Schwung, dass er gleich vier Treppenstufen überspringt und mir nicht mal Zeit zum Rauchen lässt. Kurz, ich hab ihm alles erzählt: Wie es aussieht, wo es liegt und wie man am besten rankommt. Sofort hat er die Karte rausgeholt, die betreffende Garage gefunden, sie mit dem Finger eingekreist, mich angesehen und, na klar, mich sofort komplett durchschaut, was auch nicht besonders schwer ist.
»Mein lieber Scholli!«, sagt er lächelnd. »Tja, da müssen wir wohl hin. Wir gehen gleich morgen früh los. Um neun bestelle ich den Passierschein und eine Galosche, dann können wir, wenn’s gut läuft, um zehn los. Abgemacht?«
»In Ordnung«, sag ich. »Und wer ist der Dritte?«
»Wozu brauchen wir einen Dritten?«
»Moment mal«, sag ich. »Das ist kein Picknick mit irgendwelchen Mädels. Was, wenn dir irgendwas passiert? Das ist die Zone. Ordnung muss sein.«
Schmunzelnd zuckt er mit den Schultern.
»Wie du willst! Du kennst dich da besser aus.«
Ja klar. Natürlich hat er nur meinetwegen so großzügig getan, nach dem Motto: Wozu ein Dritter, die Tour machen wir zu zweit, braucht ja keiner was davon zu wissen. Dabei ist mir vollkommen klar, dass die vom Institut nie zu zweit in die Zone gehen. Die haben eine Regel: Zwei machen den Job, und ein Dritter schaut zu, damit er im Fall des Falles später davon berichten kann.
»Ich persönlich würde Austin mitnehmen«, sagt Kirill. »Aber den willst du wahrscheinlich nicht. Oder doch?«
»Nein«, antworte ich. »Austin auf keinen Fall. Den kannst du wann anders mitnehmen.«
Austin ist kein schlechter Kerl, Mut und Feigheit sind bei ihm im nötigen Verhältnis zueinander vorhanden, aber für mich steht er auf der Abschussliste. Kirill kannst du das nicht erklären, aber ich seh es genau: Sobald sich einer einbildet, dass er die Zone von vorn bis hinten kennt, heißt das, dass er sich demnächst den Hals bricht. Von mir aus gern. Aber ohne mich.
»Na gut«, sagt Kirill. »Und Tender?«
Tender ist sein zweiter Laborant. Kein schlechter Mann, von der ruhigen Sorte.
»Ein bisschen zu alt«, sag ich. »Und Kinder hat er auch …«
»Macht nichts. Er war schon mal in der Zone.«
»Na gut«, sag ich. »Von mir aus Tender.«
Kirill bleibt dann noch über der Karte sitzen, während ich direkt ins Borczch abdampfe, denn ich hab einen Bärenhunger, und meine Kehle ist komplett ausgedörrt.
Okay. Ich erscheine also wie immer morgens gegen neun auf der Bildfläche und zeige meinen Ausweis. An der Pforte schiebt gerade dieser ellenlange Schwede Dienst, den ich letztes Jahr vermöbelt habe, als er sich stockbesoffen an Guta ranmachen wollte.
»Hallo, Roter«, sagt der Sergeant zu mir. »Man sucht dich schon im ganzen Institut …«
»Nenn mich nicht ›Roter‹«, unterbreche ich sofort. »Tu nicht so, als wären wir auf einmal Freunde.«
»Herrje, Roter«, entgegnet er verwundert. »Dich nennt doch jeder so.«
Ich bin aber schon auf hundertachtzig, weil ich auf dem Weg in die Zone bin – und außerdem nüchtern, also pack ich ihn am Schulterriemen und erklär ihm haarklein, was er für einer ist und von wem er abstammt. Worauf er ausspuckt, mir den Ausweis zurückgibt und sich alle weitere Herzlichkeit verkneift.
»Redrick Shewhart«, sagt er, »Sie sollen sich unverzüglich bei Captain Herzog, Chef der Sicherheitsabteilung, melden.«
»Geht doch«, sag ich. »Immer schön üben, Sergeant, dann bringst du’s vielleicht mal zum Leutnant.«
Gleichzeitig denk ich mir: Was soll das denn? Was will Captain Herzog jetzt schon wieder von mir, auch noch mitten im Dienst? Na gut, geh ich also mich melden. Sein Büro ist im zweiten Stock, schönes Zimmer, mit vergitterten Fenstern wie bei der Polizei. Willie sitzt an seinem Tisch, raucht knisternd seine Pfeife und hackt irgendein Geschreibsel in seine Maschine, während in der Ecke ein Sergeant in einem Stahlschrank herumsucht. Der Jungspund muss neu sein, den kenn ich noch nicht. In unserem Institut arbeiten mehr von diesen Sergeantchens als in der Garnison, alles so feiste Rotbäckchen, die niemals in die Zone müssen und denen die Probleme dieser Welt scheißegal sind.
»Guten Tag«, sag ich. »Sie wollten mich sprechen?«
Willie sieht mich an, als wär ich aus Glas, schiebt die Schreibmaschine beiseite, legt einen dicken Aktenordner vor sich hin und beginnt, ihn durchzublättern.
»Redrick Shewhart?«
»Ebenjener«, antworte ich, und jetzt finde ich das alles urkomisch, kaum auszuhalten. Ein nervöses Kichern steigt in mir auf.
»Wie lange arbeiten Sie schon am Institut?«
»Mehr als zwei Jahre.«
»Familienstand?«
»Alleinstehend«, sag ich. »Waise.«
Jetzt wendet er sich seinem Sergeantchen zu und sagt streng: »Sergeant Lummer, bringen Sie mir die Akte Nr. 150 aus dem Archiv.«
Lummer salutiert und zieht Leine, woraufhin Willie den Ordner zuschlägt und mit finsterer Stimme fragt: »Fängst du schon wieder mit den alten Sachen an?«
»Was für alte Sachen?«
»Du weißt genau, was für welche. Es ist wieder ein Bericht über dich eingegangen.«
Soso.
»Und woher kommt der Bericht?«
Er runzelt die Stirn und klopft gereizt seine Pfeife am Aschenbecher aus.
»Das geht dich nichts an«, sagt er. »Ich warne dich aus alter Freundschaft: Hör auf damit, ein für alle Mal. Wenn sie dich ein zweites Mal erwischen, kommst du mit sechs Monaten nicht mehr davon. Dem Institut kannst du dann gleich Adieu sagen, und zwar für immer. Ist das klar?«
»Sonnenklar«, sag ich. »Nur eins ist mir nicht klar: Welcher Mistkerl mich diesmal verpfiffen hat.«
Er aber blickt mich schon wieder mit ausdruckslosen Augen an, zieht an seiner kalten Pfeife und blättert in dem Ordner, als wär nichts gewesen. Was bedeutet, dass Sergeant Lummer bereits zurück ist – mit Akte Nr. 150.
»Danke, Shewhart«, sagt Captain Willie Herzog, genannt Eber. »Ich wollte das nur klarstellen. Sie können gehen.«
Na schön, geh ich also in die Umkleide, zieh den Spezialanzug an, rauch eine und denk dabei die ganze Zeit: Woher weht der Wind diesmal? Aus dem Institut? Dann wäre alles gelogen, denn hier weiß keiner etwas über mich, völlig ausgeschlossen. Und wenn die Polizei was hat durchsickern lassen? Auch nicht viel anders, was wissen die schon außer meinen alten Geschichten? Vielleicht ist Aasgeier aufgeflogen? Der würde jeden ans Messer liefern, um sich selbst rauszureden. Aber heute weiß Aasgeier doch genauso wenig über mich … Ich überlege fieberhaft, aber mir will einfach nichts Sinnvolles einfallen. Schließlich sag ich mir: Scheiß drauf! Ich bin vor drei Monaten das letzte Mal nachts in der Zone unterwegs gewesen, meinen Habar hab ich fast komplett vertickt und kaum noch Geld davon übrig. Damals hat das keiner mitgekriegt, also kann mir jetzt keiner mehr was anhaben.
Aber dann – ich geh bereits die Treppe hoch – wird mir plötzlich alles klar, und zwar so klar, dass ich wieder in die Umkleide zurückgehe, mich setze und mir noch mal eine anstecke: Ich darf die Zone heute nicht betreten. Genauso wenig morgen oder übermorgen. Diese Schweine haben mich auf dem Kieker. Sie haben mich nicht vergessen, oder aber jemand hat sie an mich erinnert. Spielt keine Rolle, wer das war. Kein Stalker, der einigermaßen klar denken kann, wird sich der Zone auf Schussweite nähern, wenn er weiß, dass er beobachtet wird. Stattdessen muss ich mich jetzt in die dunkelste Ecke verkriechen. Die Zone? Die hab ich doch seit Monaten nicht mehr betreten, nicht mal mit Passierschein! Könnt ihr einen unschuldigen Laboranten nicht in Ruhe lassen?
Ich überlege mir das Pro und Kontra und bin sogar irgendwie erleichtert, dass ich heute nicht in die Zone darf. Bloß, wie sag ich es Kirill am geschicktesten?
Einfach rundheraus: »In die Zone geh ich nicht. Was gibt’s sonst zu erledigen?«
Erst starrt er mich natürlich an. Dann scheint es bei ihm zu klicken: Er führt mich am Unterarm in sein Büro, setzt mich an seinen kleinen Tisch und sich selbst auf die Fensterbank. Wir rauchen. Und schweigen. Dann fragt er mich vorsichtig: »Ist was passiert, Red?«
Was soll ich ihm sagen?
»Nein«, sag ich, »passiert ist nichts. Hab gestern beim Poker zwanzig Geld in den Sand gesetzt – spielt verdammt gut, dieser Gauner Noonan …«
»Warte«, sagt er. »Hast du’s dir etwa anders überlegt?«
Ich stöhne vor Anspannung und presse hervor: »Ich kann nicht, verstehst du? Vorhin hat mich Herzog zu sich zitiert.«
Er fällt in sich zusammen, verwandelt sich wieder in dieses armselige Geschöpf mit dem Blick eines kranken Pudels. Dann atmet er tief durch, steckt sich an seiner Kippe gleich die nächste Zigarette an und sagt leise: »Du kannst mir glauben, Red, ich habe niemandem was gesagt. Nicht ein Wort.«
»Hör schon auf«, sag ich. »Wer redet denn von dir?«
»Nicht mal Tender habe ich bisher informiert. Der Passierschein ist schon ausgestellt, dabei hab ich ihn noch gar nicht gefragt, ob er mitgeht oder nicht …«
Ich rauche schweigend. Soll ich lachen oder heulen? Er hat tatsächlich keine Ahnung.
»Was hat Herzog zu dir gesagt?«
»Nichts Besonderes«, antworte ich. »Irgendwer hat mich verpfiffen, mehr nicht.«
Er sieht mich irgendwie komisch an, springt von der Fensterbank herunter und beginnt, in seinem winzigen Büro auf und ab zu gehen. Er läuft durch sein Kämmerchen, während ich dasitze und schweigend vor mich hin paffe. Natürlich tut er mir leid, und es ärgert mich, wie blöd das Ganze gelaufen ist. Wirklich ein voller Erfolg, meine Aufmunterungsaktion. Und wer ist daran schuld? Ich selber. Hab dem Kindchen einen Keks versprochen, nur dass der Keks an einem geheimen Ort versteckt ist und dieser Ort von lauter bösen Onkels bewacht wird …
Plötzlich bleibt Kirill neben mir stehen und fragt, ohne mich anzusehen, als wäre es ihm peinlich: »Hör mal, Red, wie viel könnte das kosten, so ein volles ›Leerteil‹?«
Erst versteh ich ihn nicht, denke mir, dass er vielleicht darauf spekuliert, irgendwo eins zu kaufen, aber wo, möglicherweise gibt es davon ja nur ein einziges auf der ganzen Welt, und außerdem könnte er sich das gar nicht leisten. Woher soll er bitte das Geld haben, als ausländische Fachkraft, und auch noch als Russe? Und da trifft es mich wie ein Blitz: Denkt der Dreckskerl vielleicht, dass ich die ganze Sache nur wegen ein paar grünen Scheinchen durchziehen will? Du Aas, denk ich mir, für wen hältst du mich eigentlich? Schon öffne ich den Mund, um ihn so richtig zur Sau zu machen, aber dann denk ich mir: Ja, klar, für wen soll er mich sonst halten? Ein Stalker ist nun mal ein Stalker, so einer hat nur eines im Sinn: möglichst viele Scheinchen zusammenraffen. Für die grünen Lappen setzt er das eigene Leben aufs Spiel. Natürlich entsteht da der Eindruck, dass ich meinen gestrigen Köder heute noch ein wenig hinausziehe, um den Preis hochzutreiben.
All diese Gedanken lähmen meine Zunge, aber er mustert mich aufmerksam, lässt mich nicht aus seinen Augen. Und in diesen Augen sehe ich keine Verachtung, sondern, ja, so was wie Verständnis. Also erklär ich es ihm in aller Ruhe: »Noch niemand mit Passierschein hat es bislang bis zur Garage geschafft. Du weißt ja, es gibt noch keine Trasse, die dahin führt. Angenommen also, wir kommen wieder zurück. Dein Freund Tender wird sicher überall von unserer kleinen Spritztour herumerzählen. Dass wir uns einfach so geschnappt haben, was wir brauchten, und dann gleich wieder zurück sind. So als wären wir mal eben ins Lager gegangen. Da merkt doch jeder, dass wir was ganz Bestimmtes suchten. Und das bedeutet, dass jemand von uns Bescheid wusste. Und wer von uns dreien das war – kein Kommentar. Verstehst du, wonach das für mich riecht?«
Ich beende meinen Monolog, wir schauen einander schweigend in die Augen. Dann klatscht er auf einmal in die Hände, reibt sie sich und sagt entschlossen: »Na gut, dann eben nicht. Ich versteh dich, Red, und ich nehme es dir nicht übel. Dann geh ich eben allein. Vielleicht schaffe ich es. Ist ja nicht das erste Mal …«
Er breitet auf der Fensterbank eine Karte aus, stützt sich mit den Armen auf und beugt sich darüber. Ich sehe förmlich, wie nun all seine Lebendigkeit wieder verpufft. Ich höre ihn murmeln: »Hundertzwanzig Meter … sogar hundertzweiundzwanzig … Und was ist da noch in der Garage selber … Nein, Tender nehm ich doch nicht mit. Was meinst du, Red, vielleicht sollte ich Tender doch nicht mitnehmen? Er hat immerhin zwei Kinder …«
»Allein lassen sie dich nicht raus«, sag ich.
»Doch, doch«, murmelt er. »Ich kenne alle Sergeanten – und die Leutnants auch … Diese Laster gefallen mir nicht! Dreizehn Jahre stehen die nun schon im Freien, und immer noch sind sie wie neu … Der Tankwagen nur zwanzig Schritt weiter ist rostig wie ein Sieb, die dagegen könnten genauso gut gerade erst geliefert worden sein … Mann, diese Zone!«
Er hebt den Kopf und starrt aus dem Fenster. Auch ich starre aus dem Fenster. Das Glas in unseren Fenstern ist dick, Bleiglas. Gleich dahinter beginnt unsere Zone, da draußen liegt sie, zum Greifen nah, vom zwölften Stock aus gut zu überblicken.
Wenn man einfach so hinschaut, sieht die Zone aus wie ein gewöhnliches Stück Land. Die Sonne scheint darauf wie auf den Rest der Erde, und man hat nicht das Gefühl, dass sich dort irgendwas verändert hat. Ist alles noch genauso wie vor dreizehn Jahren. Wäre Paps noch am Leben, ihm würde nichts Besonderes auffallen. Er würde höchstens fragen: Warum rauchen die Fabrikschlote nicht, streiken die etwa? … Gelbes Gestein in kegelförmigen Haufen, die Winderhitzer glänzen in der Sonne, überall Gleise und irgendwo auf den Gleisen eine Lok mit Güterwaggons … Eine Industrielandschaft. Nur ohne Menschen. Weder lebende, noch tote. Und da ist auch schon die Garage zu sehen: ein langer, grauer Schlauch, das Tor weit offen, und auf dem asphaltierten Platz stehen die Laster. Dreizehn Jahre stehen sie schon da, völlig unverändert. Das mit den Lastern hat er korrekt bemerkt – er hat’s schon drauf. Gott behüte, dass du zwischen zwei von denen hindurchmusst. Um die muss man einen großen Bogen machen … Da ist dieser Riss im Asphalt, wenn er nicht inzwischen von stacheligem Gebüsch überwuchert ist … Hundertzweiundzwanzig Meter – ab wo zählt er? Ach so, wahrscheinlich ab dem letzten Markierungspfahl. Korrekt, von dort aus dürfte das die maximale Entfernung sein. Kommen die Klugscheißer also doch allmählich voran … Sieh an, sogar bis zu der Halde haben sie den Weg abgesteckt, und wie geschickt! Da ist er, der Graben, wo es Schleimer damals erwischt hat, nur zwei Meter entfernt von ihrer Trasse … Dabei hatte ihm Knochenmann noch gesagt: »Idiot, halt dich fern von den Gräben, sonst gibt’s am Ende nicht mal mehr was zu beerdigen.« Als hätt er in die Kristallkugel geguckt – zu beerdigen war da tatsächlich nichts mehr … Mit der Zone ist es nämlich so: Kommst du mit Habar zurück, ist es ein Wunder. Kommst du lebend zurück, ist es ein Erfolg. Kriegst du ne Kugel von einer Streife ab, ist es Dusel. Alles andere ist Schicksal …
Ich schaue zu Kirill hinüber. Er beobachtet mich aus den Augenwinkeln. Und er macht ein Gesicht, dass ich alles gleich wieder über den Haufen werfe. Sollen sie doch alle zum Teufel gehen, denk ich, was können die Polypen mir schon tun? Er muss eigentlich gar nichts mehr sagen, aber er sagt es trotzdem: »Laborant Shewhart, von offizieller – ich betone: offizieller – Seite ist mir mitgeteilt worden, dass eine Untersuchung der Garage für die Wissenschaft von großem Nutzen wäre. Ich biete Ihnen hiermit an, die Garage gemeinsam zu untersuchen. Eine Prämie ist Ihnen garantiert.«
Er grinst von einem Ohr zum anderen.
»Von welcher offiziellen Seite denn genau?«, frage ich und grinse dümmlich zurück.
»Von einer vertraulichen«, antwortet er. »Aber Ihnen kann ich es ja sagen …« Er hört auf zu lächeln, sein Gesicht verdunkelt sich. »Sagen wir, ich habe es von Dr. Douglas.«
»Dr. Douglas … Welchem Douglas denn?«
»Sam Douglas«, sagt er trocken. »Ist letztes Jahr umgekommen.«
Mir läuft es kalt den Rücken runter. Der hat Nerven, vor dem Abmarsch in die Zone von so was zu reden. Es ist hoffnungslos, diese Intellektuellen kapieren aber auch rein gar nichts. Ich drücke meine Kippe im Aschenbecher aus und sage: »Na gut. Wo ist er denn, dein Tender? Wie lang müssen wir noch auf ihn warten?«
Wir reden nicht weiter drüber. Kirill ruft bei der Feldeinsatzlogistik an, um eine Fluggalosche zu bestellen. Derweil nehme ich mir noch mal die Karte vor. Die ist wirklich nicht schlecht gemacht, fotografische Luftaufnahmen, stark vergrößert. Sogar das Profil von dem Reifen ist zu erkennen, der da beim Garagentor herumliegt. Von so einer Karte können wir Stalker nur träumen. Wobei, was bringt dir so eine nachts, wenn du nicht mal die Hand vor Augen siehst?
Und da taucht auch schon Tender auf, atemlos, mit rotem Kopf. Er entschuldigt sich für die Verspätung, seine Tochter ist krank geworden, er musste mit ihr noch zum Arzt. Dann verraten wir ihm unsere kleine Überraschung. Erst bleibt dem armen Kerl glatt die Luft weg. »Was, in die Zone?«, fragt er. »Wieso gerade ich?« Aber als er hört, dass es eine Extraprämie gibt und dass Red Shewhart auch mitgeht, fasst er sich wieder und atmet weiter.
Dann geht’s ab ins »Boudoir« zum Umziehen. Kirill hat inzwischen die Passierscheine besorgt, die wir einem weiteren Sergeanten vorlegen, woraufhin dieser jedem von uns einen Spezialanzug aushändigt. Wirklich extrem nützlich, diese Teile. Wären sie nicht rot, sondern in einer passenderen Farbe, würde jeder Stalker dafür sofort fünfhundert Geld abdrücken, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich hab mir längst geschworen, irgendwann mal so einen mitgehen zu lassen. Auf den ersten Blick nichts Besonderes, wie ein Taucheranzug, der Helm auch so ähnlich, mit großem Sichtfenster vorn. Oder mehr wie bei einem Düsenjetpiloten oder, sagen wir, einem Kosmonauten. Leicht ist er, bequem, nirgends zu eng, und wenn es heiß wird, schwitzt man nicht. Feuerfest und gasdicht noch dazu. Nicht mal eine Kugel, heißt es, kann ihm was anhaben. Klar: Feuer, Senfgas und Kugeln sind irdisch, von Menschen gemacht. In der Zone gibt es das alles nicht, da hast du ganz andere Sorgen. Machen wir uns nichts vor: Selbst mit Spezialanzügen krepieren dort Leute, und zwar mir nichts, dir nichts. Sicher, ohne gäbe es wahrscheinlich noch mehr Opfer. Vor dem »sengenden Flaum« schützen die Anzüge jedenfalls hundertpro. Oder vor den Spritzern des »Satanskrauts«. Na gut, lassen wir das.
Wir ziehen die Spezialanzüge über, ich nehme ein paar Muttern aus der Tüte und stecke sie in die Hüfttasche, dann gehen wir los, quer über den Institutshof zu dem Ausgang, der in die Zone führt. So läuft das hier: Jeder soll den Helden der Wissenschaft dabei zusehen, wie sie sich anschicken, ihr eigenes Leben zu opfern, im Namen der Menschheit, des Wissens und des Heiligen Geistes, Amen. Tatsächlich hängen jetzt lauter mitleidige Visagen an den Fenstern, bis in den vierzehnten Stock. Fehlt nur noch Orchestermusik, und dass sie uns mit Taschentüchern nachwinken.
»Immer schön festen Schritts«, sag ich zu Tender. »Bauch rein, Brust raus! Die Menschheit wird es dir ewig danken!«
Als er mich anschaut, sehe ich, dass ihm nicht zum Spaßen zumute ist. Natürlich hat er recht, das hier ist bitterer Ernst. Aber auf dem Weg in die Zone hast du nur zwei Optionen: Entweder du weinst, oder du machst Witze – und geweint hab ich noch nie. Ich schau zu Kirill rüber: Er hält sich wacker. Nur seine Lippen bewegen sich stumm.
»Betest du?«, frag ich ihn. »Nur zu. Je weiter du in die Zone vordringst, desto näher kommst du dem Himmel …«
»Was?«, fragt er.
»Bete ruhig!«, rufe ich laut. »Stalker kommen ins Paradies, und zwar ohne Warteliste!«
Da lächelt er und klopft mir mit der Hand auf den Rücken, nach dem Motto: Keine Angst, mit mir passiert dir nichts, und wenn doch, sterben tun wir ja nur einmal. Er ist schon ein seltsamer Vogel, echt wahr.
Wir geben unsere Passierscheine beim letzten Sergeanten ab, der ausnahmsweise ein Leutnant ist. Ich kenne ihn, sein alter Herr handelt mit Grabzäunen in Rexopolis – und da ist auch schon unsere Fluggalosche, die Jungs von der Einsatzlogistik haben sie direkt neben dem Kontrollpunkt geparkt. Alle sind sie zur Stelle: Sanitäter, Feuerwehr und natürlich unsere tapfere Garde, die furchtlosen Rettungseinheiten – ein Haufen vollgefressener Taugenichtse mit eigenem Hubschrauber. Die können mir gestohlen bleiben.
Wir besteigen die Galosche, Kirill setzt sich ans Steuer und sagt: »Na dann, Red, auf dein Kommando.«
In aller Seelenruhe mache ich den Reißverschluss meines Anzugs auf, hole meinen Flachmann aus der Innentasche, nehme einen ordentlichen Schluck, schraube den Deckel wieder drauf und stecke die Flasche wieder zurück. Das muss einfach sein. Sooft ich auch schon in der Zone war, ohne das geht es nicht. Die beiden schauen mich an und warten.
»Na dann«, sag ich. »Ich hab euch nichts angeboten, weil ich heute zum ersten Mal mit euch unterwegs bin und nicht weiß, wie Hochprozentiges auf euch wirkt. Das sind die Regeln: Alles, was ich sage, ist sofort und ohne Widerspruch auszuführen. Wer rumzickt oder Fragen stellt, kriegt eine verpasst, und zwar wo immer ich hinlange, sorry dafür schon jetzt. Ein Beispiel: Wenn ich dir, Mister Tender, befehle, lauf auf den Händen weiter, schiebst du deinen fetten Hintern unverzüglich in Richtung Himmel und führst aus, was ich sage. Tust du’s nicht, siehst du dein krankes Töchterchen vielleicht nie wieder. Verstanden? Keine Angst, ich sorge schon dafür, dass du sie wiedersiehst.«
»Hauptsache, dein Befehl kommt rechtzeitig, Red«, antwortet Tender heiser. Er ist rot angelaufen und schwitzt, seine Lippen zittern. »Ich geh auch auf den Zähnen, wenn’s sein muss. Bin ja kein Anfänger mehr.«
»Für mich seid ihr beide Anfänger«, sag ich. »Aber den Befehl geb ich dir schon rechtzeitig, keine Sorge. Übrigens, kannst du eine Galosche lenken?«
»Kann er«, sagt Kirill. »Und zwar gut.«
»Gut ist gut«, sag ich. »Na dann, los. Visiere runter. Langsame Fahrt voraus, immer an den Markierungspfählen entlang, in drei Meter Höhe. Bei Pfahl Nummer 27 machen wir halt.«