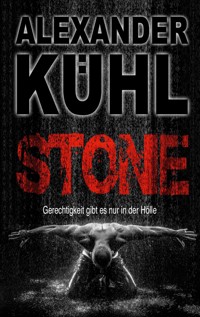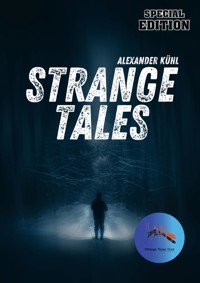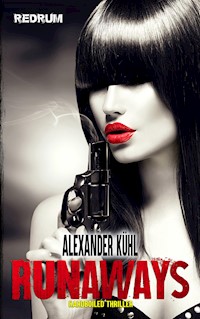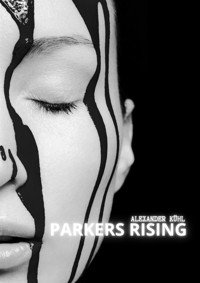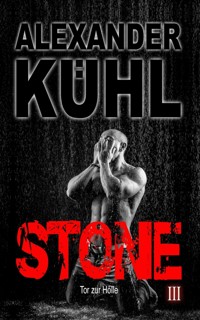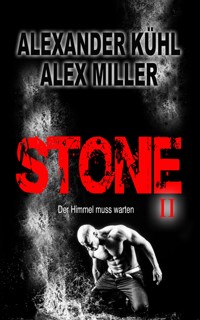5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Was wäre, wenn der Nationalsozialismus nur ein Test gewesen ist, ein Test, um auszuprobieren, wie weit man gehen kann?
Mit diesen Gedanken quält sich Alex Carter, Vize-Präsident der Umweltorganisation Blue Planet, als er mit seinem Team durch Zufall in der Antarktis auf ein verlassenes deutsches Forschungslabor trifft. Alles weist darauf hin, dass deutsche Wissenschaftler dort während des Zweiten Weltkrieges Experimente durchgeführt haben. Die Männer finden ein Tagebuch, aus dem hervorgeht, dass Hitler-Deutschland im Besitz einer fürchterlichen Waffe war, die sogar in unserer Zeit alles in den Schatten stellen würde. Warum aber hielten die Wissenschaftler ihre Erfindung zurück?
Das Tagebuch gibt nicht nur darauf Antworten, es führt die Forscher auch zu einer Kinderzeichnung aus den Siebzigerjahren, die eine Münze mit einem Sternenring darstellt. Nach weiteren Recherchen stellen sie mit Schrecken fest, welcher Grundstein für die nahe Zukunft gelegt wurde. Ein Dritter Weltkrieg, der das Ende der Menschheit bedeuten könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sternenring
Weltende
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenÜber das Buch
Was wäre, wenn der Nationalsozialismus nur ein Test gewesen ist, ein Test, um auszuprobieren, wie weit man gehen kann?
Mit diesen Gedanken quält sich Alex Carter, Vize-Präsident der Umweltorganisation Blue Planet, als er mit seinem Team durch Zufall in der Antarktis auf ein verlassenes deutsches Forschungslabor trifft. Alles weist darauf hin, dass deutsche Wissenschaftler dort während des Zweiten Weltkrieges Experimente durchgeführt haben. Die Männer finden ein Tagebuch, aus dem hervorgeht, dass Hitler-Deutschland im Besitz einer fürchterlichen Waffe war, die sogar in unserer Zeit alles in den Schatten stellen würde. Warum aber hielten die Wissenschaftler ihre Erfindung zurück? Das Tagebuch gibt nicht nur darauf Antworten, es führt die Forscher auch zu einer Kinderzeichnung aus den Siebzigerjahren, die eine Münze mit einem Sternenring darstellt. Nach weiteren Recherchen stellen sie mit Schrecken fest, welcher Grundstein für die nahe Zukunft gelegt wurde. Ein Dritter Weltkrieg, der das Ende der Menschheit bedeuten könnte.
Über den Autor
Bereits als kleiner Junge entwickelte Alexander Kühl apokalyptische Weltuntergangsgeschichten. Später folgte ein denkwürdiger Strafaufsatz mit dem Titel: ›Eine Banane ist ein wundervolles Wurfgeschoss‹. Dieser motivierte den damaligen Schüler dazu, weitere Geschichten niederzuschreiben und an seinem Traum festzuhalten: der Schriftstellerei.
2012 veröffentlichte er erstmals als Selfpublisher unter dem Pseudonym Alexander Frost seinen in der Jugend entworfenen Science-Fiction Roman ›Sternenring‹.
2017 legte er sein Pseudonym ab, wandte sich unter seinem bürgerlichen Namen dem Hardboiled-Genre zu und schrieb den Roman ›Runaways – Die Gesetzlosen‹, welcher im Redrum-Verlag erschien. Mit dieser Verlagsveröffentlichung konnte er sich einen Kindheitstraum erfüllen. Seither bleibt er dem Harboiled-Genre treu und weitere Veröffentlichungen sind geplant.
›Sternenring – Weltende‹ liegt ihm natürlich sehr am Herzen, da es sein allererstes Werk war. Daher war ihm eine Neuauflage als Selfpublisher unter seinem bürgerlichen Namen sehr wichtig, denn dieses Buch war im Prinzip der Startschuss seiner schriftstellerischen Tätigkeit, ohne dass es seine anderen Bücher niemals gegeben hätte.
Auch wenn dieses visionäre Buch etwas an das aktuelle Zeitgeschehen angepasst wurde, hat es nichts von seiner Magie verloren. Interessant bleibt, wie der Autor bereits vor etwa dreißig Jahren über unsere Zukunft spekulierte.
Vorwort des Autos
Zwischen 1986 – 1995 schrieb ich ›Sternenring‹. Auslöser war eine Phase in meinem Leben, in der ich jede Nacht von apokalyptischen Träumen heimgesucht wurde. Irgendwann habe ich dann angefangen, diese einfach aufzuschreiben. So setzte sich nach und nach eine wahre apokalyptische Geschichte zusammen, in welche wir heute tatsächlich hineinschlittern. Diese Phase prägte meine Jugend sehr und so nahm dieses Buch viel Raum in meinem Leben ein. Auch wenn die entwickelte Grundidee bereits fast drei Jahrzehnte zurückliegt, haben uns die aktuellen Ereignisse schon längst eingeholt. Es bahnen sich Wiederholungen in der Geschichte und das ausgerechnet im Herzen Europas an. Die Menschen haben Ängste. Vor allem haben sie aber Angst davor, dass diese nicht gehört werden. ›Sternenring‹ wird dadurch aktueller denn je. Deshalb ist es ein Herzenswunsch von mir, diese allererste Geschichte aus meiner Jugend und meinen Anfangsjahren der Schreiberei nun unter meinem Namen zu veröffentlichen.
Ich lade Sie herzlichst ein sich in eine Welt fallenzulassen, die es erfordert unsere deutsche Geschichte neu zu schreiben.
Prolog - Erster Teil
Antarktis 2018
Unaufhörlich peitschte der Wind den Schnee gegen die Scheibe unseres Kettenfahrzeugs. Das wilde Treiben artete zeitweise in gewaltige Sturmböen aus und versperrte uns die Sicht. Immer wieder knallten dicke Schneebälle auf den Rumpf unseres Fahrzeugs und verursachten jedes Mal angsteinflößende Geräusche. Die Expedition schien wohl unter keinem guten Stern zu stehen.
«Wir müssen anhalten, ich kann nichts mehr erkennen. Wir werden uns verfahren», erklärte Bob aufgeregt.
»Oder willst du weiter, Alex?«, fragte mich David.
»Nein, nein, halt das verdammte Ding an, wir warten die Nacht ab. Uns bleibt keine andere Wahl«, antwortete ich den beiden.
Wir wollten eigentlich schon längst den Antarktis-Stützpunkt Wostock erreicht haben, um am nächsten Morgen Messungen im Zusammenhang mit dem Ozonloch durchzuführen.
Ich ärgerte mich, dass wir hinter dem Zeitplan lagen, versuchte aber, wie immer, es mir nicht anmerken zu lassen. Als Vizevorsitzender einer kanadischen Umweltorganisation war ich auf die Idee gekommen, auf eigene Faust Messungen durchzuführen, um endlich die Wahrheit ans Licht zu bringen. Untersuchungen im Rahmen der globalen Erderwärmung waren von namhaften Institutionen durchgeführt worden und deren Ergebnisse waren fast identisch.
Einigkeit herrschte darüber, welchen Anteil der Mensch an der drohenden Klimakatastrophe hatte. Leider schien der Profit wichtiger als die Menschen. Die Politiker der führenden Wirtschaftsnationen gaben zwar zu, dass die Ozonschicht im letzten Jahr weiter geschrumpft war. Aber wir hatten den Eindruck, dass einige Wissenschaftler mit viel Geld geschmiert worden waren, um irrwitzige Thesen darüber aufzustellen, dass ein Schrumpfen der Ozonschicht normal wäre, und diese sich in den nächsten Jahren von allein wieder regenerieren würde. Lobbyisten von Energiekonzernen waren damit beschäftigt, Wissenschaftler dazu zu bewegen, die Ergebnisse von Umweltorganisationen zu relativieren. Die Studie meiner Organisation Blue Planet aus dem Jahr 2012 zeigte alle denkbaren Schreckensszenarien auf. Wir hatten es als unsere Pflicht angesehen, nichts schönzufärben. Die Mitglieder meiner Organisation waren sich darüber einig, dass die globale Erderwärmung der nächsten Generation die Lebensgrundlage und damit alle Handlungsspielräume rauben würde. Deshalb durfte nichts verschwiegen werden. Wenn unsere Kinder und Enkel eine reelle Chance haben sollten, musste die Wahrheit ans Licht.
Unsere Berichte, die wir den Regierungschefs der G8-Staaten zukommen ließen, wurden zunächst von allen Ländern als streng geheim eingestuft, danach aber ignoriert und schließlich unter Verschluss gehalten. Daraufhin spielten wir zwei Jahre später die Informationen einer Internetplattform zu, wo sie immer noch abgerufen werden konnten. Das Ozonloch und die globale Erderwärmung schienen ein Tabuthema für die Regierungen zu sein, obwohl die Fakten offen auf dem Tisch lagen und für sich sprachen. Jeder, der die Zahlen kannte, wusste, dass die Zeit knapp wurde.
Vor Kurzem hatten Forscher auf Grönland einen Süßwassersee entdeckt, der bisher nirgends verzeichnet war. Na, wie auch!? Süßwasser bedeutete Schmelzwasser. Und das wiederum war ein Beweis dafür, dass der See erst in jüngster Zeit entstanden war und die Pole schmolzen. Als noch alarmierender empfand ich die Tatsache, dass sich ein Teil der Antarktis, so groß wie eine Stadt, losgelöst hatte und nun im Atlantik trieb, ein weiterer Beweis für das langsame Schmelzen der Pole und die Umweltkatastrophe, in die wir hineinsteuerten. Wenn man bedachte, dass bereits jetzt 71 % der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt waren, wurde deutlich, wie sehr unser Lebensraum in der Zukunft schrumpfen würde. Im Gegensatz zu den meisten Politikern, denen ihre eigenen Nachfahren scheinbar egal waren, wollten wir nicht, dass unsere Enkelkinder im Schlauchboot zur Arbeit paddeln mussten und auf keinen Fall ohne Lichtschutzfaktor 300 ihre Pfahlbauten verlassen konnten.
Vielleicht traf die Katastrophe aber auch schon unsere Kinder, denn Forscher revidierten ihre Prognosen beinahe jährlich – und zwar nach unten.
Nachdem unser Geologe Bob Fox alle Fakten zusammengetragen hatte, waren wir übereingekommen, in die Antarktis zu fahren, um persönlich Messungen durchzuführen. Der Normalbürger war zunächst auf die Berichterstattung der Medien angewiesen. Nur wenige suchten sich weitere Informationskanäle. Unsere Idee war, nach der Expedition mit unseren brandaktuellen Ergebnissen an die Weltöffentlichkeit zu treten. Uns war klar, dass es harte Auseinandersetzungen mit Politikern und vor allen Dingen mit Energiekonzernen geben würde, aber wir waren entschlossen, diesen Weg zu gehen.
»Wenn nicht wir, wer dann?«, sagte ich mir immer. Ich war mit Menschen zusammen, die mir im Laufe der Jahre so ans Herz gewachsen waren, dass ich gar nicht daran dachte, keinen Erfolg mit unserer Expedition haben zu können. Bob war, genau wie David und ich, Mitte 30. Im Gegensatz zu meinem war sein Haar sehr voll. Er trug es meistens zu einem Zopf gebunden. Mit seinem blonden Vollbart und den langen Haaren sah er aus wie ein Holzfäller. So kleidete er sich auch. Er war der sprichwörtliche sanfte Riese, dem ich jedes Mal, wenn wir uns sahen, die Bemerkung verzieh, dass meine Geheimratsecken gewachsen seien. David Paganini, unser Spezialist für Technik, Messung und Elektronik, war gebürtiger Italiener. Auch er hatte mit seinem vollen schwarzen Haar kein Glatzen-, dafür aber ein Gewichtsproblem. Sein Markenzeichen war ein Bleistift, den er entweder im Mund hatte oder sich hinter das linke Ohr klemmte. Er schrieb nie damit, sondern kaute in kniffligen Situationen darauf herum. Irgendwann hörte ich auf, mir darüber Sorgen zu machen, dass er an einer Bleivergiftung sterben könnte. Einmal hatten Bob und ich ihm zum Geburtstag eine ganze Kiste Bleistifte geschenkt, da sein Stift völlig zerkaut war. Aber David ließ sich nicht überzeugen und versuchte uns zu erklären, dass alles glatt liefe, seit er auf dem Bleistift herumkaute, und dass der Stift uns alle beschützen würde. Mittlerweile hatten wir uns mit seiner Marotte abgefunden und warteten nur darauf, dass er sich an einem Splitter verschlucken und im Krankenhaus von seinem Spleen geheilt werden würde. Ich war sehr froh, dass ich die beiden für diese Expedition gewinnen konnte, denn ich hätte in dieser Situation niemandem sonst vertraut. Bob, David und ich hatten die gleiche Wellenlänge. Meine Frau drückte es so aus: »Euer Herzschlag hat die gleiche Frequenz.«
Manchmal genügte ein Handzeichen oder nur ein bestimmter Blick, dann wusste der andere, was er zu tun hatte. Unsere Kommunikation verlief oft ohne Worte. Dies stellte nicht nur einen Vorteil dar, sondern war in manchen Situationen unbedingt notwendig. Dazu kam noch, dass wir den gleichen Humor hatten, was mitunter sehr hilfreich war. Obwohl ich schon einige Jahre glücklich verheiratet war, hatte ich das Gefühl, dass die beiden meine Familie waren. Ich fühlte mich bei ihnen geborgen. Sie waren die Brüder, die ich mir immer gewünscht hatte. Wir kannten unsere Stärken und Schwächen, ergänzten uns und bildeten so das perfekte Team. Die intensive Beziehung zu meinen Freunden bedeutete aber nicht, dass meine Frau Alexandra in meinem Leben eine geringere Rolle spielen würde. Ich hatte sie während meines Geologie-Studiums in Berlin kennengelernt und mich sofort in sie verliebt. Es war die sprichwörtliche Liebe auf den ersten Blick. Allerdings dauerte es einige Vorlesungen, bis ich sie endlich ansprach. Meine Gefühle für ein deutsches Mädchen motivierten mich natürlich zusätzlich, noch schneller Deutsch zu lernen. Mein Studium war die beste Entscheidung meines Lebens.
Ich traf Mrs. Right und stellte die richtigen Weichen für meine Zukunft. Als ich direkt nach meinem Studium das Angebot von Blue Planet erhielt, war auch meine spätere Frau Feuer und Flamme gewesen. So gingen wir zusammen nach Kanada, meine Heimat. Auch nach so langer Zeit zählte ich die Tage, bis wir uns wiedersehen würden. Dass ich solch eine romantische Ader hatte, ließ ich mir gegenüber David und Bob jedoch nie anmerken. Ich wollte sie stets im Glauben lassen, dass ich durch und durch ein harter Hund war, der mit Romantik nichts am Hut hatte.
Mittlerweile war es stockdunkel geworden und wir versuchten, im Cockpit sitzend in den Schlaf zu finden.
»Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wir uns nie kennengelernt hätten, wenn der Fahrstuhl im Royal Trust Tower in Toronto nicht steckengeblieben wäre? Wir wären ausgestiegen und unserer Wege gegangen«, unterbrach Bob die Stille.
Wahrscheinlich konnte er nicht einschlafen.
»Wie lange saßen wir darin fest?«
Bob lachte, als er antwortete: »Zwei Stunden.«
»Aber die Zeit haben wir gut genutzt, um uns kennenzulernen. Sonst hätten wir nie erfahren, dass wir das gleiche Studium absolviert hatten«
Ich erinnerte mich an jede Einzelheit. Als nach zwei Stunden noch niemand erschienen war, um uns zu befreien, beschlossen wir, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Bob hatte zufällig das passende Werkzeug im Rucksack, genau wie in einem Rambofilm. Wir kletterten auf das Fahrstuhldach und hatten Glück, dass der Aufzug so stecken geblieben war, dass wir die Tür gut erreichen konnten. Wir stemmten die Tür der oberen Etage vom Fahrstuhlschacht auf, kletterten hinaus, klatschten uns wie Basketballspieler nach einem gewonnenen Play Off-Spiel ab und gingen erst einmal in ein Café. Bei einem gepflegten Molson Canadian Lager Bier tauschten wir zuerst Expeditionsgeschichten aus und zum Schluss unsere Visitenkarten. Seitdem dachte ich darüber nach, ob es tatsächlich möglich sein könnte, dass es so etwas wie Zufälle nicht gibt.
»Ich möchte nur bemerken, dass es uns drei als Team nicht geben würde, wenn euch das nicht passiert wäre«, fügte David hinzu.
Ich nickte unwillkürlich, obwohl meine Kumpel das natürlich nicht sehen konnten, und dachte an den Abend, als Bob David zu einer Pokerrunde mitgebracht hatte.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten wurden wir drei unzertrennlich. Irgendwie kam es mir so vor, als hätten wir uns gesucht und schließlich gefunden. Die Unterhaltung erstarb. Wir waren einfach zu müde. David hatte sich Watte in die Ohren gestopft, da Bob nachts schnarchte, und zwar so laut, dass man es wahrscheinlich vom Südpol bis nach Neuseeland hören konnte. Bob setzte sich die Kopfhörer seines Walkmans auf als Schutz gegen die Geräusche der Nacht. Es war beängstigend. Der Wind peitschte über unser Fahrzeug und es klang, als würde ein Wolf aufheulen. Manchmal schien es, als drohte unser Schneemobil auseinanderzubrechen, weil es dem Wind keinen Widerstand mehr entgegensetzen konnte. Es klang, als setzte jemand ein Brecheisen an und versuchte damit durchzubrechen. Manchmal ertönte ein heller, metallischer Ton, dann wieder ein tiefer. Die dicken Eisstücke, die gegen die Wände und Scheiben flogen, lieferten den Rest der gespenstischen Audiovorführung. Bob schnarchte schon und David kaute nicht mehr an seinem Bleistift. Ich hatte genug, wollte jetzt auch endlich einschlafen! So stellte ich die Scheibenwischer an und ließ mich von dem monotonen Geräusch in den Schlaf wiegen. Müde und durcheinander wie ich war, kam mir ein etwas abenteuerlicher Gedanke.
Bobs Kassette wird sicherlich irgendwann zu Ende sein, sagte ich mir im Stillen. Dann wird er von den Scheibenwischern wach, und um die Batterie zu schonen, wird er sie abstellen.
Kaum hatte ich zu Ende gedacht, schlief ich auch schon.
Am nächsten Morgen weckte uns die Sonne, die wie ein Gigant über der Antarktis thronte. Ihre Strahlen fühlten sich an wie warme Hände, die mein Gesicht streichelten. Ich rieb mir den Schlaf aus den Augen, gähnte und suchte sofort die Thermoskanne. Während ich mir die lauwarme Kaffeebrühe in eine Tasse goss, fragte ich in die Runde: »Na, Männer, habt ihr gut geschlafen?«
Bob gähnte laut und antwortete mürrisch: »Irgendein Depp muss heute Nacht gegen den Schalter der Scheibenwischer gekommen sein. Ich vermute mal, dass es David war.«
»Na klar, ich bin sowieso immer an allem schuld.« David tat etwas beleidigt. Mit einem Grinsen steckte ich mir eine Zigarette an. »Raus! Rauch‘ dein Kraut draußen«, stieß er mich an.
Es war eine Last, mit zwei Nichtrauchern zusammen zu sein. Ich zog den Reißverschluss meiner Jacke bis zum Kinn hoch, um nach draußen zu gehen, bekam aber die Tür nicht auf.
»Kann mir mal jemand helfen, wir sind eingeschneit«.
David zögerte nicht lange, schließlich wollte er nicht am Zigarettenrauch ersticken, holte tief Luft und stemmte sich mit seiner ganzen Masse gegen die Tür. Unter Ächzen ließ sich die Tür langsam öffnen. Das war erstaunlich angesichts des fast kniehohen Schneeberges, der sich vor ihr angesammelt hatte.
»Wenn du nicht rauchen und mehr essen würdest, hättest du das auch allein geschafft«, erklärte David zu mir gewandt.
Dann drückte er seinen bulligen Körper an mir vorbei und trat ins Freie. Wir folgten ihm, um erst einmal Platz für den morgendlichen Kaffee zu machen. So standen wir nebeneinander und urinierten in den Schnee. So schnell wie das Unwetter gekommen war, war es auch schon wieder vorbei. Kein einziges Lüftchen wehte mehr und die Sicht war glasklar. Bob holte Karte und Kompass aus dem Führerhaus, blickte kritisch zum Horizont und verkündete: »Wir sind circa drei Kilometer von Wostock entfernt. Mann, ich fasse es nicht, nur lumpige drei Kilometer!«
Ich nickte. »Okay Jungs, dann lasst und die Spitzhacken und Schaufeln holen und … los geht´s!«
Bob und David seufzten im Chor. Voller Tatendrang sprang ich auf den Container und reichte meinen Freunden die Gerätschaften. Über Nacht war der Schnee zu Eis gefroren, sodass wir unsere ganze Kraft aufbringen mussten, um das Fahrzeug zu befreien. Ohne Unterlass schaufelten wir schweigend den Schnee beiseite und hämmerten verbissen auf das Eis ein.
»Pass‘ doch auf, du Idiot!« Wütend richtete sich David auf und rempelte Bob an.
»He!«, antwortete dieser.
Bob war vollkommen in seine Arbeit mit der Spitzhacke vertieft gewesen und hatte dabei nicht bemerkt, dass zuerst Matschflocken und später winzige Eisschnipsel in Davids Gesicht flogen.
Ich verkniff mir das Lachen. Nach anderthalb Stunden war unser geliebtes Fahrzeug fast freigelegt. Es war wieder David, der nach einer Weile völlig unerwartet aufschrie. Bob und ich zuckten zusammen.
»Ach, du meine Güte! Hier ist eine Tür.« Davids Stimme überschlug sich fast.
Bob und ich sahen uns an. Ich grinste, er lachte drauflos.
»Ihr glaubt mir nicht?« David klang beleidigt.
Er schlug mehrmals hintereinander mit der Spitzhacke in den Boden, worauf es immer wieder einen metallischen Ton gab.
»Hier im Boden ist eine Tür.«
Ich grinste nicht mehr und Bob lachte nicht mehr. Uns war der Schreck in die Glieder gefahren. Wir warfen unsere Schaufeln in den Schnee und stolperten eilig zu David. Bob kniete sich in den Schnee und begann hastig an der Stelle zu graben. »Tatsächlich, hier ist eine Tür.«
Instinktiv suchte ich in meinen Jackentaschen nach den Zigaretten. Als ich sie fand, atmete ich erleichtert auf und zündete mir eine an. Bob ging zum Führerhaus, um eine Karte zu holen, breitete sie ihm Schnee aus und studierte sie eine Weile mit höchster Konzentration. Dann sagte er mit Bestimmtheit: »Entweder haben wir uns verfahren oder unter uns befindet sich etwas, das bisher nicht bekannt ist. Auf der Karte ist nichts eingezeichnet und ich denke nicht, dass wir uns verfahren haben oder unsere Koordinaten nicht stimmen.«
In der Zwischenzeit hatte David die Tür ganz freigeschaufelt. Jetzt hockten wir vor einer runden Luke von circa zwei Metern Durchmesser, die in der Mitte einen Hebel hatte. Hilflos sahen wir uns an. Dann unterbrach ich unsere Lethargie und machte mich am Hebel zu schaffen. Wenig später packten Bob und David mit an, aber die Luke ließ sich nicht öffnen. Völlig außer Atem ließen wir von ihr ab und setzten uns erschöpft in den Schnee.
»Klopf doch mal, vielleicht macht einer auf«, prustete David. Bob kletterte auf den Container und holte den Schweißbrenner. Ich klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter.
Er rückte seine Schutzbrille zurecht und machte sich an die Arbeit. Zu Bobs Stärken gehörte es, dass er in der Lage war, in kürzester Zeit notwendige Entscheidungen zu treffen und ich konnte mich nicht daran erinnern, dass er jemals danebengelegen hätte. Gedankenverloren sah ich ihm bei der Arbeit zu. Die wildesten Überlegungen jagten mir durch den Kopf. Was verbarg sich unter der Luke? Und warum war sie auf keiner Karte eingezeichnet? Welche Nation hatte da ihre Finger im Spiel? Wer zum Kuckuck hatte dort etwas hin gebaut und zu welchem Zweck? David kaute so heftig auf seinem Bleistift herum, dass ich dachte, er würde jeden Augenblick zerbrechen. Was hatten wir da bloß entdeckt? Mir kamen die merkwürdigsten Ideen. Hatten wir unser Fahrzeug zufällig neben dieser mysteriösen Luke abgestellt? Zwang uns der Sturm dazu, diese Entdeckung zu machen? Gab es überhaupt Zufälle? Meine Gedanken wurden immer konfuser.
Eines stand jedoch fest: Bob hatte absolut recht damit, dass wir auf etwas gestoßen waren, das bisher schlichtweg nicht bekannt war, denn was die Antarktis anging, waren wir bestens informiert.
Die helle Schweißnaht näherte sich ihrem Ziel unaufhörlich. Meine Neugierde steigerte sich ins Unermessliche.
»Fertig!«, rief Bob und stellte den Schweißbrenner ab.
Zu dritt versuchten wir nun, die schwere Luke unter Einsatz aller Kräfte hochzuheben.
Als es uns endlich gelang, schrien wir gleichzeitig auf, hievten die Luke hoch und beförderten sie mit der Vorderseite nach unten in den Schnee. Der Weg in die Tiefe war frei.
Bob saß etwas außer Atem neben der Luke und es schien, als schluckte er einen dicken Kloß hinunter, der ihm im Hals steckte.
»Seht mal, die Luke hat auf der Rückseite eine Schweißnaht!«
»Das ist bestimmt deine!« David feixte, da er einen Scherz vermutete.
Bob schüttelte den Kopf. »Quatsch, ich habe die Vorderseite aufgeschweißt. Hier hat jemand die Rückseite zugeschweißt.«
Blitzartig hockte ich mich zu Bob in den Schnee und hakte nach: »Kannst du das bitte wiederholen?«
»Klar! Jemand hat von innen die Tür zugeschweißt.« Er verdrehte genervt die Augen und fuhr fort: »Das bedeutet folgendes: Entweder gibt es einen weiteren Eingang oder derjenige, der von innen geschweißt hat, ist immer noch da unten.«
»Wenn derjenige noch da unten ist, wird er nicht gerade erfreut sein, dass wir seine Haustür zerstört haben.« David kaute eifrig an seinem Bleistift. Jeder von uns nahm die Taschenlampe, die an seiner Jacke befestigt war, in die Hand. So standen wir im Kreis und leuchteten gemeinsam in den nach unten führenden Schacht. Wir sahen eine Stahltreppe, deren Ende nicht zu erkennen war. Es schien, als würde sie ins Nichts führen.
»Na, Männer, ziehen wir Streichhölzer oder wie geht es jetzt weiter?«, fragte Bob in die Runde.
»Wenn wir Cops wären, müssten wir, glaube ich, auf die Verstärkung warten«, fügte David hinzu.
»Wir ziehen keine Streichhölzer. Ich bin der Leiter der Expedition und werde vorangehen!«
»Ich will dir nicht widersprechen, Chef«, erklärte David.
Daraufhin setzte ich mir den Helm auf, an dem vorne eine Lampe befestigt war, und kletterte auf die erste Stufe der Stahltreppe.
»Wenn dich unten ein Monster am Bein packt, dann schrei bitte ganz laut, damit ich die Luke wieder schnell verschweiße«, gab mir Bob mit auf den Weg. Ich trat den Weg in die Tiefe an und fühlte, dass es mit jeder weiteren Stufe nach unten kälter wurde. Schließlich musste ich anhalten, um mir Handschuhe anzuziehen, denn das Geländer der Treppe war so stark vereist, dass ich Angst hatte, Erfrierungen zu erleiden oder gar daran kleben zu bleiben. Die Stufen waren mit einer dicken Eisschicht überzogen, was zur Folge hatte, dass ich mehrmals trotz der Sicherheitsschuhe abrutschte und einmal sogar fast in die Tiefe gestürzt wäre. Nach geschätzten zehn Metern erreichte ich das Ende der Leiter. Der Abstieg war mir wie eine Ewigkeit vorgekommen. Eisige Kälte sammelte sich an meinen Füßen und stieg an meinen Beinen hinauf. Die Kälte und die schlechten Lichtverhältnisse gaben dem Ganzen eine gespenstische Atmosphäre.
Jetzt wurde mir flau im Magen und Angst breitete sich in mir aus. Aber meine Neugierde überwog.
»Hier ist kein Monster, ihr könnt jetzt kommen«, schrie ich nach oben. Vorsichtig blickte ich mich um. Im Halbdunkel erkannte ich eine weitläufige Halle, deren Ausmaße ich aber nicht abschätzen konnte. Ich nahm die Taschenlampe von meinem Helm und leuchtete in den Raum. Im Lichtkegel waren jetzt Regale an den Wänden zu erkennen. Auf den Brettern lagen technische Geräte, die ich von meinem Standort aus und bei den Lichtverhältnissen nicht näher identifizieren konnte. Außerdem standen dort Reagenzgläser, und zwar eine Menge. Vor den Regalen befanden sich Tische, beladen mit diversen kleinen Gerätschaften. Ich entdeckte einen Bunsenbrenner und fühlte mich an den Chemieunterricht in der Schule erinnert. Mein Chemielehrer hatte immer einen weißen Kittel getragen, der aussah, als hätte er ihn gerade gekauft und aus der Verpackung genommen.
Bob und David kletterten zu mir herunter. Je näher sie kamen, umso heller wurde es, denn drei Taschenlampen spenden natürlich mehr Licht als eine. Endlich standen sie neben mir. Bob versuchte sofort, den Raum mit seiner Lampe abzutasten.
Amüsiert nahm ich zur Kenntnis, dass David sich mit offenem Mund auf den Weg zu den Tischen mit den Reagenzgläsern machte.
Bob klatschte in die Hände und rief: »Licht.«
Da nichts passierte, fügte er schmunzelnd hinzu: »Wohl keine Sprachsteuerung.«
David widmete sich sofort den Geräten, die auf den Tischen standen, und kam aus dem Staunen nicht mehr raus.
»Dieses hier misst die Schwingungen im Erdboden, das dort drüben misst die Hitze und das daneben die Spannung«, erklärte er begeistert, während er auf die betreffenden Geräte zeigte.
»Wonach sieht es für dich aus?«
»Na ja, ich bräuchte bessere Lichtverhältnisse, um genaue Angaben machen zu können, aber wenn ich auf Anhieb etwas sagen soll, würde ich meinen, dass hier Bombentests stattfanden.«
»Bombentests?«, hakte ich nach, völlig verblüfft.
David räusperte sich. »Ja, unterirdische Bombentests! Jedenfalls misst man die Sprengkraft einer Bombe mit solchen Geräten, aber wie gesagt, ich brauche mehr Licht, um besser sehen zu können.«
Als hätte er eine Ahnung, tastete er mit dem Lichtstrahl seiner Taschenlampe die Wand ab.
»Eine Tür!« Er klang zufrieden.
Schnell ging David darauf zu und drückte den Griff nach unten. Sie ließ sich tatsächlich öffnen. Er leuchtete hinein. Sofort hefteten Bob und ich uns an seine Fersen, voller Neugierde auf das, was sich hinter der Tür verbarg. Jetzt standen wir nebeneinander und leuchteten in den Raum.
Ein riesiger Klotz füllte fast den gesamten Platz aus.
David jubelte: »Danach habe ich doch gesucht, ein Generator! Es wäre auch komisch gewesen, wenn die hier unten mit Kerzen gearbeitet hätten. Jungs, gleich haben wir wieder Licht!«
David kehrte zurück zur Treppe, um von oben sein Werkzeug zu holen. Staunend blickten Bob und ich uns an, völlig verdattert darüber, mit welchem Tempo der ›Dicke‹ nach oben eilte.
Bob konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
»Und wonach sieht es für dich aus, Alex?«
»Es sieht für mich etwas nach Alien - die Wiedergeburt oder nach irgendeinem Stephen King-Schocker aus«, antwortete ich. Und ich meinte es ernst! Bob merkte sofort, dass dies kein Scherz war, als ich mit der Taschenlampe große Gefäße beleuchtete, die mit Flüssigkeit gefüllt waren und in denen Embryonen schwammen. Uns beiden stockte der Atem. Einige wirkten missgebildet. Eines hatte sogar zwei Köpfe.
Fassungslos starrten wir auf den grausigen Inhalt. Die Kälte schien in diesem Raum noch intensiver zu sein. Die Luft brannte beim Einatmen im Hals und ich hatte Mühe, diese wieder aus meiner Lunge zu pressen. Unter meiner Schädeldecke machte sich plötzlich ein Stechen bemerkbar und ich fühlte leichten Schwindel aufkommen. Der Sauerstoffgehalt schien vielleicht hier unten zu gering zu sein. Es musste eine natürliche Erklärung dafür geben, denn dass mir übel wurde, hätte ich nie zugegeben.
»Sind das tierische oder menschliche Embryonen?«, stieß ich mit bebender Stimme hervor.
Bob trat einen Schritt näher heran und leuchtete direkt in ein großes Gefäß. Wir zuckten beide zurück, als wir ein voll entwickeltes Kind darin entdeckten.
»Das ist definitiv menschlich!«, flüsterte Bob.
Es kam mir so vor, als würde er würgen. Mein Herz hämmerte wie verrückt. Jetzt hatte ich richtige Angst vor dem, was wir noch entdecken würden. Wo waren wir hier um Gottes Willen nur hineingeraten? Vorsichtig umrundeten wir das Gefäß mit den Embryonen. Ich hatte plötzlich den Eindruck, einen tiefen, langanhaltenden Ton zu hören und bekam eine Gänsehaut. Die wildesten Ideen gingen mir durch den Kopf.
»Ich denke, wir warten bis David den Generator in Gang gebracht hat, denn bei Licht sieht bestimmt alles ganz anders aus.«
Noch bevor ich den Satz beendet hatte, standen wir vor einer weiteren Tür, und ich konnte mich nicht gegen den Drang wehren, sie zu öffnen. Ich leuchtete in den Raum hinein, der sich vor uns erstreckte. Mein Puls raste, als ich auf einen Schreibtisch leuchtete, auf dem ein aufgeklapptes Buch lag. Als wir uns dem Schreibtisch näherten, hörten wir David die Treppe herunterklettern. Auf der geöffneten Buchseite stand etwas Handgeschriebenes.
»Was ist das für eine Sprache?«, fragte Bob.
Ich holte tief Luft und antwortete: »Deutsch!«
»Das gibt es doch nicht! Versuche an Menschen traue ich ja so ziemlich allen zu, aber nicht den Deutschen«, stammelte Bob.
Ich nahm das Buch vorsichtig in die Hand, drehte es um, ohne es zuzuschlagen. Es war in einen weinroten Lederumschlag eingebunden, die Vorderseite geschmückt mit Reichsadler und Hakenkreuz.
»Ich muss mich korrigieren, diesen Deutschen hätte ich das natürlich auch zugetraut«, fügte Bob hinzu.
In dem Moment gab es ein helles, in den Ohren ziehendes Geräusch, und wir hörten den Generator anspringen. Kurz darauf gingen, unter Davids Jubelschreien, die Neonröhren an den Decken nacheinander an. Die Räume waren nun hell erleuchtet. Das Licht milderte das Gespenstische an der Atmosphäre etwas ab. Feine Härchen an meinem Handrücken richteten sich auf und signalisierten mir einen Luftzug. Scheinbar wurde auch die Sauerstoffversorgung wieder in Gang gesetzt. Als David endlich zu uns stieß und das Buch sah, wusste auch er, dass wir eine sensationelle Entdeckung gemacht hatten. Jeder versuchte in diesem Moment zu vertuschen, dass er eine Gänsehaut hatte und eigentlich jetzt lieber an jedem anderen Ort der Erde gewesen wäre als gerade hier.
»Ich schau mir noch einmal die Gerätschaften an«, unterbrach David die Stille und verschwand.
Mit zitternden Händen drehte ich das Buch um und entzifferte die letzten beiden Sätze:
Möge Gott unserem Volk vergeben.
Juli 1944, Peter von EilslebenEs handelte sich also mit größter Wahrscheinlichkeit um ein Tagebuch. Neben der Stelle, wo das Buch gelegen hatte, war noch etwas aufgeschlagen. Dabei konnte es sich um eine Geschichts-Chronik handeln. Auf der offenen Seite waren Bilder von KZ-Häftlingen zu erkennen, die hinter einem Stacheldrahtzaun standen. Darunter entdeckte ich ein Foto von einem Radlader, der einen Berg von Leichen vor sich herschob. Nun verstand ich den Satz der letzten Eintragung. Ich entdeckte einen Aschenbecher in Form eines Reichsadlers, steckte mir eine Zigarette an, setzte mich an den Schreibtisch und blätterte das Tagebuch durch.
»Kannst du das übersetzen?«, fragte Bob.
»Ich denke schon.«
Es war jetzt von unbestreitbarem Vorteil, dass ich sechs Jahre in Deutschland studiert hatte und mit einer Deutschen verheiratet war. Ich zog kräftig an meiner Zigarette und schlug die erste Seite des Tagebuchs auf. Da kam David herein, starrte auf seine Notizen und plapperte sofort drauf los: »Also, das sind alles Geräte, die Anfang der vierziger Jahre in Deutschland gefertigt wurden. Ich bin mir sicher, dass die Deutschen hier ihre Wunderwaffe getestet haben. Ja, ich denke tatsächlich, dass sie diese besaßen!«
»Wie kommst du darauf?« Ich kniff irritiert die Augen zusammen.
David klemmte sich den Bleistift hinters Ohr.
»Also, die Deutschen haben hier unterirdisch eine Bombe gezündet. Sämtliche Geräte, die für damalige Verhältnisse sehr fortschrittlich waren, sind bei vollem Ausschlag stehen geblieben.«
»Wieso stehen geblieben?«, hakte Bob nach.
Davids Gesichtsausdruck wurde plötzlich tiefernst.
»Die Messinstrumente waren nicht in der Lage, die Wucht der Detonation zu messen. Diese Bombe oder was immer es auch war, muss alles an Sprengkraft übertroffen haben, was damals existierte. Ich kenne die Messeinheiten der Atombombe von Hiroshima und die ist eine Knallerbse im Vergleich zu dem, was ich gerade abgelesen habe. Hitler hatte eine Waffe, mit der hätte er England versenken können. Und nicht nur das! Ich denke, dass Nazi-Deutschland in der Lage gewesen wäre, die Welt in Schutt und Asche zu legen. Wahrscheinlich sogar den gesamten Planeten zu zerstören.«
»Du meinst also, dass die Nazis tatsächlich ihre Wunderwaffe besaßen?«, fragte ich verblüfft.
David stibitzte den Bleistift hinter seinem Ohr und kaute wieder darauf herum. »Die hatten sie, aber scheinbar wurde sie im Krieg nie eingesetzt. Warum kann ich euch nicht sagen, denn ich bin nicht Nostradamus.«
»Vielleicht kann uns dieses Tagebuch eine Antwort darauf geben.« Hoffnungsvoll blickte ich auf die aufgeschlagenen Seiten.
Bob und David setzten sich zu mir an den Schreibtisch. Noch einmal zog ich an meiner Zigarette. Ich war begierig darauf, endlich die tausend Fragen beantwortet zu bekommen, die ganz sicher nicht nur in meinem Kopf herumschwirrten. Ich räusperte mich und begann vorzulesen:
Logbuch des Reichsstützpunktes Antarktis, Entwicklung der Endsiegwaffe
Antarktis, 24. Mai 1944
Endlich konnten wir heute hier Quartier beziehen und sind mehr als zufrieden darüber, welche Ausstattung uns zur Verfügung steht. Alles ist auf dem neuesten Stand der Technik und einige der Geräte gibt es nur hier. Die übrige Welt kennt sie noch nicht. Dies ist wieder mal ein Beweis dafür, dass das Deutsche Reich die fortschrittlichsteNation der ganzen Welt ist. Wir alle sind stolz, hier forschen zu dürfen und dem geliebten Führer dabei zu helfen, die große Wende herbeizuführen. Wir haben hier die besten Voraussetzungen, technisch, aber auch, was die Lage betrifft. Hier ist es uns möglich, fernab der Zivilisation und völlig unbemerkt von feindlichen Truppen zu forschen, um den Sieg vorzubereiten.
Von den geplanten unterirdischen Bombentests wird man außerhalb der Antarktis keine Notiz nehmen.
Peter von Eilsleben
Antarktis, 26. Mai 1944
Ich bin mehr als verwirrt, denn das Material, mit dem wir experimentieren sollen, habe ich noch nie gesehen. Angeliefert wurde es in drei Holzkisten, die jeweils etwa die Größe einer Bananenkiste hatten. Darin befanden sich zehn Kugeln, etwa so groß wie ein Fußball und jede mit einem Gewicht von 500 Gramm. Auf den ersten Blick dachte ich, es handelte sich um Blei und schätzte anhand der Größe der Kugeln das Gewicht auf mindestens das Zweifache. Nicht nur deswegen waren wir anfangs irritiert. Sofort führten wir mit dem Material einige Tests durch. Wenn man versucht, den festen Aggregatzustand einer solchen Kugel in einen flüssigen oder gasförmigen zu überführen, geht er in Sekundenschnelle wieder zurück in den vorherigen Zustand. Aber ohne Manipulation von außen verändert die Kugel, sobald sie auf dem Labortisch liegt, permanent von sich aus Form und Gewicht, wird aber nie flüssig oder gasförmig. Man sagte uns, dass wir nicht danach forschen sollten, woher der Stoff stammt. Inzwischen sind wir uns auch darüber einig, dass wir es gar nicht wissen wollen. Es mag merkwürdig klingen und wir sprechen es auch nicht offen aus, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Stoff in der Lage ist, unsere Sinne zu verwirren. Es ist so, als hätte er einen eigenen Willen und wolle uns kontrollieren. Ich weiß, dass meine Kollegen das Gleiche empfinden. Er hat Kontrolle über unsere Träume. Wir haben nachts schreckliche Albträume, die wir nicht in Worte fassen können. Das Entsetzen darüber ist zu groß.
Peter von Eilsleben
Antarktis, 28. Mai 1944
Wir werden heute die erste Bombe unterirdisch zünden. Mein Gott, wenn die Welt wüsste, welche Waffe wir in den Händen halten! Wenn alles so eintrifft, wie wir es vorausgesagt haben, ist der Endsieg nahe! Diese Waffe wird alle unsere Feinde in die Flucht schlagen. Es lebe Deutschland!
Peter von Eilsleben
Antarktis, 30. Mai 1944
Der Versuch ist fehlgeschlagen. Aus noch nicht geklärten Gründen reagierte der Zünder nicht. Unsere Enttäuschung ist unendlich. Wir haben Berlin vom Fehlversuch in Kenntnis gesetzt. Von dort signalisierte man uns, dass das Deutsche Reich keine Zeit zu verschenken habe. Wir werden nicht ruhen, bis wir den Fehler gefunden haben.
Peter von Eilsleben
Antarktis, 12. Juni 1944
Es hat funktioniert! Das ist unglaublich und uns allen fehlen vor lauter Glück die Worte. Solch eineWirkung war uns bisher gänzlich unbekannt und übertrifft unsere kühnsten Erwartungen. Die Messanzeiger sind bei vollem Ausschlag stehen geblieben. Dies bedeutet, dass die Wucht der Detonation alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Die Bombe hat einen trichterförmigen Krater von zehn Metern Durchmesser hinterlassen, der ab etwa fünf Metern unterhalb des Kraterrandes mit einer quecksilberfarbenen Flüssigkeit gefüllt ist. Niemand kann lange hineinschauen, denn, so merkwürdig das klingen mag, diese Flüssigkeit verwirrt die Augen. Sie verändert ständig die Farbe, wobei Farbe nicht das richtige Wort ist. Manchmal wirkt sie vollkommen dunkel, dann wieder schimmert sie silbrig oder sieht aus wie Quecksilber. Man könnte meinen, dass sie in Bereiche des Farbspektrums wechselt, die das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann. Es scheint so, als hätte die Flüssigkeit verschiedene Gesichter. Die Geräte sind nach der Detonation ausgefallen, wir haben also keine Daten, alles ist verloren gegangen. Wir haben nichts, womit wir unsere Arbeit belegen können. Jeglicher Beweis fehlt uns. Dieser Umstand macht uns betroffen und ist ein klarer Wermutstropfen. Aber, wir arbeiten daran!
Peter von Eilsleben
Antarktis, 13. Juni 1944
Nach genaueren Untersuchungen sind wir zu der Erkenntnis gelangt, dass die Sprengwirkung der Bombe sich nicht in der Breite, sondern in der Tiefe ausgewirkt hat. Wir können überhaupt nicht abschätzen, wie tief sich der Trichter in den Erdboden gefressen hat. Auch fehlt uns bisher die Erklärung dafür, wie die Flüssigkeit sich entwickelt hat, und woher sie stammt. Kamerad Weddel denkt, sie könne aus dem Erdkern entwichen sein, falls sich herausstellen sollte, dass der Trichter tief genug ist. Solange wir nicht alle offenen Fragen beantworten können, werden wir Berlin von der erfolgreichen Sprengung nicht unterrichten. Wir decken den Krater ab. Vorher entnehme ich noch eine Flüssigkeitsprobe.
Peter von Eilsleben
Nachtrag, 13. Juni 1944, in Vertretung Klaus Weddel
Oberleutnant Peter von Eilsleben stürzte bei dem Versuch, eine Probe der Flüssigkeit zu entnehmen, in den Krater und verschwand. Es waren keine Wellen oder sonstige Bewegungen in der Flüssigkeit zu erkennen. Als er sie berührte, schien es, als würde er pulverisiert. Ich habe dieses Bild, wie er förmlich verbrannte, ständig vor meinen Augen. Wir stehen unter Schock, müssen davon ausgehen, dass Oberleutnant Peter von Eilsleben tot ist. Natürlich befolgen wir weiterhin seinen Befehl, Berlin erst dann in Kenntnis zu setzen, wenn wir alle offenen Fragen beantwortet haben. Obwohl uns dieser Vorfall erschüttert, werden wir unsere Arbeit fortführen. Deshalb haben wir einen erneuten Versuch unternommen, Flüssigkeit aus dem Krater zu entnehmen. Dies gelang auch. Sofort haben wir sämtliche Maßnahmen eingeleitet, um festzustellen, aus welchen Inhaltsstoffen die Flüssigkeit besteht. Wir fanden Spuren von ganz unterschiedlichen, ‚harmlosen‘ chemischen Stoffen wie Asparagin, Asparaginsäure, Glutamin, Histidin, Isoleucin, Threonin, aber auch Desoxyribonukleinsäure (DNA), dem Biomolekül, das die Erbanlagen trägt!
Leutnant Klaus Weddel
Antarktis, 14. Juni 1944
Ich lebe! Ganze fünf Stunden saßen wir drei zusammen, und ich erzählte, was mir widerfahren war. Ich muss es noch einmal niederschreiben, um die Dinge zu verarbeiten, und außerdem finde ich jetzt eh keinen Schlaf. Allerdings sehe ich mich nicht in der Lage, aufzuschreiben, was ich erlebte, während ich durch den Trichter fiel. Ich kann nur sagen, dass ich Emotionen fühlte und Bilder vor meinem inneren Auge sah, an die ich mich im Einzelnen nicht erinnere, die mich aber an den Rand des menschlichen Verstandes brachten. Ganz plötzlich tauchte ich in einem See auf, der ganz und gar nicht quecksilberfarben war. Instinktiv schwamm ich zum Ufer und hievte mich völlig entkräftet auf die Böschung. Für eine kurze Weile verharrte ich dort, um wieder zu mir zu kommen. Dabei sah ich mich um: Weit und breit keine Menschenseele! An manchen Stellen dampfte es aus der Erde. Ich hatte das Gefühl, inmitten einer Vulkanlandschaft zu sein.
Wo ich mich befand, ahnte ich nicht im Geringsten, aber mir war klar, dass dies nicht die Antarktis war. Nachdem ich mich erholt hatte, stand ich auf und lief ohne Ziel los. Als ich einen Hügel erklommen hatte, entdeckte ich unter mir eine Landstraße. Ich stolperte hinunter und ging die Straße entlang. Ein vorbeifahrendes Auto hielt nach einigen Metern an. Ich lief zu dem Wagen und blickte durch das heruntergekurbelte Beifahrerfenster.
»Sie haben sich wohl verlaufen?«, fragte der Fahrer mich in gebrochenem Deutsch. »Steigen Sie ein, ich nehme Sie mit in die Stadt.« Er lächelte.
»Oh, vielen Dank!«, antwortete ich. Leise fügte ich hinzu: »Wenn ich nur wüsste, welches Auto das ist.«
Der Fahrer hörte es aber und erwiderte: »Das ist ein Alfa Romeo 2600.«
»Kommen Sie schon!«, forderte er mich nochmals auf und ich stieg ein. Er griff auf den Rücksitz, zauberte einen Mantel hervor und legte ihn mir auf den Schoß.
»Hier, ziehen Sie den über. Mit der Uniform sollten Sie nicht gesehen werden. Ich frage lieber nicht, warum Sie die tragen und woher Sie die haben, oder denken Sie etwa, dass der Krieg noch nicht vorbei ist? Karneval ist auch schon rum und wird hier bei uns eh nicht gefeiert!« Er machte eine Pause. »Verstehen Sie mich überhaupt? Sie sind doch Deutscher?«
Schweigend nickte ich. Ich fragte ihn, in welche Stadt wir fuhren und er antwortete irritiert: »In die isländische Hafenstadt Höfn.«
Ich nahm mir vor, ihm keine Fragen mehr zu stellen, denn ich bemerkte, dass ich ihm jetzt als Beifahrer unangenehm war. Wir waren beide froh, als wir die Stadt erreichten. Wortlos stieg ich aus. Verwirrt ging ich in einen Zeitungsladen und nahm eine Zeitung. Mit Entsetzen stellte ich fest, dass als Erscheinungsdatum der 14. Juni 1964 angegeben war. Hastig kontrollierte ich einige andere Zeitungen, um einen Druckfehler auszuschließen, aber alle Zeitungen wiesen das gleiche Datum aus. Ich war in Island, in der Stadt Höfn, und zwar im Jahre 1964. Mir wurde schwindlig. Die Luft blieb mir weg, ich musste sofort den Laden verlassen. Völlig orientierungslos lief ich stundenlang durch die Stadt, bis ich vor einer Bibliothek stand. Meiner Intuition folgend betrat ich das Gebäude. Ich wollte es nun genau wissen und suchte nach einer Geschichtschronik in englischer Sprache. Ich hatte Glück, fand auf Anhieb, was ich suchte, und blätterte hastig bis zu dem Jahr, aus dem ich kam, dem Jahr 1944.
Am 6. Juni sollen die Alliierten in der Normandie gelandet sein, eine Information, die meiner Truppe im Labor noch nicht bekannt war. Am 10. Oktober erreichte die Rote Armee die Grenze von Ostpreußen. Ich blätterte weiter zum Jahr 1945 und begann zu lesen:
‚Deutschland liegt in Schutt und Asche. Hitler ließ eine verheerende, eine teuflische Bombe auf das eigene Land werfen, und zwar an der Ostfront. Damit hat er Deutschland in den totalen Abgrund gerissen. Millionen verloren ihr Leben. Um die Alliierten zu vernichten, nahm er in seinem Wahn in Kauf, dass Teile der eigenen Bevölkerung dabei ebenfalls getötet wurden. Der Krieg an der Ostfront kam dadurch zunächst eine Zeitlang völlig zum Erliegen. Doch wurde der Krieg damit nur unnötig in die Länge gezogen und hatte die totale Vernichtung unserer Heimat zur Folge. Dort, wo er die Bombe abwerfen ließ, wurde alles Leben vernichtet. Sie hinterließ eine einzige brennende Wüste. An der Ostfront gab es nichts mehr zu erobern, denn es existierte nichts mehr. Der ‚Lebensraum im Osten«‘ war nun ein lebensfeindlicher Raum. Als Hitler eine zweite Teufelswaffe auf das Deutsche Reich abwerfen ließ, bombte er sein Land endgültig zurück in die Steinzeit.
Als Hitler begriff, was er getan hatte, wählte er den Freitod.
Und dann sah ich Bilder, die mir vor Scham und Entsetzen Tränen in die Augen trieben. Ich sah KZ-Häftlinge aus Auschwitz, unterernährt und halbtot. Mir wurde schlecht, als mir etwas siedend heiß einfiel. Dr. Mengele war Lagerarzt in Auschwitz. Er stand im Ruf, nicht viel für die Lagerinsassen übrig zu haben und bei seiner Arbeit ziemlich rigoros vorzugehen. Es gab Gerüchte über Forschungen, die er betrieb, über die wir einfach nicht weiter nachdachten. Wir verdrängten es! Auch über die Embryonen, die wir von Mengele zugesandt bekamen, dachten wir einfach nicht weiter nach! Jetzt war mir klar, dass diese von schwangeren KZ-Häftlingen stammen mussten. Über das, was ich jetzt auf den Bildern sah, nämlich die Bedingungen, unter denen die Insassen dahinvegetierten, hörte man ab und zu ein Gerücht, aber wir alle hielten es für Alliiertenpropaganda, denn niemand von uns konnte sich im Traum vorstellen, dass der Führer zu solchen Gräueltaten imstande war. Ich war schockiert! Alles, woran ich in den letzten Jahren geglaubt hatte, war eine Lüge! Nicht wir waren die Guten, wir, die sogenannte Herrenrasse, nein, wir waren die Untermenschen! Ich hatte das Gefühl, mich übergeben zu müssen und betete, dass dies nur einer der vielen Albträume der letzten Nächte sein möge. Dann hatte ich einen Geistesblitz. Womöglich konnte ich durch den See und den Trichter wieder zurück in meine Zeit gelangen. Das musste so schnell wie möglich geschehen! Warum?