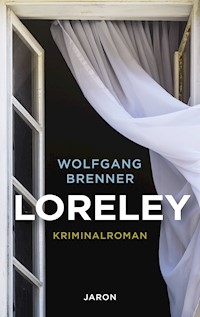Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Es geschah in Berlin...
- Sprache: Deutsch
April 1924: Hugo Stinnes, der bekannte und in republikanischen Kreisen geradezu verhasste Großindustrielle, stirbt an den Folgen einer Gallenblasenoperation. Seine Witwe glaubt jedoch nicht an ein natürliches Ableben ihres Mannes und beschuldigt die behandelnden Ärzte des Mordes. Sie beauftragt die Berliner Polizei, sich des Falles anzunehmen. Der inzwischen zum Oberkommissar beförderte Hermann Kappe kann den Ärzten zwar keine Schuld nachweisen. Doch er stößt auf eine ominöse Verbindung zwischen Stinnes und dem demokratischen Politiker Walther Rathenau, der zwei Jahre zuvor ermordet wurde. Plötzlich erhält der Fall Stinnes eine ganze neue, eine politische Dimension …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Brenner
Stinnes ist tot
Kappes achter Fall
Kriminalroman
Wolfgang Brenner, geboren 1954 im Saarland, arbeitet als freier Schriftsteller, Journalist und Filmemacherin Berlin und im Hunsrück. Neben Drehbüchern für das deutsche und französische Fernsehen schrieb er auch zahlreiche Romane und Satiren. Sein Debüt beim Jaron Verlag gab er 2008 mit «Honeckers Geliebte», einem Kriminalroman aus der Reihe «Berliner Mauerkrimis».
Originalausgabe
1. Auflage 2009
© 2009 Jaron Verlag GmbH, Berlin
1.digitale Auflage 2013 Zeilenwert GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und
aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin
Satz: LVD GmbH, Berlin
Druck und Bindung: CPI–Clausen &Bosse, Leck
ISBN 9783955520076
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Impressum
Widmung
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
Es geschah in Berlin …
Für meinen Vater.
EINS
ALLE FIEBERTEN der Verabschiedung des Chefs entgegen. Alle außer Kappe. Klar, auch er hatte von Canow nie besonders leiden mögen. Aber der Kriminalkommissar Hermann Kappe lechzte nicht nach einfachen Triumphen. Zumal der Abgang des Chefs keiner war, auch wenn die anderen das glaubten. Von Canow wurde ja nicht sofort in den unverdienten Ruhestand geschickt. Er wurde vorher noch befördert. Ins Preußische Innenministerium, als Unterunterstaatssekretär. Hieß es zumindest im Polizeipräsidium am Alexanderplatz.
«Det ist so wat wie ’n Bureaubote», hatte Galgenberg getönt. «Famoser Aufstieg für den ollen von Canow.»
Kappe wusste es besser. Von Canow würde in der Personalabteilung der Polizeiführung des Ministeriums noch ein paar Monate sein Unwesen treiben und dafür sorgen, dass halbadelige und adelige Verwandte aus der hintersten Mark, die beim Militär von wichtigen Offiziersrängen hatten ferngehalten werden können, sich nun ungestört im höheren Polizeidienst wichtig machen konnten. Womöglich begegnete man dem Sesselpupser später auf irgendeiner Chefbesprechung wieder, und er machte einen vor den Kollegen aus den anderen Abteilungen lächerlich, indem er augenzwinkernd die Erinnerung an die gemeinsamen Razzien im Rotlichtbezirk beschwor. «Zum Kringeln, Kappe, was? Erinnern Se sich noch an die Kleene mit dem Hottentottensteiß? Mann, die hatte es aber drauf.» Dabei hatte von Canow sein Bureau während der Arbeitszeit höchstens zum Mittagessen oder zum Schleimen beim Polizeipräsidenten verlassen.
Doch Galgenberg ließ sich seine gute Laune nicht verderben. «Mensch, Kappe, oller Schwarzseher, sollen se doch dem Freiherrn von Canow im Innenministerium meinetwejen ’nen Maialtar bauen und ihn in Aspik einlegen. Hauptsache is, wir sind die taube Nuss ein für alle Mal los. So musste denken, Kappe! Nich immer nur miesepetrig in die ferne Zukunft blicken. Det Unglück der Beamten im Ministerium ist unser Glück, Kappe.»
Doch Kappe lächelte nur mitleidig. «Von Canow war gar nicht so übel.»
Galgenberg verschluckte sich fast vor Empörung. «Von Canow? Jar nich so übel? Dir ham se wohl mit dem Klammersack jepudert, Kappe! Wat meinste, wer hier seit Jahren unsere Beförderungen vahindert hat?»
«Warum hätte von Canow das tun sollen, seine eigenen Leute oben schlechtmachen?», fragte Kappe.
Galgenberg tippte sich heftig an die Stirn. «Weil es sonst so ausjesehen hätte, als würden wir hier die Arbeit machen.»
«Tun wir doch auch», entgegnete Kappe.
«Klar, aber olle von Canow hat det nach außen immer so aussehen lassen, als wäre er der große Sarrasani in diesem kleenen Flohzirkus. Beförderungen der begriffsstutzigen und stinkfaulen Mitarbeiter hätten nich in’t schöne Panorama jepasst, Kappe.»
Es stimmte. Kappe hätte mit seinen Erfolgen und der Zuverlässigkeit, die er seit Jahren bewiesen hatte, in jeder anderen Abteilung längst Oberkommissar sein müssen.
Klara drängte ihn schon, sich doch versetzen zu lassen, wenn er in seiner Abteilung nicht weiter kam. Sie rechnete natürlich mit der kleinen Gehaltsaufbesserung. Die hätten sie gut gebrauchen können.
Aber Kappe dachte anders. Er machte seine Arbeit. Das Maß für die Qualität verwaltete er selbst. Er wusste, was er tat und wie ernsthaft er es tat. Er beobachtete sich selbst. Hermann Kappe war Kappes Chef. Und er war ein strenger Chef. Nichts ließ er sich durchgehen. Rein gar nichts. Das hatte etwas mit Würde zu tun.
Kappe war nicht kleinlich. Weder mit Geld noch mit Zeit. Aber wenn es um seine Würde ging, konnte er sehr penibel sein. Das war das Erbe von Wendisch Rietz. Kappe war sich selbst so viel wert, wie seine Arbeit wert war – in seinen Augen, nicht in denen von von Canow oder anderen. Was andere dazu zu sagen hatten, interessierte ihn wenig. Sich um das Lob der anderen zu bemühen kam ihm nicht in den Sinn. Entweder beförderten sie ihn, oder sie beförderten ihn nicht. Wichtig war nur, wie er selbst die Ergebnisse seiner Arbeit beurteilte. Deshalb hatte er angesichts des stillschweigenden Beförderungsstopps, den von Canow über die Abteilung verhängt hatte, auch nur lachen können. Sollte er doch! Kappe wusste selbst, was er an sich hatte. Und er wusste, dass die Berliner Polizei – von Canow hin oder her – dumm wäre, wenn sie auf ihn verzichten würde. Es gab wenige Kommissare, die mit vergleichsweise geringem Aufwand solche Erfolge vorweisen konnten wie er. Das wurde aus Gründen der Kollegialität nie offen gesagt, aber jeder wusste es.
Kappe brauchte nur eines: Er musste in Ruhe gelassen werden. Und in dieser Hinsicht hatte er sich über von Canow nicht beschweren können. Insofern fiel es einem Hermann Kappe nicht so leicht, sich über den Weggang seines Chefs zu freuen. Er seufzte. «Wer weiß, was jetzt auf uns zukommt?»
Galgenberg schlug ihm mit solcher Wucht auf die Schulter, dass Kappe für einen Moment die Luft wegblieb. «Kann nur besser werden.»
Wie alle Kommissare musste auch Hermann Kappe mehrmals in der Woche hinüber zur Dircksenstraße. Dort war die Gerichtsstube des Polizeipräsidiums, eine Art Schnellgericht, das sich zunehmender Beliebtheit erfreute – bei der Berliner Polizei ebenso wie bei den Ganoven.
In der Gerichtsstube hatten nur diejenigen Täter etwas zu suchen, die auf frischer Tat ertappt worden waren. Ihr Fall sollte rasch erledigt werden und gar nicht erst das weitläufige und undurchschaubare Röhrensystem des Moabiter Großgerichts ver-stopfen. Was dort erst nach Wochen zur Verhandlung kam, wurde hier binnen Minuten zu einem Abschluss gebracht. Dafür musste man auf beiden Seiten Einbußen hinnehmen.
In der Dircksenstraße wurden keine Zeugen vernommen, was die Angelegenheit fast schon elegant machte. Auch verzichtete man einvernehmlich auf das weitschweifige Verlesen eines Eröffnungsbeschlusses durch den Richter, obwohl es einen Richter gab. Der Staatsanwalt trat einfach mutig vor und sagte: «Ich klage an!» Schon ging es los.
Kappe wunderte sich oft darüber, wie unverzüglich die Gerechtigkeit ihren Gang ging, wenn man auf das übliche Brimborium der Moabiter Gerichtsbarkeit verzichtete und sich alle Beteiligten einig darüber waren, dass die Sache möglichst schnell und ohne unnötiges Aufsehen zu bewältigen war. Allerdings war es gerade diese Einigkeit, die den gerne etwas umständlichen Kommissar Kappe misstrauisch werden ließ.
So pflegte der Richter in der Dircksenstraße bei größeren Verbrechen den mutmaßlichen Täter zu fragen, ob er sein Verfahren bei den langsamer und ordentlicher arbeitenden Juristen in Moabit nicht besser aufgehoben sähe.
Erstaunlicherweise hatte Kappe noch nie einen Angeklagten erlebt, der dieses doch recht großzügige Angebot des Schnellrichters angenommen hätte. Deshalb fragte er sich oft, wenn er in der Dircksenstraße auf der engen Bank der Polizeibeamten saß, ob an der ganzen Sache nicht etwas faul sei. Warum sonst fanden sich die Ganoven so gerne dazu bereit, sich ohne Anwalt und ohne ordentliche Hauptverhandlung verurteilen zu lassen? Auch dass kaum einer nach seiner Verurteilung in der Dircksenstraße Rechtsmittel gegen die oft atemlos gefällten Entscheidungen einlegte, machte Kappe stutzig. Waren die Berliner Ganoven etwa scharf auf schnelle und oft unüberlegte Strafen? Oder fehlte ihnen einfach nur die Zeit für das langwierige Verhandeln in den ehrwürdigen Fluren des mächtigen Moabiter Gerichtsgebäudes?
Dabei verkannte Kappe aber auch nicht die Nützlichkeit der polizeilichen Gerichtsstube. Wusste er doch, dass viele, die auf ihre Verhandlung in Moabit warteten, während dieser Wartezeit neue Verbrechen begehen konnten, wenn man sie nicht in Untersuchungshaft gesteckt hatte. Kappe, der Praktiker, kam nicht umhin, die Vorzüge dieser seltsamen Einrichtung in der Dircksenstraße für den Polizeialltag zu würdigen. Die Täter kamen vom Tatort aus, wo man sie ja erwischt hatte, gleich vor Gericht. Sie waren sozusagen noch frisch, trugen noch den Staub ihrer unehrlichen Tätigkeit auf den Kleidern und hatten in der einen Nacht, die sie vielleicht in einer Polizeizelle verbracht hätten, noch keine Muße gehabt, sich eine ausgebuffte Verteidigung, also langwierige Ausreden, auszudenken.
Allerdings handelte es sich bei den Delinquenten in der Dircksenstraße meistens um arme Würstchen, denen man die Not, aus der heraus sie Diebstähle oder Einbrüche begangen hatten, noch ansah. Selten trat in der Dircksenstraße einer auf, der eine Arbeit hatte. Fast alle gaben an, Angst vor Hunger und Kälte zu haben. Und man glaubte ihnen unbesehen.
Die Mörder, mit denen Kappe zu tun hatte, kamen natürlich nicht in die Dircksenstraße. Aber er kam während seiner täglichen Arbeit oft genug mit anderen Tätern in Berührung, zu deren Taten dann seine Aussagen erwünscht waren.
Was Kappe hingegen genoss, war die überraschend freundliche Atmosphäre in der Gerichtsstube. Niemand musste sich beweisen, niemand stellte sich in Positur – es fehlte ja das große Publikum. Der Staatsanwalt war an einer flotten Erledigung interessiert, denn nebenbei hatte er noch einige aufreibendere Sachen in Moabit über die Bühne zu bringen.
Die Klausur ersparte vielen armen Teufeln das Zuchthaus, denn in der Dircksenstraße war öfter als in den großen Gerichtssälen von mildernden Umständen die Rede.
Warum auch nicht, dachte sich Kappe. In diesen schweren Zeiten verdiente doch jeder mildernde Umstände, sogar er und erst recht seine Klara. Er ertappte sich in letzter Zeit oft dabei, dass er sich ausmalte, wie gering die Anlässe, wie gewöhnlich die Umstände sein konnten, dass auch er oder seine Klara vom rechten Pfad abkamen. Das Leben in Berlin war sechs Jahre nach Kriegsende ein verbissener Kampf geworden, nichts wurde einem geschenkt, und es gab genügend Gestrandete in den Straßen der großen Stadt, die nicht schlechter waren als er oder Klara, denen es aber bedeutend schlechter ging. In solch einem Käfig konnte jeder innerhalb eines Tages vom Helden zum Verlierer werden. Das erlebte Kappe ständig, schließlich hatte er mit beiden zu tun – mit Verlierern allerdings bedeutend häufiger als mit Helden. Wenn alles durcheinandergewirbelt wurde und jeder sowohl oben als auch unten mitschwimmen konnte, war es da nicht beruhigend, dass es eine Dircksenstraße gab, in der nicht so genau bemessen wurde und gerne von mildernden Umständen die Rede war, sei es auch nur aus Zeitersparnis und aus Gründen der juristischen Effizienz?
Dabei waren die Zustände in der Gerichtsstube eigentlich gar nicht dazu geeignet, diese angenehme Assoziation bei Kappe zu erwecken. Es handelte sich lediglich um ein großes Zimmer, dessen drei Fenster auf die Gleise der Stadtbahn hinausgingen, wo unablässig S-Bahnen und Fernzüge vorbeirauschten, um den Menschen in der Stube zu zeigen, wie wenig ihre Bemühungen um Gerechtigkeit und Eile den großen Gang der Dinge aufhalten konnten.
Vor dem mittleren Fenster saß auf seinem Podium der Schnellrichter, das Tageslicht im Rücken, wie es sich für einen Vertreter der Justitia gehörte. Zu seinen Seiten kauerten der Staatsanwalt und der Schreiber, den es der Ordnung halber sogar in der Dircksenstraße gab.
Hinter zwei Holzschranken spielte sich nun der Publikumsverkehr ab. Von draußen wurden unablässig neue Angeklagte hereingeführt. Sie warteten sozusagen in Reserve, damit das Schnellgericht nicht leerlief. Auch gab es in der ohnehin kleinen Stube eine Ecke für das Publikum, das zugelassen war. Selbst wenn es schnell ging, durfte das Volk zuschauen. So viel Zeit musste in einer Demokratie dann doch sein.
Allerdings hatte Kappe den Eindruck, dass sich unter den Zuschauern vor allem bleiche Gerichtsreferendare befanden, die erschrocken verfolgten, wie schnell man der Gerechtigkeit Genüge tun konnte, wenn man die Erlaubnis von oben dazu hatte, und natürlich befreundete Ganoven, die den Kollegen beistanden oder lernen wollten, wie man auch vor dieser Institution mit Bravour bestand.
Diesmal musste Kappe warten, bis sein Fall an die Reihe kam. Vor ihm befand sich ein glattrasiertes Köpfchen in einem bunten Wollschal. Der Mann hatte nachts auf der Friedrichstraße schwarz mit Zigaretten gehandelt und war erwischt worden, was bei dem auffälligen Schal kein Wunder war, wie Kappe fand.
Der Richter fragte: «Sie haben keine Wohnung – wo schlafen Sie denn?»
«Det kann ick dem Herrn Richter nur unter vier Oogen saren.» Damit gab sich der Richter achselzuckend zufrieden und kam nun zur unzweifelhaften Tat.
«Nein, ick habe nich jehandelt», beteuerte der Angeklagte. «Ick hab nur an der Ecke jestanden, weil ick früher dort jehandelt habe und meener Kundschaft viele Zigaretten uff Kredit jejeben habe. Nun wollte ick die Schulden eintreiben. Da kam der Beamte, der mir kennt, und will bei mir Zigaretten koofen, und da falle ick darauf rein. Wie darf denn der Beamte bitte schön nachts um zehn Uhr Zigaretten koofen?»
Kappes Kollege erhob sich und erklärte: «Der Angeklagte hat immerzu ‹Zigaretten, Zigaretten› vor sich hin gemurmelt.»
Daraufhin sprach das Gericht in bemerkenswerter Schnelligkeit sein Urteil: Dreißig Mark Geldstrafe oder sechs Tage Haft.
Kappe hielt das für angebracht, wenn man bedachte, was dem darbenden Staat und damit den hungernden Familien entging, wenn Schwarzhändler Zigaretten auf den Straßen anboten.
Der Verurteilte schien das auch so zu sehen, denn er trat die Haft auf der Stelle an.
Das nächste Urteil hingegen fand Kappe angesichts der Verhältnisse in der Dircksenstraße geradezu drakonisch.
Es trat eine Frau auf, die die vierzig schon überschritten haben musste. Würdig zwar, aber ärmlich gekleidet und verhärmt. Wie sich schnell herausstellte – auch das ging in der Dircksenstraße schnell –, war sie wegen Einbruchsdiebstahl vorbestraft und hatte deswegen im Zuchthaus gesessen. Sie war an diesem Tag wegen «intellektueller Urkundenfälschung» und Führung eines falschen Namens angeklagt.
Die Frau hatte einem Bettler Schmiere gestanden und war zusammen mit diesem aufgefallen. Das allein wäre noch kein Grund gewesen, einen solchen Aufriss zu machen. Aber sie beging einen tragischen Fehler: Als sie ins Polizeigefängnis eingeliefert wurde, gab sie dem Protokollanten einen falschen Namen an. Sie trug also mit ihrer Angabe dazu bei, dass ihr Falschname in das amtliche Dokument gelangte. Das nannten die Juristen, wie Kappe wusste, «intellektuelle Urkundenfälschung». Ein Straftatbestand, den Kappe nie so richtig hatte einsehen können, denn das Protokoll wurde ja durch den Falschnamen nicht gefälscht. Es war so echt wie der protokollierende Beamte im Polizeigefängnis.
Nun, der Richter vermutete, die Frau könnte den Falschnamen angegeben haben, um eine noch schwerere Straftat zu vertuschen, und verurteilte das arme Ding zu zwei Wochen Gefängnis wegen besagter «intellektueller Urkundenfälschung» und noch einmal zu einer Woche Haft wegen Führen eines falschen Namens.
Kappe wurde wütend. Nicht nur, dass die Frau erst durch die Polizeiaktion in die Verlegenheit gekommen war, ihren Namen angeben und damit eine «intellektuelle Urkundenfälschung» begehen zu müssen. Mit der zweiten Strafe wurde sie für dasselbe Delikt noch einmal verurteilt. Und es fuhr ihm ein Stich durch die Brust, ein intellektueller Stich sozusagen, als er daran dachte, dass Klara, falls ihm im Dienst mal etwas zustoßen sollte, vielleicht auch in eine solche Zwickmühle der Gerechtigkeit geraten könnte.
Dann kam es noch dicker: Ein junger Bursche gab alles sofort zu. Er war in der Chausseestraße am Vormittag in ein Kino eingedrungen und hatte eine Tafel Schokolade und eine Violine erbeutet. Die Schokolade hatte er auf der Straße verschlungen, die Violine für fünf Mark verkauft. Davon konnte er zwei Tage lang leben. Als das Geld alle war, hatte er sich der Polizei gestellt.
Der Richter redete ihm zu: «Das ist schwerer Einbruch, ein Verbrechen, das vor einem ordentlichen Gericht abgehandelt werden müsste.»
Doch der Junge sagte bloß: «Nee, nee, det is hier richtig.» Der Staatsanwalt plädierte für Härte: «Der Mann zeigt keine Reue. Und freiwillig gestellt hat er sich doch nur, weil er keine Arbeit hat und bei der Kälte in Berlin eine Unterkunft braucht.»
Daraufhin wartete Kappe seinen Fall gar nicht mehr ab und floh tief bedrückt nach Hause.
ZWEI
DIE VERABSCHIEDUNG fand am nächsten Tag in von Canows Zimmer statt. Die engsten Mitarbeiter waren anwesend. Von Canow hatte Bier und Schrippen mit Schinken holen lassen. Für jeden eine Flasche und eine Schrippe. Er trug seinen Sonntagsanzug und eine verschämte Osterglocke im Revers. Andere Blumen gab es im April noch nicht. Von Canow hielt eine Rede, während Galgenberg unentwegt zu dem kleinen Rauchtisch mit den offenen Bierflaschen hinüberschaute. Kappe wusste genau, was sein Kollege dachte:«Beeil dich, von Canow, das Bier steht ab!»
Und von Canow kam wirklich schnell zum Ende. Er hatte sich sowieso nur eine Würdigung seiner Verdienste vorgenommen, und diese Aufgabe erledigte sich selbst bei äußerster Sorgfalt recht flott. Kein Wort des Lobes für die Zusammenarbeit. Keine guten Wünsche für die Zukunft der Abteilung. Nur von Canow, von Canow, von Canow.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!