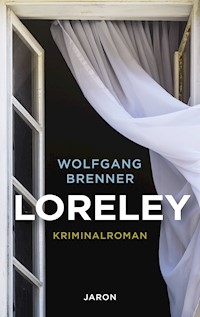Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kein anderes Datum hat die deutsche Geschichte häufiger erschüttert als der neunte November. Es war an einem neunten November, als 1918 die Novemberrevolution in der Ausrufung der Weimarer Republik ihren Höhepunkt erreichte. Es war an einem neunten November, als 1923 der bis dahin unbekannte Adolf Hitler in München einen Putschversuch gegen ebendiese Republik anzettelte. Es war an einem neunten November, als 1938 die Novemberpogrome der Nationalsozialisten in der "Reichskristallnacht" mündeten. Es war an einem neunten November, als 1939 der schwäbische Handwerker Georg Elser ein Attentat auf Adolf Hitler und seine Vertreter ausführte. Und es war an einem neunten November, als 1989 die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland fiel. Wolfgang Brenner geht der Frage nach, was diese fünf unterschiedlichen Ereignisse miteinander verbindet, er erzählt Geschichten vom neunten November, und er blickt auf jene knapp fünf Jahrzehnte ohne einen geschichtsträchtigen neunten November, in denen das "deutsche Datum" dennoch eine untergründige Wirkung entfaltet. Wolfgang Brenners Buch zeigt: Der neunte November verleiht der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert eine ganz besondere Struktur. Denn betrachtet man diese Tage intensiver, gewinnt man nicht nur einen neuen Blick auf die Vergangenheit, sondern auch ein besseres Verständnis unserer Gegenwart. Der neunte November ist ein Tag der Wendepunkte. Und gerade den Fall der Mauer und damit das Ende der DDR betrachtet Wolfgang Brenner als epochale Wende, die ohne die vorangegangenen neunten November nicht zu verstehen ist. "1989 ereignete sich der vorerst letzte neunte November, eine Art Schlussakkord, der dieses schreckliche 20. Jahrhundert besiegelte. Damit wird das neuralgische deutsche Datum zu einem Schlüssel für die jüngere Geschichte Deutschlands, Europas und der Welt." Wolfgang Brenner kann zeigen, dass selbst die aktuelle Diskussion um den Brexit in einem Zusammenhang mit dem neunten November steht. Somit stellt sich die Frage: Gibt es ein deutsches Muster? Gibt es Verbindungen zwischen den Ereignissen des neunten November? Jenseits von kruden Verschwörungstheorien: Wolfgang Brenners Recherchen machen deutlich, dass es "einen objektiven Zusammenhang der Neunter-November-Ereignisse gibt: Sie gehorchen alle einer historischen Logik. Diese Logik ist recht simpel, nämlich kausal. Der neunte November reagiert auf den neunten November. Es existiert also eine untergründige Verbindung zwischen all diesen Daten." "Das deutsche Datum" ist eine spannende Reise durch ein mörderisches, aufwühlendes und nicht immer leicht zu durchschauendes Jahrhundert. Auf seiner Suche danach, was diese unterschiedlichen Ereignisse miteinander verbindet, entwirft Wolfgang Brenner ein einzigartiges Panorama deutscher Geschichte, gewohnt flüssig und unterhaltsam zu lesen. Der glänzende Erzähler zahlreicher Sachbücher und Romane schafft es in diesem Buch, die deutsche Zeitgeschichte und ihre Zusammenhänge so spannend zu erzählen wie einen Krimi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Brenner
Das deutsche Datum
Der neunte November
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2019
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Pittner Design
Umschlagmotiv: © akg-images
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN E-Book 978-3-451-81651-2
ISBN Print 978-3-451-38475-2
Inhalt
Vorwort
Ein deutsches Datum
Die Logik der Zahl
1918
Die Naumburger Jäger
Die Kaiserschlacht
Wie erstickt man eine Revolution?
Zwei Degen
Rochade
Alleingänge
Der Vaterlandsverräter
Das Schloss
Wo bleibst du denn?
Der große Bluff
1923
Die Generalprobe
In Verzug
Die Demütigung
Der Tag
Die Exerzierhalle
Das kosmische Fenster
Das Zeitproblem
Die Grünen
Münchner Pogrom
Der Weimarer Diktator
Der Bankraub
Wie definieren Sie einen Marxisten?
Maschinengewehre am Odeonsplatz
Familie Ballin
Der Trick
Eine Landpartie
Nachspiel
1938
Das Jubiläum
Der Tag der Besessenheit
Der Plan
Die Polenaktion
Das Attentat
Der Tag und die Nacht
Das November-Muster
Katzenjammer
Die Fackel des Terrors
Die Prophezeiung
1939
Zwischenspiel: Georg Elser
Der Perfektionist
50 Jahre ohne neunten November
Die deutsche Krankheit
Neunter November gegen neunter November
Die Tupamaros
Dalli Dalli
Die Schauspielerin
1989
Verkehrte Welt
Das Neunte-November-Debakel
Die Pekinger Lösung
Die Duftmarke der Freiheit
Frontstadtchor
Die Devisenfalle
Der Ruck
Dann geht doch rüber!
Das Zeitfenster
Der nächste neunte November
Abbildungsnachweis
Endnoten
„Geschichte wiederholt sich nicht, das ist bekannt.“
(Jürgen Neffe: „Marx – Der Unvollendete“)
„Man muss B sagen, sobald man A gesagt hat.“
(Karl Marx an Friedrich Engels, 13. Januar 1865)
Vorwort
Ein deutsches Datum
Es gibt viele neunte November in der jüngeren deutschen Geschichte. Fast könnte man meinen, dieser Tag verleihe dem letzten Jahrhundert eine besondere Struktur. Am neunten November 1918 wurde eine Revolution gemacht und die erste deutsche Republik ausgerufen. Am neunten November 1923 versuchte ein bis dahin unbekannter rechtsradikaler Politiker in München einen Putsch, der allerdings auf banale Art misslang – dennoch wurde dieser „Putsch“ zu einem Fanal. Am neunten November 1938 wurden in einer Nacht Tausende Geschäfte jüdischer Bürger geplündert und zerstört. Hunderte Juden wurden getötet oder misshandelt. 30000 Menschen wurden an den Tagen darauf in Lager gesteckt. Dieser neunte November war der Startschuss für die Nazis – 1938 begann der staatlich organisierte Vernichtungsfeldzug gegen die Juden.
Ein Jahr später, am Vorabend des neunten November 1939, setzte ein schwäbischer Handwerker alles auf eine Karte – durch den Kriegsausbruch alarmiert, wollte er dem Treiben Hitlers ein Ende setzen, ihn und seine Vertreter mit einem minutiös geplanten Attentat ausschalten und damit der Weltgeschichte eine andere Wendung geben. Georg Elsers Tat blieb bis 1944 der aussichtsreichste und mutigste Anschlag auf den NS-Staat. Doch Elsers Versuch, das Schlimmste für Deutschland und die Welt zu verhindern, misslang. Durch einen dummen Zufall – so wie der Zufall Hitler oft dabei half zu überleben.
Am neunten November 1989 fiel die Mauer und damit das SED-Regime. Das war allerdings eine epochale Wende – nicht nur, aber vor allem für Deutschland. 1989 ereignete sich der vorerst letzte neunte November, eine Art Schlussakkord, der dieses schreckliche 20. Jahrhundert besiegelte. Damit wird das neuralgische deutsche Datum zu einem Schlüssel für die jüngere Geschichte Deutschlands, Europas und der Welt. Das gilt übrigens auch für die knapp fünfzig Jahre, in denen es keinen neunten November gab – das Datum entfaltete auch in dieser Zeit seine Wirkmächtigkeit.
Wer den November-Wegmarken folgt, bekommt einen besonderen Blick auf unsere Vergangenheit. Er beginnt aber auch, die Gegenwart genauer zu sehen. So steht selbst die aktuelle Diskussion um den Brexit in einem Zusammenhang mit dem neunten November (siehe S. 298). Zwangsläufig gerät ein Buch über den deutschen neunten November zu einer geführten Reise durch ein mörderisches, aufwühlendes und nicht immer leicht durchschaubares Jahrhundert. Diese Reise führt zwangsläufig zu den Kulminationspunkten des deutschen Charakters ebenso wie zu den korrespondierenden europäischen Verwerfungen.
Die Wiederkehr des Datums ist auffällig. Es gab Bestrebungen, den „Schicksalstag“ zu einem deutschen Gedenktag zu machen. Doch dazu kam es nicht – weil die Nazis den Termin schon vereinnahmt hatten (auf Anordnung Hitlers vom 4. November 1925 sollte alljährlich am neunten November der getöteten Putschisten von 1923 und der Weltkriegsgefallenen gleichzeitig gedacht werden) und ihm damit eine besondere Dynamik verliehen. Vor allem aber, weil die verschiedenen neunten November des 20. Jahrhunderts ganz unterschiedliche politische und emotionale Wertigkeiten aufweisen. Mit dem 9.11.1989, also dem Mauerfall, sind vor allem positive Assoziationen verbunden, während der 9.11.1938 (ebenso wie der 9.11.1923) allgemein als ein Tag des Schreckens und als düsteres Signal für das weitere Schicksal Deutschlands gewertet wird.
Trotz dieser unterschiedlichen Bedeutungsfarben wird immer wieder die Frage gestellt: Gibt es ein deutsches Muster? Liegt den eklatanten neunten November in der jüngeren deutschen Geschichte eine Gemeinsamkeit zugrunde? Gibt es untergründige Verbindungen zwischen den Ereignissen des neunten November?
Die verschiedenen Akteure dieses Tages haben sich fast immer selbst unter Zugzwang gesetzt. 1918 konkurrierten die politischen Machtzentren aufs Heftigste miteinander. Die Mehrheitssozialisten hinter Friedrich Ebert hatten sich entschlossen, die revolutionäre Dynamik für sich zu nutzen, wollten aber keine echte Revolution. Die linken Revolutionäre hingegen wussten, dass es eine Revolution nach ihrem Gusto nur geben konnte, wenn man das entstandene Vakuum beherzt nutzte und die unliebsamen Trittbrettfahrer von der SPD abschüttelte. So entstand ein verhängnisvolles Wettrennen um die entscheidende Tat. Ebert & Co. mussten sich mit denen verbünden, die sie eigentlich entmachten wollten. Die linken Umstürzler hingegen mussten immer höher pokern und noch mehr unsichere Kantonisten auf ihre Seite ziehen, um mit der Wucht der Masse die Reinheit ihrer Idee zu bewahren.
Hitlers Putsch von 1923 sollte generalstabsmäßig ablaufen. Doch er war chaotisch und forciert durch eine öffentliche Demütigung des Hoffnungsträgers der Nationalsozialisten: Wenige Monate zuvor war Hitler gescheitert, als er sich bei der Reichswehr Waffen erbeten hatte, um eine angekündigte linke Demonstration im Zentrum Münchens gewaltsam zu zerschlagen. Hitlers Stern befand sich nach dieser Niederlage im Sinkflug. Wenn er seine Reputation nicht gänzlich verlieren wollte, musste er alles auf eine Karte setzen. Das tat er am neunten November 1923 – und es misslang. Dennoch wurde dieser neunte November zu einem neuralgischen Datum, durch das Jahre später weitere Schlüsselereignisse initiiert wurden.
Auch die brutalen Übergriffe der sogenannten Reichspogromnacht waren Resultat einer lange vorher angelaufenen, brachialen Aufladung der Gemüter. In der Nacht zum neunten November 1938 explodierte die Gemengelage – maßgeblich angefacht von dem unter Druck stehenden Joseph Goebbels. Die Nazis hatten große Mühe, eine ihren strategischen Zielen angemessene Haltung zu den Ausschreitungen zu finden, die ihnen außenpolitisch und wirtschaftlich schadeten. Aber der Wahnsinn setzte sich durch: Die erreichte Wegmarke wurde „legalisiert“, und die Unterdrückung und brutale Bekämpfung der jüdischen Bevölkerung wurde dem Mob aus der Hand genommen und in ein staatliches Programm überführt: den Holocaust.
Auch Georg Elser stand 1939 unter einem enormen Zugzwang. Zwar war sein Attentat auf die NS-Führung von langer Hand akribisch vorbereitet – so akribisch, dass ein Scheitern fast ausgeschlossen schien. Der Kriegsbeginn aber drängte Elser: Er fühlte sich gezwungen, schnell und punktgenau zu handeln, um die Ausweitung des Krieges zu stoppen. Die Frage, warum er trotz der Präzision seines Handelns und Denkens dennoch scheiterte, ist müßig. Viel drängender scheint es, sich zu überlegen, was mit Deutschland und der Welt geschehen wäre, wenn Elsers Münchner Tat in einen wirklichen neunten November gemündet, wenn ihm der Anschlag auf die versammelte NS-Führung also gelungen wäre.
Die Mauer fiel 1989, weil ein aus den Fugen geratener Staatsapparat leerlief und ein irritierter SED-Bezirksvorsitzender nicht gleich begriff, welche Folgen eine belanglose amtliche Formulierung haben konnte, wenn er sie in seiner Pressekonferenz verlas, ohne ihren Sinn zu verstehen. Dem vorausgegangen waren eine manipulierte Wahl und eine langsame Inkontinenz der DDR. Über die westdeutschen Botschaften in Prag und Warschau, über die offene Grenze zwischen Ungarn und Österreich sickerten ihr die Bürger weg.
Sich selbst unter Zugzwang zu setzen scheint eine ausgeprägte politische Untugend in Deutschland zu sein. Dazu gehört aber auch, sich nicht ganz klar zu sein (oder sich nicht ganz klar sein zu wollen) über die Konsequenzen des eigenen Handelns. Ebenso eine gewisse Präpotenz: Siehe Friedrich Eberts Instrumentalisierung der Räterevolution, der arglose Pakt der Mehrheitssozialisten mit den alten Mächten, Günter Schabowskis Pressekonferenz, Hitlers verfehlter „Marsch auf Berlin“, in gewissem Sinne Elsers Einzelgängertum (obwohl dem kaum eine andere Wahl blieb), aber auch die Unfähigkeit, abzusehen, welchen Schaden die entfesselten antisemitischen Leidenschaften des Mobs 1938 anrichten konnten – nicht nur für die sowieso gequälten Juden, auch für die Nichtjuden, die Hitler folgten.
Am neunten November tritt die ideologische Leidenschaft in einen Wettbewerb mit der kühl organisierenden und vorausblickenden Vernunft – und die Affekte gewinnen. Das war 1918 so, als die Revolutionäre sich in linksradikale Fantasien steigerten, während die Mehrheitssozialisten glaubten, sie könnten den Tiger reiten. 1923 siegte die persönliche Eitelkeit Hitlers über das kühle Abwägen der Chancen eines Umsturzes. 1938 ließen sich die Nazi-Größen dazu hinreißen, ihre aufgewiegelten Anhänger von der Leine zu lassen, ohne zu bedenken, wie diese das Land und seine nazistische Führung verändern würden – bis zum Ende des sogenannten Tausendjährigen Reiches 1945. Selbst den Reformern in der SED war im November 1989 nicht wirklich klar, welche Kräfte sie mit ihrer Hinhaltetaktik reizten, wie groß der lange aufgestaute Druck in der DDR-Bevölkerung war und was mit ihrem Staat bei einer unkoordinierten Grenzöffnung geschehen konnte.
Die Logik der Zahl
Das alles hat mit der jeweiligen subjektiven Verfassung der Handelnden zu tun. Doch es gibt auch einen objektiven Zusammenhang der Neunter-November-Ereignisse: Sie gehorchen alle einer historischen Logik. Diese Logik ist recht simpel, nämlich kausal.
Der neunte November reagiert auf den neunten November. Es existiert also eine untergründige Verbindung zwischen all diesen Daten. Hitlers Putsch vom neunten November 1923 reagierte voller Hass auf die Revolution vom neunten November 1918. (Ganz nebenbei: Auch die ist Fortsetzung eines neunten November – nämlich des neunten November 1848, als in der Brigittenau bei Wien der Abgeordnete der Frankfurter Nationalversammlung Robert Blum seiner Immunität beraubt und erschossen wurde, womit das Ende aller republikanischen Träume in Europa eingeläutet wurde. Karl Liebknecht wies bei seiner Schloss-Proklamation sogar auf diesen Zusammenhang hin.)
Diese Revolution vom November 1918 sah Hitler wie viele andere als das Grundübel der deutschen Misere an, und sein „Putsch“ fand deshalb folgerichtig an einem neunten November statt. Die heimlich gesteuerten und von höchster Stelle geduldeten Ausschreitungen am neunten November 1938 waren ein „Gedenken“ an die Ideale und Ziele der sogenannten Kampfzeit, also der Zeit, in der nach Meinung der NS-Granden alles noch simpel und stark und unverdünnt durch taktische Rücksichtnahmen war: die Machtgier der Nazis, ihre Revanchelust ebenso wie ihr unbändiger und zerstörerischer Judenhass. Die Übergriffe, die dann kommen mussten, konnten also nur in der schicksalhaften Nacht vom neunten November stattfinden. Auch Elsers missglücktes Attentat auf die NS-Führung gehorcht dieser Logik: Elser musste sich einen Tag aussuchen, an dem die Nazispitze sich öffentlich traf und der symbolträchtig genug war – und das war der Jahrestag des Putsches im Bürgerbräukeller, ein wichtiger „nationaler Gedenktag“ im Nationalsozialismus. Folglich deponierte er seine Höllenmaschine auch dort. Im Münchner Bürgerbräu, in dem Hitler 16 Jahre zuvor die versammelten bayerischen Honoratioren mit der Pistole bedroht hatte, um damit den Sturz der verhassten Berliner Zentralregierung auszulösen.
Auch der neunte November 1989 hat einen unsichtbaren Zusammenhang mit einem anderen neunten November – nämlich mit dem von 1918. Damals sollte Deutschland zu einer demokratischen Republik werden. Das klappte – wenn überhaupt – nur sehr kurz, genau genommen, bis Hitler auftrat. Danach wurde das Land erst instabil und dann nationalsozialistisch, und nach 1945 war es zweigeteilt. Die „gesamtdeutsche“, demokratische Vision von 1918 hat sich auf lange Sicht erst mit dem Fall der Mauer eingelöst: am neunten November 1989.
1918
Die Naumburger Jäger
Der 9. November 1918 war ein verregneter Samstag. Die Nervosität, die seit Tagen in Berlin herrschte, hatte sich über Nacht noch gesteigert. Vor wenigen Stunden war Ernst Däumig, ein Führer der Revolutionären Obleute aus der Berliner Metallindustrie, verhaftet worden. Es rumorte. Die Parteioberen der Mehrheitssozialisten, also der Sozialdemokratischen Partei nach der Abspaltung der USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands), sahen sich gezwungen, etwas zu unternehmen, um die Arbeiterschaft nicht an die Radikalen zu verlieren. Die Arbeiter formierten sich, erste Gruppen verließen während der Schicht die Fabriken – obwohl die Partei ihnen geraten hatte, an ihren Arbeitsplätzen zu bleiben. Wenn die SPD jetzt nicht zeigte, dass sie auf der Seite der aufgewühlten Massen stand, stürmten diese über sie hinweg.
Um 9 Uhr in der Frühe stellte sich einer der beherztesten Sozialdemokraten, der Berliner Parteisekretär Otto Wels, überraschend an die Spitze der Aufrührer. Er rief namens der SPD den Generalstreik aus. Die Arbeiter sollten mit ihr eine gemeinsame Front bilden und in den „Entscheidungskampf unter dem alten gemeinsamen Banner“ ziehen.1 (Eine erstaunliche Parallele drängt sich hier schon auf: An einem anderen 9. November setzte auch der Berliner Bezirkssekretär einer sozialistischen Partei das entscheidende Fanal, aber anders als der zu Unrecht fast vergessene Otto Wels tat sein Pendant Günter Schabowski im Jahr 1989 dies eher unbeabsichtigt und ein bisschen verschusselt. Und anders als Schabowski sollte Wels nach seinem historischen Auftritt nicht in die Kulisse abtreten – im Gegenteil. Er wurde zu einem der Protagonisten dieses 9. November, initiierte 1920 den Generalstreik gegen den Kapp-Putsch und sollte 1933 die letzte freie Rede im Reichstag halten.)
Es war 10 Uhr, als Philipp Scheidemann, SPD-Staatssekretär ohne Geschäftsbereich im Kabinett des Prinzen Max von Baden, zurücktrat. Scheidemann war seit Oktober 1917 zusammen mit Friedrich Ebert Vorsitzender der SPD. Noch während Scheidemann seinen Rücktritt erklärte und damit einen Kurswechsel in der abwartenden, hinhaltenden Politik seiner Partei signalisierte, rief sein Co-Vorsitzender Ebert die SPD-Reichstagsfraktion zusammen. Derselbe traditionsverbundene Sattlermeister Friedrich Ebert aus Heidelberg, der gegenüber dem amtierenden Kanzler Max von Baden zwei Tage zuvor, am 7. November, noch erklärt hatte, er hasse die Revolution „wie die Sünde“, peitschte nun seine irritierten Abgeordneten auf: Er verhandele bereits mit den abtrünnigen linken Brüdern von der USPD und den Vertretern der radikalisierten Arbeiter.2 Wenn nötig, sei man in der Parteispitze entschlossen, Schulter an Schulter mit den Arbeiterräten und den Soldaten zu marschieren. Der bisher als gemäßigt und lavierend bekannte Ebert tönte vor versammelter Mannschaft: „Die Sozialdemokratie solle dann die Regierung ergreifen, gründlich und restlos, ähnlich wie in München.“ (Dort war ihnen der Berliner Kurt Eisner zuvorgekommen.) Und nach einer atemlosen Pause: „… aber möglichst ohne Blutvergießen.“
Nicht mal 24 Stunden vorher hatte die SPD, oder besser: die MSPD (Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands), ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Ein Gesicht, das auch in unseren Tagen wieder zum Vorschein kam, als die Sozialdemokraten es trotz drohender Kannibalisierung durch den mächtigen Koalitionspartner CDU/CSU nicht schafften, sich rechtzeitig aus der vermaledeiten GroKo und ihrem internen Dauerstreit zu verabschieden.
Am Abend des 7. November 1918 hatte die SPD, seit dem 4. Oktober 1918 notgedrungen Regierungspartei, die Abdankung des deutschen Kaisers verlangt. In der Überzeugung, dass nur dieser Schritt die „soziale Revolution“ verhindern könne – zumindest war Friedrich Ebert dieser Meinung. Das war nicht die einzige Forderung, aber die spektakulärste, da sie alle Beteiligten in die Enge trieb.
Kanzler Prinz Max von Baden, der sich seinem Koalitionspartner SPD sicher zu sein geglaubt hatte, fühlte sich übertölpelt. Er spürte, dass ihm die Sache längst aus der Hand genommen worden war – nicht nur von der SPD, mehr noch von denen, die ihn gerufen hatten, nämlich von der Obersten Heeresleitung und den sie unterstützenden Kreisen. Also wollte er lieber gleich selber zurücktreten. Das aber verhinderte Scheidemann, sein SPD-Verlegenheitsstaatssekretär. Er nahm den mutlosen Prinzen an diesem Abend des 7. November beiseite, um ihm zu versichern, die Sozialdemokraten würden die gemeinsame Regierung so kurz vor dem Waffenstillstand mit dem Kriegsgegner nicht platzen lassen. Forderten die Westalliierten, allen voran der US-Präsident Wilson, nicht auch den unbedingten Rücktritt des Kriegstreibers Wilhelm II.?
Porträt Maximilian Alexander Friedrich Wilhelm Prinz von Baden (Prinz Max von Baden) in Uniform eines Generals mit Orden
Max von Baden war ein Vetter des Kaisers. Ein ungeliebter Vetter allerdings, den Wilhelm überall, aber auf keinen Fall an der Spitze seiner Berliner Regierung hatte sehen wollen. (Die gar nicht zimperliche Kaiserin hat wohl im Moment allerhöchster Spannung dem Vetter ihres Gatten gedroht, man werde seine homosexuellen Neigungen öffentlich machen, wenn er nicht von seiner Kritik der kaiserlichen Linie abrückte. Max von Baden erlitt einen Nervenzusammenbruch, gab aber nicht nach.3)
Am 7. November ließ sich der Kanzler noch mal weichklopfen und gab – auch mit Unterstützung der deutlich verärgerten Zentrumspartei, der Fortschrittlichen Volkspartei und der Nationalliberalen – die Rücktrittsforderung seines Kabinetts ans Hauptquartier in Spa weiter, wo der Kaiser weilte, um den Berlinern und anderen Opponenten zu signalisieren, dass er in diesen schwierigen Tagen Wichtigeres zu tun habe. Da der Kanzler aufgrund seines Selbstverständnisses als Aristokrat den Kaiser nicht direkt um Abdankung bitten konnte, bot er seinen eigenen Rücktritt an. Wilhelm aber untersagte dem Prinzen den Rücktritt. An seinen eigenen dachte er nicht einmal.4
Im Ultimatum war der sofortige Rücktritt gefordert worden. Aber Wilhelm II. war auch am Abend des nächsten Tages, das war Freitag, der 8. November, noch im Amt. Der Kaiser schien sich einen Dreck zu scheren um die Verlautbarungen seiner Regierung im Berliner Reichstag. Aber das war sowieso klar. In Berlin zeigte man sich dennoch konsterniert. Vor allem in der SPD, die ja die Rücktrittsforderung als Problemlösung geradezu erfunden hatte. Sie sah sich dennoch gezwungen, etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen. Also wurde Scheidemanns Versicherung dem Prinzen Max von Baden gegenüber nun auch noch öffentlich bekräftigt: Die SPD wird diese Regierung vor dem Abschluss des wichtigen Waffenstillstandes nicht im Stich lassen. Die Unterhändler waren schließlich schon seit dem 6. November unterwegs und hatten noch nicht einmal das alliierte Hauptquartier erreicht. Das mit dem Waffenstillstand konnte also noch dauern.
Dass der Kaiser nichts gab auf die Forderungen seiner Regierung und die SPD das auch noch hinnahm, feuerte die Wut der Demonstranten auf der Straße nur noch mehr an. Also musste die SPD auf den fahrenden Zug, den sie mit ihrer ruckelnden Verhandlungstaktik nicht mehr bremsen konnte, aufspringen. Wie so oft an einem deutschen 9. November war der Hauptakteur auch der Verantwortliche dafür, dass er im Finale selbst gewaltig unter Druck geriet. Die SPD stellte sich an die Seite der Arbeiter- und Soldatenvertreter und forderte die Regierung auf, die Macht zu übergeben.5 Eine eigenartige Forderung von einer Partei, die ja nominell schon an der Macht war, zumindest saß sie im Kabinett des Max von Baden.
Der unfreiwillige Partner der SPD, die USPD, hatte an diesem 9. November ein Problem. Ihr Vorsitzender Hugo Haase war nicht in der Stadt. Er hatte die Aufgabe, die in Kiel meuternden Matrosen zu beschwichtigen, was ihm überraschend gut zu gelingen schien. Ohne Haase sahen sich die abtrünnigen Sozialisten nicht in der Lage, so grundsätzliche Vereinbarungen zu beschließen, wie die Mehrheitssozialisten sie anstrebten. Dazu kam noch, dass sich die Revolutionären Obleute in der USPD entschlossen hatten, erst ab dem 11. November einen großen Vorstoß gegen die Regierung und den Kaiser zu starten.
Karl Liebknecht warnte davor, so lange zu warten. Aber sein Wort hatte in der Partei in diesen Tagen weniger Gewicht, als er und andere es glauben wollten. Die Revolutionäre, mit denen die Mehrheitssozialisten um Ebert sich zusammentun wollten, waren also gelähmt – zumindest für den Augenblick.
Um den ging es aber: um den Augenblick. Denn auf der Straße wurde die Situation immer kritischer, auch wenn die USPD-Radikalen sich nicht entschließen konnten, ob und wann sie mit oder ohne Mehrheitsgenossen handeln wollten.
Eine starke militärische Kraft, die die Radikalen hätte auseinandertreiben können, gab es nicht in der Hauptstadt. Die Fronttruppen waren anderswo, in Auflösung begriffen oder ohne entschlossene Führung. Einzig die berüchtigten Naumburger Jäger waren seit dem Vortag in der Stadt stationiert. Das 4. Jägerregiment zog am 8. November mit Maschinengewehr-Kompanien und schwerbewaffneten Infanteriekolonnen am Landwehrkanal entlang in Richtung Charlottenburg. Die Berliner beobachteten den Aufzug der Kampftruppen mit Beklemmung.6
Am späten Abend rückte das 4. Jägerregiment in die Infanterie-Schießschule an der Charlottenburger Chaussee ein. Den sogenannten Naumburger Jägern traut die Generalität zu, dass sie in Berlin mit revolutionären Umtrieben kurzen Prozess machen. Noch in der Nacht zum 9. November werden Granaten an die Jäger ausgegeben. Bei der Ausgabe verweigert ein Gefreiter die Entgegennahme seiner Granate. Er wird sofort verhaftet und weggebracht. Niemand in der Truppe protestiert oder leistet gar Widerstand. Erst Stunden später beginnt es unter den Soldaten zu rumoren. Sie wollen nun wissen, was genau sie in Berlin tun sollen und was es mit den Granaten auf sich hat. Sollen sie die Granaten etwa auf die Berliner Arbeiter werfen? Die Offiziere versprechen ihnen, dass sie in wenigen Stunden genauere Anweisungen und auch Informationen über die Lage in Berlin bekommen werden. Die ermüdeten Mannschaften legen sich in ihre Betten.
Am Samstagmorgen, dem 9. November, hat sich die Stimmung in der Charlottenburger Kaserne verändert. Die Naumburger Jäger wollen die Unterrichtung durch die Offiziere nicht abwarten. Sie schicken eine Delegation zur „Vorwärts“-Redaktion, wo seit 7 Uhr die Betriebsvertrauensleute der SPD tagen. Die bekommen einen mächtigen Schreck, als die bewaffneten Elitesoldaten ins Verlagshaus stürmen. Der Sprecher der Naumburger verlangt, dass jemand in die Kaserne mitkommt. Der Reichstagsabgeordnete Otto Wels erklärt sich dazu bereit. Die Soldaten bugsieren ihn in ihren Kraftwagen und bringen ihn in den Hof der Kaserne an der Charlottenburger Chaussee. Wels wird auf einen Krümperwagen gehievt und aufgefordert, die Mannschaften ins Bild zu setzen. Er berichtet von den schwierigen Waffenstillstandsbedingungen, von den taktischen Manövern des Kaisers. Auf dem Wagen bietet er ein leichtes Ziel, wenn einer der Offiziere, die ebenfalls Stellung bezogen haben, auf ihn schießen sollte. Wels wagt es schließlich, an die Jäger zu appellieren: „Es ist eure Pflicht, den Bürgerkrieg zu verhindern. Ich rufe euch zu: Ein Hoch auf den freien Volksstaat!“7 Und die gefürchteten Naumburger jubeln ihm zu.
Als Wels gegen 9 Uhr morgens zum „Vorwärts“ zurückkehrt, befinden sich in seiner Begleitung sechzig schwerbewaffnete Jäger: Sie sollen den Verlag vor Angriffen schützen. Damit ist es entschieden: Die Armee steht in der Hauptstadt auf der Seite der Mehrheitssozialisten, die Richtung der Revolution ist festgelegt.
Wels hält einen Rekord: Kein Politiker wurde in diesen turbulenten Tagen so oft entführt, eingesperrt, bedroht, als Geisel genommen. Aber kein Politiker hat auch so hoch gepokert wie Wels: Er agitierte in Kasernen, in die hinein sich keiner seiner Genossen getraut hätte. Er holte sogar die aufständischen Kieler Matrosen nach Berlin. Doch Wels war ein Stehaufmännchen. Trotz Todesdrohungen und Misshandlungen entkam er immer wieder seinen Peinigern und konnte sie sogar politisch umstimmen – wie im Fall der Naumburger Jäger.
Die Kaiserschlacht
Die Karten sind verteilt. Nicht zuletzt durch den riskanten Einsatz von Otto Wels in den Alexanderkasernen war die stärkste militärische Machtkonzentration in der Hauptstadt zu den Sozialdemokraten übergelaufen. Das bedeutete – mehr als alles andere – das Ende des Kaiserreichs.
Im Hauptquartier der Reichswehr im belgischen Spa hatte man bis zu diesem Morgen so getan, als hätten die Kapriolen der Politik, vor allem der Sozialdemokraten, wenig Einfluss auf den großen Gang der Dinge, für den man sich trotz Parlamentsregierung in Berlin immer noch zuständig fühlte. Doch kurz nach neun an diesem Samstag machten sich die hohen Generäle Hindenburg und Groener auf einen schweren Weg. Sie mussten zum Kaiser, zu dem sie bisher stur gestanden hatten, obwohl seine Abdankung vonseiten des mächtigen Siegers auf der anderen Seite der Front als Bedingung für den Frieden angesehen wurde.
Wilhelms Zustand war seit Monaten unverändert. Unverändert weltfremd und egoman. Ein Schlaglicht auf seinen politischen Geisteszustand wirft eine Episode aus dem Frühsommer. Da in Brest-Litowsk ein Friedensvertrag mit Russland erzwungen worden war, waren eine Million deutsche Soldaten und 3000 Geschütze an die bröckelnde Westfront verlegt worden. Die beiden Hasardeure an der Spitze der Obersten Heeresleitung Ludendorff und Hindenburg warfen alles in eine Entscheidungsschlacht bei St. Quentin. Dort waren die Deutschen den Engländern 3:1 überlegen. So konnten sie im März 1918 noch 90000 Gefangene machen und 1300 Geschütze erbeuten. Als im Hauptquartier in Avesnes die Meldungen über den unerwarteten Erfolg eintrafen, jubelte der Kaiser. Das Zentrumsblatt „Kölnische Volkszeitung“ sprach von St. Quentin nur noch als der „Kaiserschlacht“. Als Wilhelm davon hörte, tobte er gegenüber Herrn von Berg, dem Chef seines Zivilkabinetts (eine Art Präsidialamt): Das klinge ja so, als habe er die anderen Schlachten nicht gewonnen.
Die „Kaiserschlacht“, also der vermeintliche „Endsieg“ von 1918, war bereits im Mai beendet, als massierte alliierte Verbände der letzten deutschen Offensive an der Marne bei Chateau Thierry stoppten.8
Währenddessen träumte der Kaiser von einer Einigung mit Japan. Er sah japanische Truppen über Sibirien nach Europa eilen, um zusammen mit den Deutschen die Amerikaner vom Kontinent zu vertreiben.9 Oder er fantasierte, ähnlich wie fast 27 Jahre später Hitler, von einem Einlenken der Briten: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Engländer mir noch Truppenhilfe anbieten, um den Bolschewismus in Deutschland zu unterdrücken.“10
Dabei war Wilhelm gar nicht mal umnachtet. Aber er wusste sehr wohl, dass dem Militär, der stärksten Kraft im Lande, die Hände gebunden waren: Die Offiziere, die ihm den Treueid geschworen hatten, konnten ihn nicht zur Abdankung zwingen. Jedem seiner sechs Söhne hatte er das feierliche Versprechen abgenommen, sich nicht zu einer Regentschaft herzugeben. Gleichzeitig diskutierten Offiziere des Generalstabes hinter vorgehaltener Hand darüber, ob es nicht hilfreich wäre, an der Front einen Schusswechsel zu simulieren, der dem Kaiser den Ehrentod und dem Reich einen Neuanfang ermöglichte.11
Wilhelm war nach Spa abgereist und hatte das hypernervöse Berlin alleingelassen. Prinz Max von Baden hatte ihm am 31. Oktober ein Telegramm hinterhergeschickt, in dem er dringlich um Rückkehr bat. Doch Wilhelm verharrte in einer Don-Quixote-haften Attitüde: Sein Platz sei an der Seite seiner Generäle (die ihn insgeheim zur Hölle wünschten, aber ihm aus Angst, dass ihnen nach seiner Abdankung die Soldaten davonlaufen könnten, einstweilen noch die Stange hielten).12
In Spa waren im Morgengrauen des 9. November 39 Truppenkommandeure von der Front eingetroffen. Sie wurden sofort von Oberst Heye, dem Chef der Operationsabteilung, eingehend befragt: Sind ihre Truppen bereit und in der Lage, für den Kaiser gegen die Revolution zu kämpfen? Die Kommandeure drucksten nicht herum. Sie bestätigten den verheerenden Eindruck, den die Realisten unter den Generälen seit letzter Nacht gewonnen hatten: Die Truppen sind für einen blutigen Einsatz im Bürgerkrieg nicht zu gebrauchen. Am Vorabend, dem 8. November, war die Nachricht aus Aachen eingetroffen, dass die 2. Gardedivision, eine Eliteeinheit aus den königlich-preußischen Leibregimentern, die von der Front in Richtung Köln abkommandiert worden war, um die dort bereits regierenden Räte zu verjagen, den Offizieren den Gehorsam aufgekündigt und sich einfach nach Hause begeben hatte. Damit waren Nachschub und Rückzug für das Feldheer nicht mehr gesichert.
Auf dem Weg vom Hotel Britannique ins Château de la Fraineuse, wo Wilhelm II. seinen Kronrat abhielt, brach Hindenburg an diesem verregneten Novembermorgen in Tränen aus. Es war noch keine 10 Uhr, als er mit Groener in den kalten Gartensaal trat. In Kamin brannte ein schwaches Holzfeuer, aber im Saal war es, der Stimmung entsprechend, eiskalt. Hindenburg versagte die Stimme – vielleicht hatte er auch einfach keinen Nerv mehr, sich dem engstirnigen Kaiser zu stellen. Er schob den Neuling Groener vor. Der unterrichtete den Monarchen in geschäftsmäßigem Ton, dass es keinen Sinn habe, Truppen gegen einen Aufstand zu schicken – das würde sich auch nach dem zu erwartenden Waffenstillstand nicht ändern. Groener versteckte sich umständlich hinter militärisch-operativen und technischen Details.
General von der Schulenburg, Mitglied des Kronrates, schnaubte Groener wütend an: In wenigen Tagen stünden genug Elitetruppen am Rhein, um dem Zauber ein Ende zu machen. Denn auf die Elitetruppen am Rhein könne der Kaiser sich bedingungslos verlassen. Elitetruppen wie die famosen Naumburger Jäger zum Beispiel, die ja schon im Osten aufgeräumt hätten.
Groener und Hindenburg wussten zu diesem Zeitpunkt bereits, dass die Naumburger Jäger, der ganze Stolz des Kaisers, zu den Sozialdemokraten übergelaufen waren. Als auch Wilhelm klar wurde, dass die Zeit des Lavierens und Abwartens vorbei war, fasste er sich ein Herz: Er wolle vermeiden, dass in diesem Bürgerkrieg deutsche Soldaten auf deutsche Soldaten schießen müssten. Deshalb werde er den Waffenstillstand abwarten und dann an der Spitze seiner Armee in die Hauptstadt einziehen.
Hindenburg schwieg beklommen und schaute auf seine Füße – oder an die Decke, das ist nicht so genau überliefert. Groener musste erneut den Buhmann machen: „Eure Majestät haben keine Armeen mehr.“
Dass das Gesicht des Kaisers dunkelrot anlief, ist hingegen überliefert.13
Er brauchte einige Sekunden, dann trat er entschlossen auf den armen Groener zu und fauchte ihn an: „Exzellenz, diese Erklärung verlange ich von Ihnen schriftlich!“
Hindenburg wusste nun gar nicht mehr, wo er hingucken sollte.
Und dann fiel dem Kaiser noch etwas ein: „Hat er mir nicht den Fahneneid geschworen??!“, bellte er Groener an.
„Der ist in solcher Lage eine Fiktion“, entgegnete der müde Groener. Später behauptete er, so etwas habe er dem Kaiser gegenüber nie gesagt, höchstens seinen Offizieren gegenüber.14
Es war schon halb elf. Immer mehr Generäle trafen im Schloss ein. Der unermüdliche Graf von der Schulenburg bestürmte den Kaiser, doch wenigstens König von Preußen zu bleiben und an der Spitze der treuen preußischen Truppen wieder die Macht an sich zu ziehen. Wilhelm sah einen Hoffnungsstreif und war geneigt, sich auf den loyalen von der Schulenburg zu stützen.
Da läutete das Telefon. Berlin war dran. Der Reichskanzler. Schon wieder.
Wie erstickt man eine Revolution?
Kurz vor elf in Berlin. Dem Reichskanzler Prinz Max von Baden ging in diesen Vormittagsstunden eine Einsicht auf: „Wir können die Revolution nicht mehr niederschlagen, sondern nur noch ersticken.“ Das jedenfalls formulierte er später in diesen klaren Worten. Was das hieß, sagte er auch Ebert: „Im Großen zu tun, was Noske in Kiel bereits im Kleinen getan hatte.“15
Der deutschen Flotte war am 22. Oktober von der Obersten Heeresleitung befohlen worden, gegen die englische Marine auszurücken. Angeblich, um den bedrängten deutschen Heerestruppen auf den Feldern im Westen zu Hilfe zu kommen – was Unsinn war. Wie hätte die Marine von der Nordsee aus die Lage in den Schützengräben in Nordfrankreich und Belgien ändern sollen?16
Die Matrosen hatten sich nicht in eine für sie tödliche Symbolschlacht schicken lassen wollen und in Wilhelmshaven und anderen Standorten den Befehl verweigert. Daraufhin wurden sie festgesetzt.
In Kiel formierte sich am 3. November ein Demonstrationszug für die Freilassung der inhaftierten Matrosen. An einer Straßenkreuzung wurde dieser von einer Militärpatrouille gestoppt. Deren Führer, ein Leutnant Steinhäuser, befahl den Demonstranten, sich zu zerstreuen. Als sie das nicht taten, ließ er seine Soldaten das Feuer eröffnen. Es gab neun Tote und 29 Verletzte. Ein Matrose erschoss auf der Stelle den Leutnant Steinhäuser. Damit war der Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gab. Der Startschuss der Revolution. Wenn es eine hätte werden sollen.17
Ein eigenartiger Moment, der sich in diesen Tagen an vielen Orten Deutschlands wiederholte. Obwohl sie bisher ziellos und oft auch ohne Tatkraft gewesen waren, wussten plötzlich alle, was sie zu tun hatten. Das genetische Programm einer Revolution lief an. Dieses Programm war nicht neu. So hatte es in Russland im Oktober des Vorjahres auch begonnen.
Gerd Krumeich weist nachdrücklich auf die Rolle der Soldaten aus dem Norden für den Fortgang der Dinge hin. Es seien diese Soldaten gewesen, die den Umsturz des alten Systems auslösten, und zwar mit dem Ziel, unter allen Umständen zu verhindern, dass man sie in einen aussichtslosen Kampf auf hoher See schickte.18
Am Abend des 4. November 1918 kamen zwei Abgesandte aus Berlin in Kiel an. Die Stadt war zu diesem Zeitpunkt in der Hand von 40000 Soldaten. Der sozialdemokratische Abgeordnete Gustav Noske und der Staatssekretär Conrad Haussmann von der bürgerlichen Fortschrittlichen Volkspartei wunderten sich sehr, dass sie von den aufständischen Soldaten jubelnd empfangen wurden. Der Grund für die Kieler Begeisterung war: Die Aufständischen wussten, dass die angeordnete Offensive, bei der sie verheizt hatten werden sollen, ein Schachzug der Obersten Heeresleitung gewesen war – ein Schachzug gegen die Friedensbemühungen der Berliner Regierung. Man fühlte sich in Kiel also trotz aller Revolutionsattitüde auf der Seite des Staates. Und der schickte nun seine Abgeordneten Gustav Noske und Conrad Haussmann.
Die Soldaten wählten den etwas steifen, hochaufgeschossenen Noske, der immer einen Kneifer trug, am 5. November zum Vorsitzenden des Kieler Soldatenrates. Die örtlichen Vertreter der SPD und der USPD ernannten ihn am 7. November sogar zum Gouverneur.19
Gustav Noske tat ganze Arbeit in Kiel. Er qualifizierte sich mitten in der Herzkammer der aufkeimenden Revolution als zukünftiger Ausputzer der Regierungs-SPD. Man kann sich nur wundern über die Gutmütigkeit der Kieler Matrosenräte, die ihn nicht nur gleich bei seiner Ankunft zum Stadtkommandanten gemacht haben, sondern es auch hinnahmen, dass er in den folgenden Tagen etwas durchsetzte, was er dem Berliner Kanzler gegenüber vage als „freiwillige Rückkehr zur Ordnung unter sozialdemokratischer Führung“ umschrieb. Sein großes Ziel: „Dann würde die Rebellion in sich zusammensinken.“ Prinz Max von Baden assistierte von Berlin aus, indem er in seinem Kabinett den Beschluss „Freie Hand für Noske bei dem Versuch, den lokalen Ausbruch (!) zu ersticken“ durchsetzte. Der sensible Max von Baden zog mit Ebert an einem Strang – sein badischer Landsmann, der Heidelberger Handwerker, war eher nach seinem Geschmack als der geistreiche und rhetorisch geschickte Scheidemann aus Kassel. Dabei waren beide Sozialdemokraten aus dem gleichen Holz geschnitzt, nämlich aus dem, aus dem damals in der SPD große Männer gemacht wurden. Sie stammten aus dem Proletariat, hatten Handwerksberufe erlernt und kamen als Setzer zu Zeitungen, wo sie schnell in politische Redaktionen aufstiegen.
Zwei Degen
Um 11 Uhr rief Max von Baden in Spa an. In Berlin war Generalstreik, die Massen konnten jeden Moment die Wilhelmstraße stürmen. Von der Schulenburg war dran. Der Kaiser wolle nun doch abdanken. Wolle. Das Wort des Kaisers gehe den Herren schriftlich zu. In einer halben Stunde.
In einer halben Stunde! Der Kanzler atmete auf – hatten doch seine sozialdemokratischen Koalitionäre, die die Stimmung auf der Straße besser kannten, in den letzten 48 Stunden immer wieder versichert, dass nur die Abdankung des Kaisers die entfesselten Massen daran hindern konnte, die Macht an sich zu reißen.
Doch die angekündigte offizielle Abdankung lag auch eine halbe Stunde später nicht schriftlich vor. Es war nun halb zwölf. Der Prinz fühlte sich erneut hingehalten – davon, dass es in Spa einen Plan B gab, also die halbherzige Abdankung und dann die Rückkehr auf den Thron als König von Preußen, hatte Schulenburg dem Kanzler nichts anvertraut. So offen sprach man aus dem Kronrat heraus nicht mit dem Kanzler der Bürgerlichen und Sozialdemokraten.
Es war fünf vor zwölf. Der Kanzler konnte nicht mehr anders. Er gab dem Wolffschen Telegraphenbüro, das die Verbindung des politischen Berlin mit dem Rest des Reiches und der Welt darstellte, bekannt, dass der Kaiser dem Thron entsagen wolle und der Kronprinz keine Absicht habe, das Erbe anzutreten. (Nicht unwichtig, weil einerseits viele Konservative und sogar einige schwerfällige Genossen glaubten, die Monarchie in Deutschland sei zu retten, wenn nur der durch den Krieg schwer belastete Kaiser ging, und andererseits genau das einige revolutionär gesinnte Deutsche fürchteten und eine Weiterführung der Monarchie mit einem Regenten unter allen Umständen verhindern wollten.) Gleichzeitig schlug der amtierende Kanzler den SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert als seinen Nachfolger vor und kündigte eine Gesetzesvorlage über sofortige Wahlen zu einer verfassunggebenden Nationalversammlung an. Zwei Vorschläge, die das Land von Grund auf verändern sollten. Ohne eine Revolution, eigentlich auf parlamentarischem Weg. Und so ist es dann ja auch – mit einiger Verzögerung – gekommen. Allerdings mit einer Revolution oder mit einer vermeintlichen Revolution.
Wilhelm II. ging mit seiner Entourage zu einem späten Frühstück ins Château de la Fraineuse. Dort erreichte ihn per Telegramm die Nachricht, die das Wolffsche Telegraphenbüro verbreitete: In Berlin behauptete der Kanzler, er, Wilhelm, deutscher Kaiser, sei zurückgetreten. Er sprang vom gerade erst angefangenen Frühstück auf und schrie: „Verrat!“ Dann stürzte er in die Halle des Schlosses und ließ seine Adjutanten Telegramme verschicken. Mitten in dieser unsinnigen Haupt- und Staatsaktion wurden Hindenburg und Groener gemeldet. „Mein Gott“, stöhnte Wilhelm, „sind sie schon wieder da.“
Die Generäle zeigten betretene Gesichter, als sie eintraten. Hindenburg faselte etwas vom Kampf zwischen Sozialisten und Bolschewisten, der nun entbrannt sei. Die Straßen nach Berlin seien blockiert. Auch zur Front sei kein Durchkommen. (Was sollte der hypernervöse Ex-Kaiser an der Front?) Er empfehle deshalb dringend die Flucht nach Holland. „Ich kann es als preußischer General nicht verantworten, dass Sie von Ihren eigenen Truppen verhaftet und der revolutionären Regierung ausgeliefert werden!“20
Jetzt zeigte der Kaiser seine ganze Entschlusskraft. Er ließ augenblicklich packen. Doch dann verfiel er in Schockstarre. Fünf Stunden lang, bis gegen 17 Uhr, kämpfte er mit sich: Sollte er wirklich ganz und gar zurücktreten und nach Holland fliehen, wie Hindenburg ihm geraten hatte? Irgendwann kam ein Telefonanruf: Die Kaiserin befinde sich „unbelästigt“ im Neuen Palais zu Potsdam. Da konnte er doch nicht die Flucht ergreifen. Um 17 Uhr entschloss Wilhelm II. sich, bis zum nächsten Morgen zu verharren. Bis zum nächsten Morgen. Während in Berlin die Welt unterging. Während in Berlin schon längst (eine Stunde zuvor, das war an diesem 9. November eine kleine Ewigkeit) die sozialistische Republik Deutschland ausgerufen worden war.
Aber als sein Adjutant Oberstleutnant Niemann meldet, dass das Gepäck bereits im Hofzug verladen sei, wo sein Gefolge ihn erwarte, beschließt Wilhelm, sich auch in den Zug zu begeben. Dort wird dann ausgiebig getafelt.
Als Generalfeldmarschall von Hindenburg sich am frühen Sonntagmorgen vom Kaiser verabschieden will, erwartet ihn eine Überraschung. Der weißgoldene Hofzug steht nicht mehr im Bahnhof des Großen Hauptquartiers zu Spa. Er ist schon vor Sonnenaufgang losgefahren. In Richtung Holland. Den Kaiser hatten die aktuellen Nachrichten aus Berlin noch in der Nacht aufgeschreckt. Eine Abschiedsbotschaft an seine Generale hat er nicht hinterlassen. Aber dem verdutzten Grenzposten am belgisch-holländischen Übergang Eijsden hat er feierlich seinen Degen übergeben. Den Zug hatte er verlassen und war in einem von zwei unauffälligeren Automobilen weitergefahren, in Begleitung von Scharfschützen, die im flachen Niemandsland angestrengt nach Bolschewisten ausspähten. Der holländische Grenzposten wusste allerdings nicht, was er mit dem Degen des Kaisers anfangen sollte. Erst der Vorgesetzte des Grenzpostens erkannte den Ernst der Lage und telefonierte nach Den Haag. Königin Wilhelmina rief erschrocken das Kabinett ein. Dann fuhr ein Zug ein, und der deutsche Kaiser durfte die Grenze passieren. Auf der Fahrt in sein Exil sah er Tausende Niederländer an der Bahnstrecke stehen und gegen die Anwesenheit des verhassten deutschen Kaisers in ihrem Land protestieren.21
Degen, vor allem Ehrendegen, scheinen an diesem Tag eine besondere Rolle gespielt zu haben, wie eine Episode in Berlin zeigt.
Harry Graf Kessler hatte schon im Krieg Jozef Pilsudski kennengelernt, einen polnischen Nationalisten, der mit den Deutschen und den Österreichern gegen Russland kämpfte – unter anderem an der Spitze seiner Polnischen Legion. 1917 hatte Pilsudski sich gegen die vom deutschen Militär installierte Marionettenregierung im Generalgouvernement Warschau gestellt und sich geweigert, einen Eid auf Kaiser Wilhelm abzulegen. Er war deswegen inhaftiert worden. Nun hoffte man in Deutschland nach dem Zusammenbruch der Ostfront auf eine Regierung in Polen, die weiterhin deutschlandfreundlich agierte. Deshalb besann man sich im Außenministerium auf den in Magdeburg einsitzenden Pilsudski und auf dessen Bekanntschaft mit dem umtriebigen Kessler.
So befand sich der Künstler und Diplomat ohne Anstellung schon seit dem 7. November in Magdeburg, um Pilsudski aus dem Gefängnis zu holen und nach Warschau zu begleiten. Wie alle ist auch Kessler in höchster Aufregung: „Die Physiognomie der Revolution beginnt sich abzuzeichnen: allmähliche Inbesitznahme, Ölfleck durch die meuternden Matrosen von der Küste aus. Sie isolieren Berlin, das bald nur noch eine Insel sein wird. Umgekehrt wie in Frankreich revolutioniert die Provinz die Hauptstadt, die See das Land: Wikingerstrategie. Vielleicht kommen wir so gegen unseren Willen an die Spitze des Sklavenaufstandes gegen England und das amerikanische Kapital. Liebknecht als Kriegsherr in diesem Endkampf, die Flotte hat die Führung.“22
Die Verkehrsverhältnisse sind katastrophal. Immerhin hat Kessler die Fahrt nach Magdeburg in vier Stunden mit der Bahn geschafft. Doch dort sitzt er erst mal zwei Tage fest, weil Pilsudski jede schriftliche Verpflichtung verweigert. Die Zeit drängt. Womöglich kommt der Pole zu spät nach Warschau und wird dort vor vollendete Tatsachen gestellt. Und weil die Truppen, die in Magdeburg den Gefangenen des Reiches bewachen, auch kurz davorstehen zu putschen. Kessler ist in einer schwierigen Situation – eine Situation, die sich an vielen Orten in Deutschland ähnlich abspielt: Die alte Ordnung agiert noch, als hätte sie das Heft in der Hand, aber die Revolutionäre stehen in Behörden und Kasernen schon auf der Türschwelle. Kessler berichtet, „daß Offizieren die Achselstücke abgerissen und der Degen (!) abgenommen würden“.23
Und Jozef Pilsudski trägt voller Stolz eine Fhantasieuniform der alten Armee. Im Wagen fahren sie über Umwege nach Berlin. In Genthin machen sie Pause bei einem Molkereibesitzer und essen zu Mittag, „friedensmäßig, mit schöner und reichlicher Butter, einer Milchsuppe, Fleisch, Käse, Sahne zum Kaffee“.24
Als Kessler sich von Pilsudski im Berliner Hotel Continental verabschiedet, bittet dieser ihn inständig, ihm schnellstens einen Degen zu besorgen, „da er in Uniform ohne Degen hier nicht ausgehen könne“. Kessler verspricht, sein Bestes zu tun: Er wird am nächsten Tag, dem 9. November, einen Degen mitbringen. Zur Not sogar einen preußischen Degen.
Alles ist ruhig, als Kessler am Samstag, dem 9. November, um 10.30 Uhr durch die Friedrichstraße läuft. Nur eine MG-Schützen-Kompanie am Potsdamer Bahnhof fällt ihm auf. Er hat am Vorabend noch einen Diener mit dem Kauf des Degens beauftragt. Doch der empfängt ihn mit einer schlechten Nachricht: Alle Waffen in Geschäften sind beschlagnahmt. Kessler wagt kaum, dem Polen unter die Augen zu treten. Als Ersatz für den Offiziersdegen bietet er ihm verschämt sein altes Feldzugsseitengewehr an. Man kommt überein, sich auf das Ehrenwort Pilsudskis zu verlassen, dass der als neuer Regierungschef in Warschau nichts gegen die Interessen Deutschlands unternehmen würde – wozu etwa die mögliche Abtrennung Westpreußens vom Reich gehören könnte.
Als Kessler sich auf den Weg zum Kriegsministerium macht, um einen Zug für Pilsudski zu organisieren, trifft er in der Königgrätzer Straße (heute Stresemannstraße) auf eine Demonstration, die zum Reichstag zieht. An der Ecke zur Schöneberger Straße schreit ein Zeitungsverkäufer die (falsche) Eilmeldung aus: „Abdankung des Kaisers.“ Harry Graf Kessler ist schockiert: „Mir griff es doch an die Gurgel, dieses Ende des Hohenzollernhauses; so kläglich, so nebensächlich, nicht einmal Mittelpunkt der Ereignisse.“
Erst um 1 Uhr in der Nacht ist er zu Hause. „So schließt dieser erste Revolutionstag, der in wenigen Stunden den Sturz der Hohenzollern, die Auflösung des deutschen Heeres, das Ende der bisherigen Gesellschaftsform in Deutschland gesehen hat. Einer der denkwürdigsten, furchtbarsten Tage der deutschen Geschichte.“25
Am 10. November ist Kesslers Schützling Pilsudski mit seinem deutschen Seitengewehr endlich auf dem Weg nach Warschau. Kessler selbst bleibt im aufgewühlten Berlin und streift durch die Stadt – oder besser durch die Salons und Hotellounges der Stadt. Im Excelsior verwickelt er den Chef der roten Wachmannschaft in ein Gespräch. Der 24-Jährige gehört eigentlich zum Matrosenregiment No. 1. Er kennt die Stimmungslage unter den Deutschen aus mehreren Tagen Revolutionserfahrung: „Diszipliniert, kaltblütig, ordnungsliebend, eingestellt auf Gerechtigkeit, fast durchweg gewissenhaft.“
Das klingt etwas oberflächlich, ist aber genau das psychische Programm der Tage und Wochen nach dem großen Beginn vom 9. November. Kaum jemand will wirklich die alte Ordnung völlig auf den Kopf stellen, die Menschen sind der Kämpfe müde, sie wollen verlässliche Verhältnisse und die unbedingte Aufrechterhaltung der Ordnung. Darin sind sie sehr ernst. Und sie sind bereit, für diese Ziele auch Blut fließen zu lassen („kaltblütig“), aber nicht ihr eigenes.26 Genau besehen: Das Charakterbild der bürgerlich-liberal-linken Gegenrevolution, die – trotz Liebknechts hehrer Proklamation – längst anläuft.
Rochade
Zurück zum Samstag, 9. November. Um 12.30 Uhr – noch immer war der Kanzler im Ungewissen über die Absichten des Kaisers – klopfte es an der Tür im Kanzlerbüro, in dem Max von Baden und seine Staatssekretäre mit starren Blicken aufs Telefon bangten. Draußen stand Ebert mit seinen SPD-Granden aus der Fraktion. Sie verlangten, dass der Prinz ihnen die Macht übergab; so wie es ihre Fraktion am Morgen beschlossen hatte. Ebert berief sich darauf, dass nur durch die Machtübergabe an die Sozialdemokraten Ruhe und Ordnung im Reich bewahrt werden würden und schweres Blutvergießen vermieden werden könnte. Er kündigte auch an, dass seine MSPD nicht allein stand. Die USPD unterstütze seine Forderung – theoretisch zumindest. Da er gerade bei der Regierungsbildung war – zwischen Tür und Angel zwar, aber immerhin im richtigen Moment –, ließ er nicht unerwähnt, dass auch nichts gegen eine Beteiligung bürgerlicher Volksvertreter einzuwenden sei, sofern seine SPD die Mehrheit behalten würde.
Der arme Max von Baden spürte wohl, dass damit sein Versuch, das Notwendige im Sinne der noch schwachen Geschäftsordnung des deutschen Parlamentarismus abzuhandeln, gescheitert war. Seufzend tat der Kanzler nun, was nicht mehr zu verhindern war: Er schlug Friedrich Ebert als seinen Nachfolger vor. Der stockte einen Moment, dachte angestrengt nach und schnaubte dann: „Es ist ein schweres Amt, aber ich werde es übernehmen.“27
Leider kann man sich diese Schlüsselszene der deutschen Geschichte nur sehr melodramatisch, stumm und in Schwarzweiß vorstellen. Als Slapstick also. Obwohl die Lage dazu eigentlich viel zu ernst war. Aber Geschichte ist manchmal so widersprüchlich und profan.
Erst gegen 15 Uhr sieht sich die Oberste Heeresleitung in Spa veranlasst, wieder einmal einen Zug in dem unübersichtlich gewordenen Spiel zu machen. In einem Telegramm an die Reichskanzlei teilt sie militärisch knapp mit: „Um Blutvergießen zu vermeiden, sind seine Majestät bereit, als deutscher Kaiser abzudanken, aber nicht als König von Preußen.“
Die Reichskanzlei, die zu diesem Zeitpunkt schon Friedrich Ebert unterstellt ist, lässt sich eine halbe Stunde Zeit. Um 15.30 Uhr bekommt Spa die Antwort aus Berlin: Die Abdankung des Kaisers sei schon um 12 Uhr bekanntgegeben worden. Mit dem Telegramm Wilhelms sei „nichts mehr anzufangen“.
Das neue Zauberwort hieß: Parlamentarisierung. Es klang modern und effizient und demokratisch, war aber nur ein anderer Begriff für die politische Umschuldung. Die Front brach zusammen, im Land herrschte Chaos, und die bis dahin stärkste Macht, die Oberste Heeresleitung, betrieb politische Planspiele.
Ludendorff hatte schon im Oktober seine engsten Offiziere über den wahren Charakter dieser Rochade ins Bild gesetzt: Er habe den Kaiser „gebeten, jetzt auch diejenigen Kreise an die Regierung zu bringen, denen wir es in der Hauptsache zu danken haben, dass wir so weit gekommen sind. Wir werden also diese Herren jetzt in die Ministerien einziehen sehen. Die sollen nun den Frieden schließen, der jetzt geschlossen werden muß. Sie sollen die Suppe jetzt essen, die sie uns eingebrockt haben.“28
Dabei hatten ihnen die Sozialdemokraten die Suppe nicht eingebrockt, das hatten die Generäle der Obersten Heeresleitung selbst getan. Die Sozialdemokraten standen nun vor zwei epochalen Aufgaben, um die sie allerdings nicht gebeten hatten: erstens durch eine Regierungsübernahme der Revolution die Basis zu nehmen. Und zweitens diejenigen aus der Schusslinie zu bringen, die den Krieg und die Niederlage zu verantworten hatten.
Scheidemann hatte sich auf der Fraktionssitzung vom 3. Oktober gegen eine Regierungsbeteiligung der SPD ausgesprochen: Er wollte nicht in ein „bankrottes Unternehmen“ einsteigen und dann für etwas verantwortlich gemacht werden, was seine Partei nicht zu verantworten hatte. Doch der nicht gerade wortgewaltige Friedrich Ebert war um große Parolen nicht verlegen: Jetzt, da alles zusammenbreche, dürfe sich die SPD nicht verweigern; sie müsse sich „in die Bresche werfen“, um zu retten, was zu retten sei. Die Fraktion stimmte mehrheitlich für Ebert und gegen Scheidemann.29 Ein Schuft, wer dabei an den SPD-Bundespräsidenten Steinmeier und die Situation nach dem Scheitern der Jamaika-Koalitions-Verhandlungen von November 2017 denkt.
Dass der Waffenstillstand auf Geheiß der Obersten Heeresleitung beim Feind erbeten worden war, wurde nicht nach außen getragen. Als wenig später das Gegenteil behauptet wurde, nämlich dass die zivile Regierung dem Heer mit ihrer Bitte um Waffenstillstand in den Rücken gefallen sei, ließ Prinz Max von Baden das unwidersprochen.30
Der Reichstag beschloss, dass fortan der Reichskanzler sich auf das Vertrauen des Parlaments stützen müsse und dass die kaiserliche Kommandogewalt der parlamentarischen Kontrolle unterstellt wurde. Ein Gesetz, das das Land fast ebenso veränderte wie die Revolution, die sich an den Küsten im Norden zusammenbraute. Aber auch Ende Oktober herrschte im Reich noch der Belagerungszustand. Das bedeutete, dass die stellvertretenden kommandierenden Generale in den Wehrkreisen zu entscheiden hatten, was in der zivilen Politik wirklich geschah, was zensiert wurde, wer sich wo und wann versammeln durfte, wer aus politischen Gründen ins Gefängnis geworfen wurde.
Als der Kanzler am 1. November Innenminister Drews nach Spa geschickt hatte, hatte Wilhelm diesen zusammengebrüllt: Er denke nicht daran, „wegen der paar 100 Juden und der 1000 Arbeiter“ zu gehen. Eher schreibe er denen „die Antwort mit Maschinengewehren auf das Pflaster, und wenn ich mein eigenes Schloss zerschieße, aber Ordnung soll sein“.31