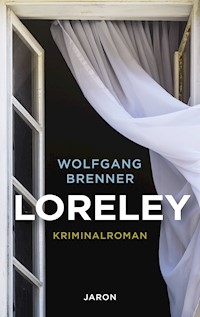Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wirr, aufregend und grotesk – so präsentierte sich das Jahr 1949 der deutschen Bevölkerung. Das hing nur am Rande mit den politischen Großereignissen der Gründung von BRD und DDR in Bonn und in Ost-Berlin zusammen. Weitaus größere Wellen schlugen andere Dinge: der "Zookrieg" um Bernhard Grzimek, die Umtriebe der berüchtigten Gladow-Bande, ein chinesischer Rauschgiftring in Hamburg, Damenringkämpfe in Düsseldorf, illegale Uranverkäufe in Hessen, braune Machenschaften in Wolfsburg oder die Liebesaffäre eines Polizeipräsidenten in Berlin. Deutschland hatte anno 1949 neben der großen Geschichte noch viel mehr zu bieten: Sex and crime oder die kleinen Revolutionen und Revolten am Rande. Diese Geschichten erzählt Wolfgang Brenner in diesem unterhaltsamen und faktenreichen Buch. Die Menschen beschäftigten sich, wenn sie schon mal Zeit fanden in ihrem Alltagskampf, mit Ereignissen, von denen sie glaubten, darin ihren wahren Zustand und manchmal sogar ihre Zukunft zu erkennen. Von solchen Ereignissen handelt dieses Buch. Es geht dabei nicht immer um Politik, aber Politik spielt immer eine Rolle. Es geht um das Überleben, um die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, um die hilflose Suche nach Glück, um scheinbare Banalitäten und um profane Kämpfe auf Leben und Tod, um Helden und Narren eben. Mit einem Wort: um den Alltag im Jahr 1949. Die Gründung der beiden deutschen Staaten im Jahr 1949 verlief weitgehend geräuschlos. Es gab kaum etwas, was die Deutschen im Mai und im Oktober dieses Jahres weniger interessierte. Das hatte viele Gründe. Erstens hatten die meisten Menschen im Nachkriegsdeutschland andere Sorgen. Die Zeit des großen Hungerns war zwar vorbei, aber immer noch lebten die Deutschen in einer Mangelgesellschaft, und sie mussten viel Energie darauf verwenden, ihren Alltag zu bewältigen. Dann konnten noch so salbungsvolle Erklärungen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Parlamentarische Rat in Bonn ebenso wenig wie der Volkskongress in Ost-Berlin nicht wirklich über den Aufbau und die Zukunft zweier neuer Staaten entschied. Das taten die Siegermächte und die hatten auch weiterhin das Sagen – mal mehr, mal weniger. Die Deutschen spielten Staat. Währenddessen gingen die Demontagen weiter. Kein Wunder, dass sich die Menschen nur für Randdetails der Staatsgründungen interessierten – wenn überhaupt. So wurde ausführlich darüber berichtet, wie viele Kilo die deutschen Teilnehmer des Währungs-Konklaves von Rothwesten bei Kassel zugenommen hatten, aber wenig darüber, was dort beschlossen worden war. Und was die Sitzungen des Parlamentarischen Rates betraf, so interessierte sich die Öffentlichkeit mehr für die Anzahl der in der Kantine gegessenen und noch mehr für die nicht gegessenen und vergammelten Buttercremetorten als für die Ergebnisse der mühsamen Diskussionen. Das in der Öffentlichkeit am heißesten diskutierte Thema war das sogenannte "Elternrecht" – das Recht der Eltern, allein zu bestimmen, welche Schule ihre Kinder besuchten. Die Ereignisse, die hier erzählt werden, klingen manchmal wie aus einer fremden Welt. Aber sie haben das Leben in den beiden deutschen Staaten zeitweise eher bestimmt, als die offizielle Politik. Mit seinen Reportagen aus der Gründungszeit von BRD und DDR begibt sich Wolfgang Brenner auf eine abenteuerliche Zeitreise in die unbekannte und absonderliche Welt der ersten hundert Tage, am Neuanfang der deutschen Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Brenner
Die ersten hundert Tage
Reportagen vom deutsch-deutschen Neuanfang 1949
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2018
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Judith Queins
Umschlagmotiv oben: © Bundesarchiv
Bildarchiv 183-2005-0823-510 (Erich O. Krüger)
Umschlagmotiv unten: © Bundesarchiv
Bildarchiv 183-N0415-363 (Otto Donath)
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, Torgau
ISBN E-Book 978-3-451-80893-7
ISBN Print 978-3-451-38181-2
Inhalt
Das Jahr 1949
Der Westen
Der Osten
Die Geschichten
Roter Schnee
Catch-as-catch-can
Düsseldorf – München
Wien – Nürnberg
Krieg im Zoo
Der Fall Grzimek
Der Privatdetektiv
Kino, Kalter Krieg und Zoo
Der Staat und der Tod
Das Fallbeil
Gladow
Wir unterschreiben nicht
Der UGO-Putsch
Dr. Katzenbergers Badereise
Die braune Stadt
Die neuen Herren
Der ideale Platz
1000 Lastautos
Der Stoff, aus dem die Träume sind
Das Wettrennen
Der Klotz
Hitlers Uranbrenner
China Connection
Der Lockvogel
Die Wehrmachtsdroge
Das Wunder von Bern
Markgraf und das Mädchen
Ein Polizist verschwindet
General Gómez
Der Polizeipräsident der Russen
Herta und Heidi
Die zweite Karriere
Paraffin
Demontage-Müller
Die Druckknopfstanze
Telegramm an Truman
Das Crèmeschnittchen
Die Selbstmördertür
Kriegskinder
Der heimliche VW
Helden der Arbeit
Ein Bergmann in Moskau
Ackermann oder der Umweg
Abbildungsnachweis
Über den Autor
Das Jahr 1949
Der Westen
1949 ist das Jahr, in dem die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik gegründet wurden. Für die Leute im Land spielten die parlamentarischen Rituale in Bonn und Ost-Berlin jedoch kaum eine Rolle. 1949 war ein belangloses Jahr, so scheint es.
Aber das ist falsch. In jeweils drei Monaten, also in etwa hundert Tagen, wurde aus den Besatzungszonen wieder ein Land. Ein neues Land, das aus zwei Staaten bestand. Aber dabei waren die Vorgänge in Bundestag und Volkskammer weniger wichtig. Wichtig waren die Haupt- und Staatsaktionen am Rande, die kleinen Revolutionen und Revolten.
Die Gründung der beiden deutschen Staaten im Jahr 1949 verlief weitgehend geräuschlos. Es gab kaum etwas, was die Deutschen im Mai und im Oktober dieses Jahres weniger interessierte. Das hatte viele Gründe. Erstens hatten die meisten Menschen im Nachkriegsdeutschland andere Sorgen. Die Zeit des großen Hungerns war zwar vorbei, aber immer noch lebten die Deutschen in einer Mangelgesellschaft, und sie mussten viel Energie darauf verwenden, ihren Alltag zu bewältigen. Dann konnten noch so salbungsvolle Erklärungen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Parlamentarische Rat in Bonn ebenso wenig wie der Volkskongress in Ost-Berlin nicht wirklich über den Aufbau und die Zukunft zweier neuer Staaten entschied. Das taten die Siegermächte und die hatten auch weiterhin das Sagen – mal mehr, mal weniger.
Die Deutschen spielten Staat. Währenddessen gingen die Demontagen weiter (siehe S. 229). Die Deutschen durften auch weiterhin ihre Interessen in der Welt nicht selbst vertreten, und fast jede wichtige politische Entscheidung musste vor den Besatzern bestehen, auch wenn diese offiziell keine Besatzer mehr waren.
Kein Wunder, dass sich die Menschen nur für Randdetails der Staatsgründungen interessierten – wenn überhaupt. So wurde ausführlich darüber berichtet, wie viele Kilo die deutschen Teilnehmer des Währungs-Konklaves von Rothwesten bei Kassel zugenommen hatten, aber wenig darüber, was dort beschlossen worden war. Und was die Sitzungen des Parlamentarischen Rates betraf, so interessierte sich die Öffentlichkeit mehr für die Anzahl der in der Kantine gegessenen und noch mehr für die nicht gegessenen und vergammelten Buttercremetorten als für die Ergebnisse der mühsamen Diskussionen. Das in der Öffentlichkeit am heißesten diskutierte Thema war das sogenannte »Elternrecht« – das Recht der Eltern, allein zu bestimmen, welche Schule ihre Kinder besuchten. Das jedenfalls ergab eine Analyse der Eingaben an den Parlamentarischen Rat: Von 5131 Eingaben betrafen 2690 das Elternrecht, 314 das Wahlrecht, 353 die Bundesflagge, 15 die Nationalhymne – fünf verlangten das Deutschlandlied und die schwarz-weiß-rote Fahne des Deutschen Reiches.1
Die Menschen beschäftigten sich, wenn sie schon mal Zeit fanden in ihrem Alltagskampf, mit ganz anderen Ereignissen als den Staatsgründungen in Bonn und Ost-Berlin. Mit Ereignissen, von denen sie glaubten, darin ihren wahren Zustand und manchmal sogar ihre Zukunft zu erkennen. Von solchen Ereignissen handelt dieses Buch. Es geht dabei nicht immer um Politik, aber Politik spielt immer eine Rolle. Es geht um das Überleben, um die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, um die hilflose Suche nach Glück, um scheinbare Banalitäten und um profane Kämpfe auf Leben und Tod, um Helden und Narren eben. Mit einem Wort: um den Alltag im Jahr 1949. Die Ereignisse, die hier erzählt werden, klingen manchmal wie aus einer fremden Welt. Aber sie haben sich in der BRD und der DDR zugetragen, und sie haben das Leben in den beiden deutschen Staaten über Jahrzehnte hinweg eher bestimmt, als die offizielle Politik das tat.
Dennoch: Das Jahr 1949 ist das deutsche Gründungsjahr. In diesem Jahr wurden aus den vier Besatzungszonen die beiden deutschen Staaten Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik. Der Weststaat entstand am 8. Mai 1949 – genau vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – auf dem Boden der seit 1945 bestehenden drei Westzonen. Der Parlamentarische Rat verabschiedete an diesem 8. Mai mit 53 Stimmen aus der CDU/CSU, der SPD und der FDP das Grundgesetz der BRD. Gegenstimmen: zwölf.
Der Oststaat entstand am 7. Oktober 1949 auf dem Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone. Also fast ein halbes Jahr später – und zehn Tage vor dem 30. Jahrestag der Oktoberrevolution von 1919. Die vom Volksrat im Mai 1949 gebilligte Verfassung wurde zur Verfassung der DDR erklärt.
Auf den ersten Blick haben beide Staaten unabhängig voneinander ihre spezifischen Geburtswehen durchgestanden. Aber das täuscht. Trotz der (noch) unsichtbaren Grenze, die der beginnende Kalte Krieg zog, waren die Geschicke eng miteinander verzahnt. Was ja auch kein Wunder ist, denn hinter allem, was geschah, standen der große Krieg und die Verbrechen des Nationalsozialismus.
Im Westen hatten die Besatzungsmächte den Verfassungsentwurf des Parlamentarischen Rates zuerst abgelehnt – was für viele ein Hinweis darauf war, dass es über dem provisorischen Parlament immer noch eine Instanz gab, der dessen Entscheidung gefallen musste. Die Westalliierten meldeten ernste Bedenken an gegen die Vollmachten, die die deutsche Polizei bekommen sollte, gegen die Geltung des Grundgesetzes in West-Berlin und gegen die Neuregelung der Ländergrenzen. Im Vorfeld hatte es schon erhebliche Kritik an der Steuerhoheit des Bundes gegeben. Die Westdeutschen ahnten bereits, dass die Sieger (oder einige davon) einen schwachen deutschen Staat wollten, dessen Zentralmacht sich mit starken Bundesländern zu arrangieren hatte.
Es stand auch eine Drohung im Raum, die jedem neuen deutschen Selbstbewusstsein von vorneherein die Spitze nahm: Am 1. Juli 1948 hatten die drei Militärgouverneure der USA, Großbritanniens und Frankreichs den Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder die sogenannten Frankfurter Dokumente überreicht. In diesen war in einer Art Tagesbefehl niedergelegt, was die Londoner Konferenz der Außenminister vorher beschlossen hatte: Bis spätestens 1. September 1948 sollte ein Parlamentarischer Rat einberufen werden, seine Mitglieder wurden von den Landtagen gewählt (ein Delegierter pro 750 000 Einwohner). Eine Verfassung sollte nur in Kraft treten, wenn zwei Drittel der Länder sie billigten, vor allem aber wenn die Militärgouverneure sie für gut befanden. Die Frankfurter Dokumente enthielten einen Vorbehalt, der sich in das politische Gemüt aller Beteiligten einbrannte: Die Militärgouverneure werden sofort die Ausübung ihrer vollen Machtbefugnisse wieder aufnehmen, falls ein Notstand die Sicherheit bedroht und um nötigenfalls die Beachtung der Verfassung und des Besatzungsstatutes zu sichern. Basta.
Das hieß: Demokratie gab es für das Volk, das den letzten Krieg zu verantworten hatte, nicht als Freifahrtschein. Es gab sie unter Vorbehalt und mit der Möglichkeit, jederzeit wieder in die Autokratie der Nachkriegsjahre zurückgestoßen zu werden, falls die Deutschen im Westen ihre sowieso begrenzten Freiheiten missbrauchten. Nicht wenige fragten: Ist das dann noch eine Demokratie? Dazu gehörten nicht nur die Nationalgesinnten, dazu gehörten auch Sozialdemokraten wie der SPD-Parteivorsitzende Kurt Schumacher und Konservative.
Wie angeordnet konstituierte sich der Parlamentarische Rat am 1. September 1948 in Bonn. Er bestand aus 65 stimmberechtigten Abgeordneten. 27 gehörten der CDU/CSU, 27 der SPD, fünf der FDP, zwei der KPD, zwei der DP und zwei dem Zentrum an.
Trotz der demonstrativen Willfährigkeit der starken Gruppe um den Präsidenten des Parlamentarischen Rates Konrad Adenauer gab es erhebliches Murren bei den Alliierten. Den Franzosen passte die ganze Richtung nicht. Sie hätten das Ruhrgebiet gerne für sich gehabt und beobachteten die internationale Verwaltung des deutschen Kohle- und Stahlzentrums mit Unbehagen. Überhaupt sahen sie nicht ein, dass die Wirtschaft des Nachbarn, der ihr Territorium in den letzten 80 Jahren drei Mal überfallen hatte, so kurz nach der Niederlage wieder florieren sollte. Jede deutsche Mark war für sie ein weiterer Schritt in Richtung einer neuen Militärmacht am Rhein. Eine aus heutiger Sicht verständliche Position – doch damals war die Not der Nachkriegszeit in Deutschland noch überall spürbar, und die Menschen fürchteten eine Beschränkung ihrer bescheiden anwachsenden Wirtschaft. Die Amerikaner hingegen forcierten die Wiederherstellung deutscher Wirtschaftskraft, weil sie die weitaus höchsten Unterstützungszahlungen leisten mussten und es deshalb zuhause schon Proteste gab.
Am 26. März 1949 nahmen die Westalliierten 31 Grenzkorrekturen zugunsten der Nachbarstaaten vor. Die Ministerpräsidenten der betroffenen deutschen Länder hatten um direkte Verhandlungen gebeten (siehe S. 135). Die alliierte Antwort auf die zaghaften Proteste: Kein Grund zur Aufregung, in Ostdeutschland betrugen die Annexionen deutscher Territorien durch Polen bzw. die UdSSR das 600-Fache dieser Korrektur.
Das war kein gutes Zeichen für die Stabilität des neuen Staates.
Im selben Monat geriet die Arbeit des Parlamentarischen Rates ins Stocken. Die alliierten Militärgouverneure lehnten die vorgesehene Balance zwischen Bund und Ländern ab. Sie wollten mehr Macht für die Bundesländer und damit eine schwächere Zentralregierung. Sofort machten die Deutschen Gegenvorschläge, die aber am 25. April 1949 in Bausch und Bogen abgelehnt wurden. Die SPD verlor die Geduld und wollte keine weiteren Zugeständnisse an die Besatzer mehr machen. Der neue Staat schien schon vor seiner Gründung zu scheitern, weil er sich keine Verfassung geben konnte.
Doch die Westalliierten hatten sich längst besonnen. Die Konfrontation mit der UdSSR wurde immer schärfer, wie die Berliner Blockade zeigte. Die Amerikaner arbeiteten daran, ihren nuklearen Vorsprung auszubauen, und die Russen standen kurz davor, eine eigene Atombombe zu testen (siehe S. 169). Die Amerikaner brauchten ein starkes Westdeutschland und keinen in die Knie gezwungenen Staat der Besiegten. Deshalb hatten sich die drei Außenminister auf ihrer Tagung in Washington am 8. April 1949 auf ein Papier geeinigt, das den Deutschen entgegenkam: Der Bund sollte eine eigene Finanzhoheit bekommen, und die Gesetzgebung sollte zwischen den Ländern und der Zentralregierung so aufgeteilt werden, dass der neue Staat handlungsfähig wurde. Seltsam war nur, dass die Militärgouverneure in den Westzonen diesen Durchbruch nicht weitergaben. Sie ließen die Deutschen noch zwei Wochen zappeln – vielleicht um die Konfrontation auf die Spitze zu treiben und ihnen so vorzuführen, dass ohne die Alliierten in Deutschland kein Staat mehr zu machen war.
Am 23. Mai 1949 kamen in Bonn die Ministerpräsidenten der Länder, die Landtagspräsidenten, die Vertreter der Militärregierungen und des Frankfurter Wirtschaftsrates zusammen. In einem Staatsakt wurde das Grundgesetz den Deutschen verkündet. Alle Mitglieder des Parlamentarischen Rates unterzeichneten die neue Verfassung, auch die Vertreter Berlins – nur die zwei kommunistischen Ratsmitglieder weigerten sich (siehe S. 107). Die Vertreter Bayerns im Parlamentarischen Rat unterschrieben auch, obwohl der Landtag in München seine Zustimmung zum Grundgesetz verweigert hatte.
Am selben Tag trafen sich die Außenminister der Großen Vier: Die USA, Großbritannien und Frankreich lehnten den Vorschlag der UdSSR ab, in Deutschland das Viermächte-Regime wiederherzustellen, weil damit die BRD auch noch den letzten Rest an Souveränität verloren hätte. Die Sowjetunion hingegen wehrte sich gegen den Vorschlag, durch Ausdehnung des Grundgesetzes auf die SBZ zu einer Vereinigung Deutschlands zu gelangen. Die Fronten waren verhärtet.
Am 14. August 1949 wurde der erste Bundestag gewählt. 18 Parteien waren zur Wahl zugelassen. Das Spektrum war breit: Es reichte von der rechtradikalen Deutschen Reichspartei DRP bis zur KPD. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,5 Prozent.
Das Ergebnis erinnert ein wenig an die Wahlausgänge der letzten Jahre: CDU/CSU waren mit 31,0 Prozent die Gewinner. Die SPD folgte mit 29,2 Prozent auf dem zweiten Platz. Der Abstand zwischen den beiden Großen war also geringer als in unseren Tagen. Die FDP kam auf beachtliche 11,9 Prozent. Die KPD erreichte 5,7 Prozent, kam also in den Bundestag. Die Bayernpartei errang 4,2 Prozent, die rechte Deutsche Partei 4,0 Prozent, das Zentrum 3,1 Prozent, die Wirtschaftliche Aufbauvereinigung WAV 2,9 Prozent. Die radikale Deutsche Reichspartei 1,8 Prozent, die Südschleswigsche Wählervereinigung 0,3 Prozent.
Konrad Adenauer, der starke Mann dieser Jahre, lehnte eine Koalition mit der SPD ab, die das Wirtschaftsministerium für sich beanspruchte. Seine Begründung für die Absage an eine Große Koalition klingt für uns, die wir seit Jahren eine Angleichung der Volksparteien aneinander erleben, kurios: Es herrsche ein zu großer Gegensatz zwischen seiner Partei und der SPD – vor allem in der Frage der Wirtschaftsform des neues Staates. Unter diesen Umständen sei es für ihn unmöglich, einen sozialdemokratischen Wirtschaftsminister zu akzeptieren. Adenauer teilte ebenfalls mit, sein Arzt habe ihm bestätigt, dass er gesundheitlich in der Lage sei, das Amt des Bundeskanzlers für zwei Jahre zu übernehmen. (Adenauer wurde mehrmals hintereinander Bundeskanzler – bis 1963, also nicht zwei, sondern 14 Jahre.) Als Bundespräsident schlug Adenauer Theodor Heuss von der FDP vor. Heuss erklärte später, er habe davon aus der Presse erfahren.
Am 12. September 1949 wählte die Bundesversammlung den Bundespräsidenten. Kandidaten waren Heuss (FDP), Kurt Schumacher (SPD) und Amelunxen (Zentrum). Heuss siegte erst im zweiten Wahlgang. Er schlug daraufhin dem Bundestag Adenauer als Kanzler vor.
Eine Woche später, am 20. September 1949, wurde das erste Kabinett Adenauer vereidigt. In seiner Regierungserklärung bekannte sich der 73-jährige Kanzler zur sozialen Marktwirtschaft. Er hoffte inständig auf ein Ende der Demontagen, ein Thema, das den Deutschen besonders am Herzen lag.
Adenauer begründete noch einmal seine Ablehnung einer Großen Koalition: Das Land brauche eine starke Opposition – auch ein Argument, das wir in letzter Zeit wieder gehört haben. Der Kanzler versprach die Amnestierung von Nationalsozialisten und bat die Alliierten, die noch verbliebenen deutschen Kriegsgefangenen freizulassen. Die Bundesregierung lehnte die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze ab – im Gegensatz zur ersten DDR-Regierung, die sie einen Monat später als polnisch-deutsche Grenze anerkennen sollte.
Der Osten
Die beiden Staatsgründungen sind nicht unabhängig voneinander abgelaufen. Das eine war eine Reaktion auf das andere. Auf die Währungsreform im Westen und die Einführung der D-Mark als alleiniges Zahlungsmittel in West-Berlin kam die Berliner Blockade. Auf die Blockade kam die Gründung der BRD. Als der Osten sich mit einem neuen deutschen Staat konfrontiert sah, lenkte er ein und stellte ein vereintes Deutschland zur Diskussion – was der Westen als eine Finte ansah, da in der SBZ machtpolitisch längst klare Verhältnisse geschaffen worden waren. Dass dort nichts geschah, ohne dass die Russen dem zustimmten, konnte der Westen jedoch nicht monieren, denn in seinem Herrschaftsbereich hatten die Besatzungsmächte auch das Sagen. Dass aber die SED die Macht fest in den Händen hielt und keine andere heimische Kraft neben sich duldete, sah er als eine Gefahr für ein künftiges einiges Deutschland an. Die Sowjets würden ihr System exportieren, fürchtete man. Dass das westliche System in den Osten exportiert werden könnte, glaubte damals keiner.
Als der Westen Stalins fragwürdiges Angebot ignorierte und seine BRD weiter entwickelte, sah sich die Sowjetunion gezwungen, dem West-Staat etwas entgegenzusetzen. Man könnte sagen: Die beiden Staaten schaukelten sich gegenseitig hoch. Eigentlich wollte jede Seite die Einheit, zumindest wurde das immer wieder bekräftigt. Aber sie kam nicht zustande, weil sich die beiden Kräfte misstrauten und auf jeden zaghaften Schritt des einen eine donnernde Reaktion des anderen folgen musste.
Seit Kriegende hatte sich Stalin mehrmals dafür ausgesprochen, Deutschland als Einheit zu erhalten. Fortan gehörte die Forderung nach einer deutschen Einheit zum festen Instrumentarium der Politik in der SBZ. Das ließ den Westen, der sich in dieser Frage in die Ecke gedrängt fühlte, nicht gut aussehen. Ein absurder Mechanismus wurde in Gang gesetzt: Die Sowjets forderten nun bei jeder Gelegenheit die deutsche Einheit. Die Westalliierten waren sich darüber uneins und wollten sich auch durch Stalin nicht dazu drängen lassen. Zudem vermuteten sie, dass die Russen ihren Statthaltern über zentrale Institutionen einen Platz an den Hebeln der Macht sichern wollten. Deshalb zeigten sich auch die Amerikaner und die Briten skeptisch, wenn aus dem Osten ein neuer Vorschlag in Richtung Einheit kam. Die Franzosen waren sowieso grundsätzlich dagegen, dass Deutschland wieder zentral regiert wurde.
Die Einheit war in aller Munde. Aber umso mehr lief alles auf eine Teilung hinaus.
Die Sache war aber viel verworrener – und zeigte, dass die Alliierten eben nicht nur wortkarg waren, wie Sieger das zu sein pflegen. Sie hatten einfach keinen detaillierten und für alle verbindlichen Plan für das Land, das sie besiegt und besetzt hatten.
Wie sollte unter diesen Bedingungen ein Friedensvertrag mit Deutschland zustande kommen? Der war doch aus der Sicht der Westalliierten die Voraussetzung für eine rechtliche Klärung der Oder-Neiße-Grenze. Aber nur eine gemeinsame Vertretung der Deutschen kam als Vertragspartner der Alliierten in Frage. Diese Voraussetzung konnte nicht eintreten, wenn nicht mal Frankreich seine Zustimmung dazu gab.
Ein Ende des langen Jammers war nicht in Sicht. Zwar wollten die Amerikaner aus finanziellen Erwägungen die wirtschaftliche Einheit, die ihre Steuerkassen entlastet hätte. Aber sie wollten den Russen nicht politisch nachgeben – und somit entstand eine gegenseitige Blockade.
Schon am 26. November 1947 hatte der Vorstand der SED alle Parteien, Gewerkschaften und Massenorganisationen im ganzen Land (!) dazu aufgerufen, zu einem Deutschen Volkskongress für Einheit und Frieden zusammenzukommen.
Am 6. und 7. Dezember konstituierte sich der Deutsche Volkskongress in Berlin. Von den 2215 Abgeordneten gehörten 893 der SED an. Der Rest bestand aus Mitgliedern der CDU, der SPD (auch aus dem Westen) und der liberaldemokratischen Partei. Eine Abordnung des Volkskongresses wurde nach London geschickt. Sie sollte die Wünsche der Vollversammlung der dort tagenden Außenministerkonferenz vortragen: einen Friedensvertrag, aber auch eine Regierung für ganz Deutschland und freie und geheime Wahlen. Doch die Delegation wurde in London nicht vorgelassen. Der Osten fühlte sich düpiert.
Am 17./18. März 1948 traf sich in Berlin der Zweite Deutsche Volkskongress. Die 2000 Delegierten verstanden sich als »einzige gesamtdeutsche Repräsentanz«.
Selbstbewusst bestätigte der Volkskongress die Oder-Neiße-Grenze und beschloss ein Volksbegehren über die deutsche Einheit. Es wurde ein Deutscher Volksrat mit 400 Mitgliedern gewählt. Der Volksrat sollte zwischen den Kongressen die Vorbereitungen für einen deutschen Staat im Osten treffen. Am Tag nach der Wahl von Wilhelm Pieck (SED) zum Vorsitzenden des Volksrats löste sich der Alliierte Kontrollrat im Streit auf.
Der Osten gab seine Einheits-Ambitionen auf und orientierte sich enger an der Sowjetunion. Diese Moskau-Justierung war auch im Alltag zu spüren – z. B. in der Arbeitswelt. Am 5. Februar 1949 fand in der SBZ die Konferenz der Hennecke-Aktivisten statt – das waren Musterarbeiter, die Unglaubliches vollbrachten. Viele ihrer Kollegen aber sahen in den Aktivisten einfach Normbrecher (siehe S. 259).
Die Entwicklung von Deutschland Ost und Deutschland West war zwar nicht entkoppelt, sie bewegte sich aber nun in verschiedene Richtungen. Und das immer schneller. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juni 1948 hatten die Sowjets West-Berlin hermetisch abgeriegelt. Der Personen- und Güterverkehr wurde unterbrochen. Strom gab es für die West-Berliner nur aus dem Osten.
Ende Januar 1949 gibt Stalin der US-Agentur INS ein Interview. Er scheint einlenken zu wollen. Der Osten leidet mittlerweile selbst unter der Blockade, weil auch keine Waren mehr von West-Berlin in den Osten der Stadt gelangen (Gegenblockade). Stalin willigt ein, die Blockade Berlins zu beenden – allerdings nur, wenn sofort eine Viermächtekonferenz einberufen wird. Er will im Kreis der Sieger im letzten Moment verhindern, dass sich ein eigenständiger Staat im Westen bildet und damit der Weg zu der auch von ihm angestrebten Einheit (allerdings zu seinen Bedingungen) für lange Zeit verbaut ist. Die Westmächte gehen auf seine Bedingungen nicht ein. Dennoch knickt die Sowjetunion ein und beendet die Berliner Blockade am 12. Mai 1949 – vier Tage nach Gründung der BRD. Das ist die erste große Niederlage der UdSSR – die Blockade, nicht die BRD.
Innenpolitisch wurden in der SBZ die Zügel fester angezogen. Im September 1948 distanzierte sich die SED-Führung von der Lehre eines deutschen Sonderwegs zum Sozialismus. Anton Ackermann, der stärkste Verfechter des deutschen Sonderwegs, musste Selbstkritik üben und einen Knicks in Richtung Osten machen (siehe S. 263) Gleichzeitig wurde die Kasernierte Volkspolizei gebildet, eine quasimilitärische Truppe, die mit schweren Waffen für einen Einsatz gegen den Westen trainierte (siehe S. 205). Ostdeutschland war nun ein fester Teil des sowjetischen Systems und musste auch dafür sorgen, dass die sowjetische Atombombe möglich wurde (siehe S. 169).
Seit Oktober 1948 hat der Deutsche Volksrat seinen Verfassungsentwurf fertig: Darin ist von Bürgerrechten die Rede, aber auch von strafbaren Delikten wie Boykotthetze – ein Hebel gegen jede Art von Opposition. Es soll eine Volkskammer und eine Länderkammer geben. Beide sollen gemeinsam den Staatspräsidenten wählen. Hat eine Fraktion 40 Angeordnete, kann sie sich an der Regierungsbildung beteiligen.
Am 15. und 16. Mai 1949 fanden die Wahlen zum Dritten Deutschen Volkskongress statt. Sie liefen über Einheitslisten, die willkürlich festlegten, wie stark der Anteil der Parteien war: Die SED sollte 25 Prozent der Sitze im Kongress bekommen, CDU 15 Prozent, LDP 15 Prozent, NDPD 7,5 Prozent, DBD (Bauernpartei) 7,5 Prozent. Ein Zehntel aller Sitze ging an den Gewerkschaftsbund FDGB, ein Zwanzigstel an die Freie Deutsche Jugend FDJ, ein Zwanzigstel an den Kulturbund, je 3,7 Prozent an den Demokratischen Frauenbund und an die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN und die restlichen zwei Prozent entfielen auf Genossenschaften. Als der Ausgang der Wahl kein klares Votum für den Volkskongress erbrachte, ließen die Länder-Innenminister die Stimmen neu auszählen: »unbeschriebene Zettel gelten als Ja-Stimmen, ebenso Streichungen«.2 Die 1400 Volkskongress-Mitglieder aus der SBZ und die 600 Westdeutschen wählten die 400 Mitglieder des Zweiten Deutschen Volksrates.
Am 7. Oktober 1949 war es dann so weit: Der Volksrat unter Vorsitz von Wilhelm Pieck erklärte sich zur provisorischen Volkskammer. Damit war die DDR gegründet. Kuriosum am Rande: Schon einen Tag später, nämlich am 8.10.1949, schloss die DDR einen Handelsvertrag ab, das erste Interzonen-Handelsabkommen mit der feindlichen BRD.
Die vom Volksrat ausgearbeitete Verfassung sah nun Wahlen vor – so wie in Westdeutschland wenige Wochen nach der Gründung der BRD Wahlen zum ersten Deutschen Bundestag stattgefunden hatten. Doch im Osten wurden sie kurzerhand auf den Herbst 1950 verschoben. Am 10. Oktober 1949 bestimmten die fünf Landtage der SBZ die 34 Mitglieder der Länderkammer. Am nächsten Tag trafen sich Volkskammer und Länderkammer, um Wilhelm Pieck zum Präsidenten der DDR zu wählen. Am 12. Oktober 1949 bestätigt die Volkskammer die Regierung des Ministerpräsidenten Otto Grotewohl und seiner Stellvertreter Ulbricht (SED), Kastner (LDPD), Nuschke (CDU). Die SED hält sechs der 14 Ministerien. Das Aufbauministerium bekommt die neue nationaldemokratische Partei NDPD. In seiner Regierungserklärung beklagt Grotewohl, dass die Westmächte Deutschland gespalten hätten. Er bekennt sich zur Oder-Neiße-Grenze und zur Freundschaft mit der Sowjetunion.
Damit besteht Deutschland aus zwei Staaten. Zwei Staaten, die sich gegenseitig nicht anerkennen. Das wird 40 Jahre so bleiben.
1 »Ich suchte den göttlichen Funken«, in: Der Spiegel 21/1949 vom 19.05.1949
2 Herbert Lilge (Hg.): Deutschland 1945–1964. Bundeszentrale für politische Bildung. Hannover 1969. S. 55
Die Geschichten
Im äußersten Westen des Landes explodierte eine ganze Stadt. Wo vorher emsig Aufbau betrieben worden war, war nur noch eine Trümmerwüste. Die Bewohner hatten gewusst, dass sie auf einer Zeitbombe saßen, und sich gewehrt. Aber die Zeitbombe gehörte einer Besatzungsmacht ... (S. 25ff.)In der Kultur brach nach der Währungsreform eine große Krise aus. Die Menschen gingen nicht mehr ins Theater, sie kauften von der harten Mark lieber Wurst und Schuhe. Die Künstler mussten wieder hungern. So begannen Operettensängerinnen zu ringen. Damenringkämpfe wurden zu einem Politikum – und zu einem Aufreger. (S. 35ff.)Die Deutschen sehnten sich auch 1949 nach der Ferne, der Exotik – und nach der Natur. Tiere standen hoch im Kurs. Tiere und Zoos. Deshalb war es kein Wunder, dass im jungen Deutschland ein Zookrieg ausbrach – mittendrin ein damals schon berühmter und charismatischer Veterinär. Dr. Bernhard Grzimek wurde von seiner braunen Vergangenheit eingeholt und von neidbesessenen Kollegen bedrängt. Am Schluss bleiben fast 100 Tiere auf der Strecke – vergiftet. (S. 53ff.)In Berlin wurde die Gladow-Bande verhaftet. Die jungen Kriminellen hatten jahrelang Raubüberfälle und Morde verübt und davon profitiert, dass die Stadt polizeitechnisch geteilt war. Nun mussten sie bezahlen. Der noch nicht volljährige Anführer, für viele ein Volksheld, starb unterm Fallbeil, während der eigentliche Drahtzieher glimpflich davonkam. Grund: Er war der Henker der Besatzungsmächte und er saß in West-Berlin, wo die Todesstrafe (fast) abgeschafft war. (S. 77ff.)Max Reimann war der Frontmann der westdeutschen Kommunisten. Er überredete seinen Genossen Kurt Müller zu einem Besuch in Ost-Berlin. Dort wurde der Bundestagsabgeordnete verhaftet und nach Sibirien geschickt. Der Mann, der das KZ der Nazis überlebt hatte, musste nun das Lager Stalins überstehen. (S. 107ff.)Im Osten kam es zu einem Putsch – dem sogenannten UGO-Putsch, der als kleiner Tarifstreit begann, aber durchaus das Zeug dazu hatte, die Supermächte USA und UdSSR in einen neuen Krieg zu verwickeln. (S. 119ff.)Kurz vor der Verabschiedung des Grundgesetzes im Westen wurden noch große Teile des deutschen Staatsgebietes annektiert. Die Menschen, die davon betroffen waren, wechselten über Nacht und ohne ihre Zustimmung ihr Staatsgebiet. Ein ehrgeiziger Ministerpräsident begab sich deshalb auf eine Odyssee. Er wollte seine Bürger zurückhaben und Kanzler werden. Um es vorweg zu sagen: Beides misslang. (S. 135ff.)In der VW-Stadt Wolfsburg spielen sich eigenartige Dinge ab. Die Stadtspitze wird von einer Landeskommission abgesetzt. Grund: Es sitzen nur noch Rechtsradikale im Rathaus. Die VW-Arbeiter haben dafür gesorgt – das sind in der großen Mehrheit Flüchtlinge aus dem Osten. Unter denen bricht ein heftiger Streit aus. Eine starke Gruppe will 1000 Lastwagen mit schlagkräftigen Männern in den alten Osten schicken, um die Polen »in Verlegenheit zu bringen«. (S. 149ff.)In Süddeutschland versucht eine Gruppe Geschäftsleute, illegal Uran zu verkaufen. Die Amerikaner schicken einen Geheimagenten und die Möchtegern-Atomhändler kommen vor ein Militärgericht. Die Russen sind kurz davor, ihre A-Bombe zu testen – deshalb droht den Deutschen die Todesstrafe. (S. 169ff.)In Hamburg wird ein chinesischer Rauschgiftring aufgedeckt. Es stellt sich aber schnell heraus, dass die Dealer aus Fernost harmlos sind – verglichen mit der Gefahr, die die legalisierte und verharmloste Wehrmachtsdroge Pervitin für das junge Deutschland darstellt. (S. 189ff.)Der Berliner Polizeipräsident Markgraf verschwindet spurlos, als der Boden in Ostdeutschland zu heiß für ihn wird. Er soll sein Dienstmädchen in ein sowjetisches KZ gesteckt haben, weil es ein Kind erwartete. Das Kind war von Markgraf – aber der hat mächtige Gönner. (S. 205ff.)Im Ruhrgebiet kommt es nach der BRD-Gründung zu Krawallen: Die Briten betreiben die Demontage der Paraffinindustrie. In der Kohleveredelung hatten die Deutschen einen Spitzenplatz, deshalb vermuten die Gewerkschaften, dass Londoner Wirtschafts-Kreise einen Konkurrenten ausschalten wollen. Es geht um fast 40 000 Arbeitsplätze. Da sie die Besatzer nicht frontal angreifen können, halten sich die Demonstranten an einen Deutschen, einen Abriss-Unternehmer namens Müller, der als Demontage-Müller eine traurige Berühmtheit erlangt … (S. 229ff.)Der VW-Käfer kommt nur stockend in Fahrt – im Südwesten aber hat er unerwartete Konkurrenz: Das kleine Crèmeschnittchen ist billiger und einfacher zu haben. Und dann heißt es auch noch, der französische Kleinwagen sei eine deutsche Erfindung. (S. 247ff.)Im Osten wird der sowjetische Stachanow-Kult auf deutsche Art weitergeführt. Adolf Hennecke bricht alle Normrekorde, die SED trägt ihn auf Händen. Straßen werden nach ihm benannt. Bei der Nationalpreisverleihung in Weimar bekommt Hennecke sogar die begehrte 1. Klasse. Doch in der Weimarer Innenstadt gibt es Proteste gegen Hennecke, der alles andere als beliebt bei der Bevölkerung ist. (S. 259ff.)Roter Schnee
Anfang Juli 1949 begaben sich der Polizeichef von Trier und der Leiter der Gendarmerie des Kreises auf eine Dienstreise durch die Nordeifel. Über die mit kräftigen Heckenriegeln bestandenen Hochebenen und durch schmale, dunkle Täler gelangten sie nach Prüm. Ihr Ziel war das dortige Munitionslager.
Am Eingang des Bergbunkers wurden die beiden höchsten Polizeioffiziere der Region von einer Patrouille der französischen Besatzungsmacht empfangen. Die Franzosen teilten ihnen mit, dass ihnen der Zugang zu der Anlage nicht erlaubt sei. Obwohl die Polizisten darauf hinwiesen, dass die Bevölkerung wegen des Depots in großer Unruhe sei, schickte man sie kurzerhand weg.1
Dass die Franzosen – die Betreiber des Prümer Munitionslagers – es nicht gerne sahen, wenn Deutsche sich um ihre Liegenschaften kümmerten, war allgemein bekannt. Im Frühjahr 1948 hatte sich der örtliche Stadtrat mit dem Munitionsdepot beschäftigt. Der zuständige Stadtinspektor war beauftragt worden, sich über die Einlagerung von gefährlichen Stoffen im Prümer Stadtgebiet zu beschweren. Doch bevor er überhaupt tätig werden konnte, wurde ihm von höherer Stelle signalisiert, er habe sich aus den »Besatzungs-Angelegenheiten der Franzosen« gefälligst herauszuhalten.
Auch Johannes Rüdel hatte lange gewarnt. »Sie reden sich um Kopf und Kragen«, bremste deshalb der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Peter Altmeier den für den Kreis Prüm zuständigen Landrat, als Rüdel sich in der Sache Munitionslager allzu weit aus dem Fenster lehnte. Schließlich betraf die Klage des Kommunalpolitikers die Besatzungsmacht.
Es ging um den Kalvarienberg, am Stadtrand von Prüm gelegen.
»Man weiß, die Leute von Prüm sind fromm«, schrieb die Zeit damals. »Den Berg, der am 15. Juli 1949 Feuer spie, nannten sie Kalvarienberg. Der Kreuzweg führte hinauf mit den Stationen des Leidens Christi. Droben stand eine Kapelle, neben dem Munitionsdepot (…)«2
Der biblische Berg war vollgestopft mit Munition. Sie war in ein Bunkersystem eingelagert, das die Wehrmacht 1939 bei Errichtung des Westwalls als Bereitschaftsunterkunft gegraben hatte. Nach Informationen der Zeit soll es sich sogar um einen »Luftschutzkeller für tausend Soldaten« gehandelt haben und: »Darüber lagen fünfzig Meter gewachsene Erde.« Die US-Army hatte die Stollen nach dem Krieg für ihre Sanitätseinrichtungen genutzt, zudem waren bis Ende 1946 obdachlos gewordene Prümer Bürger dort untergebracht worden. Das Bunkersystem bestand aus einem 100 Meter langen und 60 Meter breiten Hauptstollen und mehreren Querstollen, es reichte bis zu einer Tiefe von 30 Metern in den Berg hinein.
Die Bewohner der umliegenden Dörfer und der Stadt hatten mehrmals die Räumung des Kalvarienberges verlangt. Sie lebten in Angst.
Nicht zu Unrecht, wie sich am 15. Juli 1949 zeigte.
Beim damals prominenten Zeit-Autor Jan Molitor (ein Pseudonym von Josef Müller-Marein, ab 1957 Chefredakteur) klingt das Prümer Lied, als habe Bert Brecht ihm den Stift geführt: »Die Leute von Prüm saßen in den Wäldern. Acht Uhr dreiundzwanzig abends.«3
Vier Wochen nach der Ausrufung des neuen westdeutschen Staates flog ihm seine Vergangenheit um die Ohren. Im Kalvarienberg bei Prüm brach gegen 19 Uhr ein Brand aus, die Feuerwehr versuchte mit 140 Mann im Innern des Berges zu löschen, aber sie gelangte nicht zum eigentlichen Brandherd, weil sie keine Sauerstoffgeräte zur Verfügung hatte.4
Als die stählernen Stollentüren zu glühen begannen, zog der Einsatzleiter seine Männer ab: »Die Feuerwehr von Prüm kam angerasselt, Meyer schickte sie weg. Was sollten sie denn ausrichten gegen einen Berg voll Sprengstoff!«5 Um 20.22 Uhr geschah das, was die Prümer seit Jahren befürchtet hatten: 500 Tonnen Munition explodierten und jagten einen ganzen Berg in die Luft. Die Bergspitze löste sich, hob sich um die Höhe eines Hauses und prallte dann wieder auf den Berg. Dabei wurde das rotgelbe Eifeler Vulkangestein pulverisiert und legte sich als feiner Staub über die ganze Region. Fast eine Stunde lang herrschte eine totale Finsternis. Die Explosion war in Trier und Koblenz zu hören.
Die Eifelstadt Prüm war während eines Luftbombardements am Tag vor Weihnachten 1944 schon zu über 92 Prozent zerstört worden. Zwei Stunden lang hatten die alliierten Flugzeuge Prüm angegriffen, in sieben »Wellen«. Später empfahl der erste US-Stadtkommandant, die Stadt an anderer Stelle neu aufzubauen. Doch die Prümer wollten ihre alte Stadt wiederhaben.
Abb. 1: Kinder mit den wenigen Überresten, die aus den Trümmern ihres Heims geborgen werden konnten
Im Sommer 1949 hatten sie den Wiederaufbau fast schon geschafft, aber über 900 Einwohner waren noch ausgesiedelt und mussten im Umland leben – ein Glücksfall, sonst hätte es mehr Tote gegeben. Am 15. Juli wurde Prüm ein zweites Mal dem Erdbeben gleichgemacht. Mehr als vier Jahre nach Kriegsende.
Landrat Rüdel hat an diesem Abend vielen das Leben gerettet, indem er kurzerhand die gesamte Stadt räumen ließ. Bei Molitor/Müller-Marein/Brecht war es der Gendarmerie-Hauptmann Meyer mit seinem »guten Gesicht«: »Meyer ließ die Glocken der zerstörten Kirche läuten, Männer mit Schellen liefen herum: ›Räumt die Stadt!‹«
In noch nicht einmal einer Stunde war Prüm von 2700 Einwohnern geräumt. Da es keine Sirene in der Stadt gab, mussten die Bürger von Ausrufern alarmiert werden.6 Einige blieben in ihren Kellern zurück – darin hatten sie Routine. Auf diese Art hatten sie fünf Mal alliierte Bombenteppiche (mehr oder weniger) überstanden. Möglicherweise hatten die häufigen Luftangriffe der Westalliierten im Jahr 1944 dem Bunker im Kalvarienberg gegolten.
Eine Stunde nach Ausbruch des Brandes explodierte der Berg. Der Gendarmeriemeister Ohberg war mit seinem Schwager Josef Remmelt zum Brandort geeilt. Die Explosionswelle enthauptete sie in Ohbergs Dienstwagen.7
Die Presse sprach später von der »Hölle von Prüm«.8
Die gesamte Oberstadt lag in Trümmern. Ausgerechnet der Straßenzug Langemarckstraße, Stainkaulstraße und Reginostraße, in dem sich die wenigen Prümer Häuser befanden, die den Krieg unbeschadet überstanden hatten, war nun total zerstört.9 Jan Molitor fand die richtigen Worte: »An der Tiergartenstraße – sie gleicht einem Pfad, der durch den Staub führt, als sei er quer durch roten Schnee gebahnt –, an der Tiergartenstraße also nageln zwei Männer für ein halbdemoliertes Haus ein neues Dach aus Brettern.«10
Viele der durch die Explosion zerstörten Häuser waren in letzter Zeit erst wieder aufgebaut worden. Es gab nur zwölf Tote (ein kleines Wunder), neun Schwerverwundete und 51 Leichtverletzte. 970 Menschen waren obdachlos geworden. Unter den Toten war auch die 72-jährige Katharina Zimmer, besser bekannt als »Zimmesch Kettchen«. Sie war Ende 1944 der einzige Mensch gewesen, den die Amerikaner in Prüm angetroffen hatten, als sie die Stadt erstmals betreten hatten. »Zimmesch Kettchen« hatte öfters behauptet, die Schwester von Adolf Hitler zu sein. In Prüm nahm das niemand ernst; aber die Amerikaner sollen etwas irritiert gewesen sein, schon kurz hinter der Grenze eine nahe Verwandte des Führers anzutreffen.
Das örtliche Krankenhaus wurde völlig zerstört, von 240 Häusern waren nur noch Geröll und Staub übrig. Hätte der Landrat (oder Molitors famoser Gendarmeriekommissar Meyer) beim Ausbreiten des Brandes nicht die Evakuierung aller Einwohner befohlen, hätte ein Großteil der Einwohner die Katastrophe nicht überlebt.
Die Explosion des Kalvarienberges war im Umkreis von 60 Kilometern zu sehen. 250 000 Kubikmeter Gestein wurde aus dem Berg geschleudert und auf einer Fläche von fast 100 Hektar verteilt. Der feine, rote Staub der Vulkanerde ging selbst noch im 20 Kilometer entfernten Gerolstein nieder. Die Erdbebenwarte in Stuttgart (rund 350 Kilometer entfernt) registrierte die Detonation der 500 Tonnen Munition, die im Kalvarienberg gelagert waren. Molitor: »Das sah, wie eine Frau es beschrieb, so aus, als weinte der Himmel blutige Tränen (…)«
Die luxemburgische Garnison in Bitburg und die französische Besatzungsbehörden schickten ihre Sanitäter. So konnte im Hotel »Goldener Stern« eine Unfallhilfestelle eingerichtet werden, die die Verletzten betreute. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Altmeier und sein Gesundheitsminister Johann Junglas trafen noch in der Nacht in Prüm ein, um Hilfs- und Spendenaktionen zu organisieren.
Die Bevölkerung im ganzen Land zeigte sich betroffen von dem Unglück in der schon im Krieg arg gebeutelten Eifelstadt. Vor allem als publik wurde, wie heftig sich die Prümer gegen das Munitionslager in ihrer Stadt gewehrt hatten und wie kühl die französische Besatzungsmacht diese Beschwerden immer wieder abgewiesen hatte. Es kamen Spenden aus ganz Deutschland zusammen: Schulklassen opferten ihre Ausflugskassen, Betriebe sammelten für den Wiederaufbau. Mithilfe dieser Gelder gelang es relativ schnell, die Not zu lindern und den erneuten Wiederaufbau in Angriff zu nehmen.
Bis heute weiß man nicht, wie es zu dem Unglück kam. Der ehemalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) versuchte Ende der Neunzigerjahre zusammen mit dem Französischen Archivamt, etwas Licht ins Dunkle der Ereignisse zu bringen, musste aber schon nach kurzer Zeit aufgeben.
Umso heftiger wird bis heute spekuliert. Angeheizt durch die Tatsache, dass die französische Besatzungsmacht der Stadt Prüm nach dem Unglück zwei Millionen Mark gezahlt hat, weil der Bunker nicht ausreichend gesichert war. Die Zahlung war allerdings mit der Verpflichtung verknüpft, dass die Schuldfrage nicht weiter verfolgt werden durfte. Von einer beabsichtigten Sprengung war die Rede, die dann außer Kontrolle geraten sei, aber auch von Fahrlässigkeit der Wachmannschaften und von einem technischen Defekt in den damals nur provisorisch verlegten elektrischen Leitungen. Es wurde aber auch Sabotage vermutet – wie jedes Mal, wenn in diesen Jahren ein Unglück geschah. Die Alliierten witterten überall versprengte Nazis, was sich meist als Trugschluss erwies, oder militante Besatzungsgegner, was durchaus realistisch war.
In Prüm fiel ein erster Verdacht auf die Wachmannschaft selbst, eine international besetzte Gruppe, zu der viele displaced persons gehörten. Für besondere Aufregung sorgte die Entdeckung, dass zwei Wachmänner, ein Jugoslawe und ein Ungar, kurz nach der Explosion nach Australien verschwunden waren.
Die Zeit verfügte über Informationen, die die Wachmänner-These stützten: »Die Wächter, sagen die Leute, waren betrunken, und noch vom Leichnam des einen hat man Blutproben genommen.« Und: »Der Hauptwächter des Depots, der Ungar Barany – der wollte sogar, als die Katastrophe nahte, hinauf zum Berg (›Er war nicht nüchtern‹, sagten die Leute), und Gendarmeriemeister Hoberg hielt ihn fest, wollte nicht, daß er in sein Verderben rannte; da kam die Explosion, zentnerschwere Betonklötze segelten durch die Luft; beide wurden sie erschlagen, Hoberg und Barany.«
Oder aber: Sabotage von deutschen Widerstandsgruppen. Ein Bekennerschreiben sorgte für Aufsehen: eine »Kampfgruppe zur Erzwingung eines gerechten Lastenausgleichs« nahm die Verantwortung für einen Anschlag im Kalvarienberg-Bunker auf sich. Angeblich wollte sie damit die Aufmerksamkeit der Welt auf die ungerechte Behandlung der Deutschen lenken. Die Behörden aber spielten diese Spur, die sie für wenig glaubwürdig hielten, herunter.11
Anfang 1949 war die Öffentlichkeit noch der Meinung, in dem Stollensystem des Kalvarienberges sei Munition der Wehrmacht gelagert – die Anwohner sahen bis Ende 1948, wie tagtäglich Zwangsverpflichtete mit LKWs Material anlieferten, die Bomben und Granaten putzten, in Kisten verpackten und in den Berg einlagerten.12
Erst später stellte sich heraus, dass es sich bei der explodierten Munition größtenteils um modernen Sprengstoff aus Beständen der US-Army gehandelt hatte, den die Franzosen in Prüm eingelagert hatten, um damit die Reste von Hitlers Westwall zu sprengen.13
Der Prümer Krater gehört zu den größten weltweit, die durch Menschenhand entstanden sind. Er ist 190 Meter lang, 90 Meter breit und 27 Meter tief. Die Explosion zerstörte auch die Kalvarienberg-Kapelle, was bei der tiefgläubigen Eifel-Bevölkerung besonderen Unmut hervorrief. Jan Molitor in der Zeit über den spirituellen Schaden – schön, aber leider nicht ganz faktengetreu: »Wie der Kadaver eines überdimensionalen Walfisches mit seinem geschwungenen Rücken. In diesem Ungetüm klafft eine Wunde –: zweihundert Meter lang, fünfhundert Meter breit, sechzig Meter tief. Von hier ist die Zerstörung ausgegangen.«
Bleibt die eine große Frage: »Ist es über alle Maßen außergewöhnlich zu nennen (um diesen gelinden Ausdruck zu gebrauchen), daß derartig nahe einer menschlichen Siedlung ein derartig großes Sprengstoffdepot angelegt wurde, so ist gleichfalls über alle Maßen außergewöhnlich die Tatkraft eines Mannes zu nennen, der Tausenden das Leben gerettet hat.« Gemeint ist natürlich der famose Gendarmeriechef Meyer, dem Jan Molitor, als er auf dem Kalvarienberg weilte, unbedingt ein Denkmal errichten wollte. Zurück im sichern Hamburg vergaß er diesen hehren Vorsatz schnell wieder. Schade.
1 »Und dann wurde es finster«, in: Trierischer Volksfreund vom 11./12. Juli 2009
2 »Roter Staub über den Ruinen von Prüm«, in: Die Zeit 29/1949 vom 21. Juli 1949
3 Ebenda
4 Brief des Prümer Bürgermeisters an den Landrat Rüdel, vom 16. Juli 1949. Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz. LHA Koblenz, Bestand 700,172, Nr. 13, Bl. 1 https://www.landeshauptarchiv.de/fileadmin/user_upload/Gemeinsame_Dateien/Download/Blick_Geschichte/Bilder/15.07.1949/15_07_0_1_full.jpg
5 »Roter Staub über den Ruinen von Prüm«, in: Die Zeit 29/1949 vom 21. Juli 1949
6 Brief des Prümer Bürgermeisters an den Landrat Rüdel, vom 16. Juli 1949
7 »Geputzt und verpackt«, in: Der Spiegel 30/1949 vom 21.07.1949
8 Trierische Landeszeitung vom 16. Juli 1949
9 Brief des Prümer Bürgermeisters an den Landrat Rüdel, vom 16. Juli 1949
10 »Roter Staub über den Ruinen von Prüm«, in: Die Zeit 29/1949 vom 21. Juli 1949
11