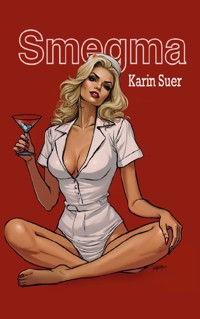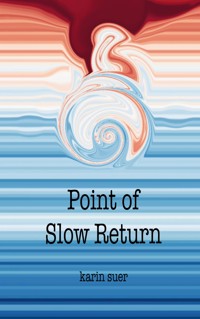Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman "STÖRUNG" beschreibt sieben Tage im Leben eines biederen Berliner Versicherungsangestellten, der plötzlich seinen Job, jede Perspektive und komplett die Nerven verliert. Und je mehr ihn einfach alles um ihn herum zu stören beginnt, wird er selbst mehr und mehr zum Störenfried. Sehr zum Leidwesen anderer Menschen in seinem Umfeld. Eine spannende, zum Teil auch sehr düstere, raue Geschichte, mit schrägem Humor erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Und eines Donnerstages dann, fast
zweitausend Jahre, nachdem ein Mann an einen
Baumstamm genagelt worden war, weil er gesagt hatte,
wie phantastisch er sich das vorstelle, wenn die Leute zur
Abwechslung mal nett zueinander wären, kam ein Mädchen,
das ganz allein in einem Café in Rickmansworth saß,
Plötzlich auf den Trichter, was die ganze Zeit so
schiefgelaufen war, und sie wusste endlich, wie die Welt
gut und glücklich werden könnte.
Douglas Adams
“Per Anhalter durch die Galaxis”
Liebe/-r Leser/-in,
Und da geht’s auch schon los. Wie mir das auf den Keks geht, wenn auch der schönste Text zerhackstückelt wird, vermeintlich aus Rücksichtnahme. Wer nimmt Rücksicht auf meine Augen? Das ist, wie wenn in der überfüllten Bahn jemand mit starkem Schweißgeruch dicht neben dir steht, und du kannst nichts dagegen tun. Oder wenn einer im Café die ganze Zeit viel zu laut spricht, oder sogar noch laut lacht. Die Lacher, das sind die Schlimmsten. Und ich könnte aus der Haut fahren, wenn in Filmen grundsätzlich ein Sturmfeuerzeug dran glauben muss, jedes Mal, wenn einer was in Brand steckt. Allerdings gibt es Gemeinheiten, denen man sich entziehen kann, wie etwa in dem Café. Man kann gehen. Den Film kann man abschalten.
Und Vorworte. Von wie vielen Büchern war ich schon im Vorwort enttäuscht, oft weil sie gar nichts mit dem Klappentext zu tun hatten, der mir das Buch schmackhaft gemacht hatte, manchmal auch nur, weil sie zwischen mir und meinem ersehnten, dem eigentlichen Lesestoff standen. Zum Glück kann man von sich behaupten, das Werk gelesen zu haben, auch wenn man das ganze Gerede davor heimlich überspringt. Was ich tatsächlich gerne tue. Schreibt man allerdings ein Buch, wird das Vorwort gewissermaßen zur Pflicht. Denn tut man es nicht, denken die Leser, man hätte selbst noch nie ein Buch von innen gesehen oder wäre gar schreibfaul. Ich bin also, ohne Mitleid zu erwarten, doppelt genervt von dieser Unart in der Literatur. Wenn es dir genauso geht, entschuldige ich mich hiermit aufrichtig für meinen Prolog. Und solltest du ihn gar nicht gelesen haben, hast du mein vollstes Verständnis.
Karin Suer - die Autorin
Inhaltsverzeichnis
Neuland
Pfirsich Maracuja oder Müsli
Tanz auf dem Vulkan
Totalausfall
Reisefieber
Die Gunst der Stunde Null
Frau Soundso
Männerfreundschaft
Tamara
Mahlzeit
Schlussworte
Eine kleine gedankliche Nachspeise
Neuland
„Es ist sechs Uhr. Die Nachrichten. Berlin. Nach den Stromausfällen vom Wochenende wird weiter europaweit nach den Ursachen der Panne gesucht. Wie das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte, arbeitet die Bundesnetzagentur dabei bereits eng mit den anderen betroffenen Staaten zusammen. Überprüft werde insbesondere, ob die gesetzlichen Bestimmungen von den Netzbetreibern eingehalten worden seien. Auch die für die europäischen Netzbetreiber zuständige Union für die Koordinierung der Erzeugung und des Transports elektrischer Energie (UCTE) hat zugesagt, ihre bei der Aufklärung gewonnenen Erkenntnisse schnellstmöglich zu übermitteln.
In Dresden beginnt der Prozess gegen den Entführer der Schülerin Stephanie R. Der Angeklagte Mario M. hielt die 13-jährige Stephanie 36 Tage lang in seiner Wohnung gefangen und missbrauchte sie dort laut Aussagen der Anklagevertretung mehr als hundert Mal. Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Berlin. Wirtschaftsminister Michael Glos, CSU, hat sich mit seinem erneuten Vorstoß zur Lockerung des Kündigungsschutzes den Zorn von Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, zugezogen. Merkel sei verärgert, dass Glos wieder ein neues Fass aufgemacht hat und damit die positiven Nachrichten zur Einigung bei der Unternehmenssteuerreform verdrängt hat, erfuhr die Berliner Zeitung aus Unions-Kreisen. Vergangene Woche hatte bereits Verteidigungsminister Jung mit Äußerungen zum Abzug der Bundeswehr aus Bosnien Merkels Unmut erregt. Glos und Jung gelten in der Koalition als Minister mit Profilierungsproblemen.
Berlin/ Brüssel. Die anhaltend gute Konjunktur in Deutschland sorgt für deutlich mehr Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt: Die Bundesagentur für Arbeit zählte im Oktober 825 000 offene Stellen. Dies seien 200 000 mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Drei Viertel der Stellen hätten auf eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt gezielt. Laut BA-Sprecher Ulrich Waschki gegenüber der Berliner Zeitung steckt hinter diesen Zahlen eine große Dynamik des Arbeitsmarktes. Wenn die Konjunktur anzieht, so Waschki, treibe es die Zahl der offenen Stellen in die Höhe. Etwa ein Drittel der Firmen nehmen bei der Suche nach neuen Mitarbeitern die Hilfe der Arbeitsagenturen in Anspruch, zwei Drittel nicht. Umgerechnet bedeutet dies, dass die tatsächliche Zahl der freien Stellen in der deutschen Wirtschaft weit über einer Million liegt.
Und nun zum Sport. Beim 1. FC Magdeburg erfüllt sich Heiner Bertram endlich den Traum vom modernen Stadion. Heiner Bertram war sechs Jahre Präsident des 1. FC Union Berlin. Unter seiner Ägide stieg der Klub in die zweite Bundesliga auf und erreichte das DFB-Pokalfinale. 2003 wurde er abberufen und sitzt mittlerweile im Aufsichtsrat des 1. FC Magdeburg. Das neue Stadion bietet 22 500 Sitz- und 4 500 Stehplätze. Es kostet 31 Millionen Euro.
Die Wetteraussichten für Berlin heute, Dienstag, den siebten November. Zu erwarten sind vereinzelt starke Regenschauer mit leichten Sturmböen und lockerer Bewölkung bei Temperaturen bis neun Grad am Nachmittag.“
Etwas bewegt sich unter der dicken Daunendecke im Bett neben dem Radiowecker. Eine Hand kommt zum Vorschein und drückt den Alarm Ausschalter. Der Mann, der bis gerade eben noch regungslos und mit geschlossenen Augen dagelegen hat, setzt sich auf, schiebt ohne hinzusehen seine Füße in die am Boden sauber nebeneinander abgelegten Hauslatschen, schlägt die Bettdecke zum Fußende um und geht aus dem Zimmer. Er streift sich mit den Fingern durchs dichte, rötlich braune Haar und gähnt mit halb- offenem Mund. Auf seinem Weg ins Badezimmer legt er einen Zwischenstopp in der Küche ein und drückt auf den Startknopf der Kaffeemaschine, die er schon gestern Abend vorbereitet hat. Dann schlendert er über den Flur in ein kleines Wohnzimmer.
In dem Raum befindet sich ein Sofa aus Kiefernholz mit braunen Cord Bezügen und ein Couchtisch in Buche mit Tonkacheln, höchstwahrscheinlich ein Relikt aus dem dritten Reich, außerdem ein großes Billy-Regal mit vielen Büchern darin. Hauptsächlich Taschenbücher, Drei-Groschen-Romane, wie man sie im Supermarkt findet. Ein Plattenspieler und eine kleine Plattensammlung stehen außerdem darin, und ein paar veraltete zehn Watt Lautsprecherboxen, in die Ecke neben dem Regal gequetscht steht sogar ein Gitarrenkoffer, aber ein wahrhaftiger Musikliebhaber wohnt hier nicht. Es sieht alles sehr aufgeräumt aus, nicht überladen mit Bildern und Schnickschnack, nicht einmal einen Fernseher findet man hier, nur ein großes, rundes Rotweinglas und eine Schale mit Cashewkernen auf dem klotzigen Tisch und daneben ein geschlossenes Buch, in dem eine Postkarte aus Lanzarote als Lesezeichen steckt.
Der Frühaufsteher geht zu einem kleinen, mit einer beige-braun karierten Wolldecke verhängten Kasten, der am Fenster steht, nimmt die Decke herunter und legt sie ordentlich zusammengefaltet neben sich auf die Armlehne des Sofas. Zwei bunt gefiederte Wellensittiche beginnen sogleich ihre morgendliche Arie, ein fröhliches Lied, und bemerkenswert laut für ihre winzigen Kehlen. Sie hüpfen in ihrer Behausung aufgeregt von Stange zu Stange und putzen sich für den Tag heraus. Der Mann zwitschert ihnen freundlich lächelnd ein „Tschilp, tschilp“ zu, streicht mit der Fingerkuppe über die Stäbe des Käfiggitters und führt seine Runde fort ins Badezimmer. Dort wirft er einen Blick in den Spiegel.
Er trägt ein T-Shirt, das ihm bis zur Gürtellinie reicht, und darunter hat er außer den Latschen nichts an. Vielleicht kann er das noch so tragen, schließlich sieht er für seine dreiundvierzig Jahre durchaus passabel aus. Nicht besonders sportlich, Sport hat er schon in der Schule gehasst. Aber er ist schlank und achtet, ohne übertriebene Eitelkeit, auch darauf, dass es so bleibt. Die schmalen Schultern hält er gerade und unter dem T-Shirt ist keine Spur von einem Bierbauch zu sehen. Seine kräftigen Oberschenkel und die im Verhältnis dazu recht dünnen Waden verraten, dass er zwar vielleicht viel spazieren geht, aber ganz bestimmt nie Fußball gespielt hat. In seinem unten-ohne-Look wirkt er ein bisschen wie ein kleiner Junge, den sie zum ersten Mal ohne Windel – dafür mit Opas Schlappen – auf die Wiese gelassen haben. Das wirkt vor allem im Zusammenspiel mit der Morgenlatte eines Erwachsenen, die er gänzlich ungeniert noch immer vor sich her durch die Wohnung trägt, ein wenig seltsam.
Aber darüber würde sowieso seit Jahren niemand mehr lachen. Verheiratet war er nie, und außer einer einzigen längeren Beziehung, mit der es schon seit 4 Jahren und zwei Monaten aus ist, war auch sonst nicht viel mit Frauen. Immerhin kann er vielleicht gerade deshalb noch nicht über graue Haare klagen. Ganz im Gegensatz zu einigen seiner verheirateten Arbeitskollegen gleichen Alters. Ob es nun an ihren pubertierenden Kindern oder an den Ehefrauen liegt oder an beidem, graue Haare kriegen sie nach und nach alle. Und Falten. Auch darüber wird immer häufiger gejammert unter denen, die sonst immer so getan haben, als wären Äußerlichkeiten ein reines Frauenthema.
Der Mann reibt sich die Augen, sie sind noch etwas verquollen von immerhin acht Stunden Schlaf. Dann geht er mit dem Gesicht ganz nah an den Spiegel und zieht mit zwei Fingern über dem Jochbein die Haut hoch. Nein, Falten hat er keine. Seine Haut ist glatt und rein, nur die Poren auf der Nase sind in den letzten Jahren ein bisschen größer geworden. Etwas blass war er schon immer. Das Einzige, was bei ihm im Sommer braun wird, sind ein paar Sommersprossen. Aber die warme Jahreszeit und die für die zarte, menschliche Pelle unglückselig hohe Strahlenbelastung ist längst vorbei und sein letzter Sonnenbrand ist schon fast vergessen. Stattdessen ist es jetzt morgens so kalt, dass man am liebsten im Bett bleiben möchte. Er geht aufs Klo und entledigt sich seines Ständers, dann setzt er seine Morgentoilette fort.
Kaltes Wasser ins Gesicht, Zähne putzen, rasieren. Danach dreht er den Hahn der Dusche auf, zieht das Shirt aus und wirft es in einen Flechtkorb mit einem Wäschebeutel aus geblümtem Stoff darin, der so auch schon im Badezimmer seiner Großmutter gestanden haben könnte. Er wartet, bis das Wasser die richtige Temperatur hat, dann steigt er aus den Hausschuhen und in die Duschwanne. Allmählich wach werdend, wäscht er sich gründlich und dudelt dabei die Melodie von Ginger Bakers „Da Da Man“. Ohne Eile, aber noch bevor der Spiegel ganz beschlagen ist, stellt er das Wasser wieder ab, trocknet sich mit einem großen, gelb-grün gestreiften Handtuch ab und geht nackt in seinen Schlappen zurück ins Schlafzimmer. Dort nimmt er seine Brille vom Nachttisch und setzt sie auf.
Die Brille trägt er jeden Tag, schon seit er ein Junge war und der Lehrer seine Mutter darauf hingewiesen hatte, dass er sich immer so weit über den Tisch beugt, wenn er zur Tafel sehen soll. Anfangs hat er sie gehasst, hat sie auf dem Schulweg in der Tasche verschwinden lassen und sich krampfhaft bemüht, seine spontan verbesserte Sehkraft vorzutäuschen. Jedes Mal, wenn der Lehrer etwas an die Tafel geschrieben hat, hat er sich heimlich vorgelehnt, um alles zu lesen, und wenn sich der Lehrer wieder zurück drehte und ihn etwas fragte, hat er versucht, aus dem Gedächtnis zu antworten. Das ging natürlich irgendwann schief, und als seine Mutter erfuhr, dass er die Brille in Wahrheit während des Unterrichts nicht trug, gab es einen Mordsärger. Seit dem Tag trägt er sie von morgens bis abends, obwohl er sie keineswegs braucht, um nicht vor die Wand zu laufen.
Auf einem Sessel in der Zimmerecke gegenüber seinem Bett hatte er bereits am Vorabend, noch bevor er es sich mit Wein und Buch gemütlich gemacht hat, sorgfältig seine Kleidung aufgeschichtet. Weiße Unterhose, weißes Unterhemd, schwarze Socken und zuunterst eine dunkelgraue Stoffhose. In derselben Reihenfolge zieht er sich an und nimmt dann das hellblaue Hemd, das auf einem Bügel an der Schranktür hängt. Den Bügel hängt er gleich zurück in den Schrank. Alles muss seine Ordnung haben.
Über dem Hemd knöpft er die Hose zu, zieht einen schwarzen Ledergürtel durch die Schlaufen und geht in den Flur zum Wandspiegel, während er die Gürtelschnalle schließt. Dort überprüft er den Sitz seines Hemdkragens und fährt sich noch einmal mit der Hand durchs Haar. Perfekt. In der Küche sproddern gerade die letzten Tropfen Wasser zischend durch den Kaffeefilter, und die Vögel werden allmählich ruhiger. Mit der rechten Hand das Ergebnis seiner Rasur prüfend, geht er in die Küche, öffnet den Kühlschrank und nimmt heraus, was er für die wichtigste Mahlzeit des Tages braucht. Butter, Schinken, Käse und ein in Plastik verpacktes Scheibenbrot. Er macht sich drei Scheiben fertig, zwei mit Schinken, eine mit Käse, und legt die Zutaten wieder ordentlich zurück in den Kühlschrank. Zwei Stullen packt er in eine Brotdose, die andere bleibt auf dem Teller. Dann gießt er Kaffee in einen Becher und setzt sich mit Teller und Tasse an den kleinen Esstisch, der gegenüber der Einbauküche unter einem Fenster in der Schrägwand steht.
Die Küche ist ebenso belanglos eingerichtet wie der Rest der Wohnung. In Eiche furnierte Schränke mit cremefarbener Arbeitsplatte, an der Wand moosgrüne Fliesen. Und neben der Kaffeemaschine ist außer einem Gewürzregal, einer Rolle Küchenpapier und einem perfekt, Kante auf Kante über die Armatur des Spülbeckens gehängten Lappen sonst nichts zu sehen. Alle Gläser und Tassen stehen in Reihe und Glied im Schrank, kein Geschirr vom Vortag, kein einziger Brotkrümel. Auf dem Tisch, auf einer abwischbaren Wachsdecke mit grün-gelbem Margeritenmuster, steht ein Teller mit drei dunkelroten Äpfeln. An der Wand neben dem Kühlschrank hängt ein großer Bilderrahmen mit verschiedenen Familienfotos, liebevoll zusammengestellt und mit kleinen Herzen verziert. Auf ein größeres Herz steht in glitzernd goldener Handschrift „Alles Liebe zum 40. Geburtstag” geschrieben. Und einmal abgesehen von dem Mann, der da still am Tisch sitzt und aus dem Fenster schaut, ist die Collage an der Wand so ziemlich der einzige Hinweis darauf, dass hier jemand wohnen könnte.
Draußen ist noch nicht viel zu sehen, nur ab und zu huscht flüchtig etwas vorbei, das genauso gut ein schnelles Blatt im Wind sein könnte wie eine langsame Fledermaus auf Mottenjagd. Der ordnungsliebende Junggeselle wendet sich vom Fenster ab und seinem Frühstück zu. Beim ersten Schluck Kaffee beschlägt er seine Brille vom aufsteigenden Dampf, er legt sie beiseite und beißt vom Schinkenbrot ab. Während er kaut, mit übereinander geschlagenen Beinen, schaut er seinem rechten Fuß dabei zu, wie er leise federnd auf und ab wippt. Er kaut im selben monotonen Rhythmus, und auf jedem vierten Takt zwinkert er einmal mit den Augen. Bis irgendwann die Kaffeemaschine in den Windungen ihrer Wasserleitungen doch noch einen letzten Tropfen findet, den sie nun mit einem plötzlichen, lauten Brodeln in die Kanne schießt. Kurz aufgeschreckt, sieht er von dem Fuß auf und guckt in die Richtung, aus der das störende Geräusch kommt. Ruhig legte er das Brot zurück auf den Teller, steht auf und schaltet das Gerät ab. Dann setzt er sich wieder hin, schlägt die Beine übereinander und isst in genau derselben Weise weiter.
Aus dem Wohnzimmer ertönt das Tschilpen der Wellensittiche, sonst ist nichts zu hören. Die Straße ist um diese Zeit noch tot. Nachdem er sein Frühstück beendet hat, schiebt er die Butterdose in eine lederne Aktentasche. Dazu eine Thermoskanne mit dem restlichen Kaffee aus der Maschine und einen der Äpfel vom Tisch. Teller und Tasse stellt er in die Spüle. Er spült immer erst abends nach dem Abendessen. Nicht aus Faulheit, sondern um Wasser zu sparen. Und das auch wohl nicht so sehr aus Gründen des Umweltschutzes, sondern der Sparsamkeit aus Prinzip. Zuletzt kippt er noch das Küchenfenster einen Spalt auf, dreht die Heizung runter und geht in den Flur, letzter Kontrollblick in den Spiegel. Er zieht seine Jacke aus ockerfarbener Schurwolle an, legt sich einen farblich abgestimmten Schal um den Hals und nimmt die Schlüssel vom Haken an der Garderobe. Dann verlässt er die Wohnung und schließt die Tür zweifach hinter sich ab. Die Vögel im Käfig veranstalten, aufgestört durch das Geräusch der ins Schloss fallenden Tür, noch ein kurzes Geträller, dann ist es still.
Drei Minuten vergehen. Vier Minuten. Fünf Minuten. Plötzlich das Geräusch von Schlüsseln an der Tür. Das Schloss dreht sich und die Tür geht auf. Der Mann kommt rein, nimmt die Jacke ab, hängt sie zusammen mit dem Schal wieder an den Haken und den Schlüssel daneben an seinen Platz. Er zieht die Schuhe aus, tauscht sie gegen die Hauslatschen und begibt sich wieder in die Küche an den kleinen Esstisch. Setzt sich hin, schlägt die Beine übereinander, eine Hand aufs Knie, die andere leicht von sich gestreckt auf den Tisch. Er schaut auf seinen Fuß herab, der wie eben langsam wippend am rechten Bein hängt. Das Wippen hat den selben Rhythmus wie das tickende Blindensignal der Fußgängerampel unten an der Strasse, das man durch das geöffnete Fenster nun nicht mehr überhören kann. Tip, tip, tip, tip tip – sein Fuß hat den Takt verloren. Versucht auch nicht, ihn wiederzufinden. Er wippt schneller. Und immer schneller. Bis er zittert wie das Druckventil eines Wasserkessels.
Auf einmal stoppt er abrupt. Der Mann schaut hoch zum Fenster, als würde er dort etwas suchen, und starrt minutenlang in den leeren Morgenhimmel hinaus. Da ist nichts zu sehen. Er erinnert sich an gestern. Es war einer dieser Montage, mies gelaunte Gesichter im ganzen Büro, restalkoholisiert geraunte „Morgen" ´s und schneidende Kälte, weil wieder mal niemand vor Arbeitsbeginn die Heizung angestellt hatte. Auf jedem Tisch wartete ein Turm von Akten auf seinen Fallbearbeiter, um ihm die mühsam über ´s Wochenende erarbeitete gute Laune im Handumdrehen wieder zu verderben, und jedem der Angestellten war schon im Aufzug nach oben klar, dass es wieder mit irgendeinem Ärger los gehen würde.
Wenn nicht die Kopierer streiken, dann ist es das veraltete System auf den Computern. Oder der Kaffeeautomat. Gestern war es dann auch tatsächlich wieder einmal der Kaffeeautomat, der bereits kaum zwei Minuten nach Eröffnung für die ersten Kraftausdrücke sorgte. Ein ganz normaler Tag, bis alles ganz anders kam. Auf dem Weg zum Schreibtisch hat ihn der Chef persönlich abgeholt und hat dabei als ausgerechnet derjenige, der nach dem Wochenende immer die schlechteste Stimmung mitgebracht hat, ein überaus freundliches Lächeln an den Tag gelegt. Er hat ihn in sein Büro gebeten und ihm einen Stuhl gewiesen. Und sich dann ans Fenster gestellt und einen Moment lang raus gesehen, als würden sie noch auf jemanden warten.
Doch dann hat er sich umgedreht, mit weniger freundlichem Lächeln, und erklärt: „ Herr Hinterwald – oder darf ich Merten zu ihnen sagen? Merten, sie müssen mir glauben, ich befinde mich gerade in einer extrem schwierigen Lage. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich es ihnen erklären, wie ich anfangen soll, nur ist es leider so, dass ich ganz furchtbar schlechte Nachrichten für sie habe. Für sie, aber auch für mich. Und ich kann ihnen gleich versichern, es bereitet mir Magengeschwüre...“Und dann hat er die ganze Weltwirtschaftslehre für Vorschulkinder runter gebetet, alles von Konjunkturschwäche, Marktkausalitäten, Rettungsmaßnahmen und Einbußen bis hin zur patriotischen, ja geradezu heroischen Selbstaufopferung Einzelner für den Erhalt des Großen und Ganzen. Und die seien ohnehin, wohl bemerkt, allerbestens abgesichert. Das ist nicht das Ende, das ist nur der Anfang von etwas Neuem.
Schwere Einschnitte für den Einzelnen wären eben manchmal unabwendbar. Aber die größte Niederlage sei es letztlich doch für ihn selbst, wegen all der Verantwortung und da der Druck für ihn als Abteilungsleiter nur immer weiter zunehme und er ja am Ende für alles den Kopf hinhalten müsse. Nicht etwa, dass er ihn um sein Mitleid bitten wollte, nein, um ein wenig Verständnis ginge es ihm. Und dass er ihm glauben müsse, dass er persönlich ja schon immer große Sympathie hege, beruflich gesehen und Respekt vor seiner Arbeitsweise habe, ist ja gar keine Frage. Merten hat nicht viel gesagt, meistens nur genickt. Der Chef hat ja selbst die ganze Zeit geredet, es war kaum Gelegenheit dazu. Nicht einmal um darüber nachzudenken, was er vielleicht sagen sollte. Er hat nur da gesessen, unter dem wasserfallartigen Redeschwall, und wie blöde genickt.
Das alles ist ihm vorgekommen wie ein Traum, nur dass Träume normalerweise realer wirken. Die Sätze sind wie eine Horde Wildpferde rechts und links an seinen Ohren vorbei galoppiert und sie haben dabei einen furchtbaren Lärm gemacht und viel Staub aufgewirbelt. Aber sie sind nicht zu seinem Verstand vorgedrungen. Irgendwann ist ihm das alles zu viel geworden, da ist er einfach aufgestanden und hat das Büro verlassen, ohne ein Wort zu sagen. Er hat nur genickt. Und dann hat er ein paar persönliche Sachen vom Schreibtisch genommen und ist zwischen den Kollegen her zur Tür raus. Einer hat ihm noch „Schönen Urlaub!“ gewünscht, ein anderer hat gezischt, „He, lass besser, das ist sein Resturlaub.“, dann ging die Tür zu seinem Arbeitsplatz hinter ihm zu.
Da draußen hinter dem Küchenfenster wird es allmählich heller. Merten Hinterwald steht vom Tisch auf und nimmt die Kaffeekanne aus der Ledertasche. Er holt eine neue Tasse aus dem Hängeschrank über der Spüle und setzt sich mit beidem zurück an den Tisch. Dann gießt er sich Kaffee ein und trinkt einen Schluck. Wieder legt er die beschlagene Brille weg. Er trinkt einen weiteren Schluck, dann starrt er eine Weile gedankenverloren in die dampfende Tasse, regt sich nicht. Er ist wie erstarrt, kein Finger rührt sich, kein Fuß wippt, selbst seine Lider stehen still. Für einen langen, atemlosen Augenblick sitzt er nur da und hält die Tasse vor sich in die Luft. Dann besinnt er sich wieder, schüttelt den Kopf und setzt sie wieder an den Mund, leert sie mit einem Zug und läuft zurück in den Flur, zieht sich an und verlässt die Wohnung erneut.
Unten auf der Straße muss er nicht weit laufen, um sein Auto zu erreichen. Meistens ist direkt vor der Tür etwas frei. Er steigt ein, startet den Motor, stellt die Heizung auf Maximum und schaltet das Gebläse aus, weil da sowieso bis zur übernächsten Straßenecke nur kalte Luft raus gepustet wird. Auf zum Arbeitsamt. Dort ist er bisher nur manchmal dran vorbeigefahren. Arbeitslos war er seit der Ausbildung nicht einen Tag. In der Firma, in der er bis gestern gearbeitet hat, hat er als junger Telefonist angefangen. Damals gab es noch Telefonisten innerhalb einer Firma und nicht nur diese externen Services, wo kein Mensch auch nur die geringste Ahnung von Service hat.
Und es gab auch noch keine Anruf-Automaten, nein, wer da am Telefon saß, kannte sich mit sämtlichen Betriebsabläufen bestens aus und konnte beinahe jegliches Problem selber lösen, ohne an die Rechnungsabteilung, die Vertragsabteilung, die Schadensabteilung oder die Juristische vermitteln zu müssen. In dieser Firma ist er ganze drei Etagen aufgestiegen, und das allein durch Fleiß und gute Leistung, und dort hat er vierundzwanzig Jahre seiner Lebenszeit verbracht, sie fast zu seiner Familie gezählt. Nicht dass er die Arbeit besonders geliebt hätte, die Leute kommen und gehen, und hier und da war auch mal einer dabei, der dem Betriebsklima gehörig geschadet hat, sowas konnte einem schon mal auf die Nerven gehen.
Aber richtig schlecht war es nicht. Und es gab immer wieder was zu lachen, denn im Haushalt passieren bekanntlich nicht nur die meisten Unfälle, sondern auch bei Weitem die besten. So mancher Schadensbericht wurde im ganzen Büro herumgereicht und hat für schallendes Gelächter gesorgt. Merten verzieht sein Gesicht etwas angesäuert, während er darüber nachdenkt. Was ist eigentlich so witzig daran, wenn irgendein Horst vom Sohn der Busenfreundin seiner Frau dabei erwischt wird, wie er das Kindermädchen der Busenfreundin fickt, dem Jungen vor Schreck die Tür des Elternschlafzimmers vor der Nase zuknallt, der wiederum vor Schreck an eine teure Vase stößt, die auf den Boden fällt und zu Bruch geht. Dass eine Vase in die Brüche gegangen ist, oder der Hausfrieden irgendwelcher Leute mit zu viel Zeit? Er hat da meistens nicht mitgelacht, nur aus Höflichkeit stumm gegrinst, und um nicht allzu prüde zu wirken. Die Kollegen haben ihn trotzdem für prüde gehalten. Gesagt haben sie es nie, aber sehr laut gedacht.
Vor dem Arbeitsamt gibt es genügend freie Parkplätze. Merten fährt geradewegs auf das Eingangsportal zu und parkt mit der Stoßstange zum Bürgersteig. Er steigt aus und sieht auf die Uhr, zehn vor acht, dann blinzelt er über den Weg zum Schild an der Amts Fassade, geöffnet ab Acht. Also setzt er sich wieder in den Wagen und wartet ab, den Blick an die Tür geheftet. Bis um zwei Minuten nach Acht jemand von innen öffnet. Merten verlässt sein Auto, das Einzige auf einer Parkplatz-Reihe von rund siebzig Metern und noch dazu ein nagelneuer Golf, und folgt dem Türöffner ins Innere des Gebäudes. Er ist offensichtlich der Erste. Drinnen, auch das kennt er bislang nur aus Fernsehfilmen, geht er zu einem Automaten mit einem großen, roten Pfeil darüber und drückt auf den Knopf. Ein Zettel mit einer 001 darauf wird ausgegeben.
Mit seiner Nummer in der Hand dreht er sich um, blickt durch den Raum und auf die verschiedenen Türen, die von ihm abgehen, und ein alter Mann mit enormer Wampe und berstender Knopfleiste weist ihm wortlos die Richtung zum Warteraum. Er geht hin und findet einen menschenleeren Saal vor, in dem in mehreren langen Reihen aus orangenen Plastikstühlen genügend Sitzplätze für mindestens dreihundert Leute sein müssen. Aber noch ist nicht ein Einziger da. Kaum dass er Platz genommen hat, erscheint auf einer Tafel über seinem Kopf mit lautem Klick seine Nummer 001 und die Platznummer Vierzehn. Sofort springt er auf, streicht seinen Mantel glatt und eilt zurück in den ersten Raum, schaut nochmal auf die Anzeigetafel und macht sich auf den Weg zu Platz Vierzehn.
Hinter einem großen Monitor, einem Stapel Akten und einem noch größeren Haufen von Porzellanfiguren niedlicher Tierchen hockt eine untersetzte Dame mittleren Alters mit tief auf die Nasenspitze gezogener Brille. Sie sieht ihn darüber hinweg knapp an, während er auf dem Stuhl vor ihrem Tisch Platz nimmt. Zu nah an der Rückwand des Tisches, seine Knie sind im Weg, darum rückt er umständlich ein Stück nach hinten. Dann räuspert er sich und presst die Worte durch seine Lippen, die er nie im Leben zu sagen geglaubt hätte.
„Guten Morgen. Mein Name ist Merten Hinterwald, ich bin soeben arbeitslos geworden und möchte sie…”
Die Beamtin aber unterbricht ihn jäh. „Tragen sie hier bitte ihren Namen ein und worum es geht, sie werden dann aufgerufen.“
Er sieht sie verdutzt an, füllt dann aber gehorsam den Zettel aus, gibt ihn ihr und geht zurück in den ersten Raum, auf den Wartesaal von eben zu. Der alte Mann korrigiert ihn mit einer Handbewegung:
„Da lang.“
Merten folgt seiner Weisung in einen langen, breiten Korridor mit vielen Türen und nur wenigen funktionierenden Neonleuchten an der Decke. Der Flur sieht aus wie der in einem Krankenhaus, es riecht nur anders. Aber auch nicht besser. Er setzt sich auf einen der Stühle, die überall zwischen den Zimmertüren stehen, die selben Plastikstühle wie auch bereits in dem ersten Warteraum.
Kaum, dass er sitzt, kommt ein paar Türen weiter ein Kopf zum Vorschein. „Herr Hinterwald?“ Er steht auf und betritt das kleine Büro der jungen Frau, die ihn aufgerufen hat. Auf dem Fensterbrett stehen gelbe Chrysanthemen, an den Wänden hängen Kinderfotos und selbstgemalte Bilder. Die geschäftig dreinschauende Dame, die da in einer Strickjacke am Schreibtisch sitzt, sieht aus wie eine Hausfrau, die gerade ihre Einkaufsliste schreibt. Nichts in diesem Raum passt zu dem Flur da draußen. Hier hat sich jemand häuslich eingerichtet und auf einer Fläche von zehn Quadratmetern mehr offene Bekenntnisse zu seinem glücklichen Privatleben ausgestellt, es sich auch viel gemütlicher gemacht, als Merten in seiner gesamten Wohnung. Eigentlich fehlt nur noch ein Kaminfeuer.
Aber Frau Sonnenschein selbst erweckt nicht unbedingt den Eindruck, eine Frohnatur zu sein. Sie lächelt ihn mit dem äußersten Minimum einer um Freundlichkeit bemühten Mundwinkelregung an:
„Was kann ich für sie tun?“
„Guten Morgen. Mein Name ist Merten Hinterwald. Ich bin gerade arbeitslos geworden und möchte mich bei ihnen nach einer neuen Stelle erkundigen.“
“Haben sie ihr Kündigungsschreiben dabei? Und dann bräuchte ich noch ihren Personalausweis...“
Er kramt aus seiner Tasche den Personalausweis hervor und hält ihn hoch. „Ein Kündigungsschreiben habe ich bisher nicht.“
„Ein Kündigungsschreiben bekommen sie von ihrem ehemaligen
Arbeitgeber. Sie waren doch in einer Beschäftigung?“
„Ja, das heißt, ich bin, eigentlich. Noch.“
„Dann sind sie hier verkehrt. Solange sie sich in einer Anstellung befinden, haben sie keinen Anspruch auf Leistungen. Haben sie ein Kündigungsschreiben, Einkommensnachweise der letzten drei Monate, einen Personalausweis, ihren Mietvertrag, gegebenenfalls Versicherungsnachweise und aktuelle Kontoauszüge aller bestehenden Konten, melden sie sich wieder und ziehen draußen eine Nummer. Ich gebe ihnen für den Fall, dass sie einen Antrag stellen wollen, dieses Formular mit.“
„Gut. Dann... Auf Wiedersehen.“
Ein wenig irritiert und mit einem dicken Stapel chlorfrei gebleichtem Recyclingpapier unterm Arm, verlässt Merten das kleine Büro und findet seinen Weg an dem Trommelträger vorbei zurück auf die Straße. Er steigt in seinen Golf und fährt auf die nächste Hauptstraße. Auf die biegt er in Richtung seiner Wohnung ein. Der Himmel ist dunkelgrau angeschwollen und es beginnt zu regnen. Er schaltet den Scheibenwischer ein und fährt an der folgenden Abzweigung zu seiner Wohnung in Schönholz vorbei.
Pok, pok, pok, pok von den Scheibenwischern und ein dumpfes Prasseln des Regens auf seiner Windschutzscheibe. Der Weg führt ihn durch Niederschönhausen und auf die Landstraße raus nach Mühlenbeck. Immer geradeaus, wie in der Fahrschule, solange der Fahrlehrer nichts von Abbiegen gesagt hat. Der Regen wird stärker und die Häuser immer kleiner. Merten stellt die Scheibenwischanlage einen Gang höher.
Pokpok, pokpok, pokpok, und der Regen trommelt lauter und lauter auf dem Blech seines Autodachs. Von der Metropole ist nichts mehr zu sehen, nicht mehr Ost noch West, nur noch gewittergraue Wildnis. Die gerade Straße wird kurviger zwischen den Bauernschaften, Merten muss seine Fahrt verlangsamen und beugt sich angestrengt blinzelnd zum Lenkrad vor. Die Sicht ist beschissen. Scheiß Regen.
Als er gerade am grünen Ortsschild irgendeiner Bauernschaft vorbeigekommen ist, geht stotternd der Motor aus. Merten dreht ein paar Mal hin und her am Schlüssel, dann schaut er auf die Tankanzeige und schlägt mit beiden Handballen aufs Lenkrad. In seinem ganzen Leben als Autofahrer ist ihm das noch nicht passiert. Wie konnte er vergessen, zu tanken? Er steigt aus dem Wagen, knallt mit voller Wucht die Tür zu und lässt ihn mitten auf der Straße einfach stehen. Dann läuft er los in die dichte Wasserwand vor ihm, die Hände in den Taschen und den Nacken tief in den Kragen gezogen. Es muss wohl November sein.
Ein paar entschlossene Schritte erst, dann ein paar weitaus zögerlichere, dann bleibt er stehen und blickt sich um, starrt sein Auto an, als wollte er es überreden, ihn irgendwie doch noch nach Hause zu bringen. Zwecklos. Er stampft auf den Boden, dass der Matsch weit nach allen Seiten hoch spritzt, schreit seine mir nichts, dir nichts nutzlos gewordene Karre an und vollführt einen wahren Affentanz der Wut, doch dann ergibt er sich missmutig in sein Schicksal und marschiert los. Der Weg vor ihm sieht aus wie das Störbild einer Braunschen Bildröhre.
Merten senkt den Kopf und kneift die Augen bis auf einen kleinen Sehschlitz zu, um gerade noch die Straße zu erkennen. Eiskaltes Wasser läuft ihm binnen Sekunden den Rücken hinunter, seine Hosen sind schon nach wenigen Metern bleischwer und bei jedem Schritt muss er die Füße hörbar schmatzend aus dem Sumpf ziehen, der vorher einmal eine Straße war.
Nach einer Weile tauchen aus der Nebelwand schemenhaft die Gestalten von drei Milchkühen auf, die mit hängenden Köpfen im diffusen Schatten einer Eiche ausharren, reglos stehen sie da. Als er näher kommt, kann er deutlich ihre Euter sehen, bis zum Boden hängen sie und sind so berstend voll, dass ihm unwillkürlich die Frage kommt, warum wohl die Kühe dort stehen wie Ölgötzen. Wissen die etwa, dass es bei Gewitter unter freistehenden Bäumen nicht sicher ist? Sind fluchtbereit für den Fall eines Blitzeinschlags? Man weiss, Merten weiss, dass jedes Jahr etwa tausend Personen durch Blitze sterben, wobei sogar ungefähr 70% der vom Blitz getroffenen überleben, aber unter diesen schweigsamen Damen scheint es sich nicht herumgesprochen zu haben, dass es die Vierbeiner noch viel häufiger, vor allem viel häufiger tödlich trifft. Wegen ihrer Anatomie, aber auch, weil sie nicht zum Melken reingeholt werden, wenn man nicht einmal seinen Hund vor die Tür lässt. Statistik scheint nicht so ihr Ding zu sein.
Oder können sie einfach auf ihren prallen Eutern nicht sitzen? Das muss ja weh tun. Merten dreht sich noch ein letztes Mal nach seinem Fahrzeug um. Das ist aber schon längst außer Sichtweite. Zurückzugehen, um pitschnass darin zu sitzen und darauf zu warten, dass ein Berliner bei dem Mistwetter aussteigt und freundlich Hilfe leistet, wäre bodenloser Schwachsinn. Eine Tankstelle war auf der Fahrt hierher weit und breit nicht zu sehen gewesen. Nach Hause ist es noch mindestens ein Tagesmarsch. Ein Handy hat er aus Prinzip nicht. Nie gehabt. Jetzt wäre es wahrscheinlich hilfreich, nicht so viele unnötige Prinzipien zu haben. Er senkt den Kopf, wendet sich wieder nach der Richtung, aus der er gekommen ist, und setzt dann doch seinen Marsch fort. Schwere Tropfen hämmern ihm auf den Schädel und es kommt ihm vor, als würde das Geräusch immer lauter. Ein Geräusch ohne jeden erkennbaren Rhythmus.
Nach und nach erscheinen im Rauschen des Störbildes schattenartige Formen, sie erinnern an Gesichter. Das Hämmern der Tropfenschläge in seinem Kopf wirkt wie ein Halluzinogen; künstlich hervorgerufen ist das bekanntlich auch durchaus mal eine beliebte Foltermethode bei kommunistischen Diktatoren. Die Gesichter im Regen erscheinen ihm vertraut. Er kann fast ihre Stimmen hören. Wahrscheinlich ist es nur die Erinnerung an ihre Stimmen. An Marie, seine kleine Schwester. Wie sie ihm vorhält:
“Merten, es ist so, so wichtig, im Leben ein paar gute Freunde zu haben. Was wär ich ohne meine Mädels? Also, ich jedenfalls könnte nicht ohne meine Truppe, wir haben SO viel Spaß und es ist immer jemand da, wenn du mal wen brauchst. Du machst doch gar keinen so unüblen Eindruck. Zumindest nachts im Dunkeln.”
Und wie sie lacht..! “Im Ernst, Merten, was ist eigentlich mit dieser... wie heißt sie noch? Deine Kollegin von der Arbeit. Die war doch ganz lustig, also ich hab mich super mit der verstanden.
Sie hat mich ja sogar eingeladen, demnächst mit in ihren Pilates-Kurs zu kommen. Oder dieser Dirk, der Bursche ist doch ein echter Kracher. Mit dem solltest du wirklich mal was unternehmen. Der kommt doch mit dir auch ganz gut klar, wie´s scheint.”
Hätte er sie doch nur nicht, in Ermangelung einer Ehefrau, zur letzten Weihnachtsfeier mitgenommen. Wenn die Freundin volltrunken mit dem Chef rumgeknutscht, kann man immer noch behaupten, das war ein flüchtiges Abenteuer. Nicht viel passiert, nur zwei Zungen, die sich im Vollrausch verlaufen haben. Die Zunge des Chefs im Mund der Schwester bleibt für immer.
“Jedenfalls solltest du echt mal was machen. Oder glaubst du, dass extra für dich jemand den Traumfrauen-Lieferservice erfindet? Ist ja nicht so, dass du eine Putzfrau brauchst, aber vielleicht gibt es eine Putzfrau, ja oder halt irgendeine bestimmt ganz tolle Frau, die dich braucht, das wollte ich nur sagen. Nimm es mir nicht übel. Ich kann ja auch nur von mir selber schließen.”
“Ich kann nur von mir selber schließen”, das bedeutet doch nichts anderes als “Ich kann mir kein anderes Lebensmodell als mein eigenes vorstellen und du tust mir leid, aber ich halte dich leider für einen Idioten”. Das bedeutet “Du wirst schon wissen, was du tust".
Oder: “Was kann ich daran ändern, dass du anscheinend für den Rest deines Lebens eine kümmerliche Mimose bleiben wirst. Sag nur nicht hinterher, ich hätte es dir nicht gesagt.”
Marie mit all ihrem Mitgefühl und Erbarmen und guten Ratschlägen. Im Grunde will sie damit doch nur zeigen, wie himmelweit sie über ihm steht. Das Gesicht der ollen Schwester schwimmt im Nebel vor ihm hin und her zwischen hämischem Grinsen und dem Ausdruck mitleidsvoller Fürsorglichkeit, bis es endlich verblasst. Doch sogleich laufen vor ihm im Nebel die Regentropfen in einem Bild zusammen, das aussieht wie die Visage von seinem Chef, wie er ihn steif bis zum Gesichtskrampf angrinst, mit Schweiß auf der Stirn, aufdringlich nach Aftershave stinkend. Es ist, als könnte Merten ihn hören: Mein lieber, lieber Herr Hinterwald, ich bin mir sicher, dass ganz besonders sie Verständnis haben werden, sie kennen unser Haus lange genug, um zu wissen, dass wir alle hier schon weitaus bessere Zeiten gesehen haben. Die Lage ist ernst, für uns alle ist sie das, wir sitzen alle in einem Boot. Nun müssen wir alles Erforderliche tun, damit es nicht untergeht, und mit ihm die Zukunft aller seiner Mitarbeiter. Bei dem Gedanken kommt ihm fast die Galle hoch.
Lieber, lieber Herr Hinterwald. Dass ich nicht lache. Warum sagen die Menschen eigentlich immer das genaue Gegenteil von dem, was sie meinen? Tritt dir einer in die Fresse und nennt dich mein Lieber. Der hätte mich doch auch einfach kündigen können, von mir aus schriftlich, und ich hätte das erstmal in Ruhe verdauen können. Warum zum Teufel muss ich mir zu allem Übel auch noch diesen ganzen Unsinn anhören? Er fühlt sich benommen, wie betäubt von der Monotonie des hämmernden Regens. Er hat das Gefühl, nicht mehr klar denken zu können. Als würde er schwimmen, und seine Gedanken schwimmen ihm davon. Und er hat immer so klar denken können, war immer der Sachliche, Ruhige, auf dem Boden der Tatsachen. Nicht selten ist er der Einzige, der die Nerven behält. Das war schon in seiner Kindheit so.
Wie in jeder Familie haben sich seine Eltern manchmal gestritten, dass die Fetzen flogen. Da galt es, Ruhe zu bewahren, sonst war man ganz schnell der Nächste an der Reihe, übel angeschnauzt zu werden. Und als seine Schwester in die Pubertät kam und sich alles im Haus nur noch um ihre apokalyptischen Launen drehte, behielt er als Letzter den Überblick.
Er wusste ganz genau, was kommen würde, wenn sie morgens länger als sonst das Bad besetzte, dann schließlich mit vom Mitesser Ausdrücken rot geschwollener Nase heraus gestürmt kam und alles über den Haufen rannte, das sich ihr in den Weg stellte. Und er wusste ganz genau, wann man besser in Deckung ging. Alle in seiner Familie sind impulsive Naturen.
Sein Vater, der trotz aller Verachtung für die Strenge seines eigenen Vaters genau dieselbe Karriere eines Tyrannen unweigerlich antreten und voll in die vorgesehenen Fußstapfen stolpern musste. Er war sicher nie von seinem eigenen Erziehungsstil überzeugt, aber einmal in der Misere, hat er wohl für seine Integrität keine Rettung mehr gesehen, als einfach so weiterzumachen, wie er einmal begonnen hatte. Und seine Mutter, ewig unsicher, immer auf der Suche nach einem neuen Ideal, die auch schnell mal das schönste Gebilde selbstgemachter Idylle in einem einzigen Wutanfall abreißen und verzweifelt nach etwas Neuem schreien konnte – wofür dann Vater meistens zu sorgen hatte. Da konnte es gut mal vorkommen dass sie, fröhlich zu einer ihrer Sixties-Platten mitsingend, Kuchen für den anstehenden Besuch der Nachbarn gebacken hatte, und dann plötzlich wie aus heiterem Himmel in einem einzigen tobsüchtigen Ausbruch die halbe Küche zerlegt hat. Weil der Kuchen angebrannt war.
An solchen alltäglichen Katastrophen war grundsätzlich der erste schuld, den sie zu packen kriegte. Und so waren es meistens Vater oder Marie, die unter dem Krakele der Mutter losfahren und schnellstens neue Backzutaten besorgen mussten, während Merten still in seinem Zimmer saß und sich aus der Schusslinie hielt. Er hatte ein sicheres, beinahe hellseherisches Gespür dafür, welche Szene auf welches Geräusch folgen würde und hätte den Teufel getan, sich blicken zu lassen, wenn aus der Küche mal wieder ein Lärm zu hören war, als wäre in einer Irrenanstalt der Fernseher ausgefallen. Und gewundert hat er sich irgendwann nur noch darüber, dass es seine Mutter nicht lassen konnte, sich immer wieder mit ungewohnten Situationen anzulegen, wo sie doch nur in dem wirklich gut war, was auf ihrer normalen Tagesordnung stand.
Die Schlimmste von Allen war Marie, aber ausgerechnet die macht heute ihre Sache sehr gut, soweit Merten das beurteilen kann. Als Mutter ist sie endlos geduldig, fürsorglich und nimmt ihre Aufgabe manchmal eher etwas zu ernst. Man möchte kaum glauben, was die früher für eine Furie war. Zuweilen konnte sie vollkommen hysterisch werden, dann ist sie wild schreiend und stampfend durch die Gegend gerannt, hat Türen geknallt und gewütet, dass man es mit der Angst zu tun bekam. Dabei wusste selten irgendjemand, was nun wieder vorgefallen war. Und irgendwann nahm das auch niemand mehr wirklich ernst.
Vielleicht hat sie es deswegen irgendwann gelassen, alle in den Wahnsinn zu treiben. Und vielleicht ist es deswegen auch in Wahrheit am Ende sie, die vielleicht doch irgendwie einsam ist. Jedenfalls ist sie nichts Besonderes. Merten kneift die Augen fester zusammen, kämpft gegen die einschläfernde Wirkung des dumpfen Prasselns auf seiner Stirn an und konzentriert sich darauf, zwischen den Figuren, die der Regen in die hochschwangere Luft malt, die Straße zu erkennen.
Solche Schwierigkeiten hatten Herr und Frau Hinterwald mit ihm nie. Er war als Kind das, was man auffällig unauffällig hätte nennen können.
Später dann war er wohl einfach nur noch unauffällig. Still, zufrieden und mit beiden Beinen fest auf dem Teppich. Für viele ein Langweiler, in dessen Nähe man sich lieber nicht für einen Joint auf dem Pausenhof verabreden wollte, weil bei ihm niemand so recht wusste, auf welcher Seite er stand. Und tatsächlich hätte er bei so etwas im Traum nicht mitgemacht. Auch in seiner Ausbildungszeit und als Erwachsener mit den Kollegen einen trinken zu gehen, wäre für ihn sinnlose Vernichtung von Zeit und Gehirnzellen gewesen. Abgesehen davon haben sie ihn nie eingeladen. Und woran das auch immer gelegen haben mag, er fand, er konnte nur zufrieden damit sein, seine sechs Sinne beisammenzuhalten. Wenn es doch nur nicht so kalt wäre.
Merten kann sich nicht entscheiden, was ihm mehr gegen den Strich geht: Das quälend eintönige Getrommel des fallenden Regens oder die schneidende Kälte, die ihm Gesicht und Ohren einfriert und jeden Muskel allmählich erstarren lässt. Und es nimmt kein Ende, als wollte es bis zum jüngsten Gericht weiter regnen und der Weg noch mindestens bis in die siebte Hölle führen. Mühsam schleppt sich die dunkle Gestalt voran, mal taumelnd, mal eilend, durch das feuchte Dickicht des Unwetters. In der Ferne donnert und grollt es, hin und wieder zuckt ein Blitz über den grauen Himmel. Aber das Gewitter tobt nicht an einer bestimmten Stelle, so dass man sagen könnte, woher es kommt und wohin es geht.
Vielleicht ist es an einer Stelle, aber dann wäre das wohl ungefähr Brandenburg.
Die Straße hat sich in einen reißenden Fluss verwandelt, in dessen Bett Schlaglöcher und ausreichend andere Stolperfallen heimtückisch lauern, um endgültig schlechte Laune aufkommen zu lassen.
Einmal kann Merten sich nur mit einem bühnenreifen Dreifach-Schritt, mehr geflogen als gegangen, vor einer näherem Bekanntschaft seiner Nase mit dem Asphalt retten. Aber er fängt sich, dreht sich nach dem Hindernis um, als wollte er sich beschweren und sieht nichts, als bächeweise Wasser. Dann wendet er sich wieder zurück, dann wieder um und dreht sich langsam ein paar Male im Kreis. Er bleibt einen Moment stehen und schaut in die Gegend, oder was von ihr zu erkennen ist, blickt sich nach allen Seiten um und brüllt schließlich laut, so laut er nur kann:
„Scheisse!!!“ Da ist nichts, und abgesehen von den zwei Autos, die in all der Zeit vorbeigekommen sind – falls er sich die nicht eingebildet hat – gibt es hier gar nichts außer höhnenden Gesichtern, Projektionen des Wahnsinns, und Wasser. Der Schatten eines Pferdes galoppiert vor ihm durch das Rauschbild, er wischt es gleich wieder weg. Da muss man ja bekloppt werden. Ist wohl nicht mein Tag heute. So eine Scheiße. Scheiße!
„Scheiße!“, schreit er den Gedanken laut heraus. Er schüttelt den Kopf und wischt sich das eisige Rinnsal aus dem Gesicht, die Gestalten verschwinden. Das Wasser dagegen tropft sofort wieder an seiner Stirn und Nase runter, er hält sich mit verkrampfter Hand den hochgeklappten, nasskalten Kragen seiner zentnerschwer durchtränkten Wolljacke fest um den Hals. Ein Gebäude wird sichtbar. Es ist eine Tankstelle. Die muss er übersehen haben. Oder bin ich hier gar nicht hergekommen, fragt er sich, hab ich denn überhaupt eine Ahnung, wo ich bin? Als er dann nach schier endloser Wanderung aber doch tatsächlich die richtige Stadt erreicht, lässt der Regen allmählich nach. Der Betrieb auf den Straßen holt Merten langsam in die gute, alte Realität zurück, er beobachtet die Autos, die an ihm vorbeifahren.