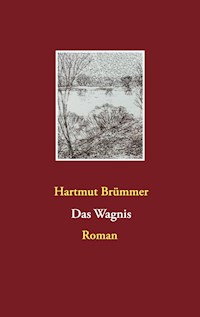Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paul hat alles verloren: Arbeit, Frau, Wohnung, Freunde. Auf das in der Ehe gemeinsam geführte Bankkonto hat er keinen Zugriff mehr, dafür hat seine Frau, die ihn scheinbar grundlos plötzlich verlassen hat, gesorgt. Seine Taschen sind leer, so leer wie auch sein Kopf, in dem kein Gedanke verfangen will, wie er aus dieser Situation herauskommen kann. Antriebsarm begibt er sich auf die Suche nach einer Bleibe, landet schließlich auf der Straße. Hier trifft er auf Georg, einen Mann, den ein ähnliches Schicksal ereilt hat. Die beiden Männer raufen sich zusammen, so gut es geht. Paul gerät mehr und mehr auf die schiefe Bahn, während Georg sich seinen Aufzeichnungen widmet, die er »Straßenbilder« nennt. Aus dem Zweckbündnis dieses ungleichen Paares erwachsen mit der Zeit kleine wechselseitige Abhängigkeiten, die ihr Leben auf der Straße ein klein wenig erträglicher erscheinen lassen. Das Zusammenleben der beiden Männer findet abrupt ein tragisches Ende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Paul hat alles verloren: Arbeit, Frau, Wohnung, Freunde. Seine Taschen sind leer, so leer wie auch sein Kopf, in dem kein Gedanke verfangen will, wie er aus dieser Situation herauskommen kann. Antriebsarm begibt er sich auf die Suche nach einer Bleibe, landet schließlich auf der Straße. Hier trifft er auf Georg, einen Mann, den ein ähnliches Schicksal ereilt hat.
Die beiden Männer raufen sich zusammen, so gut es geht. Paul gerät mehr und mehr auf die schiefe Bahn, während Georg sich seinen Aufzeichnungen widmet, die er »Straßenbilder« nennt. Das Zusammenleben der beiden Männer findet jedoch abrupt ein tragisches Ende.
Der Autor
Hartmut Brümmer hat nach dem Studium der Sprachen Russisch und Tschechisch an der Berliner Humboldt-Universität viele Jahre als Übersetzer vor allem auf dem Gebiet Technik gearbeitet. Seine Lebensstationen waren Berlin, Frankfurt a. M., Hamburg, Lüneburg.
Seit seiner Pensionierung widmet er sich verstärkt seiner Tätigkeit als Autor literarischer Texte. Von ihm erschienen sind bisher die beiden Romane »Unkenstimmen« und »Das Wagnis« sowie der Erzählband »Heimkehr des verlorenen Vaters«.
Brümmer beleuchtet in seinen Büchern facettenreich Schicksale, wie sie sich aus zwischenmenschlichen Beziehungen zuweilen zwangsläufig ergeben.
Heute lebt und arbeitet Brümmer in einer Dorfgemeinde in der Nähe von Lüneburg.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
1
Als Hedwig den Paul heiratete, konnte sie nicht ahnen, wen sie sich da eingefangen hatte. Die Liebe war auf beiden Seiten groß, keiner tat einen Schritt ohne den anderen. Und was groß ist, wird ewig halten, dachte sie. Sie wollte eine Hochzeit »mit allen Drum und Dran«. Sie bestand auf einem Brautkranz aus weißen Blüten, und geschlossen sollte er sein, das auf jeden Fall, wenngleich von Geschlossenheit schon lange nicht mehr die Rede sein konnte. Unter dem Jubel der Gäste trug Paul seine Braut am Hochzeitsabend auf Händen ins nunmehr eheliche Schlafzimmer, die Nacht währte bis in die frühen Mittagsstunden des darauffolgenden Tages.
»Ist er nicht süß?«, buhlte sie bei ihrer Schwester Selma um Zustimmung zu ihrer Wahl. Selma gab keinen Kommentar von sich. Sie nahm Hedwigs angetrauten Mann näher in Augenschein und fragte sich, was sie an dem nur habe. Ist etwas spillerig, befand sie. Sein nervöses Augenzucken fand sie nervig, wenngleich, das musste auch sie zugeben, unter dem Gezucke große tiefblaue Augen lagen, die auch sie als schön, wenn nicht gar anziehend empfand. Ein See, ein tiefes Wasser, in das man tauchen möchte, dem man aber auch nicht bedingungslos trauen sollte.
Und so entschied sie: blau und falsch.
Nach nicht einmal zwei Wochen Ehe machte Paul ihr die ersten Avancen. Darüber bewahrte sie ihrer Schwester gegenüber Stillschweigen. Paul gab sich nach dreisten Annäherungsversuchen, die im unverfrorenen Griff unter ihren Rock gipfelten, geschlagen. Sie wies ihn brüsk von sich. Sie solle sich nur nicht so haben, reagierte er mit düsterem Blick auf ihre Entrüstung und beließ es bei diesem einen Übergriff. Vorerst. So ganz konnte er sich von der Vorstellung, die Schwester seiner angetrauten Frau ins Bett zu holen, noch immer nicht verabschieden.
Hedwig hatte so ihre Ahnungen, diffuse Gedanken wirbelten durch ihren Kopf. Selmas verhaltene Seufzer, sobald Paul in ihrer Nähe war, ihre fahrigen Hände, das Flackern in ihren Augen, all das konnte ihr nicht entgehen, und so stellte sie eines Tages ihre Schwester zur Rede. Es gelang Selma, Hedwig mehr schlecht als recht von ihrer Unschuld zu überzeugen. Was ihr Selma allerdings nicht gestand: Sie war zunehmend fasziniert von Pauls dunklem Augenblau, in ihrem Innern brodelte der heftige Wunsch, sich besinnungslos in diesen See zu stürzen, es kostete sie einiges an Widerstandskraft, sich diesem Sog zu entziehen. Seine Schmalheit störte sie nun auch nicht mehr. Ein zartes Hähnchen, befand sie, und in ihren Träumen empfand sie eitel Lust, an seinen Knöchelchen zu knabbern. Sein Geturtel brachte sie zunehmend in Bedrängnis. Sie litt. Sie haderte mit dem Gott, an den sie glaubte: Wie konnte er es nur wagen, sie derart in Versuchung zu führen. Allen inneren Widerständen zum Trotz hegte sie die Vorstellung, so attraktiv wie nur irgend möglich bleiben zu müssen, auf jeden Fall attraktiver als ihre Schwester, seine Ehefrau, wenigstens diesen Triumph wollte sie in ihrer stummen Duldsamkeit davontragen. Sie magerte ab. Sich schlank halten, das wollte sie. Doch mit zunehmender Magerkeit ebbte Pauls Bemühen um sie ab. Sie hielt sein geschrumpftes Interesse für rücksichtsvolle Zurückhaltung.
Jetzt war sie es, die ihn umgarnte. Mal mit Worten wie diesen: »Was hat doch meine Schwester für ein Glück gehabt mit dir.« Oder, unverhohlener: »Geteiltes Glück ist doppeltes Glück.« Paul verstand, schritt aber nicht zur Tat.
»Habe ich es doch geahnt«, war einer von Hedwigs Lieblingssätzen. Ihre Ahnungen, dass ihre Schwester es mit ihrem Paul treibe, zerstoben angesichts des inneren und äußeren Verfalls, den sie bei ihr wahrgenommen hatte. Und so hatte sie auch geahnt, dass ihrer Schwester kein langes Leben beschieden sein werde. »Du isst zu wenig«, hielt sie ihr vor. Und tatsächlich wurde Selma von Monat zu Monat weniger, wenn nicht gar von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag. »Durchscheinend«, befand Hedwig. »Wenn das so weitergeht, kann man bald das Vaterunser durch dich hindurchpusten.« Selma starb dünn. »Filigran«, bemerkte Hedwig beschönigend. Selma hatte knapp vierzig Jahre überschritten und knapp fünfzehn Kilo ihres Normalgewichts unterschritten. Zu Tode gehungert, wurde gemunkelt. Andere sagten, zu Tode verzehrt, wonach auch immer. Doch sich verzehren, wie sollte das gehen? Steckte hinter diesem Verzehren nicht auch der Kummer um den Verlust ihres Freundes, von dem man irgendwann einmal gehört hatte und an den sie die Hoffnung auf ein dauerhaftes Zusammenleben über Jahre hinweg geknüpft hatte? Diesem schemenhaften Freund war die Liebe abhandengekommen, und somit ihr die Hoffnung. Paul war eine Art Nachklang dieser Liebe, ein Dessert, von dem sie nie gekostet hatte. Sie schied dahin als ein Schemen, ein Licht, das ausgepustet wurde.
Auch angesichts des Todes ihrer Schwester sagte Hedwig: »Ich habe es geahnt.« Sie hatte Selma geliebt, auf ihre Weise, wie nun mal Schwestern sich untereinander lieben können. Trotz aller amourösen Verunsicherungen, die sie ihr bereitet hatte.
Nun hatte sie keine Schwester mehr. Auch ihre Eltern hatten sich bald nach ihrer Hochzeit und viel zu früh für immer verabschiedet. In der Trauer hatten die beiden einander getröstet, hatte doch die eine jeweils die andere für sich. Etwas wird gut ausgehen, etwas wird böse ausgehen – und so deutete Hedwig jetzt auch das Hinscheiden ihrer Schwester als bösen Ausgang, sie hatte es geahnt.
Nicht geahnt hatte sie ihre fristlose Entlassung bei Henschel & Co., einem Getränkevertrieb für alles, was trinkbar ist. Hedwig bediente dort die Kasse. Zunächst halbtags und auf Probe, sie mache ihre Sache gut, sagte ihr Chef, und so wurde aus halbtags ganztags. Bei Bedarf saß sie auch hin und wieder über die offizielle Öffnungszeit hinaus zum Kassensturz hinter der Kasse auf diesem vermaledeiten Drehstuhl, dessen Lehne durch die jahrelange Benutzung nach hinten wegkippte und nicht mehr ihre Funktion erfüllte. Anlehnen konnte Hedwig sich jedenfalls nicht mehr, und so verbrachte sie dort auf diesem Thron ohne Rückenstütze ihre langen Dienststunden, die ihr gegen Feierabend meldeten, wo sich ihr Kreuz befand. Hedwig entschädigte sich mit kleinen »Unregelmäßigkeiten«, wie sie es für sich nannte, in der Annahme, Henschel & Co. werde das schon nicht merken. Die Kasse musste am Ende des Arbeitstages stimmen, doch Hedwig hatte so ihre kleinen Tricks. Die Kasse stimmte auch, wenn man ab und zu einzelne Artikel kassierte, ohne den Betrag einzugeben. So machten es die meisten. Hin und wieder ließ sie auch ein Fläschchen (für sie war jede Flasche ein Fläschchen, gleich welcher Größe) mitgehen – für ihren Paul, der nicht danach fragte, ob dieses Fläschchen ehrlich erworben war. Ihn interessierte lediglich der Inhalt.
»Von irgendwas muss der Mensch doch schließlich leben«, rechtfertigte er seinen Alkoholkonsum. Seine Arbeit als Bäcker hatte er vor weit zurückliegenden, besser »vielen« Monaten, wenn nicht gar Jahren, aufgegeben. »Meine Mehlallergie macht mir zu schaffen«, hatte er geklagt. Hatte er geahnt oder gar einkalkuliert, wie schwierig es sein würde, ihn in seinem Bäckerberuf neu zu vermitteln?
»Ohne Mehl geht es nun mal nicht«, wurde ihm bei jeder neuen Bewerbung auch von Amts wegen entgegengehalten. Er hatte es mit anderen Arbeiten versucht. Die Lachnummer für ihn war das Angebot eines Mühlenbetriebs. »Die vom Center haben absolut keine Ahnung«, mit diesem Kommentar tat er auch die Mühle ad acta.
Hedwig kannte seine Gereiztheit, wenn sie ihn auf sein tatenloses Vor-sich-hin-Dämmern ansprach. Sie solle doch froh sein, dass wenigstens sie einen Job habe, reagierte er. Und ansonsten: »Sind wir denn nicht verheiratet? Gehören wir denn nicht zusammen, in guten wie in schweren Tagen? Na also.«
Wie es denn nur weitergehen solle, wagte sie kleinlaut einzuwenden. »Ich ahne nichts Gutes.«
Was nun Hedwig nicht ahnte, ahnte Henschel und Co. Aus dem Stand heraus wurde ihr glasklar und unumkehrbar kundgetan, sie sei entlassen. Hedwig rang nach Luft und Rechtfertigungen für das, was ihr, wie sie meinte, unterstellt wurde. Sie hielt die vorgehaltenen Diebereien und die Selbstbedienung aus der Kasse für Unterstellungen. »Dafür gibt es überhaupt keinen einzigen Beweis.« Wie ein geprügelter Hund schlich sie nach Hause, schüttelte unentwegt und verständnislos den Kopf. Was habe ich schon Schlimmes getan.
Hedwigs Mann Paul saß auf dem Sofa vor laufendem Fernseher. Als Hedwig ins Zimmer trat, traf sie sein kurzer Blick, der für Minuten wie ein Fragezeichen im Raum hing. Sie zuckte mit den Achseln und er hatte verstanden. Keine Flasche, kein Seelentröster. Auch dazu ist sie nun nicht mehr zu gebrauchen, sagte sein unruhiges Geruschel. Er verschränkte seine Arme vor der Brust, streckte die gespreizten Beine weit von sich, seinen Kopf drückte er gegen die Sofalehne.
»Komm her!«, zischte er.
»Lass das!«, reagierte sie. »Ist doch immer dasselbe. Ich hatte einen langen Arbeitstag.«
Paul schlug die Beine übereinander. Jetzt kriegt er wieder seinen dicken Hals, ahnte Hedwig. Wenn der so weit anschwillt, dass die Adern zu zerplatzen drohen, habe ich schlechte Karten, das kannte sie von ihrem Paul. Helfen kann hier nur noch sein Fläschchen, nach dem er schreit wie der Säugling nach der Brust. Aber heute gibt es kein Fläschchen, und überhaupt wird es nie wieder ein Stillfläschchen von mir geben. Sie war verzweifelt. Sie überlegte krampfhaft, wie sie sich seiner Gereiztheit entziehen sollte.
»Na komm schon!«, rief er in bedrohlichem Befehlston aus seiner Sofaecke. Sie tat ein paar Schritte in seine Richtung. »Weiter! Mach schon, hab dich nicht so!« Sie setzte sich auf ihn, hob ihren Rock an, steckte sein Ding in ihre Öffnung, ließ ihn arbeiten. Sie hasste sein grinsendes Gesicht, das seiner Erleichterung folgte. Sie hätte in dieses Gesicht dreinschlagen können, mal rechts, mal links, immer heftiger. Dieses triumphierende Gegrinse wegschlagen bis zu seiner und ihrer Besinnungslosigkeit. Oder bis zur Besinnung: Was hast du aus uns gemacht, Paul? Und vor allem: Was hast du aus mir gemacht, eine Befriedigungsmaschine? Ein Loch, in dem du dir deinen Lebensfrust wegreibst?
Ja, ich bin ein Loch, so schwarz und auch so tief wie die Nacht. Und alles um mich herum ist nichts als ein Loch, in dem ich krabbeln kann, so viel ich will, ich komme nicht hinaus.
Danach, als sie die Einkaufstasche auspackte, spürte sie, wie er sie beobachtete. Lange würde sein Zustand der Zufriedenheit nicht vorhalten, da machte sie sich nichts vor. Eine Stunde Ruhe, wenn es hoch kommt, zwei, dann wird er munter, treibt mich zum Wahnsinn mit seinem Gewusel. Läuft in der Wohnung auf und ab wie der Tiger im Käfig. Am besten geht es mir, wenn er schläft, auch ihm geht es dann am besten. Aber er hat tagsüber genug geschlafen, was sonst tut er hier den lieben, langen Tag allein. Er wollte mein Fahrrad in Ordnung bringen, das Licht tut es nicht, die Handbremse auch nicht. Wollte. O ja, was er nicht schon alles wollte. Er wollte sich nach einer anderen Wohnung umsehen, raus aus diesem dunklen Loch hier, dieser Enge, ein Zimmer mehr täte uns beiden gut. Südseite, das wär’s. Tagsüber Sonne, große Fenster, die Vorhänge habe ich mir schon ausgedacht: Tüll, cremeweiß. Volants, wie Sabine sie hat, aber bei mir bitte etwas üppiger, Sabine wird staunen. Und, ach ja, die Küche. Immerzu muss ich vor Ungers Küchenausstatter stehen bleiben. Wie das alles blinkt und lockt. »Ungers Küchenzeile« – ein Traum. Plastikbeschläge kommen für mich nicht infrage, ich habe die Nase voll von diesem Kunststoffplunder. Am liebsten hätte ich Messing, aber da muss man so viel putzen. Unpraktisch. Sabine hat gebürsteten Edelstahl. Na gut, warum nicht. Vor allem aber: keine tropfenden Wasserhähne. Das Getropfe in unserer Uraltküche kann ich schon nicht mehr hören, auch die Dusche im Bad tropft vor sich hin, da kann ich scheuern, so viel ich will, den grünlichen Wasserstein kriege ich nicht mehr weg. Sieht er denn das nicht, hört denn nicht auch er dieses nervige Tropf-Tropf? Aber bei ihm ist mittlerweile scheinbar alles abgestumpft. Hört nichts, sieht nichts. Hat nur noch das Eine im Kopf. Und ich? Was eigentlich tue ich noch hier? Die Tage rinnen weg, und weg ist nun auch Henschel & Co. Das werde ich ihm nicht sagen, und ich werde ihn auch nicht fragen, wie es denn weitergehen soll, so ohne ein festes Einkommen, eine griffige Antwort hat er ohnehin nicht. Die Volants und die neue Küche? Die kann ich wohl in den Rauch schreiben. Ihm wäre das ohnehin egal, er fühlt sich wohl in dieser Wohnhöhle in seinem ausgebeulten Hausanzug. Hausanzug, dass ich nicht lache. Ich wollte dieses Ding waschen, wenigstens einmal nach hundert Jahren. Und was soll ich dann anziehen, wollte er mit weinerlicher Stimme wissen, wie ein kleines Kind, dem man das Lieblingsspielzeug wegnehmen will. Bleib du doch sitzen mit diesem Dingsda, ja, mach es dir gemütlich. Hausanzug und Fläschchen und hin und wieder mein Loch. Ist uns so der Weg vorgezeichnet? Soll das unser Leben sein?
Das Telefon klingelte, es war Sabine. Doch, doch, es gehe ihr gut, reagierte sie auf Sabines Frage nach ihrem Befinden. »Alles in Ordnung.«
Und dann sprudelte es aus ihr hervor: Wie der Arbeitstag verlaufen war, wie nett doch die Kunden zu ihr wieder gewesen waren.
»Der Laden brummt nur so. Und auch der Chef ist eigentlich ein feiner Mann, immer so etepetete.«
»Na, na«, sagte Sabine, »du bist doch nicht etwa …«
»Nicht was du denkst«, reagierte Hedwig. »Er ist mein Chef. Aber das eine oder andere wird man sich doch denken dürfen.« Sie sah vor ihrem geistigen Auge, wie Sabine schelmisch den Zeigefinger erhob. Das Gespräch glitt in eine Richtung, die sie so nicht haben wollte. Woher sollte Sabine auch wissen, dass der Etepetete-Chef sie heute vor die Tür gesetzt hatte? Sie ließ Sabines Flachserei am anderen Leitungsende freien Lauf. Nach langen Minuten Redeschwall unterbrach sie Sabine: Sie müsse ganz dringend noch etwas erledigen, sie werde zurückrufen, sobald sie könne. Sie legte den Hörer auf, sie spürte, wie ihre Ohren glühten. Sie würde nicht zurückrufen, jedenfalls nicht so bald.
2
Am nächsten Morgen verließ sie die Wohnung wie immer um halb acht. Zuvor hatte sie wie an jedem anderen Arbeitstag auch für Paul das Frühstück bereitgestellt. Den Kaffeepott mit dem Männchen machenden Pudel, sein Lieblingsstück, zwei Scheiben Brot, Butter, Marmelade, einen Zipfel Blutwurst, die er so sehr mochte. Paul, erschöpft von der langen Fernsehnacht, nahm ihr Fortgehen wie sonst auch an jedem anderen Arbeitstag nicht wahr, er lag schnarchend im Bett, hin und wieder entschlüpften seinem Mund ein paar gebrabbelte Laute.
Zu vorgerückter Stunde warf er die Bettdecke ab, schlurfte ins Bad, schlurfte zum Fenster, warf einen prüfenden Blick auf den Himmel, schlurfte in die Küche und verzehrte seine Blutwurst. Der Tag zog sich dahin im Nichtstun, das heißt, er verbrachte die meiste Zeit des Tages auf dem Sofa, was er, zu seiner Rechtfertigung, für Tätigkeit genug hielt. Denn was macht Hedwig anderes? Auch sie sitzt den lieben langen Tag. Der eine auf dem Stuhl, der andere auf dem Sofa.
Am Abend gegen sechs Uhr erhob sich Paul aus seiner Sofaecke, schlurfte wiederum ins Bad, schlug sein Wasser ab, warf einen Blick in den Spiegel, überlegte, ob er sich heute noch rasieren solle. Doch um sechs Uhr abends, wer tut denn so etwas?
Er blieb vor der Wohnungstür stehen, hielt sein linkes Ohr gegen die Tür, lauschte. Die Haustür fiel krachend ins Schloss. Er hielt den Atem an. Ist sie das? Er schlurfte zurück zum Sofa und wartete, dass der Schlüssel ins Schlüsselloch gesteckt würde. Aber die Tür öffnete sich nicht. Die Tür der Wohnung gegenüber wurde unsanft zugeschlagen, wie zuvor auch die Tür vom Hauseingang. Was sie nur wieder zu erledigen hat! Ihre Unpünktlichkeit konnte ihn in Rage bringen. Mal zehn Minuten mehr, mal fünfzehn, das Höchste, was sie sich erlaubte, war eine halbe Stunde »Verspätung«, wie er es nannte, wenn ihr Einkauf nach ihrem Kassenschluss sich hinzog, weil um diese Tageszeit im Supermarkt Hochbetrieb herrschte.
Um zwanzig nach sieben schlurfte er wiederum in die Küche, inspizierte den Kühlschrankinhalt, knallte den Kühlschrank missmutig zu, hangelte nach der Keksdose auf dem Bord oberhalb der Spüle, strauchelte, konnte sich aber fangen. Ein 10-Euro-Schein und ein paar Münzen, das war der ganze Doseninhalt. Er stellte die Dose wieder an ihren angestammten Platz zurück, denn er wusste, wie ungehalten sie reagieren konnte, wenn sie mitbekam, dass er in der Haushaltskasse, »ihrer Kasse«, wie sie sie nannte, herumgeschnüffelt hatte.
Mittlerweile war es zehn vor acht geworden. Spätestens zu den Fernsehnachrichten um acht wird sie hier sein, die Nachrichten lässt sie sich nicht entgehen, nie.
Um halb neun schlurfte er abermals zur Eingangstür, legte wieder ein Ohr gegen die Tür. Vom Treppenhaus her Stille, aus dem Hintergrund des Wohnzimmers krachten Colts vom Bildschirm. Verständnislos schüttelte er den Kopf, brummelte halblaut ein paar Unflätigkeiten vor sich hin, spürte, wie eine Wolke aus Wut sich überall in seinem Körper aufbaute, die ihn aufblähte wie einen Ballon, der jederzeit zu platzen drohte. Wenn sie jetzt reinkommt, kann sie was erleben! Doch sie kam nicht. Auch nicht um neun, nicht um zehn. Nach zehn Uhr fiel der Ballon in sich zusammen. Er bediente sich mit dem letzten Zipfel Blutwurst und der letzten Scheibe Brot, der letzten Dose Bier, ließ sich wieder in seiner Sofaecke nieder und stierte vor sich hin. Das Geschehen auf dem Bildschirm flackerte vor seinen Augen, ohne ihn zu berühren, er schaltete das Gerät ab. Halb elf. Wo vorher der Ballon war, war jetzt ein Vakuum. Sein ganzer Körper eine einzige leere Hülle. Auch sein Kopf war leer. Was sie nur noch da draußen treibt zu so später Stunde, versuchte er zu ergründen. Geht sie fremd? Ein aberwitziger Gedanke, den er so schnell strich, wie er aufgetaucht war.
Müde vom Warten legte er sich ins Bett.
Am folgenden Tag wachte er früher auf als gewohnt. Ihre Bettseite war unberührt. Weder ein eingedrücktes Kissen noch eine verrutschte Bettdecke. Ihr Nachthemd hing über der Stuhllehne, so, wie sie es gestern am Morgen nach dem Aufstehen hinterlassen hatte. Was war geschehen, was war ihr zugestoßen? Er hatte das Gefühl, sich nicht bewegen zu können. Nur langsam löste sich die Starre aus seinen Gliedern und seinem Kopf. Ein Unfall? Aber dann hätte sich jemand gemeldet – vom Rettungsdienst, von der Feuerwehr, vom Kreiskrankenhaus, von der Polizei. Doch die Klingel am Eingang blieb stumm, auch das Telefon verharrte in Stummheit. Er hob den Hörer ab, vergewisserte sich, ob die Leitung intakt sei. Ich sollte bei Henschel & Co. anrufen, überlegte er. Aber was frage ich? Ob meine Frau zur Arbeit erschienen ist? Tut man das, ruft man seiner Frau auf der Arbeitsstelle hinterher? Die feixenden Gesichter in ihrem Laden kann ich mir ersparen. Und überhaupt: Wenn sie dort nicht erschienen sein sollte, werden die ganz alleine von sich aus anrufen und sich nach ihrem Verbleib erkundigen.
Gegen neun Uhr rasierte er sich, kleidete sich sorgfältig an, setzte die Kappe mit den gekreuzten Golfschlägern auf dem Schild auf und verließ das Haus. Von dem 10-Euro-Schein kaufte er sich einen Ring Blutwurst, eine Packung Aufbackbrötchen und ein Minifläschchen Korn. Nach dem Laden lenkten ihn seine Schritte in Richtung Sparkasse zum Geldautomaten. Kein Guthaben auf dem Girokonto? Wie kann das sein, schüttelte er verständnislos den Kopf. Das ist doch die richtige Karte, das richtige Konto, ausgestellt auf uns beide, das Konto, auf das ihr Monatsgehalt überwiesen wird, regelmäßig, in diesem Punkt ist auf Henschel & Co. Verlass. Er wandte sich um, und da er sich von keinem beobachtet fühlte, startete er einen erneuten Versuch, sich Bargeld zu ziehen. Nichts. Sind wir blank, bin ich blank, schoss es ihm durch den Kopf. Werde ich auch an der Ladenkasse nicht mehr mit der Karte bezahlen können? Eine beklemmende Vorstellung. Doch vielleicht liegt hier ein Irrtum vor, eine Verwechslung, ein Fehler im System. Was hat doch die neumodische Bankenführung nicht alles schon für Schäden angerichtet, ich denke da nur an Lehman Brothers oder wie dieser amerikanische Pleiteladen hieß. Ein Nullkommanichtskonto, das kann ganz einfach nicht sein, kein einziger Cent. Er spürte, wie seine Knie weich wie Pudding wurden, sein Magen krampfte sich zusammen, die Umgebung verschwamm vor seinen Augen. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen! Als er sich gefangen hatte, betrat er den Schalterraum, legte die Bankkarte auf den Tresen und forderte den freundlich lächelnden Bankangestellten auf, die Angelegenheit zu klären. »Dieses Konto ist gesperrt, da kann ich nichts tun, leider.« Leider? Wer hat hier wann was gesperrt? »Da kann ich Ihnen keine Auskunft geben, hier ist ein Formular, wenn Sie das ausfüllen, wird man der Sache nachgehen, versprechen kann ich Ihnen nichts.«
Mit dem Formular in der Jackentasche verließ Paul die Bank. In der Wohnung begann er, den Kleiderschrank zu inspizieren. Er glaubte zu wissen, wo sie ihre heimlichen Ersparnisse gewöhnlich aufbewahrte, hinter der Bettwäsche in einem Kuvert, das vom vielen Aufund Zumachen schon ganz fadenscheinig geworden war. Voller Ungeduld zerrte er die Laken hervor, entfaltete sie, ließ sie auf den Boden fallen. Nichts. Er durchwühlte ihr Wäschefach, warf wütend Höschen und Büstenhalter über seine Schulter hinweg ins Zimmer. Kein Umschlag und somit auch kein Geld. Irritiert schaute er auf die herumliegenden Kleidungsstücke. Das räume ich nicht wieder ein, das soll sie doch machen, wenn sie wieder zu Hause ist, wer ist schließlich schuld an diesem Chaos hier? Weiß der Teufel, was sie im Schilde führt, wo sie stecken mag!