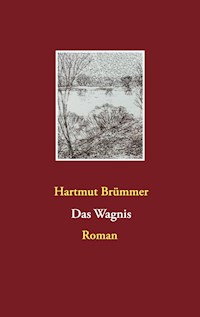6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"In der zurückliegenden Nacht hatte er um zwei Uhr das Bett verlassen, war in die Küche gegangen, hatte sich ein Bier aus dem Kühlschrank geholt und sich im Halbdunkel aufs Sofa gesetzt. Der Mond stand hoch und vollrund am Himmel, er erhellte den Garten hinterm Haus und warf kaltes Licht als breiten kalkweißen Streifen in das Wohnzimmer. Kein Laut. Eine Stille, die er, so empfand er es, hätte mit Händen greifen können." Durch einen mysteriösen Unfall hat Edgar Frau und Tochter verloren. Seither findet er keine innere Ruhe mehr, Nächte sind ihm ein Graus. In seiner Ratlosigkeit versucht er, bei seinem langjährigen Freund Verständnis und Zuspruch zu finden. Aber das Leben seines Freundes hat mittlerweile einen Weg eingeschlagen, der diesen immer tiefer in politische Kreise hineinzieht, an denen die Freundschaft zu zerbrechen droht. Selbstzweifel, Suche nach Lebenssinn, Träume, die sich nicht erfüllen, Liebe, die einen Scherbenhaufen hinterlässt - das sind die Gefühlswelten, in denen sich die Figuren dieses Romans bewegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zu diesem Buch
„In der zurückliegenden Nacht hatte er um zwei Uhr das Bett verlassen, war in die Küche gegangen, hatte sich ein Bier aus dem Kühlschrank geholt und sich im Halbdunkel aufs Sofa gesetzt. Der Mond stand hoch und vollrund am Himmel, er erhellte den Garten hinterm Haus und warf kaltes Licht als breiten kalkweißen Streifen in das Wohnzimmer. Kein Laut. Eine Stille, die er, so empfand er es, hätte mit Händen greifen können.“
Durch einen mysteriösen Unfall hat Edgar Frau und Tochter verloren. Seither findet er keine innere Ruhe mehr, Nächte sind ihm ein Graus. In seiner Ratlosigkeit versucht er, bei seinem langjährigen Freund Verständnis und Zuspruch zu finden. Aber das Leben seines Freundes hat mittlerweile einen Weg eingeschlagen, der diesen immer tiefer in politische Kreise hineinzieht, an denen die Freundschaft zu zerbrechen droht.
Selbstzweifel; Suche nach Lebenssinn; Träume, die sich nicht erfüllten; Liebe, die einen Scherbenhaufen hinterlässt – das sind die Gefühlswelten, in denen sich die Figuren dieses Romans bewegen.
Der Autor
Hartmut Brümmer hat seine Kindheit und Jugend in einem Dorf in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze verbracht. Das Studium der Sprachen Russisch und Tschechisch führte ihn nach Berlin. Dort arbeitete er als Dolmetscher und Übersetzer. Später ging er nach Frankfurt a. Main und übte dort seinen Übersetzerberuf vor allem im Bereich Technik und Technologie aus. Darauf folgte eine jahrelange freiberufliche Tätigkeit in Hamburg. Heute lebt er auf dem Lande in der Nähe von Lüneburg.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
1
Sein Freund Bruno hatte die Wohnung gewechselt. Nicht nur die Wohnung, auch den Wohnort. Was Edgar sehr bedauerte. Bruno war der einzige Mensch, dem er blind vertrauen konnte. Auch Bruno konnte Edgar blind vertrauen. Eine Freundschaft kann sehr intim sein, und vielleicht muss sie das auch. Bis zu einer gewissen Grenze natürlich. Denn wenn man alles offenlegt, ist das so eine Art innerer Ausverkauf. Einen letzten Rest Selbstbehalt sollte man sich bewahren, so Edgars Maxime. Abgesehen davon wusste Edgar mehr als jeder andere Mensch über Bruno, und auch Bruno wusste mehr als jeder andere über Edgar – bis auf jenes letzte Zipfelchen Selbstbehalt. Edgar wusste, würde er – oder Bruno – diesen Rest von sich preisgeben, liefe ihre Freundschaft ins Leere. Kein Geheimnis mehr, kein letzter intimer Winkel vom Ich, und sei er noch so klein. Das ist wie mit dem Ersparten: Hebt man alles ab, ist da nichts mehr. Null. »Ein bisschen Guthaben, muss ja nicht viel sein, sollte schon bleiben – für alle Fälle«, hätte Edgars Mutter gesagt, und da hätte sie mal wieder recht gehabt.
Mit Brunos neuer Wohnung war soweit alles in Ordnung: zwei Zimmer, Mini-Küche, Mini-Bad. Sogar einen Keller gab es, von dem er jedoch keinen Gebrauch machte.
»Günstig«, betonte Bruno, und er meinte kostengünstig. »Klein, aber für mich allein, da reicht das. Und dann dieser Blick, sieh dir das mal an!«
Edgar sah es sich an, und er musste zugeben, so einen schönen Ausblick hatte er aus seinem Nullachtfünfzehn-Häuschen am Stadtrand von Flensburg nicht. Ein bisschen Grün, das den Namen Rasen nicht verdiente, ein Pflaumenbaum, dessen Früchte er brüsk ablehnte, weil ihm der Anblick der gelben quirligen Würmchen im Fruchtfleisch Brechreiz verursachte. Neben dem Baum dümpelte die Schaukel. Er hätte sie längst abnehmen sollen. Das hatte ihm auch Bruno angeraten, aber Edgar konnte sich nicht dazu durchringen. Immer wenn die Schaukel im Wind hin- und herschwang, konnte er sich nicht von der Vorstellung losreißen, Lotte darauf sitzen zu sehen. Wie sie Schwung holte mit ihren nach innen gedrehten Beinchen. Ihr flatterndes Haar, das sie sich im Flug aus dem Gesicht strich und das aber doch wieder auf ihre vor Eifer glühenden Wangen zurückfiel. Sentimentales Zeug, natürlich. Es gibt diese Bilder tausendfach, wenn nicht gar millionenfach, und überall auf der Welt. Auch hier hast du recht, Bruno, dachte er. Sich losreißen. Wie lange schmerzt ein Riss? Er sollte die Schaukel entfernen. Und wenn sie sich nachts in seinen Träumen an ihm rächen würde, könnte er sie wieder dort anbringen, wo sie tagsüber ihr Unwesen trieb. So einfach könnten Lösungen aussehen.
Bruno wurde nicht müde, ihn auf die Details bis hin zum Horizont aufmerksam zu machen: »Und ganz dahinten dann der Wald, und in dem Wald ein See, na ja, mehr ein Teich, aber den sieht man von hier aus nicht.«
Womit er recht hatte.
»Wir sollten mal dorthin gehen. Der Teich ist nicht nur bloßes Wasser. Der Teich lebt, sogar Unken gibt es dort, ich selbst habe sie gehört, in der Dämmerung, zum Gänsehautkriegen.«
Doch was zum Teufel hatte Bruno hierher in dieses Nest gezogen? Die Aussicht? Die Nachbarn rechts waren ein Ehepaar mit zwei Kindern, von Bruno als deutscher Standard benannt. Links wohnte eine betagte Bauersfrau, die nicht nur von ihrem Mann und ihren Kindern, sondern auch – wie Bruno konstatierte – von allen guten Geistern verlassen war, denn sie machte einen wunderlichen Eindruck auf ihn. Wenngleich er sie zunächst ganz zugänglich, ja geradezu sympathisch fand. Wer er denn sei, wollte sie so über den Zaun gefragt wissen. Wie sollte er ihr ihre Direktheit nicht verzeihen? Was schon passierte hier draußen sonst um sie herum?
»Ach«, reagierte sie, nachdem er sie über sich informiert hatte. »Ich dachte schon …«
Ja, sie dachte schon. Wo viel Einsamkeit ist und auch viel Aussicht, bleibt viel Raum für Mutmaßungen.
»Von den Äpfeln können Sie nehmen so viel Sie wollen. Wer soll die denn sonst essen? Die Leute in der Stadt gehen in den Laden und holen sich dort diese abgepackten Dinger, die alle gleich schmecken. Ich habe extra ein Schild aufgestellt: ZUM MIT-NEHMEN! Nimmt aber niemand mit. Aber wen wundert es? Kommt so und so kaum einer vorbei.«
Nach hinten raus waren drei Pferde eingekoppelt, wodurch das Bild von der Romantik zu Romantik pur gesteigert wurde. Aber ein bisschen ruhig ist es schon, dachte Edgar beim Umrunden des Anwesens mit den himmelragenden Pappeln, den halbverfallenen Stallungen, dem altersschwachen Zaun. Käme man hier überhaupt ins Netz? Was, zum Teufel, hatte seinen Freund hierhergezogen?
»Die Post hier ist pünktlich«, betonte Bruno, »auf die kannst du dich verlassen.«
Na schön, dachte Edgar, die Post. Und sonst?
»Es gibt Orte, die sich für gewisse Aktivitäten ganz einfach von selbst anbieten, anders als, sagen wir mal, die großen Städte. Die Städter sind immer gleich aufmüpfig. Aber hier? Die Ruhe selbst.«
Edgars Gesicht war ein einziges Fragezeichen. Aktivitäten? Er konnte sich nicht erklären, was ihn hemmte, Bruno direkt zu fragen. Diese Hemmung war für ihn neu, sie irritierte ihn.
Was hast du vor, Bruno, was aktiviert dich?
Natürlich war Bruno nicht wirklich weg. Und doch war er nicht da – jedenfalls nicht dann, wenn man ihn brauchte, weg war die Spontaneität. Ein Straßenzug weiter war schon was anderes als vierzig Kilometer. Bei ihm klingeln, ob bei Tag oder in der Nacht, das konnte er bisher immer. Aber jetzt? Wer fährt schon schnell mal so mitten in der Nacht runter zur Treene, über vierzig Kilometer, nur um mal kurz zu klingeln? Wobei das kurz immer etwas länger wurde, auch mitten in der Nacht.
»Hast du wieder deine Anwandlungen?« Mit immer diesen Worten hatte er ihm die Wohnungstür geöffnet und sich die verquollenen Augen gerieben. Anwandlungen nannte er die Attacken auf Edgars Psyche, die ihn mitten in der Nacht überfallen konnten. »Ach was, du störst doch ganz und gar nicht!«
Eine Zeit lang war Edgar naiv genug zu glauben, dass er Bruno tatsächlich nicht störe, so mitten in der Nacht. Wer Probleme hat, neigt zum Egoismus.
»Nur nicht einigeln«, hatte Bruno ihm geraten. »Wir packen das.«
Wir hatte er gesagt, und dieses Wir hatte Edgar gutgetan. Doch jetzt war er fort. Vierzig Kilometer.
Bruno, musste es denn gleich so weit sein?
2
Diesmal kam der Angriff um zwei Uhr nachts. Er empfand die Traumattacken als Angriff. Ihnen vorausgegangen waren Bilder, mit denen er nichts anzufangen wusste: Ein übergroßes Lastauto, das nicht von der Stelle kam, dessen Räder durchdrehten, wenngleich die Fahrbahn gar nicht rutschig war. Kein Glatteis, keine Ölspur, auch kein Rollsplitt. Er hatte genau hingesehen, sich gebückt, um die Straßendecke zu prüfen, hatte sie sogar mit der Hand berührt, an ihr gerochen. Kein Krümelchen, kein verräterischer Geruch. Nichts. Die Räder standen nicht still, aber sie bewegten das Fahrzeug nicht, weder vorwärts noch rückwärts. Er wusste nicht einmal, ob im Führerhaus überhaupt ein Kraftfahrer saß. Es schien ihm auch zu hoch, um hineinschauen zu können. Ratlos stand er am Straßenrand, hielt Ausschau nach einem Menschen, der hätte helfen können. Statt eines Menschen tauchte ein Tier am Horizont auf. Es näherte sich mit tastenden Schritten. War es ein streunender Hund, ein Fuchs, gar ein Wolf? Das Tier bewegte sich mit gesenktem Kopf auf ihn zu, hielt die Nase vorgestreckt, witterte. Der blubbernde Motor schien es nicht zu stören, denn sein Ziel war nicht das Fahrzeug – sondern Edgar. Das spürte er bis in die Zehenspitzen, das musste ihm niemand signalisieren, niemand erklären, das Gefühl war ganz einfach da, es bohrte sich in seine Eingeweide, bis sie vor Spannung zu zerreißen drohten.
Das Erwachen war zunächst wie Erlösung. Er machte Licht und vergewisserte sich, ob im Zimmer alles an der gewohnten Stelle vorhanden war. Doch was sollte sich während der ersten zwei Stunden Schlaf verändert haben? Der Stuhl mit den abgelegten Kleidern, die Kommode mit den Fotos von Luise, seiner Frau, und von seiner Tochter Charlotte. Das Seestück, das er immer im Blickfeld haben wollte, wenn er zu Bett ging, wenn er aufstand. Auf dem Tischchen neben dem Bett die besseres Einschlafen versprechenden Pillen. »Nehmen Sie eine, das reicht. Noch besser, Sie nehmen gar keine!« Doch was schon wusste der Hausarzt. Neben den Pillen die Brille, neben der Brille das Buch, in dem er vor dem Einschlafen ein paar Seiten gelesen hatte.
Manchmal dachte er, dass es nicht gut sei, sich noch am späten Abend in die Welt fremder Menschen zu versenken. Hatte nicht schon seine Mutter gesagt: »Junge, lies nicht so viel, das bringt nichts, auf Dauer verdirbt es die Augen. Und auch den Charakter.«
Mit den Augen schien sie recht behalten zu haben. Und mit dem Charakter? Jedes Mal, wenn ihm die Worte seiner Mutter einfielen, verzogen sich seine Gesichtszüge zu einem schiefen Lächeln. Es stimmt schon, was ging ihn das Leben einer Odette an, was das Leben eines Swann? Wenn man abdriftet in eine andere Welt, driftet damit auch der eigene Charakter ab? Manche Leute lesen Krimis, können nicht genug davon kriegen. Macht Krimis lesen etwa kriminell? Proust lesen macht hungrig. Immer noch ein Souper, und was da nicht alles aufgetischt wird. Die Magensäfte geraten ins Fließen, das Loch im Bauch weitet sich, der Speichel tropft.
Eine Kleinigkeit musste er sich aus der Küche holen: ein Stück Käse, eine Scheibe Wurst. Die Keksrolle hatte er ganz weit hinten in den Küchenschrank verbannt, aber wohin er sie verbannt hatte, das hatte er nicht vergessen. Proust lesen macht dick. Und dann die vielen Roben der Odette. Doch die tangierten ihn weniger, könnten eher für weibliche Leser gefährlich werden. Ach ja, dachte er manchmal, deren Probleme möchte ich haben. Und doch konnte er das Buch nicht ein für alle Male aus der Nähe seines Bettes verbannen. Die einmal gepackte Neugier über den Fortgang und Ausgang der Endloserzählung saß fest wie ein Widerhaken.
Das Lastauto war fort, und die Erinnerung daran hat sich in Sekundeneile verflüchtigt. Er verspürte jetzt auch kein Loch mehr im Bauch. Wahrscheinlich habe ich vor dem Einschlafen zu wenig Proust gelesen, dachte er. Er konnte sich nicht entschließen, das Licht wieder auszuknipsen. Er lag lieber im Hellen wach, da konnte er seine wandernden Gedanken besser einfangen. Andererseits hinderte ihn das Licht am Wiedereinschlafen, im Schlaf musste es bei ihm dunkel sein.
Einmal hatte er das Licht brennen lassen und war dann doch eingeschlafen. Als er erwachte, war es taghell. Hell, und das Licht war an? Sollte das ein erstes Anzeichen dafür sein, dass er so langsam verlotterte? Das durfte ihm nie wieder passieren! Dann hätte er den Beweis in den Händen, bestätigte sich das, was Bruno in letzter Zeit immer häufiger zu ihm sagte: »Du hast dein Leben nicht mehr im Griff.«
Da war er wieder, dieser Stich in die Stirn, rechts oben, tief in die Schädeldecke – der Angriff. Wenn er einfach nur so liegenbleibe, würde es nicht lange dauern, bis die ersten Tränen aus den Augen träten. Keine Trauertränen, Tränen der Freude schon gar nicht. Sie waren ganz einfach da und rollten an der Nase entlang, verfingen sich an den Mundwinkeln und verharrten dort, als wollten sie Einlass in den Mund begehren. Sie schmeckten schwach salzig. Erst wenn er sie im Mund fühlte und herunterschluckte, setzte der Katzenjammer ein. Diesen Zustand kannte er allzu gut. Ich sollte aufstehen, dachte er. Aber was dann? Durch die Wohnung geistern? Doch das war unergiebig, er hatte keine Zimmerfluchten.
Bruno, dachte er. Das Bedürfnis nach einem Menschen in seiner Nähe wuchs mit zunehmendem Tränenfluss. Er schaltete das Licht aus. Der stechende Schmerz hatte nachgelassen. Jetzt trieb der schwarze Vogel sein Unwesen. Jetzt, und zwar genau in diesem Moment, wäre es an der Zeit, bei Bruno zu klingeln. Diese vermaledeiten vierzig Kilometer! Dass das zu viel war, wusste auch Bruno. Hatte er sich deshalb aus dem Staube gemacht? Aktivitäten? Ausgerechnet er, der sich so sehr seiner großen Freiheit rühmte.
»Du musst lernen, damit umzugehen, Edgar. Meinst du, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der vom Schicksal geschlagen ist? Ich könnte dir da Dinge erzählen …«
Was ist das überhaupt, Schicksal? Alle hackten sie auf diesem Wort herum, und jeder verstand was anderes darunter. War sein Schicksal der schwarze Vogel? Er sollte ihn einfangen, töten, erbarmungslos. Sich nicht unterkriegen lassen. Doch die Gedanken würden nicht wegbleiben, auch wenn er den schwarzen Vogel zu fassen kriegen sollte und ihm die Federn rupfte.
Vor Erschöpfung fiel er in einen tiefen Schlaf.
3
Johanna hatte gesagt, sie käme am kommenden Tag. Nicht gesagt hatte sie, wann für sie der kommende Tag begänne. Am Vormittag, am Nachmittag? Oder erst am Abend? Doch sie werde ihn vorher anrufen. Sie brächte ihm Skizzen vorbei, Entwürfe für den Umbau des unteren Wohnbereichs. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn er Veränderungen vornähme, womit sie meinte, er solle die Trennwand zum Nebenzimmer entfernen lassen, so dass im unteren Bereich ein schöner großzügiger Raum, wie sie sagte, entstünde. Sollte auch Johanna recht haben? Veränderungen, Änderungen, was Neues? Ratschläge, die auf ihn von allen Seiten einprasselten, Stockschläge, denen er nicht ausweichen konnte. Aber wenn auch sie recht hätte? Johanna kannte er seit seiner Kinderzeit, auch aus der Studienzeit. »Spätes Mädchen«, behaupteten Lästerzungen. Aber beruflich sei sie sehr kompetent. Sie hatte sich auf die Gestaltung von Gaststätten spezialisiert. Innenarchitekten können zwar alles machen, sollten sie aber nicht, so Edgars Urteil.
»Nichts wird so sehr geschätzt wie Spezialisierung. Jeder sollte sein Gebiet finden und ausbauen«, waren Johannas Worte. »Hast du die Goldene Eiche gesehen? Ich meine vorher und nachher? Nicht wiederzuerkennen. Ist jetzt ein richtiges Schmuckstück. Und die Gäste kommen, ein Selbstläufer.«
Auch er brauche ein neues Rooming, wie sie sagte. Eine umgestaltete Wohnung bringe neue Stimmungen, verändere sogar den Charakter des Menschen, der sich darin aufhält. Großzügigkeit im Raum, vielleicht auch anderes Mobiliar, alles ließe sich machen, alles würde sich finden. Mit diesen Worten hatte sie ihren Kopf in den Nacken geworfen und ihre rote Mähne auf die Schulter zurück.
»So gegen elf«, ließ sie am Telefon vernehmen, nachdem er sie angerufen hatte. Ob ihm das recht sei? Es war ihm recht, wie ihm auch die vorzunehmende Veränderung inzwischen recht geworden war. Überzeugt war er davon noch nicht, doch das werde sich schon finden, meinte Johanna. Sie kenne den Verzögerungseffekt, sei bei den meisten Kunden so. Kunden? Dass er sie seit urewigen Zeiten kannte, schloss ja nicht aus, dass er für sie heute ein Kunde sei, sinnierte er.
Das Telefon klingelte. Johanna. Ob es nicht auch übermorgen ginge. Er hatte sich auf morgen eingestellt.
»Also gut, dann übermorgen gegen zehn.«
Er war wütend, und am liebsten hätte er ihr ganz abgesagt. Doch was machte es schon aus, ob die Wand einen Tag früher oder einen Tag später niedergerissen würde oder ob letztendlich doch alles so blieb, wie es war. Zum ersten Mal machte er sich Gedanken über die Statik. Wenn nun alles zusammenbräche nach dem Entfernen der Wand? Ist eine Leichtbauwand nicht das, was ihr Name sagt: leicht, also nicht tragend? Außerdem würde er ohnehin alles Johanna, der erfolgreichen Innenarchitektin mit Reputation, überlassen. Er ließ sich auf seinen Lieblingsstuhl mit den Armstützen und der hohen Lehne nieder und versuchte sich vorzustellen, wie der Raum aussähe – ohne diese Trennwand zum Nebenzimmer, das nun, funktionslos, weil keine Charlotte mehr darin spielen und herumtoben würde, ein toter Nebenraum war. Tot, ein Wort, vor dem er sich drückte, so gut es ging.
Niemand hatte gesagt, wie leid es ihm tue, dass sie jetzt tot waren, so unverhofft, auf so tragische Art. So mitten aus dem Leben, so jung, so klein. Sie sind »von dir gegangen«, haben sie gesagt.
Der Pastor gar wusste: »Gott der Herr hat sie zu sich gerufen.« Edgar hatte ihn nicht um seine Auslegung gebeten. Der Würdenträger hatte es ihm ganz simpel ins Gesicht gesagt, auf offener Straße, quasi im Vorübergehen, wenngleich er hätte wissen sollen, was Edgar von solchen Weisheiten hielt. Er gehörte nicht einmal dessen Kirchengemeinde an, doch offenbar sah Pastor Weber sich berufen, in solch sperrigen Fällen auch Menschen außerhalb seines Wirkungskreises anzusprechen. Also gut, sie kannten sich, ebenfalls von Kindheit an, auch aus der Zeit, wo jeder seinem Studium nachgegangen war, hatte Edgar in Gedanken eingelenkt. Doch seit der diesen gesalbten Blick durch die Öffentlichkeit trug, taten sie, als kennten sie sich nicht mehr. Er ließ ihn gewähren mit Gott dem Herrn, mit seiner Sicht auf die Welt. Die Hilflosigkeit kennt viele Ausdrucksvarianten, eine der schlimmen Art sind die Worte »Wer weiß, wozu es gut ist.« Wozu sollte es gut sein, ein siebenjähriges Kind zu Grabe zu tragen, zusammen mit seiner Mutter?
Ich muss das Rad anhalten, ehe es außer Kontrolle gerät, dachte er. Ich muss Bruno anrufen.
Bruno war nicht da. Das heißt, vielleicht war er da, nahm aber nicht den Hörer ab.
»Sprechen Sie nach dem Signalton.«
Er wollte nicht nach dem Signalton sprechen. Außerdem, vielleicht war Bruno wirklich nicht zu Hause. Doch in sein Vertrauen zu Bruno hat sich seit dessen Weggang ein leiser Zug von Misstrauen eingeschlichen, ein feines Gift, das in Situationen wie dieser seine Wirkung entfaltete. Wer war es doch gleich, der ihm versichert hatte, er sei mit Bruno in B. gewesen? Wohingegen Bruno behauptete, zu jenem Zeitpunkt zu Hause gewesen zu sein, er habe das Telefon lediglich für ein paar Stunden auf stumm geschaltet, weil er sich auf die Aufträge habe konzentrieren müssen. Schließlich fordere sein Job vollen Einsatz – was man bei Bruno glauben kann, aber nicht muss. Wie käme er dazu, ihn zur Rede zu stellen. Auf Aufträge konzentrieren? Na ja. Sie waren kein Ehepaar. Auf die Freiheit, die er sich einräumte, durfte er keinen Zugriff haben, das wäre lachhaft. Brunos Job: Pharmavertreter. Klinkenputzer der gehobeneren Kategorie – das durfte er denken, durfte es ihm aber nicht sagen. Klar doch, Bruno war nicht zu Hause, wie nur hatte er annehmen können, ihn am helllichten Vormittag in seinem neuen Refugium anzutreffen.
»Und wenn was ist: Ich bin für dich da, immer.«
Er wusste, dass er Bruno unrecht tat. Und auch allen anderen, die ihm mit diesen Worten auf den Lippen die Hand gegeben hatten, tue ich unrecht, dachte er.
Johanna würde heute also nicht kommen, traf er für sich die nüchtern sachliche Feststellung. Das warf ihn am allerwenigsten aus der Bahn.
Sonst warf ihn seit jenem unheilvollen Tag so vieles aus der Bahn. Unpünktlichkeiten versetzten ihn in Unruhe. Luise hatte gesagt, sie käme gegen drei nach Hause, spätestens. Und das bedeutete bei ihm dann auch: Nicht später als drei Uhr, plus minus fünf Minuten. Darauf konnte er sich stets verlassen – für eine gewisse Zeit jedenfalls. Später verrutschten ihre Voraussagen.
Jener Tag war hell und freundlich, ein Tag, der ein Gefühl wachrief, als hätte man noch irgendetwas zu erwarten. Etwas Gutes, Hübsches, Positives allemal. Vielleicht würde sie ihm wieder etwas aus der Stadt mitbringen: Eine druckfrische Erstausgabe, die sie »so rein zufällig« in der Auslage entdeckt hatte, oder eine kleinformatige Glaskatze, wie er sie sammelte, aus glattem, klaren Glas, man musste durch sie hindurchschauen können, die gäbe es äußerst selten. Sie hatte ein Gespür dafür, derartige Dinge ausfindig zu machen. Großformatig jedenfalls ginge nicht, dafür wäre kein Platz mehr. Oder irgendeine andere Schnurrpfeiferei. Als schlüpfte sie in die Rolle einer Mutter, die, vom Einkauf zurückgekommen, ihrem Kind an der Eingangstür entgegenruft: »Ich habe dir etwas mitgebracht! Aber du musst dich gedulden, bis ich ausgepackt habe.«
Um vier Uhr hatte er zum Handy gegriffen: «Ihr Gesprächsteilnehmer ist momentan nicht erreichbar ...«
Wo zum Teufel mochte sie stecken? Sie war mit Lotte unterwegs, bummeln, hatte sie gesagt. Das hieß einkaufen; etwas fand sich immer. Anschließend wollten sie einen Abstecher zu ihrer Freundin in Querdorf machen. Um mit den beiden Töchtern der Nachbarin ihrer Freundin spielen zu können, nahm Lotte die Bummelei durch die Straßen der Stadt in Kauf. Einen anderen Weg, zu den beiden Mädchen zu gelangen, hätte es für sie ohnehin nicht gegeben.
Es war halb fünf, als er die kalte Wahrheit mitgeteilt bekam: Dass sie wohl nie wieder in sein Haus zurückkommen würden. So direkt hatten sie es nicht gesagt, sie waren geübt im Verschlüsseln von bösen Nachrichten.
»Auf jeden Fall ist es besser, Sie suchen den Unfallort nicht auf, jedenfalls nicht jetzt. Sie werden stark sein müssen, bleiben Sie im Haus, wir kommen zu Ihnen.«
Stark, ja, gewiss, was sonst. Wer eigentlich war die Anruferin? Polizei, Rettungsdienst? Mit dem Handy in der Hand war er auf dem Sofa sitzengeblieben. Fünf Minuten, zehn Minuten? Wer schon blickte auf die Uhr in solchen Situationen. Er konnte nicht sagen, dass ihn die Nachricht von dem Unfall wie ein Keulenschlag getroffen hätte. »Aha«, war seine erste Reaktion. Kein Gezeter, kein Zusammenbruch, es hatte ihm nicht einmal den Appetit verdorben. Der Magen hatte wie immer um diese Tageszeit seine Bedürfnisse angemeldet. Er war in die Küche gegangen, hatte auf der Suche nach Essbarem den Kühlschrank geöffnet, hatte den Herd angemacht, zwei Eier in die Pfanne geschlagen, zwei Scheiben Brot vom Laib abgeschnitten, Teller, Messer und Gabel auf dem Küchentisch zurechtgelegt. Und sich dabei ertappt, wie er für drei Personen den Tisch decken wollte. Bis ihm einfiel, sie kämen ja heute nicht zum Essen. Als seien sie bei ihrer Freundin hängengeblieben, wie das hin und wieder schon mal vorkam: »Ach, weißt du, warte nicht auf uns, mach dir was in der Küche. Es kann spät werden, du weißt ja, Kati und ich ...«
Kati und sie – Busenfreundinnen. Nannte man das so? Auch die zwei Frauen kannten sich so lange, wie Edgar Bruno kannte. Eine glückliche Konstellation, meinte Luise. Nur dass die Freundin keinen Mann hatte und offenbar nichts dazu tat, sich mit einem Mann zusammenzutun. Doch was soll’s. Bruno hatte keine Frau, jedenfalls »nichts Festes«, wie er bei jeder neuen Frauenbekanntschaft versicherte. Er würde sich nicht binden, nie! Doch vielleicht waren es auch die Frauen, die sich mit ihm nicht binden lassen wollten. Bruno hatte ein Talent, sich die Welt so zurechtzulegen, wie es ihm gerade ins Lebenskonzept passte. Junggeselle auf Lebenszeit. Stundenlang hatten sie darüber diskutiert, auch noch nach Edgars Bindung mit Luise. Das könnte er nicht, hatte Bruno gesagt: Einem fremden Menschen gegenüber Rede und Antwort stehen. Ein Lebenspartner sei kein fremder Mensch, hatte Edgar ihm entgegnet.
»So?,« hatte Bruno gezweifelt. »Und was ist er sonst? Aus den Millionen und Abermillionen Menschen auf dieser Welt fällt deine Wahl ausgerechnet auf diesen einen, den du auch noch den einzigen nennst. Ist doch aberwitzig.«
»Luise ist kein Aberwitz.«
»Gott bewahre!«, hatte Bruno mit dramatischer Geste abgewehrt. Schweigen. Sie hatten sich stumm zugetrunken, jeder auf der Suche nach dem Stöpsel, mit dem er für diesen Tag diesen Gedankengang hätte verschließen können. Sie kannten sich gut genug, um zu wissen, dass solche Gespräche in die Sackgasse führten. Wohin wanderten die Gedanken in solchen Situationen? Ob andere auch so reagieren?, fragte sich Edgar. Absurd.
Sie hatten auch nicht erwähnt, ob man sie in ein Krankenhaus gebracht hatte. Sie schwiegen einfach. Tut man das in solchen Fällen? Was überhaupt für ein Fall war das?
Er entnahm dem Kühlschrank eine Flasche Bier, öffnete sie, nahm einen Schluck. Ein Glas sparte er sich, was er, wenn sie zu dritt am Tisch saßen, nicht tat, nicht hätte tun dürfen. Sie hätte einen Flunsch gezogen, mit Seitenblick auf ihre Tochter. Sie hatte ja recht. Hatte? In Gedanken wischte er dieses Wort weg wie verirrte Regentropfen der Scheibenwischer.
Mit der Bierflasche in der Hand ging er ins Wohnzimmer. Das Zimmer lag im Halbdämmer. Um diese Tageszeit war es im Hochsommer draußen noch taghell, keinerlei Anzeichen von Abendstunde. Für das diffuse Licht im Zimmer sorgten die halb zugezogenen Fenstervorhänge und die dicke Linde gegenüber auf der Straße, die schon oft für Dispute Stoff geboten hatte. Die einen mochten sie nicht, sie schaffe zu viel Schatten, zu viel Dunkelheit, die andere Partei verteidigte das schöne Grün, von dem es ohnehin schon immer weniger gäbe. Und außerdem der Duft, das Gesummse der Bienen. Er seinerseits war für das Verbleiben der Linde, schon allein wegen des Schattens, den sie an Tagen wie diesen ihrem Haus spendete.
Es schien, als lägen ihm die Gedanken über den Verbleib des Baumes näher als die Gedanken an das, was ihm dieses Stück aus Blech und Kunststoff vor zehn Minuten kundgetan hatte. Auf dem Herd in der Küche brutzelten die Eier, die Duftfahne zog sich bis zum Wohnzimmer hin. Luise würde bekritteln, dass er die Küchentür nicht verschlossen hielt, wenn etwas auf dem Herd stand, dessen Gerüche sich über das ganze Hause zu verbreiten drohten. »Soll es etwa auch noch im Schlafzimmer nach Küche riechen?«
Sie würden nicht zurückkommen, jedenfalls heute nicht. Und: Sie wollten anrufen, Bescheid sagen. Geduld. Und Lotte? Der Gedanke schien ihm absurd. Von solchen Stoffen lebten Fernsehkrimis. Heerscharen von Stückeschreibern wetzten ihre Messer in der Drehbuchküche. Und was war, wenn sich jemand mit dieser Schreckensnachricht einen Scherz erlaubt hatte? Fieslinge trieben ihr Unwesen, in allen Medien, scheuten vor nichts zurück. Hielten das womöglich auch noch für einen geglückten Scherz.
Mit diesen Gedanken ging er zurück in die Küche, nahm die leicht angekohlten Eier vom Herd und überlegte, ob es nicht sinnvoller sei, sie direkt von der Pfanne zu essen, das gäbe weniger Umstände mit der Nachsorge, weniger Abwasch. Und weniger Abwasch hieße mehr Zeit für andere Dinge. Zehn Minuten Abwasch oder zehn Minuten Lektüre? Da sollte ihm die Entscheidung nicht schwerfallen. Er zerstückelte die Eier in der Pfanne und steckte sich einen Bissen in den Mund, kaute, wo es nichts zu kauen gab. Das Stück Ei im Mund entwickelte sich zu einem Kloß immer größeren Ausmaßes. Dieser verstopfte ihm die Speiseröhre, die verstopfte Speiseröhre engte die Luftröhre ein, er musste nach Atem ringen, Brechhusten schüttelte ihn, er spuckte den Bissen in die Spüle, wischte sich die Hustetränen mit Papiertuch aus dem Gesicht, griff nach der Bierflasche und spülte den letzten Ei-Krümel mit einem kräftigen Schluck herunter. Und wenn es doch kein fingierter Anruf war?
Die Klingel an der Haustür ertönte durchdringend und schrill. Da er nicht reagierte, wurde ein zweites Mal geklingelt, diesmal noch schriller, noch eindringlicher. Jemand klopfte an die Tür, rief: »Sind Sie zu Hause? So öffnen Sie doch!«
Er öffnete nicht. Er vernahm das Klicken der Briefkastenklappe, hörte, wie Schritte sich vom Haus entfernten, wie die Schritte innehielten. Wobei er annahm, die Personen seien stehengeblieben, um sich zu vergewissern, ob nicht doch jemand im Hause sei. Dann stiegen sie in ein Auto, das Auto entfernte sich.
Er saß weiterhin am Tisch, vor sich die Tageszeitung und die halbleere Bierflasche. In seinem Kopf hatte kein einziger, die neuerliche Realität betreffender Gedanke verfangen. Geistesabwesend spielte er mit dem Messer, befühlte die Klinge, fuhr mit dem Finger über die Mini-Säge, prüfte die Schärfe der Zacken, hielt das Messer gegen das Licht, drehte es wie einen Propeller in der Rechten hin und her. Wieder verharrte der linke Zeigefinger an der Klinge. Er drückte die Klinge bis zur Schmerzgrenze in den Finger hinein, und er spürte: Würde er noch mehr drücken, dränge die Klinge ins Fleisch. Blut würde spritzen, ein jäher Schmerz risse ihn ins noch tiefere Elend.
Das lag jetzt mehr als ein Jahr zurück.
4
Johanna war auch »übermorgen« nicht gekommen.
»Wie peinlich mir das ist, Edgar. Aber wenn du wüsstest, was in letzter Zeit bei mir so alles los ist. Und alle haben es eilig. Als sei ich der letzte Zug, den sie noch unbedingt erreichen müssten.«
Ganz verstanden hatte er die Sache mit dem letzten Zug nicht. Aber so ist sie nun mal, die Johanna. Und so bist nun auch mal du, Bruno, immer in Eile, wobei ich nie weiß, wohin du eilst, sinnierte er. Manchmal beschlich ihn das Gefühl, Bruno zu viel abverlangt zu haben. Hatte er überzogen? Hatte er sich zu sehr mit seiner Trauer in den Mittelpunkt gestellt? Das wollte ich nicht, Bruno. Ich wollte stark sein, wenigstens tagsüber.
Der Tag verwischte die Nachtgedanken, drängte sie in den Hintergrund, so als machte er den Platz frei für die bevorstehende Nacht. Dass sein Verhängnis die Nächte sein würden, hatte ihn überrollt wie eine unaufhaltsam vordrängende Walze.
»Du musst dir Strategien für die Nacht zurechtlegen«, hatte Bruno geraten. Rituale. Immer zur gleichen Stunde zu Bett gehen, kein aufreizendes Fernsehprogramm, lieber Barockmusik, Scarlatti, nur nichts Jazziges, nichts Modernes. Vielleicht als Schlaftrunk ein Bierchen. Abschalten.
»Also dann am Freitag, Johanna, nach Feierabend.«
»Dann“, meinte sie, »könnten wir uns auch viel mehr Zeit lassen.« Sie habe ihren Plan schon konkretisiert. Und: »Du darfst jetzt nicht abspringen.«
»Ich werde nicht abspringen, Johanna«, versprach er.
Um mit solch einer Situation umgehen zu können, werde er viel Zeit brauchen, hatte der psychologische Berater ihm prophezeit. Es wäre besser gewesen, er hätte es ihm nicht gesagt; Allgemeinplätze höre er mehr als genug, war seine stumme Reaktion. Der Berater wurde ihm für die ersten Tage und Wochen zur Seite gestellt, von Amts wegen, das mache man in solchen Fällen so. Wenigstens ein-, zweimal in der Woche solle er das Angebot annehmen. Das habe bisher jedem gutgetan. Und ein-, zweimal hatte er ihn auch tatsächlich aufgesucht. Er wusste nicht, wer von beiden sich befangener verhielt. Er solle doch von sich erzählen, egal, was.
»Egal, was?« Nun ja, was er wolle, was ihm so einfalle, vielleicht welche Lieblingsspeisen er habe, welche Urlaubsziele er bevorzuge, ob seine Tätigkeit als Steuerberater ihn ausfülle.
Nach der zweiten Sitzung fiel dann dieses vermaledeite Wort von der »vielen Zeit«, die er brauchen werde. Nach einigen Sekunden des Schweigens, in denen er das zwanghafte Gefühl hatte, vom Berater permanent fixiert zu werden, schleuderte er ihm erregt entgegen: »Ich habe nicht viel Zeit!« Er war heftig von seinem Stuhl aufgesprungen. »Noch dreißig, wenn’s hochkommt fünfunddreißig Jahre, was ist das schon!«, hatte er gerufen, war zur Tür geeilt und hatte sie hinter sich zugeschlagen. Die Sitzungen waren für ihn damit beendet.
Einige Monate war das her, er konnte sich die damalige Situation noch gut vergegenwärtigen, später tat es ihm leid, so reagiert zu haben. Er hatte sich bei diesem Betreuer mehr oder weniger halbherzig entschuldigt, wofür dieser durchaus Verständnis zeigte. Die zeigen wohl für alles Verständnis, dachte er. Könnten sie sonst ihren Beruf ausüben?
Zwei Monate nach dem Unfall musste er für sich feststellen, dass seine Gedankengänge mehr denn je vom Vergangenen überlagert waren. Hätte er antworten sollen, welcher Verlust – der der Ehefrau oder der der Tochter – der schwerwiegendere sei, hätte er keine Antwort geben können. Wer auch würde es gewagt haben, ihm solche Fragen zu stellen. Es gab keine Gewichtungen. Nur er allein durfte sich das fragen, und er erkannte, wie aberwitzig derartiges Nachsinnen war. Leben mit Erinnerungen, die ihn begleiteten wie Schatten, überall hin, da gab es nichts abzuwägen. Die neuerliche Wirklichkeit war kalt und hart wie Glas, eine Scheibe, an der man sich die Stirn blutig stieß. Niemand sah das, niemand konnte das mitfühlen.
5
Sein Leben schien seine Bahn gefunden zu haben. Am Anfang gab es Luise, ohne Luise keine Lotte. In seiner Erinnerung zeigte sich ihm Luise als das junge Mädchen von der Badeanstalt in ihrem knallengen Badeanzug mit dem Zwickel zwischen den Schenkeln, der ihr Geschlecht mehr markierte, als dass er es kaschierte. Wenn sie aus dem Schwimmbecken stieg, schob sie als Erstes die Zeigefinger unter den Badeanzug über die Pobacken, streifte das Textil glatt und landete mit beiden Zeigefingern im vorderen Unterbereich, um das Wasser, dass sich als kleine Beule in dieser Gegend verfangen hatte, herauszustreifen. Eine Geste, die nicht mehr als ein, zwei Sekunden Zeit in Anspruch nahm und die er auch bei anderen Mädchen beobachtet hatte. Aber nur Luises Tun hatte seine ganze Aufmerksamkeit geweckt. Luise war gertenschlank, hatte eine von der Sonne leicht getönte Haut. An Stellen, wo der Sonne keine Berührungschancen blieben, war die Haut heller, ja fast weiß, was sich immer dann offenbarte, wenn sie ihren Badeanzug wechselte und unfreiwillig – oder doch gewollt? – hinter dem Badetuch die eine oder andere Stelle ihres blanken Körpers seinen Blicken preisgab. Luise kam nicht einfach nur so aus dem Schwimmbecken heraus, nein, Luise entstieg den Fluten. Jeder Schritt auf der aus dem Schwimmbecken herausführenden Treppe eine Offenbarung. Das Wasser troff in langen Bahnen von ihren biegsamen Hüften hinunter, Rinnsale, die sich nur zögernd von ihrem Körper zu lösen schienen. Eine Nymphe schenkte sich der Welt.
Lange Zeit hatte er sich Gedanken darüber gemacht, wie er auf sich aufmerksam machen könnte. Manchmal, wenn sie sich anschickte, ins Wasser zu steigen, folgte er ihr, sprang, kaum dass sie im Wasser war, vom Beckenrand dicht neben ihr mit einem Anlaufköpper ins Wasser – was sie jedoch zu ignorieren schien. Nur einmal, als er nach seinem Sprung den Kopf zurückwandte, trafen seine Augen auf ihre Augen, und als er aus ihrem Blick ihr Missfallen, wenn nicht gar Verärgerung herauszulesen glaubte, tauchte er ab, schwamm unter Wasser fast bis ans andere Ende des Schwimmbeckens, und als er wieder auftauchte, war sie nicht mehr im Wasser. Mist, ich habe sie vergrault!, dachte er. Auch er hatte keine Lust mehr, weitere Bahnen zu schwimmen, er lupfte sich aus dem Wasser und lief dorthin, wo er seine Sachen hinterlegt hatte. Bäuchlings warf er sich auf den Rasen, legte seinen Kopf auf die Unterarme und blinzelte in die Richtung, wo sie sich niedergelassen hatte. Auch sie hatte sich bäuchlings auf ihr quietschbuntes, mit allerlei Getier verziertes Badetuch gelegt und strampelte mit ihren in die Luft gereckten Beinen. Zehn Meter, so schätzte er, galt es zu überwinden. Sein Frust stürzte ins Bodenlose, als er beobachtete, wie dieser junge Dunkelhaarige sich an ihrer Seite niederließ. Plötzlich war der ganz einfach da, wie aus den Wolken gefallen, ein stämmiger Bursche mit haariger Brust und haarigem Bauch. Doch er hatte sich nicht lange bei ihr aufgehalten, fünf Minuten, höchstens zehn. Hatte sie ihn weggescheucht? Ihre Stimme nahm an Lautstärke zu, das Letzte, was zu ihm herübertönte, war: »Verschwinde!«, und der Haarige trollte sich.
Eine Bö war über den Rasen gewirbelt und verwandelte Gegenstände zu Flugobjekten: Bälle kullerten herrenlos bis an den Rand des Schwimmbeckens, Teile von Badebekleidung flogen zu fremden Plätzen, eine Gummiente hatte sich erhoben, als wollte sie ihren lebenden Vettern nacheifern. Bei ihm war eine übergroße Plastikeinkauftasche mit dem Logo einer Ladenkette für jugendliche Bekleidung gelandet. Die Tasche war von Luises Platz aus gestartet, hatte sich in der Luft zu einem Ballon aufgebläht, vollzog zwei, drei Loopings, und als die Bö sich gelegt hatte, ließ sie sich wie ein schlaffer Sack neben ihm nieder. Er hatte überlegt: Entweder sie kommt zu mir, um sich ihre Tasche zu holen, oder ich bringe ihr die Tasche zurück, ganz große Geste, lächelnd, mit »aber das macht doch nichts« auf den Lippen, etwas in der Art. Ja, so war das, ohne Bö keine fliegende Tasche, ohne fliegende Tasche keine Luise, ohne Luise keine Lotte, eine Abfolge von Ereignissen, die sich ergaben, als seien sie von einer zwingenden Logik getragen.
Und jetzt?, dachte er. Als wäre eine Bö über das Haus hinweggefegt, die alles mit sich riss. Es gibt diese Stürme in der Karibik, die alles dem Erdboden gleichmachen. Stürme? Ach was, Stürme: Hurrikane. Mit Opfern, die in die Hunderte gehen. Wieso eigentlich Opfer? Wer opfert hier wem was? Der Hurrikan ist ein wesenloses Etwas, eine Wolkenmasse, die sich um die eigene Achse dreht und mit zunehmender Umdrehung an Fahrt gewinnt. Ein rasendes Ungeheuer. Aber auch das traf nicht ganz zu, weil wir mit Ungeheuer ein Wesen vor Augen haben, dem wir Züge verleihen, die wir dem menschlichen Wesen entliehen haben. Wir versehen Naturereignisse mit Namen, als wären sie die Frucht eines weiblichen Wesens. Hurrikan Maria, »die von Gott Bevorzugte« – welch ein verstörender Name für ein Geschehnis, das Tod und Verderben mit sich bringt. Wie mögen die Menschen dort mit dem Tod umgehen, mit dem Verlust ihrer Ehefrauen, Ehemänner, Söhne, Töchter, Väter, Mütter? Opfer? Zigfach, hundertfach. Weggewischt auf einen Streich. Waren Luise und Lotte Opfer, Opfer eines Verkehrsunfalls? Ich verrenne mich wieder, grübelte er. Sein Verstand sagte ihm, wie sinnlos es sei, sich auf solche Gedankengänge einzulassen.