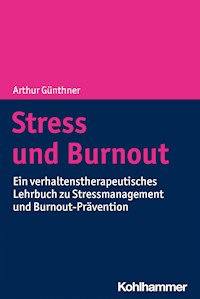
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Immer häufiger suchen Menschen aufgrund von Stress und Burnout professionelle, insbesondere auch therapeutische Hilfe. Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung des Stressmanagements aus verhaltenspsychologischer und verhaltensmedizinischer Sicht. Die Begriffe "Stress" und "Burnout" werden unter Berücksichtigung gängiger Stresstheorien eingehend abgehandelt. Anhand zahlreicher Beispiele wird die Verhaltensanalyse von Belastungs- und Überforderungssituationen anschaulich dargestellt und aufgezeigt, welche verhaltensmodifikatorischen oder -therapeutischen Implikationen sich daraus ableiten lassen. Dem verhaltenspsychologischen Rational wird dabei viel Raum gegeben, um verständlich zu machen, dass Stressmanagement nicht aus einem Rezeptblock besteht, sondern meist eine sorgfältige funktionale Verhaltensanalyse im Einzelfall voraussetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Dr. Arthur Günthner ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinische Geriatrie, Suchtmedizin. Psychologischer Psychotherapeut. Studium der Psychologie und der Humanmedizin an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen; Fulbright-Stipendiat an der University of Miami, Florida, USA (1975/76). Weiterbildung zum Arzt für Psychiatrie am Universitätsklinikum Tübingen (1986–1991). Oberarzt an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Tübingen (1993–2001). Chefarzt der Fachklinik Eußerthal der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz (2001–2010). Leitender Medizinaldirektor, Stabsstelle Evaluation und Begleitforschung, Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, Speyer (2010–2016). Seit 2016 im Ruhestand.
Schwerpunkte: Psychotherapie (Verhaltenstherapie), Suchtmedizin, Stressmedizin.
Arthur Günthner
Stress und Burnout
Ein verhaltenstherapeutisches Lehrbuch zu Stressmanagement und Burnout-Prävention
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-036252-9
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-036253-6
epub: ISBN 978-3-17-036254-3
Geleitwort von Prof. Dr. Anil Batra
Man fragt sich oft: Was sind Ursachen meines Stresses? Der Alltag, selbstgesteckte Ziele, das moderne Leben, die Gesellschaft, das Klima, die Corona-Pandemie, Familie und Beruf …? Ursachen für Stress gibt es fast so viele, wie es Menschen gibt, die ihren Alltag gestalten und Herausforderungen meistern.
Grundsätzlich sind wir Menschen als komplexe Wesen aber anpassungsfähig: Wir gestalten unsere inneren und äußeren Lebenswelten, um unter den unterschiedlichsten Bedingungen überleben zu können. Doch dies ist Arbeit, bedeutet Anforderung und geht auch mit der Überforderung unseres Systems bei anhaltender Beanspruchung unter Ausnutzung aller Ressourcen einher. Wir verbrauchen Reserven, die wir angehäuft haben. Insbesondere der Stress durch eine mangelnde oder eingeschränkte subjektive oder objektive Anpassung an soziale Herausforderungen (über-)fordert den Einzelnen und führt bei suboptimalen Anpassungsreaktionen zu noch mehr Stress.
Störfaktoren für etablierte Regelwerke gibt es vielfältige in unserem Alltag: Veränderung von privaten Umgebungsbedingungen, Veränderungen in der Familie, berufliche Herausforderungen, neue Hierarchien, unterschiedliche Verhaltensprogramme für Wochenendtage und Werktage, der permanente Kampf im Computerspiel, die Vorliebe für aufregende Thriller, Störung des Nachtschlafs durch permanente Lichtexposition, Homeoffice in Pandemie-Zeiten, Jetlag und vieles mehr: in einer Welt, in der wir jederzeit »online« und verfügbar sind, überfordert dies unsere Kapazitäten noch mehr, als dies schon zu »Modernen Zeiten« der Fall war.
Der Abbau von Stress durch die Reduktion von Stressoren, die Suche nach alternativen Nischen, der Ausbau von Fähigkeiten und die Erweiterung durch neue Kompetenzen sowie die Einführung neuer operanter Verstärkermechanismen für Verhaltensanpassungen sind Teil effektiver Stressbewältigungsverfahren und Kompensationsmechanismen.
Die Ursachen von Stress und wirksame Vorgehensweisen zur Bewältigung finden wir in diesem unterhaltsam und in ausgezeichneter Weise anschaulich geschriebenen Lehrbuch von Arthur Güntner zum Thema Stress und Burnout.
Der erfahrene Psychologe, Arzt und Psychotherapeut vermittelt lernpsychologische Grundlagen und therapeutisches Know-how und verknüpft dies mit Alltagserfahrungen, die uns allen zugänglich sind.
Ob für den eigenen Gebrauch, für die Behandlung von Patienten oder zum Verständnis der eigenen Lebenssituation – dieses Buch bietet allen Lesenden, die eine stressfreie Work-Life-Balance durch ein Gleichgewicht von Belastungen und Ressourcen und einen Ausbau von Kompetenzen anstreben, eine hervorragende Einführung in das Thema. Wenn dieses Buch gefällt, so sei als Fortsetzung das therapeutische Manual des gleichen Autors empfohlen, in welchem ganz behandlungspraktisch und stressfrei Anleitungen zur Behandlung von Stress im Alltag aber auch im Kontext mit anderen psychischen Störungen gegeben werden.
Dem Autor gebührt Dank und Anerkennung für die lesenswerte Aufarbeitung von Stress und Burnout! Dem Werk wünsche ich Akzeptanz und Erfolg in der Fachwelt.
Anil Batra
Reihenherausgeber Störungsspezifische Psychotherapie (Kohlhammer Verlag)
Inhalt
Geleitwort von Prof. Dr. Anil Batra
1 Einleitung
1.1 Was Zauberer und Frohnaturen uns lehren
1.2 Allgemeine Ratschläge für einzigartige Individuen
1.3 Ein bisschen muss sein
1.4 Der verhaltenstherapeutische Ansatz
1.4.1 Die Eigenschaften dieses Ansatzes
1.4.2 Ein Vergleich mit anderen Bereichen
1.4.3 Stressmanagement individuell und auf Systemebene
1.4.4 Stress als gesellschaftliches Phänomen
1.4.5 Stressmanagement für Therapeuten und intelligente Laien
1.5 Das Relationale Stress-Modell (RSM)
1.6 Psychotherapie: Von der Kontrolle zum Chaos und wieder zurück
2 Grundlagen
2.1 »Stress« – Geschichte und Bedeutung eines Begriffs
2.2 »Burnout« – wenn das Feuer erloschen ist
2.3 »Stress« und »Burnout« – aus lernpsychologischer Sicht
2.3.1 Stress
2.3.2 Burnout
2.4 Stressmanagement und Burnout-Prävention – Modifikation des Verhaltens oder der Verhältnisse?
2.5 Stressmanagement – eine Aufgabe für Verhaltenstherapeuten?
3 Diagnostik von Stress und Burnout – funktionale Verhaltensanalyse
3.1 Stimulus – Situation – Setting (S)
3.2 Reaktion (R)
3.3 Organismus (O)
3.4 Konsequenzen (C)
3.4.1 Die Konsequenzen des Verhaltens im Einzelnen
3.5 Kontingenzen (K)
3.5.1 Kontingenzen individuellen Verhaltens
3.5.2 Kontingenzen des Verhaltens in sozialen Systemen
3.6 Funktionale Verhaltensanalyse und hypothetisches Bedingungsmodell
3.6.1 Kontingenzen und das Problem der Verhaltensänderung
4 Klärung der Ziele und motivationalen Grundlagen der Veränderung
5 Kurzfristiges Stressmanagement
5.1 Was können wir an der Situation ändern?
5.2 Was können wir am Verhalten ändern?
5.3 Was können wir an der Person ändern?
5.4 Was können wir an den Konsequenzen ändern?
5.5 Was können wir an den Kontingenzen ändern?
6 Langfristiges Stressmanagement
6.1 Was können wir an der Situation ändern?
6.2 Was können wir am Verhalten ändern?
6.3 Was können wir an der Person ändern?
6.4 Was können wir an den Konsequenzen und Kontingenzen ändern?
7 Aufrechterhaltung erfolgreicher Verhaltensweisen
8 Burnout-Prävention und -Behandlung
8.1 Diagnostik und die funktionale Verhaltensanalyse bei Burnout
8.1.1 Burnout: systematische und klassifikatorische Einordnung
8.1.2 Besonderheiten bei der funktionalen Verhaltensanalyse von Burnout
8.1.3 Der Einsatz systematischer und standardisierter Diagnostik-Verfahren zu Burnout
8.2 Klärung der Ziele und motivationalen Grundlagen der Veränderung bei Burnout
8.3 Kurzfristige Maßnahmen bei Burnout
8.4 Langfristige Maßnahmen bei Burnout
8.5 Burnout-Prävention
8.6 Burnout und Langeweile: zwei Pole einer Dimension?
9 Stressmanagement in ausgewählten Anwendungsgebieten
9.1 Stressmanagement in bestimmten Lebensbereichen/-situationen
9.1.1 Stress in der heutigen Arbeitswelt
9.1.2 Stressmanagement bei Finanzfragen
9.1.3 Stressmanagement bei der Ernährung
9.1.4 Stressmanagement in sozialen Beziehungen
9.1.5 Stressmanagement bei Erkrankungen
9.2 Stressmanagement in bestimmten Lebensphasen (Entwicklungsaufgaben)
9.2.1 Kindheit und Jugend
9.2.2 Erwachsenenalter
9.2.3 Alter
10 Stressmanagement – jenseits von Glück und Zufriedenheit?
10.1 Stress, Stressmanagement und Gesundheit – ein dynamischer Zusammenhang
10.1.1 Gesundheit als Gleichgewicht – die Grenzen der Natur und unseres Verhaltens
10.1.2 Stress und Gesundheit im Querschnitt – die Bedeutung der Bezugssysteme
10.1.3 Stress und Gesundheit im Längsschnitt – die Bedeutung der Entwicklung
10.1.4 Stressmanagement – universal, global und nachhaltig
10.2 Stress und Stressmanagement als persönliche Erfahrung – die Bedeutung der Biografie
10.3 »Jeder ist seines Glückes Schmied« – Stressmanagement mit Hammer und Amboss?
Arbeitsmaterial zum Download
Literatur
Stichwortverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Was Zauberer und Frohnaturen uns lehren
Lassen Sie sich gerne verzaubern? Was fasziniert uns, wenn wir Zauberern1 zuschauen, wie sie fast Unglaubliches mit nahezu größter Selbstverständlichkeit und anscheinender Mühelosigkeit bewerkstelligen? Dabei ist es weniger das, was sie tun, was uns fasziniert, denn dies nehmen wir ja mit unseren Sinnen wahr. Es ist vielmehr das Wie und Warum. Wie stellen sie es bloß an, dass sie all diese Phänomene so verblüffend und anscheinend mühelos in Szene setzen? Warum funktioniert das überhaupt, und warum gelingt uns dies nicht in gleicher Weise?
Finden Sie es nicht auch zauberhaft, Menschen zu begegnen, die fröhlich und leichten Herzens, engagiert und leidenschaftlich, selbstbewusst und voller Zuversicht selbst an die schwierigsten und unüberschaubarsten Situationen herangehen und diese anscheinend mühelos und stressfrei meistern? Wie schaffen die das eigentlich, und warum gelingt uns das nicht in gleicher Weise?
Nun, am Ende dieses Buches werden Sie vermutlich immer noch nicht zaubern können. Auch habe ich Zweifel, ob Sie sich nur durch die Lektüre dieses Buches zu einer souveränen und stressresistenten Frohnatur entwickeln. Und doch geben Ihnen diese beiden Beispiele einen Hinweis, um was es in diesem Stressmanagement-Ansatz geht: Nicht nur zu wissen, was man tut oder tun sollte, sondern auch warum, und wie wir angesichts schwieriger oder belastender Situationen scheinbar mühelos in der Balance bleiben, unsere Ziele erreichen und uns dabei auch wohl fühlen. Wie soll dieses Kunststück gelingen?
Blicken wir für die Antwort noch einmal auf das Beispiel unseres Zauberers. So mühelos und selbstverständlich uns die Zauberkunststücke eines Magiers zum Zeitpunkt der Darbietung erscheinen mögen, sie sind es nicht. Sie setzen voraus, dass der Zauberer sich akribisch auf diese Darbietung vorbereitet. Dazu gehört nicht nur, dass er uns Ereignisse präsentiert, sondern auch, dass er trickreich verbirgt, wie diese Ereignisse zustande kommen und durch welche Faktoren sie kontrolliert werden. Auch muss er sich in die Erwartungen seiner Zuschauer hineinversetzen können, um verblüffende Effekte zu produzieren, die diesen Erwartungen widersprechen. Die Illusion der Leichtigkeit, Selbstverständlichkeit und Mühelosigkeit basiert also auf sorgfältiger Analyse und Kontrolle der Situation und des eigenen Verhaltens, ggf. unter Einbeziehung des Verhaltens assistierender Personen. Selbst Zuschauer können dabei mit einbezogen werden, ohne dem Geschehen seinen verblüffenden Zauber zu nehmen. Der scheinbar mühelosen Darbietung geht eine Zeit intensiver, detaillierter und oft mühsamer Arbeit im Großen wie im Kleinen voraus, verbunden mit reichlich Übung und dem Sammeln von Erfahrungen im Detail. Auch der bewussten Gestaltung der Situation kommt große Bedeutung zu, sei es dem Spiel mit den Perspektiven oder den Lichtverhältnissen, oder dem passenden Einsatz sichtbarer und nichtsichtbarer technischer Hilfsmittel, z. B. eines Spiegels. Nicht jede Bühne ist jedoch gleich, ebenso wenig jede Zuschauerschaft, und auch das eigene Befinden des Zauberers unterliegt Schwankungen. Was von außen oft so mühelos aussieht, vollzieht sich unter konzentrierten und kontrollierten Bedingungen, auch wenn sich diese unserer Sicht und unserer Kenntnis oft entziehen.
Auch bei unserer oben beschriebenen stressresistenten Frohnatur können wir eine Lerngeschichte unterstellen, u. U. gleichfalls mit Zeiten mühevoller, intensiver Vorbereitung und Übung in den verschiedensten Situationen. Auch Zeiten ernsthafter, konzentrierter Arbeit, Rückschläge sowie Lernen aus Fehlern können dazu gehören. Oft kennen wir diese Lerngeschichte nicht oder nur kleine Ausschnitte davon. Und doch ist sie, in Verbindung mit der nahezu unendlichen Vielfalt an Situationen, denen wir in unserem Leben begegnen können, mitentscheidend dafür, wie wir mit den Belastungen des Alltags und mit Krisensituationen umgehen und wie mühelos uns dies gelingt.
Leitsatz »Zauber«:
Hinter jedem Zauber steckt oft harte Arbeit im Verborgenen.
1.2 Allgemeine Ratschläge für einzigartige Individuen
Diese nahezu unendliche Vielfalt an Lebenssituationen, individuellen Biografien undLerngeschichten ist auch der Grund, warum appellative, gut gemeinte und auch prinzipiell richtige allgemeine Ratschläge oft nicht ausreichen.
»Nimm Dir Zeit!«, »Gehe Dinge mit Ruhe und Besonnenheit an!«, »Verliere nicht die Geduld!«, »Gehe achtsam mit Dir und Deiner Umwelt um!«, »Ernähre Dich gesund!«, »Bleib in Bewegung, treibe Sport!«, »Achte auf ausreichenden Schlaf!«, »Gönne Dir regelmäßige Pausen!«, »Mach, was Dir Spaß und Freude bereitet!«, »Pflege Deine Beziehungen!«, »Sei zuversichtlich und denke positiv!«. Wer würde vielem von dem nicht zustimmen? Und als Leitsätze mögen sie für manche von uns in bestimmten Situationen auch nützlich sein. Doch sind sie aus verhaltenspsychologischer Sicht zu allgemein und unbestimmt, zu losgelöst von den Situationen und Bedingungen unseres Verhaltens, um uns hinreichend vor Stress zu bewahren. Auch unserem Zauberer wäre mit Ratschlägen wie »Gehe trickreich vor!«, »Verblüffe Deine Zuschauer!«, »Spiele mit Illusionen!« kaum hinreichend gedient.
Allerdings gibt es für viele der oben aufgeführten Ratschläge durchaus brauchbare Ratgeber, die ausführlich darauf eingehen, wie die damit verbundenen Verhaltensziele in bestimmten Situationen zu erreichen sind. Ob diese jedoch auf unsere individuellen Lebens- und Stresssituationen oder die unserer Klienten bzw. Patienten übertragbar und persönlich brauchbar sind, müssen wir in der Regel selbst herausfinden. Die Ausführungen in diesem Buch können dabei Unterstützung bieten, indem sie auf Aspekte und Prinzipien hinweisen, die bei der Veränderung des Verhaltens-in-einer-Situation aus lernpsychologischer Sicht wichtig sind. Hierfür werden wir uns zu Beginn mit den Besonderheiten des verhaltenspsychologischen und verhaltenstherapeutischen Ansatzes beschäftigen und anschließend der Frage nachgehen, wie und inwieweit wir Verhaltensprozesse, sei es beim Stressmanagement oder in der Psychotherapie, im erwünschten Sinne kontrollieren können und wo die Grenzen dieser Prozesskontrolle liegen. Dabei werden wir die Kontrolledes Verhaltens in einen allgemeineren Zusammenhang stellen, indem wir uns anschauen, wie Prozesse in der unbelebten und belebtenNatur generell ablaufen und inwieweit diese kontrollierbar sind. Wir werden für manche Leser vielleicht verblüffende Parallelen und Analogien behandeln zwischen Prozessen wie dem sanften Dahingleiten des Wassers in einem Fluss, dem plötzlichen Auftreten von Turbulenzen und schließlich dem unvorhersagbaren chaotischen Verlauf einerseits, und dem Geschehen bei Verhaltensprozessen andererseits, die einer ähnlichen Dynamik folgen, bis hin zu den Veränderungsprozessen im Rahmen einer Psychotherapie, bei der wir uns nicht selten bemühen, chaotische Prozessverläufe zu verhindern oder wieder in geordnete Bahnen zu lenken.
Aber bei aller Verblüffung kann ich nicht zaubern. Auch kann ich kein »Handbuch zur Lebensbewältigung« für jeden schreiben. Dies ist, wie wir bei der Betrachtung dynamischer Prozesse, zu denen auch unser Verhalten gehört, sehen werden, prinzipiell unmöglich. Ich überlasse es deshalb Ihnen, meinen Kolleginnen und Kollegen sowie allen interessierten Laien, herauszufinden, mit welchen Werk- und »Denkzeugen« aus diesem Buch oder aus der Vielzahl möglicher Ratgeber oder aber aus Ihrer persönlichen Erfahrung Sie sich und anderen helfen können, den Belastungs- und Stresssituationen des Alltags wirkungsvoll zu begegnen, mitzuhelfen, dass die Turbulenzen im Leben nicht zu chaotischen Verläufen führen, und selbst bei chaotischen Verläufen wieder zurück in geordnete und stabile Bahnen zu finden, die wir mit Gesundheit, Wohlbefinden, Freude und persönlichem Glück verbinden.
Leitsatz »Ratschläge«:
Auch Ratschläge können »Schläge« sein, besonders wenn sie den Falschen treffen.
1.3 Ein bisschen Wissenschaftstheorie muss sein
Dieses Lehrbuch zu Stress und Stressmanagement ist wissenschaftlich ausgerichtet. Ich werde jedoch darauf verzichten, jede Aussage mit einer Fülle experimenteller oder sonstiger empirischer Studien höchsten Evidenzgrads zu untermauern. Stattdessen werde ich mich bei umschriebenen Fragestellungen auf ausgewählte Studien und Quellen beschränken. Dasselbe gilt auch für die Präsentation ausführlicher Reviews oder Metaanalysen, auf die ich zugunsten der Darstellung zahlreicher Beispiele und Hinweise weitgehend verzichte. Warum folge ich dieser Strategie?
Nun, zum einen hat die Stressforschung in den letzten einhundert Jahren zu zahlreichen Ergebnissen geführt, die belegen, wie Stress entsteht, wie er sich äußert, mit welchen Folgen er verbunden ist und wie man ihm begegnen kann.
Dies gilt vor allem für die experimentellen Arbeiten unter kontrollierten Bedingungen, wo bereits Hans Selye (1936, 1978), einer der Urahnen der Stressforschung, gezeigt hat, wie sich Stress- und Adaptationssyndrome auf der physiologischen Ebene manifestieren.
Ebenso belegen zahlreiche naturalistische Studien, mit welchen Reaktionen und Folgen umschriebene Stresssituationen in unserer Lebens- und Arbeitswelt verbunden sein können und welche Interventionen dabei von Vorteil sind. Auch wenn diese Studien nicht (im experimentellen Sinne) »kontrolliert« sind, so unterliegen sie doch auch gewissen Rahmenbedingungen, die die Objektivität, Reliabilität, Validität, Repräsentativität und den Geltungsbereich ihrer Ergebnisse bestimmen bzw. einschränken. Selbst einfache Beobachtungsstudien sowie die systematische Betrachtung von »Best Practice«-Beispielen unterliegen zahlreichen Einflüssen wie z. B. situativen oder populationsbezogenen Selektionseffekten.
Diese Forschungsansätze sind keine Gegensätze, sondern stellen komplementäre Strategien dar. Die Ergebnisse experimenteller Studien unter eng kontrollierten Bedingungen erlauben uns die Formulierung mehr oder minder allgemeiner Gesetze. Die Bedingungen naturalistischer Studien sind nicht oder nur teilweise kontrollierbar, so dass wir diese fehlende experimentelle Kontrolle durch eine »statistische Kontrolle« ersetzen und uns mit Wahrscheinlichkeiten begnügen müssen. In der freien Wildbahn dagegen sind angesichts der riesigen Streubreite möglicher Lebensräume und Lebenssituationen viele Bedingungen im Einzelfall nicht durch (nomothetisch-)wissenschaftliche Studien abgedeckt bzw. nicht abdeckbar.
»Das ›biopsychosoziale Modell‹ in der Medizin und Therapie«:
Auch das von George Engel (1977) sogenannte »biopsychosoziale Modell« kann als Ausdruck der Komplementarität von Nomothetik und Idiographie angesehen werden. Engel führte dieses Modell als Reaktion auf das bis dahin vorherrschende biomedizinische Modell ein, das ihm als klassisches naturwissenschaftliches und reduktionistisches Modell zu eng erschien, indem es die molekularbiologischen Aspekte von Krankheit (engl. disease) in den Vordergrund stellte und psychosoziale Aspekte ausklammerte. Er dagegen forderte in seinem biopsychosozialen Modell die explizite Einbeziehung psychosozialer Faktoren, mit dem Krankheitserleben (engl. illness) des Individuums im Vordergrund und der Anerkennung der therapeutischen Beziehung als eigenen Wirkfaktor.
International hat das biopsychosoziale Modell besondere Bedeutung erlangt, indem die Weltgesundheitsorganisation dieses Modell als Grundlage nahm zur Entwicklung ihrer »Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit« (engl. International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) (World Health Organization 2001).
Was folgt daraus für die wissenschaftliche Erklärung von Kausalzusammenhängen bei Stress und Stressmanagement?
Nach dem deduktiv-nomologischen Modell, auch als »Hempel-Oppenheim-Schema« bekannt (Hempel und Oppenheim 1948), leitet sich die deduktiv-nomologische Erklärung eines Sachverhalts aus zwei Komponenten ab: Allgemeinen Gesetzen und speziellen (Rahmen-)Bedingungen. Im Experiment werden die Bedingungen so gut wie möglich vereinfacht und kontrolliert, so dass die Gesetze erkennbar werden, die maßgeblich für die Ergebnisse sind. In naturalistischen Studien und vor allem im alltäglichen Leben ist es die nahezu unüberschaubare Vielfalt der speziellen Bedingungen, die (wissenschaftlich) unkontrolliert einen Sachverhalt bzw. Prozess bestimmen und das Erkennen von Gesetzen erschweren.
Beispiel »Stressmanagementtraining am Arbeitsplatz«:
Pars pro toto mag als Beispiel die Metaanalyse quasi-experimenteller Studien zur betrieblichen Gesundheitsförderung durch Stressmanagementtraining (SMT) dienen, in der die Autorinnen Bamberg und Busch (1996, S. 127) zusammenfassend anmerken:
»Die Programme und die Effektvariablen berücksichtigen vor allem individuelle Stressreaktionen. … Bei betrieblichen SMT bleiben somit wesentliche Elemente von Streß am Arbeitsplatz ausgeklammert: Stressoren und eine mögliche Reduzierung von Stressoren werden vernachlässigt. Ferner werden die Möglichkeiten von Streßmanagementinterventionen, die nicht das Individuum, sondern Merkmale des Arbeitsplatzes oder der Organisation betreffen, wie z. B. Arbeitsplatzgestaltung, weitgehend ignoriert.«
Die Ergebnisse dieser Metaanalyse betreffen ein Grundproblem der Stressforschung, das auch heute noch gilt und sich auf zwei Teilprobleme zurückführen lässt:
1. Das ProblemdiagnostischerAbbildbarkeit: Individuen und deren Eigenschaften lassen sich diagnostisch viel leichter und abgrenzbarer abbilden als Situationen (z. B. in der Arbeitswelt) in ihrer unendlichen Vielfalt und Erscheinungsform.
2. Das Problem der Zurechnung vonVerantwortung: Unsere ethischen und rechtlichen Überzeugungen tragen dazu bei, dass wir Verantwortung und Schuld eher auf Personen attribuieren als auf Institutionen oder gar auf Verhältnisse.
Das Problem diagnostischer Abbildbarkeit ähnelt formal der Geschichte vom verlorenen Schlüssel (Watzlawick 2009), in der ein Betrunkener seinen Schlüssel nicht dort im Dunkeln sucht, wo er ihn verloren hat, sondern unter einer Straßenlaterne, weil dort Licht ist. Unser diagnostisches Dunkelfeld ist die unüberschaubare Menge situativer Gegebenheiten, die sich noch dazu ständig ändern können, während wir Individuen im Scheinwerferlicht leicht und rasch »dingfest« machen und abbilden können.
Das Problem der Zurechnung von Verantwortung zeigt sich auch darin, dass wir bei Fehlern eher »nach dem Schuldigen«, dem »Sündenbock«, suchen als uns mit den oft komplexen und unüberschaubaren Rahmenbedingungen zu beschäftigen, die diese Fehler überhaupt erst ermöglicht haben (siehe Reason 1990, 2000a, 2008).
»Stress und persönliche Verantwortung«:
Um beim oben erwähnten Bild vom verlorenen Schlüssel zu bleiben: Personenzentrierte Ansätze beim Stressmanagement suchen den Schlüssel oft bei den Eigenschaften und Verhaltensweisen der Betroffenen, da diese im Laternenlicht leichter erkennbar sind als die vielleicht passenderen Schlüssel im Dunkelfeld der Lebenssituationen der Betroffenen. Dadurch kann der Eindruck entstehen »Wenn Du achtsam bist, positive Selbstwirksamkeitserwartungen entwickelst und Dir Skills wie systematische Entspannung, soziale Kompetenz und Zeitmanagement aneignest, kriegst Du Deinen Stress in den Griff«.
In der Tat können solche personenzentrierte Empfehlungen helfen, wenn sie verhaltensnah sind und zur Situation des Betroffenen passen. Aber wenn es dann doch nicht klappt? Dann kann im Umkehrschluss der Eindruck entstehen, der Betroffene sei selbst schuld an seinem Stress, z. B. weil er den Empfehlungen nicht oder nicht ausreichend oder nicht richtig gefolgt ist. In diesem Fall kämpft der Betroffene nicht nur weiter mit seinem Stress, sondern auch mit seinem Versagen beim Stressmanagement.
So sehr wir für unser Stressmanagement nach allgemein gültigen Wahrheiten, Gesetzen, Regeln, Rezepten und Empfehlungen suchen: Die Antwort liegt meist nicht auf dem asphaltierten Boden im gut einsehbaren Lichtkegel der Laterne, sondern im Dunkelfeld oft komplexer Lebenssituationen. Und dort stolpern wir bei unserer Suche nach dem Schlüssel nicht selten über Steine oder bleiben im Gebüsch hängen und können bei unserer Suche die Orientierung verlieren oder uns verirren. Doch wenn der Schlüssel wirklich in diesem Dunkelfeld liegt, kann es sich lohnen, gerade dort zu suchen, verbunden mit Hypothesen, wo er am wahrscheinlichsten liegen könnte und ggf. mit passenden Hilfsmitteln.
Stressmanagement ist also oft Arbeit im Detail, sei es bei der Analyse der speziellen Bedingungen für den Stress gerade dieser einzelnen Person, sei es bei der Entwicklung von Hypothesen zu einem passenden Modell für eben diese Person, wie sie mit diesem Stress am besten umgehen kann, oder sei es bei der Überprüfung und Evaluation dieses Modells an der Lebenswirklichkeit des Betroffenen.
Vergleichen wir hierzu abschließend (und etwas vereinfacht) noch einmal unsere beiden wissenschaftlichen Ansätze:
Nomothetiker und Statistiker orientieren sich bei der Betrachtung des Verhaltens eines Systems an Wahrscheinlichkeitsräumen und an Erwartungswerten. Wenn sie eine Wette abgeben müssten, würden sie sich im Einzelfall nach dem »Durchschnittswert« richten, denn dieser Wert ist im Rahmen eines probabilistischen Modells der beste Schätzwert, allerdings nur dann, wenn man sonst keine weiteren maßgeblichen Informationen über diesen Einzelfall hat. Wenn Sie also einem neuen Brieffreund, von dem sie nur wissen, dass er erwachsen und Deutscher ist, mit einem Anzug als Geschenk eine Freude machen wollten, würden Sie sich als Nomothetiker nach der Durchschnittsgröße und dem Durchschnittsgewicht der männlichen deutschen Erwachsenen richten und mit etwas Glück das »passende« Geschenk finden.
Der Idiograph dagegen ist eher ein Maßschneider. Aus alter Freundschaft zu seinen nomothetischen Kollegen mag er sich vielleicht vorab und allgemein sogar am Durchschnitt orientieren, z. B. wenn er für die nächsten 100 Business-Anzüge, die er anfertigen will, den Stoff bestellt. Dann jedoch beginnt seine eigentliche Arbeit im Detail, wobei er sich weniger am Durchschnitt, sondern vor allem an der Streuung der Einzelfälle orientiert und idealerweise jedem Einzelfall seinen eigenen Anzug schneidert. Der perfektionistische Maßschneider geht sogar noch weiter und ordert auch den passenden Stoff erst im Einzelfall, denn er überlegt weiter: Zu welchen Anlässen dient der Anzug? In welcher Jahreszeit soll er getragen werden? Soll er pflegeleicht sein? Nachhaltig? Mit jeder weiteren Frage bzw. Information kann sich das Bild vom »passenden Anzug« ändern bzw. weiter differenzieren, u. U. unter Eingehen von Kompromissen, wenn Entscheidungen zur Priorität bestimmter Auswahlkriterien getroffen werden müssen. Unser perfektionistischer Schneider geht sogar noch einen Schritt weiter und fragt seinen Kunden: »Möchten sie den Anzug auch noch in zehn Jahren tragen?« Falls die Antwort »Ja« lautet, erkundigt sich der idiographische Maßschneider bei seinen Kollegen in der Nomothetik-Abteilung, um wieviel sich der Bauchumfang eines männlichen Erwachsenen in dieser Altersklasse im Verlauf der nächsten zehn Jahre wahrscheinlich ändern wird. Diese nomothetische Information kann ihm dann für die Wahl einer entsprechend variablen Bundweite im Einzelfall helfen.
Wie nachfolgend deutlich wird, folgen wir hier dem Ansatz des idiographischen Maßschneiders, allerdings gerne mit einem gelegentlichen Besuch bei unseren nomothetischen Kollegen.
Leitsatz »Wissenschaft und Wissenschaftstheorie«:
Die Wissenschaft beschäftigt sich damit, was wir bei unserer Suche nach Erkenntnis tun. Die Wissenschaftstheorie beschäftigt sich damit, warum wir dies so und nicht anders tun.
1.4 Der verhaltenstherapeutische Ansatz
Betrachtet man sich die Flut vergangener und aktueller Publikationen zum Thema Stress und Stressmanagement, so könnte man meinen, dass hierzu eigentlich genug gesagt bzw. veröffentlicht wurde. Warum also noch ein Buch zum Thema »Stressmanagement«?
Nun, der Untertitel dieses Buchs liefert hierfür bereits einen ersten Hinweis: »Ein verhaltenstherapeutisches Lehrbuch«. Damit soll die Zielsetzung deutlich werden, ein praxisrelevantes Lehrbuch zu schreiben, das auf etablierten und (sofern möglich) evidenzbasierten lernpsychologischen und verhaltenstherapeutischen Prinzipien basiert. Es geht über einfache Pauschal-Empfehlungen (»Rezepte«) für Stressmanagement hinaus, indem es den Stellenwert einer vorausgehenden Verhaltensdiagnostik (hier v. a. einer funktionalenVerhaltensanalyse) und eines persönlichen Veränderungsplans betont und somit prinzipiell ein »maßgeschneidertes« individualisiertes Stressmanagement auf verhaltenstherapeutischer Grundlage ermöglicht.
Das Burnout-Syndrom wird als Sonderform von Stress sowohl theoretisch als auch praxisbezogen im selben verhaltenstherapeutischen Rahmen beschrieben, wobei seine Besonderheiten in Diagnostik und Behandlung explizit dargestellt werden. Ebenso wird seine Einordnung im Rahmen gängiger Klassifikationssysteme (ICD-10/-11 bzw. DSM-IV/-5) behandelt.
Natürlich gibt es auch im psychotherapeutischen bzw. verhaltenstherapeutischen Umfeld bewährte Ansätze, die sich mit dem Thema Stress und/oder Stressmanagement befassen (z. B. Meichenbaum 1985, 2012a/b; Kaluza 2018). Ich werde deshalb dort, wo bereits ausführliche Darstellungen zu Prinzipien, Strategien und Techniken zum Stressmanagement existieren, gerne darauf verweisen. Dies gilt auch für die Darstellung gängiger Stress-Theorien (z. B. Selye 1936, 1978; Cannon 1935; Lazarus 1997), die in der Literatur ausführlich beschrieben werden, sowie für die vielfältigen Beschreibungen typischer Stress-Reaktionen, nicht selten im Rückgriff auf den sprichwörtlichen »Säbelzahntiger«, der in vorvergangenen Zeiten unsere Ahnen in Angst und Schrecken versetzt haben soll.
1.4.1 Die Eigenschaften dieses Ansatzes
Dieser Ansatz verfolgt das Ziel der Entwicklung eines allgemeinen Modells zum Umgang mit Belastungen und Stress, das wir weiter unten als »Relationales Stress-Modell« genauer kennenlernen werden, und zwar mit folgenden Charakteristika:
1. »Stress« wird in diesem Modell als ein Ungleichgewicht in einem System definiert, auf das Anforderungen einwirken und dessen Bewältigungsmöglichkeiten nicht ausreichen, um angesichts dieser Einwirkungen und Belastungen seine Stabilität bzw. Funktionalität aufrecht zu erhalten. Das heißt, wir gehen bei jedem System, sei es in der unbelebten Welt oder in der belebten Welt, davon aus, dass es sich unter seinen üblichen Existenzbedingungen grundsätzlich in einer stabilen Balance (»Gleichgewicht«) befindet zwischen den Einflüssen, denen es von außen ausgesetzt ist und seinen Eigenschaften, aufgrund derer es seine Stabilität aufrechterhält. Diese Stabilität kann primär struktureller Art sein, z. B. bei unbelebten Systemen wie einer Brücke oder anderen Bauwerken, oder funktioneller Art, z. B. in biologischen Systemen, wo ein stabiler Zustand wie unser Blutdruck oder unsere Körperkerntemperatur auch angesichts vielfältiger Einflüsse von außen in einem »Fließ-Gleichgewicht« innerhalb bestimmter Grenzen aufrechterhalten bzw. an Anforderungen flexibel angepasst wird. Bei speziellen biologischen Systemen mit Bewegungs- und Handlungseigenschaften, wie es Tiere und Menschen darstellen, kommt dem Verhalten-in-einer-Situation eine wichtige Funktion zu, wenn es um die Aufrechterhaltung ihres Gleichgewichts geht, bis hin zu kognitiven Funktionen, die wir als Sonderform des Verhaltens verstehen.
2. Da wir uns hier primär mit dem menschlichen Verhalten in seinen unterschiedlichsten Facetten und Ausprägungsformen beschäftigen, wozu wir auch körperliche Reaktionen sowie Denken (Kognitionen) und Emotionen zählen, sind Grundlage dieses Ansatzes die vielfältigen Entwicklungen und empirischen Ergebnisse der Lerntheorie, wie sie sich in Ansätzen zur Verhaltensmodifikation und Verhaltenstherapie niedergeschlagen haben. Viele dieser Erkenntnisgrundlagen beruhen auf tierexperimentellen Studien, was uns allerdings nicht veranlassen muss, den Menschen (nur) als Tier anzusehen, sondern uns eher Hochachtung vor den zum Teil unglaublichen Lernleistungen unserer Mitgeschöpfe lehren kann.
Verhalten werden wir stets als »Verhalten-in-einer-Situation« verstehen und darstellen, ggf. und genauer auch als »Verhalten-einer-Person-in-einer-Situation«. Dabei orientieren wir uns an dem in der Verhaltensanalyse und Verhaltenstherapie bewährten sog. »SORKC–Modell«, das F. Kanfer und andere (z. B. Kanfer und Philipps 1975; Kanfer et al. 2012; Kanfer und Saslow 1965, 1974) in Anlehnung an die theoretischen und experimentellen Arbeiten von B. F. Skinner (1953) und anderen Verhaltenspsychologen für die Belange der klinischen Psychologie und Verhaltenstherapie als Arbeitsmodell entwickelt haben. Auch hier mögen uns andere Experten nachsehen, dass wir bei der Interpretation und Anwendung dieses Modells eine sehr verhaltens- und situationsnahe Orientierung einnehmen, wo sich eifrige Anhänger der sog. kognitiven Wende oder der dritten Welle der Verhaltenstherapie vielleicht eine häufigere Verwendung kognitiver Konstrukte gewünscht hätten. Da sich jedoch viele kognitive Konstrukte (z. B. »Selbstwirksamkeitsüberzeugung«, »Achtsamkeit«, »Schemata«) funktional aus der Lerngeschichte eines Menschen herleiten lassen, werden wir bei der Behandlung von »Kognitionen« (als besondere Form des Verhaltens) darauf näher eingehen.
Nach diesem universal anwendbaren Modell für »Verhalten-in-einer-Situation« werden wir im Hinblick auf Belastungen und Stress sowohl das jeweilige Verhalten einer Person als auch die jeweilige Situation sowie deren funktionalen Zusammenhang betrachten und die Ergebnisse dieser funktionalen Verhaltensanalyse zum Leitfaden für die Entwicklung »alternativer« Situationen und Verhaltensweisen im Rahmen des Stressmanagements nutzen.
Stress und Stressmanagement sind sehr individuelle Angelegenheiten, ausgenommen vielleicht bei Katastrophen oder anderen Extremsituationen, die nahezu jeden von uns »an den Rand« der Bewältigung bringen. Wie ein Mensch mit Anforderungen umgeht, hängt wesentlich von seiner Lerngeschichte ab. Glücklicherweise weisen viele Menschen, die in einem gemeinsamen Kulturraum leben, für alle praktischen Zwecke ähnliche Lerngeschichten auf, nicht zuletzt aufgrund ähnlicher Lebenssituationen, sodass wir diese Gemeinsamkeiten für unsere Betrachtungen nutzen können (z. B. Anforderungen und Bewältigungsstrategien in verschiedenen Berufen, Tätigkeitsfeldern oder Beziehungen). Allerdings kann Stress auch eine sehr individuelle oder persönliche Note aufweisen, die ohne die Kenntnis der jeweiligen Lerngeschichte und Lebenssituation nicht verstanden werden kann, was gerade allgemeinen Ratgebern zum Stressmanagement (»gut für Jeden und Alles«) Grenzen setzt.
Dementsprechend bedeutet dieser universale Ansatz für das Stressmanagement nicht, dass unsere Betrachtungen und insbesondere mögliche Empfehlungen für »Alle« gelten (im Sinne einer allgemeinen Norm), sondern im Gegenteil: ein effektives Stressmanagement setzt in der Regel die Berücksichtigung der Lerngeschichte eines Menschen voraus, vor allem bei komplizierten oder gar einzigartigen Entwicklungen. Universal sind dagegen die Gesetzmäßigkeiten des Lernens, die bei einem Menschen mit seinen Anlagen dazu führen, dass er Belastungen gerade so und nicht anders bewältigt. Diese Universalität der Gesetzmäßigkeiten des Lernens einerseits und die Individualitätdes Menschen auf der Basis seiner persönlichen Lerngeschichte und Lebens- bzw. Verhaltenssituationen andererseits stellen eine zentrale Grundlage dieses Ansatzes dar.
Dieser Betrachtungsansatz rechtfertigt auch, ein solches Buch für Verhaltenstherapeuten zu schreiben, die es gewohnt sind, bei ihren Patienten und Klienten Verhalten-in-einer-Situation funktional zu analysieren und für den Einzelfall die angemessenen Interventionen abzuleiten. Dabei dient das Ergebnis der jeweiligen Analyse als Hypothese für das weitere Vorgehen. Stimmt unsere Analyse, dann sind wir in der Lage, den positiven Effekt einer Intervention genauer vorherzusagen, als es eine blinde Vorhersage auf zufälliger Basis erlauben würde.
Dieser universale Ansatz erlaubt es uns auch, phänomenal völlig unterschiedliche Bereiche von Stress und Stressmanagement zu betrachten, solange sich die betrachteten Phänomene als Verhalten-einer-Person-in-einer-Situation darstellen lassen (z. B. bei der Betrachtung möglicher Stressquellen wie Krankheit, Arbeitsüberforderung, Katastrophen und andere schicksalshafte Lebensereignisse; oder möglicher Stressmanagement-Strategien wie Entspannung, Achtsamkeit, aktives Coping, Problemlösen).
1.4.2 Ein Vergleich mit anderen Bereichen
Im Folgenden werden wir nicht selten über unseren verhaltenstherapeutischen Tellerrand hinausblicken und sehen, dass sich der Blick auf andere Wissenschaftsbereiche wie Physik und Biologie, aber auch auf die Situationen des Alltags durchaus lohnt. Menschen haben sich schon immer darüber Gedanken gemacht, wie sie mit Anforderungen und Belastungen am besten fertig werden, und sie haben im Lauf der stammesgeschichtlichen Evolution durchaus bewährte, ja manchmal geradezu elegante Strategien entwickelt, Belastungen zu verhindern, ihnen rechtzeitig auszuweichen oder sie anderweitig zu bewältigen. Interessant ist, wie gerade in der jüngsten Zeit die Entwicklungen in der Computerwissenschaft, und hier besonders im Bereich lernender Maschinen und künstlicher Intelligenz, darauf hinauslaufen, die situative Bedingtheit jeden Verhaltens und die große Bedeutung der Lerngeschichte anzuerkennen und zu versuchen, Maschinen zu lernenden Systemen in ihrer jeweiligen Umgebung weiter zu entwickeln (Valiant 2013). Vielleicht hängen manche Stressquellen in unserer heutigen gesellschaftlichen Entwicklung sogar damit zusammen, dass wir, auf der Grundlage falscher Annahmen über menschliches Verhalten, lernenden Menschen zumuten, eher wie Maschinen zu funktionieren. Ein solch »mechanistisches« Bild menschlichen Verhaltens kann z. B. in der Arbeitswelt dann zu Problemen führen, wenn normative Anforderungen an das menschliche Verhalten gestellt werden, die unangemessen oder gar schädlich sind.
Aber nicht nur ein Blick auf aktuelle oder künftige Entwicklungen ist lehrreich, sondern auch ein Blick in die Vergangenheit: Die Natur hat immer schon vor dem Problem gestanden, wie sie »belastbare« Strukturen entwickelt. Dabei hat sie bei biologischen Systemen aus gutem Grund oft weiche, dehnfähige Strukturen (z. B. Sehnen und Muskeln) entwickelt, die aufgrund ihrer Elastizität im Verbund mit festeren Strukturen (z. B. Knochen) an die Belastungen, denen Pflanzen und Tiere ausgesetzt sind, bestens angepasst sind. Während die Euphorie der frühen Ingenieurskunst mit der Bevorzugung fester, z. B. »stählerner« Strukturen zwar Erfolge feierte, aber auch eine Serie von Unfällen und Katastrophen nach sich zog, bedient sich die moderne Materialwissenschaft zunehmend der Erfahrungen aus der Natur, da sich bio-mechanische Strukturen im wahrsten Sinne des Wortes oft als tragfähiger erwiesen haben als bis dahin verwendete rein mechanische Strukturen (Gordon 1988).
1.4.3 Stressmanagement individuell und auf Systemebene
Vielleicht wäre es angebracht, wenn auch die Sozial-Ingenieure der heutigen Zeit die evolutionären Erfahrungen der Natur und die Gesetzmäßigkeiten menschlichen Verhaltens und Lernens mehr berücksichtigen würden, vor allem, wenn sie gesellschaftliche Strukturen schaffen, die hinsichtlich des Verhaltens der Menschen, die in diesen Strukturen leben, arbeiten oder wohnen, tragfähig sein sollen und nicht zu Unfällen oder Katastrophen führen. Dies gilt insbesondere für globale Strukturen (Umwelt- und Klima-Schutz, Wirtschaft, Finanzen und Handel usw.), bei deren mangelnder Tragfähigkeit große Teile der Menschheit, wenn auch z. T. in unterschiedlichem Ausmaß, großen Belastungen ausgesetzt werden können.
Damit sind zugleich auch die Grenzen eines individuellen, personenbezogenen Stressmanagements aufgezeigt. Wenn z. B. eine ganze Organisation »im Stress« ist, hat es wenig Sinn, nur am individuellen Verhalten Einzelner anzusetzen, es sei denn, dieses hätte entscheidenden Einfluss auf die stressrelevanten Organisationsbedingungen. Stattdessen sind hier organisationsbezogene Ansätze gefragt, etwa im Rahmen der Organisationsentwicklung und Unternehmensberatung. Auch wenn ganze Gesellschaften oder globale Strukturen »im Stress« sind, z. B. im Rahmen einer Weltwirtschaftskrise oder einer Pandemie, sind Lösungen auf den entsprechend globalenSystem-Ebenen wie Politik und Wirtschaft erforderlich. Dies schließt nicht aus, dass bei den zentral handelnden Personen bzw. Entscheidungsträgern ein persönlicher Stressmanagement-Ansatz sinnvoll sein kann, da auch diese Entscheidungsträger als Handelnde in einem System jeweils ein Verhalten zeigen, das mit entsprechenden Konsequenzen verbunden ist, wobei diese Konsequenzen viele Menschen betreffen und durchaus globaler Art sein können.
1.4.4 Stress als gesellschaftliches Phänomen
Da wir Stress im Rahmen eines Verhalten-in-einer-Situation-Ansatzes verstehen, folgt daraus, dass neuzeitliche Situationen, die nur in einer zivilisatorischen Gesellschaft wie der unsrigen denkbar sind (z. B. medial vermittelte Wirklichkeiten mit Informationsüberflutung, neue Arbeitsanforderungen durch technologischen Fortschritt wie z. B. Bildschirmarbeit) zu anderen Stressformen führen wie noch vor ein paar Hundert Jahren, wo natürliche (im Sinne von naturnahen) Lebensbedingungen und die unmittelbare Erfahrung (im Vergleich zu medial vermittelter) den Alltag bestimmten. Ob der Design heutiger gesellschaftlicher Strukturen und Lebenswelten insgesamt im Vergleich zu früher zu einem größeren Ungleichgewicht im Hinblick auf unsere Verhaltensmöglichkeiten führt, ist eine spannende Frage, die wir am Ende unserer Betrachtungen unter dem Aspekt der Gesundheit nochmals aufgreifen werden.
Das Thema Stress wird in unserer Gesellschaft oft thematisiert, bis hin zur politischen Forderung nach Anti-Stress-Verordnungen oder anderen Maßnahmen zur Eindämmung oder Prävention von Stress. Oft wird dabei impliziert, dass Stress krank mache, und der Anstieg psychischer Erkrankungen mit dem zunehmenden Stress in unserer Gesellschaft verbunden sei. Nun lassen sich psychische Störungen und Erkrankungen durchaus in einem Diathese-Stress-Modell interpretieren (Davison und Neale 2014), indem entsprechende Dispositionen auf Seiten des jeweiligen Individuums ins Verhältnis gesetzt werden zu den Anforderungen in seiner Lebenswelt. So gesehen können wir im Rahmen unseres generellen Ansatzes auch psychische Störungen als eine spezielle Ausprägungsform stressbezogener Reaktionsformen ansehen, und zwar dann, wenn die jeweiligen Anforderungen die Bewältigungsmöglichkeiten eines Menschen so stark überfordern, dass dieser unter Konsequenzen (Symptomen) leidet, denen wir aufgrund ihrer Schwere oder ihrem Muster Krankheitswert beimessen.
Natürlich steigt in einer Gesellschaft insgesamt der Stress-Pegel, wenn viele Menschen unter Stress oder psychischen Erkrankungen leiden, wie immer dieser Anstieg gesehen oder interpretiert wird. Wenn dieser Anstieg zu einer zunehmenden Zahl frühzeitiger Berentungen führt, die betroffenen Menschen also nicht mehr in gesellschaftliche Arbeits- und Teilhabeprozesse eingebunden sind, kann dies zu weiteren gesellschaftlichen Problemen führen. Da in Deutschland von Seiten des Gesetzgebers im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes gefordert wird, auch psychische Belastungen in entsprechende Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz mit einzubeziehen, werden wir uns auch diesem Thema widmen.
Bei der gesellschaftlichen Diskussion zum Thema Stress sollten sich die Angehörigen der Berufe, die sich mit dem Thema menschlichen Verhaltens und/oder seiner Störungen beschäftigen (»Psycho«-Berufe), aufgrund ihrer speziellen Ausbildung und Erfahrungen einbringen, damit nicht naiv-psychologische oder unwissenschaftliche Konzepte das gesellschaftliche Handeln bestimmen. So gesehen soll auch das vorliegende Werk dazu beitragen, den Stellenwert der Stressmedizin, der Psychotherapie und der Verhaltenstherapie bei der Entwicklung und dem Einsatz von Stressmanagement-Programmen zu verdeutlichen.
Darüber hinaus sind wir in unserer doppelten Rolle als Verhaltensexperten einerseits und als Staatsbürger andererseits auch dazu aufgerufen, auf gesellschaftliche Umstände und Prozesse hinzuweisen, die für die Entstehung von Stress und den Umgang damit wichtig sind. Hierfür werden wir die wesentlichen Kontingenzen und Lebensbedingungen betrachten, die auf den verschiedenen Systemebenen (soziale Beziehungen privat und bei der Arbeit; Institutionen und Organisationen; Gesellschaft und Kultur; globale Lebensräume) unser eigenes, individuelles Verhalten und den damit verbundenen Stress maßgeblich bestimmen. Denn im Gegensatz zu Naturvölkern, die auf relativ engem Lebensraum in ihrem Existenzkampf den Naturgewalten und naturgegebenen Stressoren wie dem Säbelzahntiger trotzen mussten, sind es heute vor allem die von uns geschaffenen gesellschaftlich-kulturellen Lebensbedingungen, die räumlich übergreifend immer universaler und globaler unser Leben beeinflussen. Diese »modernen« Lebensbedingungen stehen in enger Wechselwirkung mit der Natur, deren Gesetze wir nicht ungestraft übergehen können und denen wir mit Achtsamkeit und Achtung begegnen müssen, um unser Überleben und das nachfolgender Generationen zu sichern.
1.4.5 Stressmanagement für Therapeuten und interessierte Laien
Damit auch Leser ohne explizite psycho- bzw. verhaltenstherapeutische Ausbildung die wesentlichen Aussagen nachvollziehen können, habe ich Vieles ausführlicher dargestellt und mit Alltags-Beispielen unterlegt, oft auch umgangssprachliche Formulierungen gewählt; die Experten in Psychotherapie und Verhaltenstherapie mögen mir dies nachsehen. Gleichermaßen gehe ich hier nicht auf alle möglichen Psychotherapie-«Schulen« ein, da ich prinzipiell der Ansicht bin, dass die Verhaltenstherapie einen geeigneten Rahmen darstellt, um auch die Ansätze anderer Schulen zu berücksichtigen. Deren Anhänger, die diese wissenschaftstheoretische Position nicht teilen, mögen mir auch dies nachsehen, ja vielleicht sogar motiviert werden, bessere Alternativmodelle für ein praktikables Stressmanagement im Rahmen ihres Ansatzes zu entwickeln.
Auch das Manual, das begleitend zu diesem Lehrbuch veröffentlicht wird, beruht auf verhaltenspsychologischen Prinzipien und soll durch viele praxisbezogene Hinweise, Anleitungen und Übungen die Umsetzung eines verhaltenstherapeutischen oder verhaltensmodifikatorischen Stressmanagements im Alltag unterstützen (Arthur Günthner, Anil Batra (2022) Stressmanagement und Burnout-Prävention. Kohlhammer Verlag; Link zum Shop: shop.kohlhammer.de/burnoutpraevention).
1.5 Das Relationale Stress-Modell (RSM)
Auf der Grundlage der bisherigen Ausführungen und mit Blick auf das, was folgt, wollen wir bereits an dieser Stelle das Relationale Stress-Modell betrachten, auf dem der hier vorgestellte verhaltenstherapeutische Ansatz basiert ( Abb. 1.1). Dieses Modell ist hier noch sehr allgemein, formal und stringent formuliert, wird jedoch durch die nachfolgenden Beschreibungen und vielen »lebendigen« Beispiele in seiner inhaltlichen Bedeutung klarer werden.
Das Relationale Stress-Modell (RSM) ist die Anwendung verhaltenswissenschaftlicher Grundlagen und Prinzipien auf Anforderungen und Belastungen, denen ein System (im engeren Sinn ein Organismus, ein Individuum, eine Person) bei seinem Verhalten-in-einer-Situation ausgesetzt ist. »Relational« bedeutet hierbei, dass die Eigenschaften der Umwelt stets »in Relation« zu den Eigenschaften des Systems (des Organismus, des Individuums) und dessen Verhalten gesehen werden müssen, sowohl auf der biologischen als auch auf der psychischen, der sozialen sowie der ökologischen Ebene.
Im engeren Sinn bezieht sich »relational« auf das Verhältnis der Anforderungen der Umwelt zu den Belastungen des Systems oder Organismus, d. h. auf die Frage,
Abb. 1.1: Das Relationale Stress-Modell (RSM)
inwieweit ein System oder Organismus bei Anforderungen der Umwelt sein stabiles Gleichgewicht aufrechterhalten kann, indem es oder er aufgrund seiner System- oder Organismuseigenschaften und seines Verhaltensrepertoires adaptiv seine Funktionen innerhalb eines sicheren Bereichs hält und bewahrt.
»Stress« entsteht dann, wenn die Anforderungen der Umwelt zu einer relativen oder absoluten Unter- oder Überbelastung führen, bei der das System oder der Organismus in einen kritischen Bereich gerät, in dem seine Funktion beeinträchtigt und sein Gleichgewicht gefährdet sind, oder in einen überkritischen Bereich, in dem es zum irreparablen Funktionsverlust und Schaden kommt.
Diagnostisch basiert das Relationale Stressmodell vor allem auf einer lernpsychologisch fundierten funktionalen Verhaltensanalyse. Aus den Ergebnissen dieser Analyse werden Hypothesen abgeleitet, welche Interventionen für das Stressmanagement im Rahmen einer Verhaltensmodifikation oder Verhaltenstherapie indiziert sind.
Bevor wir uns den Grundlagen von Stress und Stressmanagement zuwenden, wollen wir zuvor noch einen Aspekt betrachten, der in der Wissenschaftsgeschichte relativ neu ist, jedoch überaus bedeutsam, wenn es um Gleichgewicht und Stabilität geht, sei es in der unbelebten Natur, wie beim Wetter, oder in der belebten Natur, z. B. in der Psychotherapie.
1.6 Psychotherapie: Von der Kontrolle zum Chaos und wieder zurück
Den Fluss des Lebens hat Heraklit mit seinem Spruch »Alles fließt, nichts bleibt« (gr. panta rhei, ouden menei) versinnbildlicht. Wir alle kennen das sanfte Dahingleiten des Wassers in einem Fluss, das uns an heißen Tagen zum Baden einlädt. Doch kennen wir auch das plötzliche Auftreten von Turbulenzen und wissen um die Gefahren, die einem Badenden durch Strudelbildung und Strömungen unter der Wasseroberfläche drohen können.
Wie in einem Fluss verläuft auch der Großteil unseres Lebens in ruhigen, kontrollierten und vorhersehbaren Bahnen, doch kann es immer wieder zu mehr oder minder heftigen Turbulenzen kommen, deren Entstehung und Verlauf unvorhersehbar sind und die wir in unserem Zusammenhang als »Chaos« und sinnbildlich für Stressphänomene ansehen.
Wenn Menschen uns aufgrund solcher Turbulenzen in ihrem Leben aufsuchen und uns im Rahmen einer Psychotherapie um Hilfe bitten, um nicht unterzugehen, stehen wir vor der Aufgabe, weitere chaotische Prozessverläufe zu verhindern oder wieder in geordnete, kontrollierte bzw. kontrollierbare Bahnen zu lenken.
Wieviel Kontrolle haben wir aber wirklich als Psychotherapeuten über das Verhalten derjenigen, die wir beraten, psychoedukativ begleiten, coachen oder behandeln? Bereits der Begriff »Kontrolle« mag manchen von uns stören, verbinden wir damit doch oft negative Assoziationen wie Einengung, Unfreiheit, Fremdbestimmung usw. Andererseits erschrecken wir, wenn wir daran denken, dass unser Herz außer Kontrolle geraten könnte, wie es z. B. bei Herzrhythmusstörungen geschieht. Auch möchten wir nicht, dass der Hochgeschwindigkeitszug, in dem wir gerade sitzen, außer Kontrolle gerät. Und auch bei dem Gedanken, dass das globale Finanzsystem ins Wanken und außer Kontrolle gerät, wird uns nicht ganz wohl sein.
Wenn wir uns einer Operation unterziehen, lassen wir es zu, ja vertrauen geradezu darauf, dass Andere, wie Chirurgen und Anästhesisten, die weitgehende Kontrolle über unsere Existenz ausüben, zumindest über eine bestimmte Zeitspanne. Dabei haben die Bedingungen eines Operationssaals eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was wir als Laborbedingungen mit »experimenteller Kontrolle« bezeichnen. Unser psychotherapeutisches Handeln jedoch findet in der bunten Vielfalt realer Lebenswelten statt, definiert durch natürliche, klimatische, kulturelle, gesellschaftliche und sonstige Lebensbedingungen, die das Verhalten entscheidend beeinflussen. Was können wir als Psychotherapeuten in diesen natürlichen Lebenswelten bewirken? Und was hat dies mit »Chaos« zu tun?
Nun, bereits der Begriff »natürlich« kann hinterfragt werden. Wir haben der Natur im Rahmen unserer kulturellen und industriellen Entwicklung viele ihrer unbarmherzigen Konsequenzen wie Hunger, Erfrieren oder durch eine Epidemie dahingerafft werden weggenommen, zumindest in Teilen, und haben uns dadurch viel »natürlichen« bzw. naturgegebenen Stress erspart. Unsere schützenden, klimatisierten Behausungen, unsere befestigten, geebneten und vernetzten Transportwege, unsere Gesundheitssysteme, unsere Agrar- und Wirtschaftssysteme und vieles andere mehr sind oft weit von den natürlichen Verhaltens- und Stressbedingungen entfernt. Doch haben auch diese relativ neuen Bedingungen einen wesentlichen Einfluss auf uns, indem sie, aus lernpsychologischer Sicht, unser Verhalten »kontrollieren«. Natürlich ist diese Kontrolledes Verhaltens unendlich vielfältiger und auch schwerer zu fassen geschweige denn zu messen im Vergleich zu experimentellen Laborbedingungen. Ja, selbst wenn wir davon ausgehen, dass unser Verhalten wie alle physikalischen Prozesse in der Natur deterministisch bestimmt ist, könnten wir es angesichts der Vielfalt unterschiedlicher und sich stetig ändernder Lebensbedingungen in vielen Fällen unmöglich vorhersagen.
Damit sind wir bei einem Grundproblem angelangt. Wie können wir zum einen davon ausgehen, dass viele Prozesse in der Natur und in unserer Gesellschaft weder vorhersehbar noch kontrollierbar sind und sogar im »Chaos« enden können, dennoch aber annehmen, dass unser eigenes Handeln eine vorhersagbare Wirkung hat, sogar auf das Verhalten anderer Menschen, die sich uns anvertrauen? Verfügen wir nicht über evidenzbasierte Interventionsstrategien, die uns leitliniengerecht nahelegen, wie wir was bei wem in welcher Zeit bewirken können? Zumindest folgen wir diesem Ansatz beim Umgang mit klinisch definierten psychischen Störungen wie z. B. Angsterkrankungen, Depressionen, Psychosen etc. Gilt dies nicht auch für Störungen im Erleben und Verhalten von Menschen, die sich im Stress fühlen?
Es wäre sicher schön, als Orientierung eine allgemein gültige Leitlinie »Stress und Burnout« zu haben, mit der wir den Überlastungen unseres täglichen Lebens gegenübertreten könnten. Sie könnte auf den Grundlagen der experimentellen und klinischen Forschung zum Stressgeschehen aufbauen, die seit den Untersuchungen von Hans Selye eine stürmische Entwicklung durchlaufen hat. Sobald wir jedoch in die Alltagswelten eintreten, sehen wir, dass Grundlagenforschung und evidenzbasierte klinische Forschung auch hier ihre Grenzen haben. Dies liegt, wie wir bereits oben bei unseren wissenschaftstheoretischen Überlegungen angesprochen haben, zum einen an der nahezu unendlich großen Menge möglicher Prozesse und Bedingungen, die mit dem Stressgeschehen in der Alltagswelt verbunden sein können, und zum anderen an der unvermeidbaren Kopplung jeder Art von Stress an die individuelle Lebens- und Lerngeschichte bei uns allen.
Wie gehen wir mit dieser individuellen Einzigartigkeit einerseits und unserem Bemühen um Kontrolle, sei es als Kontrolle unserer selbst (Selbstkontrolle) oder als Kontrolle Anderer oder unserer Umwelt, um?
Eine mögliche Antwort findet sich dort, wo man eher das Gegenteil von Kontrolle vermutet: im Chaos, genauer gesagt in der Chaos-Theorie, die sich wissenschaftlich mit sog. nichtlinearen, dynamischen Prozessen beschäftigt (Peitgen et al. 1992, 1994). Nichtlineare Prozesse waren lange Zeit nicht unbedingt das Lieblingskind der Wissenschaften, und erst mit dem Aufkommen der modernen Computerwissenschaft und Informationstechnologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm ihre Entwicklung Fahrt auf. Auch viele Psychotherapeuten dürften bei dem Wort »Chaos« wohl eher an die vielen Begebenheiten im Alltag denken, die ihnen von ihren Klienten bzw. Patienten berichtet bzw. dargeboten werden. Und doch behandelt die Chaostheorie Prozesse, die in verblüffender Weise an das Geschehen bei Stress erinnern und auch im Rahmen psychotherapeutischer Prozesse zu beobachten sind. Vielleicht haben diese Prozesse sogar eine noch allgemeinere und wesentliche Bedeutung für die Entwicklung menschlichen Verhaltens überhaupt, auch wenn deren Beschreibung, Analyse und Modellierung im psychosozialen Bereich bei weitem nicht die methodische und mathematische Stringenz erreicht wie dies in der Physik, der Chemie oder der Biologie der Fall ist.
Der berühmte »Schmetterlingseffekt« aus der Chaos-Theorie hat es inzwischen auch schon in die allgemeine Medienlandschaft geschafft und dürfte vielen bekannt sein. Er wurde als Begriff im Zusammenhang mit den Forschungen des Meteorologen Edward N. Lorenz (1972) geprägt und steht als Bild für die hypothetische Frage, ob schon der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien ausreichen könnte, um in Texas einen Tornado auszulösen. Allgemein wird damit beschrieben, dass bei manchen nichtlinearen dynamischen Prozessen bereits sehr kleine Änderungen in den Ausgangsbedingungen zu großen, prinzipiell nicht vorhersehbaren Auswirkungen bzw. Prozessverläufen führen können (chaotische Sensitivität). Solche Prozesse finden sich z. B. bei den bereits erwähnten Turbulenzen, beim Wettergeschehen, bei chemischen Reaktionen, physikalischen Phänomen und selbst bei medizinisch relevanten Phänomenen, z. B. bei der Erregungsausbreitung im Herzen, die für unseren periodischen und regelmäßigen Herzrhythmus sorgt und in manchen Fällen, z. B. beim Herzflimmern, einen chaotischen Verlauf nehmen kann.
Dass solche chaotischen Prozesse, auch wenn sie deterministischen Gesetzen folgen, letztlich und prinzipiell unvorhersagbar sind, muss uns keinesfalls zum Fatalismus führen. So hat bereits Lorenz in seinem berühmten Vortrag darauf hingewiesen, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings ebenso ausreichen könnte, einen Tornado zu verhindern: »If the flap of a butterfly’s wings can be instrumental in generating a tornado, it can equally well be instrumental in preventing a tornado« (Lorenz 1972, S. 1).
Wenn wir dieses Bild mit aller Vorsicht auf unsere psychotherapeutische Praxis bzw. auf das Stressmanagement übertragen, so könnten in Überlastungssituationen, die wir mit Stress verbinden und die in ihrem Verlauf chaotischer Art sind, u. U. bereits kleine Änderungen der Ausgangssituation eine große Auswirkung im Hinblick auf wünschenswertere Konsequenzen haben. Und in der Tat lässt sich bei vielen dynamischen Prozessen zeigen, dass sie gegenüber unterschiedlichsten Anfangsbedingungen ein nichtsensitives, stabiles Verhalten zeigen und auch bei unterschiedlichen Anfangsverläufen schließlich den gleichen Endzustand erreichen. Somit können wir für unser therapeutisches Handeln, auch hier mit aller Vorsicht, annehmen, dass beim Stressmanagement manchmal geringe Änderungen in der Situation oder in unserem Verhalten ausreichen können, um vomChaoszurStabilität zu gelangen.
Was tun wir, wenn unser periodischer, regelmäßiger Herzschlag unvorhergesehen in ein chaotisches Herzflimmern übergeht? Wir führen absichtlich eine Defibrillation durch, bei der die chaotische Bahn des Erregungsverlaufs wieder in ein stabiles, periodisches Muster überführt wird. Auch die Elektrokrampftherapie, die wir bei der Behandlung besonders schwerer, therapieresistenter Depressionen oder katatoner Zustände bei Schizophrenie einsetzen, kann als Versuch angesehen werden, chaotisch verlaufende Prozesse wieder in stabilere Bahnen zu überführen. In ähnlicher Weise könnten Pharmaka wirken sowie psychotherapeutische Interventionen oder durch Selbsthilfe-Manuale angestoßene Verhaltensänderungen. Dieses Einschwingverhalten dynamischer Prozesse auf den gleichen gemeinsamen Endpunkt bei unterschiedlichen Ausgangsbedingungen könnte nicht nur verständlich machen, weshalb unterschiedliche Modalitäten der Verhaltenskontrolle (chemisch/pharmakologisch, physikalisch/elektrisch, situativ/psychotherapeutisch usw.) in gleicher oder ähnlicher Weise wirksam sind, sondern auch, warum unterschiedliche psychotherapeutische Methoden zu einem gemeinsamen Endpunkt führen können.
Was bedeutet dies für unser Stressmanagement und unser psychotherapeutisches Handeln? Zum einen machen diese Ausführungen deutlich, dass Standardempfehlungen, seien sie noch so evidenzbasiert auf der Basis wissenschaftlicher Studien unter kontrollierten Bedingungen, schon bei geringen Änderungen der Ausgangsbedingungen im Alltag zu völlig verschiedenen Konsequenzen führen können (chaotische Sensitivität). Andererseits können bei definierten Prozessen ganz unterschiedliche Bedingungen herrschen und wir erhalten am Ende dennoch dasselbe Ergebnis (Konvergenzzu einem stabilen Verhalten).
Damit sind wir bei der Frage, ob wir Chaos kontrollieren können, und wenn ja, wie. Auch hier zeigt die Forschung, die sich vor allem physikalischen, chemischen, und biologischen Prozessen widmet, überraschende Parallelen zu Prozessen, die uns beim Stressmanagement und in der Psychotherapie begegnen. So lässt sich zeigen, dass selbst bei chaotisch verlaufenden Prozessen Inseln der Ordnung existieren, so wie wir z. B. auch im Inneren eines Orkans ruhige Zonen finden können. Das Prinzip der Kontrolle chaotischer Prozesse besteht nun darin, abzuwarten, bis der chaotische Prozess in seiner Bahn einer anderen Bahn nahekommt, die wir präferieren oder als wünschenswert ansehen. Man kann nun versuchen, durch eine geeignete »Perturbation« (Störung, Unordnung) bewusst eine Änderung der unerwünschten Bahn hin zu der erwünschten Bahn zu induzieren und so im günstigen Fall das System zu stabilisieren (Boccaletti et al. 2000). Dies entspricht dem Prinzip der Sensitivität, von dem Edward N. Lorenz sprach, als er hypothetisch davon ausging, dass ein (geeigneter) Flügelschlag eines Schmetterlings einen Tornado auch verhindern könne. Nun stellt sich für die Chaos-Forscher aber ein Problem: Wie können sie wissen, wann die Nachbarschaft einer chaotischen und unerwünschten Bahn zu einer erwünschten, periodischen bzw. stabilen Bahn erreicht ist? Und von welcher Art und Intensität muss die Perturbation sein, um ein Einschwingen des Systems auf die neue, erwünschte Bahn zu erreichen? Analoge Fragen stellen sich auch dem Psychotherapeuten bzw. den von Stress geplagten Zeitgenossen: Wann ist eine Änderung der Überlastungssituation oder der Stressreaktion am wahrscheinlichsten, und wie bzw. in welcher Intensität muss die Intervention erfolgen, damit eine stabile Änderung der Stresssituation bzw. des Verhaltens erreicht wird? In der Chaos-Forschung nennt man das die Frage der adäquatenZielfindung(engl. targeting). Und wieder finden wir eine verblüffende Analogie zwischen dem Vorgehen bei der Erforschung klassisch naturwissenschaftlicher Prozesse einerseits und der Analyse von Verhaltensprozessen in der Psychotherapie andererseits. Diese Analogie liegt darin begründet, dass man in beiden Fällen empirisch vorgeht und sich genau ansieht, wie der jeweils individuelle Prozess abläuft. Bei physikalischen bzw. mathematischen Prozessen erstellt man hierzu eine Zeitserie zum Verlauf einer dynamisch relevanten Variablen und prüft dann experimentell, inwieweit dieser Prozess durch externe Kontrolle beeinflussbar ist. Die Erfahrungen in dieser Zeit des Lernens (engl. learning time) nutzt man dann, um die richtige Perturbation auszuwählen. Analog hierzu führen wir beim verhaltenstherapeutisch orientierten Stressmanagement eine hypothetische funktionale Verhaltensanalyse durch, bei der wir das Zielverhalten und dessen Abhängigkeit von äußeren Bedingungen über einige Zeit erfassen und als Grundlage für unsere Intervention benutzen.
Beispiel »Chaos-Prävention und der kleine Stupser in Beziehungen«:
Der kleine Stupser zur rechten Zeit, wohl dosiert und in die richtige Richtung, lässt sich auch in Partnerschaftsbeziehungen beobachten, sei es körperlich, verbal (z. B. als kleiner Hinweis) oder auf andere Weise. Er hilft uns als »Perturbation«, von einer (drohenden) chaotischen Bahn wieder zurück in geordnete Bahnen zu gelangen. Unser Partner weiß oft sehr wohl, wann solch ein Stupser angezeigt ist, verfügt er oder sie doch über ausreichende Erfahrungen im Rahmen der gemeinsamen Lernzeit, sprich Partnerschaft.
Doch die Analogie geht noch weiter, denn wir haben bei der Auswahl einer Perturbation bei mathematisch-physikalischen Prozessen zwei Möglichkeiten (Boccaletti et al. 2000).
Zum einen können wir an der äußeren Kontrolle ansetzen und die Art der zur Stabilisierung eines Systems erforderlichen Perturbation aus den experimentellen (gelernten) Daten herausrechnen: »Selection of the perturbation is done by means of a reconstruction from experimental data of the local linear properties of the dynamics around the desired point« (Boccaletti et al. 2000, S. 108) (»Die Auswahl der Perturbation erfolgt mittels Rekonstruktion der lokalen linearen Eigenschaften des dynamischen Verlaufs um den erwünschten Punkt herum auf der Basis der experimentellen Daten«; Übersetzung durch den Verfasser).
Zum anderen aber können wir auch an der inneren Kontrolle eines Systems ansetzen. So können wir z. B. bei einem System, das instabil bzw. aus einer stabilen Bahn geworfen zu werden droht, durch negative Rückkopplung des Systemverhaltens erreichen, dass es wieder in einen stabilen Zustand zurückkehrt. Hierfür brauchen wir in diesem System eine Zustandsvariable, die uns während seines Betriebs zugänglich ist und die bei einer kritischen Abweichung des Systemverhaltens von einer stabilen Bahn dafür sorgt, dass stabilisierende Perturbationen im Rahmen des Feedbacks das gefährdete System proportional zu den festgestellten Abweichungen wieder auf einen stabilen Kurs zurückführen. Mit den Worten der Autoren (Boccaletti et al. 2000, S. 108): »In some practical situations, however, it may be desirable to perform perturbations on a state variable accessible to the operator« (»In einigen Situationen jedoch mag es wünschenswert erscheinen, Perturbationen bei einer Zustandsvariable anzuwenden, die dem Systembetreiber zugänglich ist«; Übersetzung durch den Verfasser).
Beispiel »Auch Uhren leiden unter Stress«:
Die alten Römer hatten es nicht so leicht, pünktlich zu sein. Für die Zeitmessung wurden im Römischen Reich Sonnen- und Wasseruhren benutzt, deren Werte abgelesen und zu dem Ort gebracht werden mussten, wo sie gebraucht wurden, wozu man oft Sklaven als Kuriere einsetzte. Die Zeitmessung war relativ ungenau, aber auf Minuten oder Sekunden kam es damals wohl weniger an.
Mechanische Uhren verfügen für die Zeitanzeige über Schwingsysteme mit einer Unruh und einer eingebauten Hemmung, wobei letztere wichtig ist für die »Kontrolle« der Drehfrequenz. Quarz-Uhren nutzen als Taktfrequenz die piezoelektrischen Schwingungen eines Quarzkristalls. Stimmen die Frequenzen bei diesen Uhren nicht überein mit der »echten« Referenzfrequenz (z. B. einer Atomuhr), so können immer größere Abweichungen auftreten. Deshalb ist eine externe Kontrolle erforderlich, bei der man z. B. die Abweichung mittels eines Drehrädchens manuell korrigiert.
Auch Funkuhren sind Quarzuhren, die zusätzlich eine Antenne enthalten, mit der sie ein von einem Zeitzeichensender per Funk ausgestrahltes Zeitsignal empfangen können. Weicht der interne Zeitwert der Quarzuhr vom Wert dieses zyklisch gesendeten Zeitsignals ab, so wird nachreguliert. Diese interne Kontrolle und Synchronisation macht ein Eingreifen von außen nicht erforderlich, das System bleibt stabil.
Auch wenn Abweichungen bei mechanischen und quarzgesteuerten Uhren nicht gleich zum Chaos führen, kann dieses Beispiel zumindest die Funktion und Bedeutung externer vs. interner Kontrolle in Systemen illustrieren.
Doch selbst Funkuhren können unter »Stress« kommen: Zum einen führt der gesteigerte Komfortbedarf an Bedienung und Zusatzfunktionen zu komplexerer Software, was zu mehr Fehlermöglichkeiten führt. Zum anderen werden diese Uhren immer mehr in Umgebungen mit hohem Störpegel eingesetzt, was eine Verschlechterung der Empfangsverhältnisse und vermehrt EMV-Probleme (Elektromagnetische Verträglichkeit) zur Folge hat (Mohr und Schubert 2000).
Solche abstrakte chaostheoretische Aussagen von Physikern und technische Beispiele können einen lebensnah orientieren Psychotherapeuten wahrlich verschrecken. Deshalb rasch zurück zu unserem stressgeplagten Klienten, der neben der Spur (bzw. auf einer chaotischen Bahn) läuft und sich in einem verzweifelten Anspannungszustand befindet. Wir können externe Kontrolle anwenden, z. B. ihn in eine ruhige Umgebung bringen, mit ruhigen Worten zu ihm sprechen, ihm die Hand halten oder sonst wie beruhigend auf ihn einwirken. Oder aber wir können seinen inneren Zustand beeinflussen, indem wir ihn Achtsamkeit und systematische Entspannung lehren, so dass er destabilisierende Anspannungen rechtzeitig bemerkt und durch gezielte und dosierte Entspannung wieder selbst ein stabiles Niveau erreichen kann. Noch schneller, aber weniger nachhaltig geht es, indem wir ihm ein Beruhigungsmittel geben, das ihn wieder in die Lage versetzt, ruhiger zu reagieren.
Natürlich haben wir unter Alltagsbedingungen nicht die Möglichkeit, in exakt gleicher und quantifizierbarer Weise dynamische Prozesse so zu analysieren und zu beeinflussen, wie dies mathematisch oder physikalisch möglich ist. Doch helfen uns diese qualitativen, prinzipiellen Vergleiche und Analogien bei unserem Bemühen, einerseits psychologische Gesetzmäßigkeiten des Lernens und Verhaltens systematisch zu erforschen, evidenzbasiert zu formulieren und schließlich anzuwenden (z. B. unter Verwendung des unten dargestellten SORKC-Schemas), andererseits aber die Besonderheiten des individuellen Einzelfalls und die mögliche Sensitivität dynamischer Prozesse gegenüber leicht veränderten Ausgangsbedingungen zu berücksichtigen. Die große Bedeutung, die bei chaotischen Prozessen den Anfangsbedingungen und der Lerngeschichte beigemessen wird, kann uns in analoger Weise verdeutlichen, wie wichtig die situativen Ausgangsbedingungen und die Lerngeschichte einer bestimmten Person für ihr Verhalten-in-einer-Situation sein können und welche Möglichkeiten der Einflussnahme wir haben.
Die vorherigen Ausführungen machen deutlich, warum wir unser verhaltenstherapeutisch orientiertes Stressmanagement nicht als manualisierte Rezeptsammlung verstehen, sondern eher als wissenschaftlich basierten, für die Praxis im Einzelfall jedoch flexibel handzuhabenden Werkzeugkoffer zur Analyse individueller Stressprozesse eines Menschen in seiner Alltagswelt. Je differenzierter, erfahrungsgeleiteter und enger an dieser Alltagswelt orientiert wir dabei vorgehen, umso eher werden wir bei der Zielfindung dessen, was wir ändern wollen und können, erfolgreich sein. Letztlich steht unser aller Handeln stets unter dem Vorbehalt, dass die Annahmen und Modelle für unsere Interventionen eine hinreichend genaue Abbildung der Wirklichkeit darstellen und unsere Hypothesen richtig sind. Bewusst sollte uns auch sein, dass bereits kleine Abweichungen entscheidend sein können. Der Weg von der Ordnung zum Chaos ist manchmal nicht weit. Glücklicherweise gilt auch das Umgekehrte sowie die Tatsache, dass viele Prozesse trotz unterschiedlichster Ausgangsbedingungen auf stabile Endzustände konvergieren, die sich im besten Fall mit unseren psychotherapeutischen oder Stressmanagement-Zielen decken.
Zusammenfassung
1. »Stress« ist ein Ungleichgewicht in einem System, auf das Anforderungen einwirken und dessen Bewältigungsmöglichkeiten nicht ausreichen, um angesichts dieser Einwirkungen und Belastungen seine Stabilität bzw. Funktionalität aufrecht zu erhalten.
2. Im »Relationalen Stress-Modell« (RSM) wird Stress als Störung und Bedrohung des Gleichgewichts einer Person (allgemein: eines Systems) aufgefasst und im Rahmen einer funktionalen Verhaltensanalyse beschrieben. Aus den Ergebnissen dieser Analyse werden Hypothesen abgeleitet, welche Interventionen für das Stressmanagement im Rahmen einer Verhaltensmodifikation oder Verhaltenstherapie indiziert sind.
3. Verhalten ist immer »Verhalten-einer-Person-in-einer-Situation«.
4. »Burnout« ist ein Sonderfall von Stress mit besonderen (zusätzlichen) Charakteristika.
5. Bei Prozessen, sei es in der Natur, in sozialen Institutionen oder im individuellen Verhalten, hat »Kontrolle« eine zentrale Bedeutung.
6. Unter experimentellen Bedingungen strebt man hierfür die Reduktion prozesswirksamer Bedingungen auf ein Minimum bzw. auf definierte Variablen an.
7. In der natürlichen bzw. kulturell und industriell geprägten Lebenswelt herrscht dagegen eine Vielfalt unterschiedlichster Einflussbedingungen für physikalische, soziale und individuelle Verhaltensprozesse, die unser Wohlbefinden oder unser Stresserleben bestimmen können.
8. Nichtlineare, dynamische Prozesse in der unbelebten und belebten Natur können äußerst sensitiv auf Änderungen in den Ausgangsbedingungen reagieren und einen instabilen, chaotischen Verlauf nehmen (Schmetterlings-Effekt).
9. Andererseits können dynamische Prozesse, die sich in ihren Ausgangsbedingungen wesentlich unterscheiden, zum gleichen stabilen Endzustand führen (Konvergenz).
10. Dynamische mathematisch-physikalische, chemische und biologische Prozesse zeigen in ihrem Verhalten Muster und Prinzipien, wie wir sie auch bei individuellen und sozialen Verhaltensprozessen finden können, so auch beim Stressmanagement und bei psychotherapeutischen Prozessen.
11. Chaos und Ordnung liegen oft nahe beieinander. Dies ist für Verhalten unter Stressbedingungen und bei psychischen Störungen ein Risiko, allerdings auch eine Chance für Interventionen beim Stressmanagement oder in der Psychotherapie, wenn man maßgebliche Wirkfaktoren, seien diese in der Situation oder im Zustand der Betroffenen begründet, gezielt beeinflussen kann.
12. Dabei ist die individuelle Lerngeschichte von zentraler Bedeutung. In ihr spiegeln sich die deterministischen Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens ebenso wieder wie die spezifischen Ausgangs- und Verlaufsbedingungen. Sie hilft uns auch, die Einzigartigkeit eines einzelnen Menschen und seines Verhaltens besser zu verstehen.
1 Zugunsten einer lesefreundlichen Darstellung wird im Band bei personenbezogenen Bezeichnungen in der Regel die männliche Form verwendet. Diese schließt, wo nicht anders angegeben, alle Geschlechtsformen (weiblich, männlich, divers) ein.
2 Grundlagen
2.1 »Stress« – Geschichte und Bedeutung eines Begriffs
»Stress« gibt es nicht nur bei uns Menschen. So monieren wir mit Recht den Stress, dem unsere Mitgeschöpfe in Schlachtbetrieben und in nicht artgerechten Lagerhaltungen ausgesetzt sind. Auch Pflanzen leiden unter Stress, was sich in offenem »Verhalten« wie Wachstum und Vermehrung bis hinunter zu molekularen Reaktionen ausdrücken kann.
Im deutschen Sprachraum verwenden wir den aus dem Angelsächsischen stammenden Begriff »Stress« häufig bei der Beschreibung biologischer





























