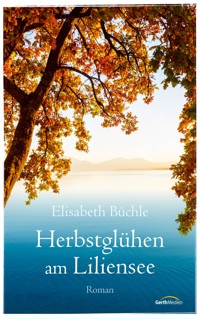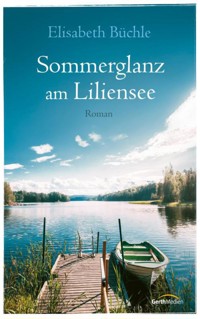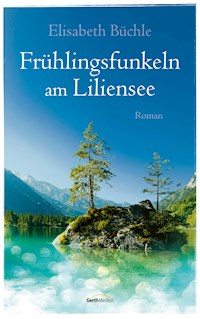9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Die Meindorff-Triologie
- Sprache: Deutsch
St. Petersburg im Juli 1914: Anki van Campen hat sich in den jungen Arzt Robert Busch verliebt. Doch ihre zarte Romanze wird vom Beginn des Ersten Weltkriegs überschattet. In Berlin werden unterdessen die Lebensmittel knapp, die jüngeren Meindorff-Männer sind an der Front, der alte Patriarch krank. Noch glauben alle, der Krieg sei bis Weihnachten vorbei. Doch das soll sich als bitterer Irrtum erweisen ... Der zweite Band der großen Meindorff-Familiensaga, die in vergangene Zeiten und an spannende Schauplätze wie Berlin, St. Petersburg und Deutsch-Südwestafrika entführt. Band 1: Himmel über fremdem Land, 5516750 Band 2: Sturmwolken am Horizont, 5516921 Band 3: Hoffnung eines neuen Tages, 5516927
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Über die Autorin:
Elisabeth Büchle hat bereits mehrere sehr erfolgreiche Romane veröffentlicht. Ihr Markenzeichen sind spannende Liebesgeschichten, die in gründlich recherchierte historische Zusammenhänge eingebettet sind.
www.elisabeth-büchle.de
Elisabeth Büchle
Sturmwolken
am Horizont
Die Meindorff-Saga, Band 2
Für Stefan Ade
Personenregister
Familie van Campen, Holland
Erik, Vater
Tilla, älteste Tochter aus erster Ehe (mit einer Meindorff)
Anki, zweite Tochter aus erster Ehe (mit einer Meindorff)
Demy, erste Tochter aus zweiter Ehe
Rika, zweite Tochter aus zweiter Ehe
Erik Feddo, Sohn aus zweiter Ehe
Familie Meindorff, Berlin
Joseph, Familienpatriarch, Inhaber von Meindorff-Elektrik
Joseph, erster Sohn (Ehemann von Tilla)
Hans (Hannes), zweiter Sohn
Albert, dritter Sohn
Philippe, Pflegesohn der Meindorffs, Sohn einer Familienangehörigen des französischen Meindorff-Zweigs
Großbürgertum, Berlin
Klaudia Groß, Lesezirkel
Lina Barna, Freundin von Demy
Margarete Groß, Freundin von Demy
Martin Willmann, erfolgreicher Jungunternehmer,Verlobter von Brigitte Ehnstein, Elektrobranche-Kartell
St. Petersburg/Petrograd1, Russland
Familie Chabenski:
Ilja Michajlowitsch, Arbeitgeber von Anki
Oksana Andrejewna, Arbeitgeberin von Anki
Nina Iljichna, älteste Tochter
Jelena Iljichna, zweite Tochter
Katja Iljichna, jüngste Tochter
1 Weil die russische Hauptstadt St. Petersburg einen deutschen Namen trug, nannte Zar Nikolaj II. sie kurz nach Kriegsbeginn in Petrograd um.
Weitere Familien und Personen
Jevgenia Ivanowna Bobow, Bekannte von Ljudmila
Ljudmila Sergejewna Zoraw, Freundin Ankis
Raisa Wladimirowna Osminken, ältere Freundin von Nina
Wladimir Pawlowitsch Osminken, Raisas Vater
Demys »Gäste«
Edith Meindorff, Hannes’ Ehefrau, Luisa und Leni, deren Töchter
Irma und Pauline, Freundinnen, beim Betteln angetroffen
Monika Lisrep und ihr Sohn, flüchteten vor ihrer Mutter
Peter und Willi, Zwillingsbrüder von Lieselotte
Viktor Müller, ehemaliger Patient von Marias Ehemann
Hannes’ Zug, Westfront
Adrian Oettinger, Sprecher der »Neuen«
»Bubi« August Butzmann, lange Zeit das Nesthäkchen des Zugs
Eisenburg, Dahn, Lasswitz, Unteroffiziere
Heinz Markt, einer der »Neuen«
Hillgart, erfahrener Soldat
Otto Waldmann, Feldwebel
Ulrich Unzer, erfahrener Soldat
Wolfang Göke, einer der »Neuen«
Sonstige
Henny, Dienstmädchen der Meindorffs
Maria Degenhardt, Angestellte der Meindorffs
Julia Romeike, Geliebte von Joseph d. J.
Lieselotte Scheffler, ältere Schwester von Peter und Willi, erste Freundin von Demy in Berlin
Theodor Birk, ehemaliger Kadettenkollege von Hannes und sein Trauzeuge
Udako, verstorbene Verlobte von Philippe aus Deutsch-Südwestafrika2
2 Heute: Namibia. Von 1884 – 1915 deutsche Kolonie.
Die Situation unmittelbar vor Kriegsausbruch
Am 28. Juni 1914 wurde das Attentat von Sarajewo auf das österreichische Thronfolgerpaar durch Gavrilo Princip verübt, einen gebürtigen Serben. Am 13. Juli 1914 sendete Österreich Serbien eine Vergeltungsnote, die ein 48-stündiges Ultimatum beinhaltete, und machte damit die Regierung in Belgrad für das Attentat verantwortlich.
Kaiser Wilhelm II. befahl der in den nordischen Fjorden liegenden deutschen Flotte die Heimkehr, sehr zum Widerwillen Reichskanzler von Bethmann Hollwegs, da dieser den Anschein vermeiden wollte, das Kaiserreich rechne mit einem baldigen Krieg. Dieser Eindruck verstärkte sich zudem durch eine Äußerung des Kaisers, in der er die knappe Frist von 48 Stunden, die die österreichisch-ungarische Regierung Belgrad zur Beantwortung ihres Ultimatums gegeben hatte, eine »brillante Leistung, ein großer, moralischer Erfolg für Wien« nannte. Und dies, obwohl Wilhelm II. wie auch Franz Joseph I. sehr wohl bekannt war, dass die serbische Regierung keinen Anteil an dem Attentat auf das österreichische Thronfolgerpaar hatte.
Nach Ablauf des Ultimatums und damit knapp einen Monat nach dem Attentat in Sarajevo überschlugen sich die Ereignisse: Zwar waren die Serben bereit, einen Großteil der von Österreich gestellten Forderungen zu erfüllen, auf keinen Fall wollten sie jedoch ihre eigene Souveränität aufgeben. Dies wäre aber zwangsläufig der Fall gewesen, hätten sie allen geforderten Punkten der von Österreich überreichten Note widerspruchslos zugestimmt.
Den Österreichern musste von vornherein bewusst gewesen sein, dass Serbien einigen dieser strittigen Punkte niemals würde beipflichten können. Dennoch enthielt die Vergeltungsnote den Vermerk, dass, wenn Serbien nicht in allen Punkten klein beigab, Österreich eine sofortige Mobilmachung seiner Truppen einleiten würde. Einen diplomatischen Spielraum gab es nicht.
Als Konsequenz auf das für sie nicht erfüllbare Ersuchen erließ die serbische Regierung vorsichtshalber die Räumung ihrer Hauptstadt, da Belgrad nur durch die Donau von Österreich getrennt lag, und verfügte zu diesem Zweck eine Mobilmachung der Truppen. Auf das Verstreichen des Ultimatums ohne Einigung ließ Österreich-Ungarn sich erneut die Bündnistreue des Deutschen Reiches zusichern und brach noch am gleichen Tag die diplomatischen Beziehungen mit Serbien ab.
Sechs Stunden nach der passiven Mobilmachung Serbiens rief auch die Donaumonarchie die Teilmobilmachung aus, während Großbritannien eine Konferenz der vier nicht unmittelbar beteiligten Staaten Frankreich, England, Italien und Deutschland zur Klärung des Serbienproblems vorschlug.
Erst jetzt regte sich bei den diplomatischen Vertretern dieser Länder ein Verdacht, dass der neuerliche Konflikt womöglich nicht friedlich zu lösen sein könnte, nachdem zuvor noch viele Botschafter in den Sommerurlaub abgereist waren und somit der Eindruck entstand, Österreich-Ungarn und Serbien würden die Frage um eine Vergeltung des Attentates unter sich klären.
Russland, das um seinen Zugang zum Schwarzen Meer fürchtete, bat Deutschland, auf Österreich einzuwirken. England jagte Telegramme durch den Äther mit der erneuten Bitte um eine Konferenz. Teilweise kreuzten sich diese mit anderen Nachrichten der verschiedenen Botschaften.
Kaiser Wilhelm II. zeigte sich zufrieden über die serbische Antwortnote und schlug Österreich vor, es solle Belgrad als Pfand nehmen, um dafür zu sorgen, dass die zugesicherten Punkte eingehalten würden. Er könne sich daraufhin als Friedensvermittler einschalten. Doch fast zur selben Stunde erklärte Österreich Serbien den Krieg.
Entscheide dich immer für die Liebe.
Wenn du dich ein für alle Mal entschlossen hast,
so wirst du die Welt bezwingen.
Die Liebe ist die allergrößte Kraft
und ihresgleichen gibt es nicht.
Fjodor M. Dostojewski
Prolog
1916
An den Zweigen der Bäume glitzerten unzählige Eiskristalle gespenstisch im Mondlicht, und auf der gefrorenen Wasseroberfläche schimmerte der silbrige Abglanz des Erdtrabanten. Die eisige Luft schmerzte beim Einatmen, was die einsame Gestalt auf dem Uferweg dazu veranlasste, mit ihren klammen Fingern den Schal bis über die Nase hochzuziehen. Immer weiter trieb es sie vorwärts. Sie lauschte auf das Brechen des dünnen Eises unter ihren Füßen in der unnatürlichen Stille, die sich über die von Krisen geschüttelte Stadt gelegt hatte.
Ein Motorengeräusch näherte sich ihr von hinten, und sie fuhr erschrocken herum. Die Scheinwerferkegel eines Automobils tasteten wie suchende Finger über die Straße. Da sie nicht gesehen werden wollte, beschleunigte sie ihre Schritte. Ihr Ziel, die nächststehende Baumgruppe, behielt sie fest im Blick. Die Eisschicht, die die schlanken Zweige der Weiden starr umhüllte, klirrte wie winzige Glöckchen, als die Frau zwischen ihnen hindurchhuschte.
Mit einem wütenden Aufheulen des Motors schoss das Fahrzeug an ihr vorüber. Sie presste sich Schutz suchend an einen rauen Baumstamm und hoffte, unentdeckt zu bleiben. Unkontrolliert schlitterte das Gefährt auf die nahe gelegene Brücke und stoppte dort mit quietschenden Reifen.
Ein heißer Schauer der Furcht durchlief ihren Körper. Sie durfte um diese nächtliche Stunde nicht allein auf den Straßen unterwegs sein. Was würde mit ihr geschehen, wenn die Insassen des Wagens sie entdeckten?
Vor Kälte und Angst zitternd beobachtete sie, wie mehrere Männer aus dem Automobil sprangen und sich in seinem Inneren an irgendetwas zu schaffen machten. Unverständliche Wortfetzen drangen zu ihr.
Die schwarzen Silhouetten schleppten etwas Schweres mit sich und hievten es auf das Brückengeländer. Entsetzt riss die heimliche Beobachterin die Augen auf. War das etwa ein Mensch, den die Männer da hielten? Was hatten sie mit ihm vor?
Sekunden später schlug das reglose Bündel auf der Eisschicht der Neva auf, die unter seinem Gewicht in tausend Teile zersprang. Die Splitter blitzten für einen kurzen Moment silbern im fahlen Mondlicht auf, als wollten sie die Grausamkeit der Szenerie beleuchten. Dann trug das schwarze, jetzt im Winter träge fließende Wasser den Körper mit sich davon.
Die Frau glaubte zwischen den Eisschollen zwei nach oben greifende Hände zu sehen, als suche die Person verzweifelt nach Rettung, doch dann verschwanden auch sie.
Zurück blieb der eiskalte Fluss, dessen Gurgeln vom aufjaulenden Motor des sich entfernenden Wagens übertönt wurde … und eine junge Frau; reglos vor Entsetzen über das Gesehene, zumal sie die Täter erkannt hatte.
Teil 1
Kapitel 1
Bei Paris, Frankreich, Juli 1914
Der prächtige Saal des Chateaus erstrahlte im Licht flackernder Kerzen und vereinzelt in den Nischen angebrachter elektrischer Lampen. Die in altrosa gehaltenen Wände mit ihren hellen Fensterrahmen und die weiße Stuckdecke gaben dem Raum eine würdevolle Note, während zwei offene Kamine, in Gold gerahmte Landschaftsbilder und mit Blumenmustern geschmückte Chintzsessel für eine heimelige Atmosphäre sorgten. Den jetzt im Sommer unbenutzten Kaminen gegenüber lag eine Fensterfront, von der drei Türen zur erhöht gebauten Terrasse führten. Vor ihnen tanzten luftige Gardinen wie zarte Elfen im leichten Nachtwind.
Attraktive Damen in aufsehenerregenden Abendroben flanierten an den ebenso exquisit gekleideten Herren in Frack, Gehrock und Zylinder vorbei oder saßen in Gruppen beieinander und unterhielten sich angeregt. Obwohl ein hervorragendes Musikensemble spielte, drehten sich nur wenige Paare auf der Tanzfläche. So mancher Mann fand die Zeit nach dem tödlichen Attentat Gavrilo Princips auf den österreichischen Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gattin Sophie nicht zum Tanzen geeignet, zumal sich die politische Lage dramatisch zuzuspitzen begann, seit Österreich sein Ultimatum an Serbien übermittelt hatte.
Wenngleich sich mit Staatspräsident Raymond Poincaré, der erst vor wenigen Tagen aus dem russischen St. Petersburg zurückgekehrt war, nun ein hochrangiger Politiker an den Gesprächen beteiligte, war Philippe Meindorff nicht konzentriert bei der Sache. Hinter der Männergruppe schlenderten einige Damen vorüber, und sein Blick fiel auf eine groß gewachsene junge Frau in modischem Kostüm. Anders als die zierlichen Grazien in ihrer Begleitung wirkte sie ungewöhnlich athletisch, dabei aber noch immer sehr feminin. Er erhaschte einen Blick auf das Profil der Frau und stellte erstaunt fest, dass sie ihm bekannt vorkam.
Ohne Zögern stieß er sich von der cremefarbenen Marmorsäule ab, an der er gelehnt hatte. Er umrundete die Diskutierenden, um freie Sicht auf die Frauen am Büfett zu erlangen, ohne dass er dabei ein Wort der politisierenden Unterhaltung versäumte. Während Philippe dem lebhaften Wortwechsel zwischen französischen Militärs, Politikern und wohlhabenden Geschäftsmännern lauschte, zog er an seiner straff sitzenden schwarzen Krawatte, die ihm die Atemluft abzuschnüren drohte. Anschließend öffnete er den obersten Hemdknopf.
Lag es an seinen düsteren Überlegungen um die sich zuspitzenden Verhältnisse zwischen den Ländern, dass ihm auf einmal so heiß wurde, oder trieb der Nachtwind die Hitze des vergangenen Tages durch die Terrassentüren herein?
Philippe, der schon vor Jahren einen Krieg befürchtet hatte und für seine Schwarzmalerei verlacht worden war, da ein Konflikt nach dem anderen friedlich, jedoch niemals endgültig beigelegt werden konnte, verspürte keinen Triumph darüber, dass er damals wohl richtig gelegen hatte. Wie viele Bürger in den betroffenen Ländern hoffte auch er auf ein Einlenken der Parteien. Immerhin hatte er sich nach seinem Einsatz im Herero- und Namakrieg3 in Deutsch-Südwestafrika geschworen, sich fortan von Kriegen fernzuhalten. Dennoch überrollten die Ereignisse der letzten Julitage auch ihn.
Erschüttert fuhr Philippe sich mit der Hand über sein frisch rasiertes Kinn. Ob es noch ein Halten gab? Wie standen die Chancen, dass der losgetretenen Lawine noch Einhalt geboten wurde, ohne dass sie Tausende oder Hunderttausende Opfer mit sich riss?
Die Stimmen der diskutierenden Männer in seinem Rücken nahmen an Lautstärke zu und drängten mit Vehemenz in seine Überlegungen. »Nein, Deutschland rechnete nach dem Attentat nicht sofort mit einem Krieg, meine Herren. Der Kaiser brach weder seine Schiffsreise ab, noch beendeten seine Berater und Minister ihren Urlaub.«
Verwundert über die in diesem Kreise erstaunlich beschwichtigenden Worte drehte Philippe den Kopf und betrachtete den wohlgenährten Sprecher in der stramm sitzenden Offiziersuniform. Für einen gebürtigen Franzosen klang seine Aussprache eine Spur zu hart. Ein Zeichen dafür, dass in seiner Ahnenreihe deutsches Blut floss? Der Offizier fuhr fort: »Deshalb genügt es momentan, wenn wir den Grenzschutz zum Deutschen Kaiserreich hin verstärken.«
Philippe verharrte weiterhin im Hintergrund, wenngleich er aufmerksam zuhörte. Ein anderer Uniformierter plusterte die Wangen auf, wobei sein Schnauzbart eigentümliche Bewegungen vollführte. »Die k.u. k.4 Truppen werden aufgeboten. Und die Deutschen sprechen nach der russischen Gesamtmobilmachung von einem Zustand drohender Kriegsgefahr. Für mich heißt das, dass Kaiser Wilhelm, allen voran aber sein Militär, sprich Moltke, binnen achtundvierzig Stunden ebenfalls seine Truppen mobilisieren wird, zumal sie gestern den Russen eine deutliche Warnung zukommen ließen. London wartet noch immer ab. Allerdings hält die englische Regierung nach ihrem in Kriegsstärke abgehaltenen Manöver die Kriegsschiffe zusammen. Ich sehe darin eine Mobilisierung ihrer Flotte.«
»Außenminister Grey befindet sich im Austausch mit dem deutschen Botschafter. Er bemüht sich um Schadensbegrenzung, und Kaiser Wilhelm und Zar Nikolaj stehen ebenfalls in Kontakt«, wusste ein jüngerer Mann in Zivil. Sein Einwand verleitete einige der Diskussionsteilnehmer zu einem knappen Nicken. Ob die hier vertretenen Militärs den Abbruch aller Gespräche bevorzugen würden? In Berlin ging es wohl nicht anders zu. Die deutsche Armeeführung, ohnehin mit extrem viel Macht ausgestattet, strebte schon länger einer kriegerischen Auseinandersetzung entgegen.
Als die lauten Worte eines Leutnants Phillipe aufschreckten, kniff er unwillig ein Auge zu. »Kaiser Wilhelm hat sich Roms Treueschwur eingeholt und Kontakt mit Griechenland und Rumänien aufgenommen! Friedliche Absichten sehe ich darin nicht.«
»Unser Problem ist doch im Moment vielmehr, ob wir in diesen Krisenzeiten die Spaltung in ein republikanisches antiklerikales und ein konservatives klerikales Frankreich aufhalten können. Sonst gilt es am Ende nicht nur einen außenpolitischen, sondern auch einen innerpolitischen Krieg auszutragen«, wendete der französische Präsident ein und strich sich mit der Rechten über seinen leicht struppigen Schnurrbart bis hinab zu dem spitz zulaufenden Kinnbart. Er wirkte äußerlich gelassen, dennoch glaubte Philippe, Nervosität aus seiner Stimme herauszuhören, zumal seine Gestik diesen Eindruck unterstrich.
Die Frauen in Philippes Nähe lachten, was ihn zu ihnen hinüberblicken ließ. Nun stand die ihm vertraut vorkommende Dame frontal zu ihm. Schwarze Haare, kunstvoll mit perlenverzierten Kämmen aufgesteckt, umrahmten ein rundliches Gesicht mit wachen, blauen Augen und einer etwas vorwitzig aussehenden Nase. Ein kleiner Mund, hinter dem sich, wenn sie lächelte, gepflegte, ebenmäßige Zähne zeigten und ein spitz zulaufendes Kinn vervollkommneten ein Gesicht, das man gern ansah.
Philippe runzelte die Stirn. Sein Eindruck, der Frau früher schon einmal begegnet zu sein, verfestigte sich, je länger er sie betrachtete. Allerdings sperrte sich sein Gedächtnis, ihm einen Namen, einen Ort oder zumindest irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen preiszugeben. Da sich die Männergruppe mittlerweile in innerpolitischen Fragen erging, näherte er sich der fröhlichen Frauenrunde, entschlossen, der schlanken Schönheit vorgestellt zu werden.
»Philippe! Du hast ja nicht mal ein Glas in der Hand. Wer ist der rüpelhafte Gastgeber, der dich so sträflich vernachlässigt?« Claude Dupont, der junge Mann, der ihn eingeladen hatte, gesellte sich zu ihm und reichte ihm einen gut gefüllten Schwenker mit echtem Cognac.
»Ein Pilot. Wer sonst überzeugt durch so liederliche Manieren?«
Der Franzose lachte und zeigte dabei zwei Reihen schief sitzender Zähne, was angesichts seines extrem schmalen Gesichts nicht weiter verwunderte. »Warum stehst du so allein herum? Langweilst du dich?«
»Ich langweile mich nicht, frage mich aber, wer diese sportive Erscheinung dort drüben ist.«
Claude drehte sich um, sodass er ebenfalls die fröhlich lachenden und schwatzenden Frauen betrachten konnte. »Du sprichst von der Mademoiselle mit dem schwarzen Haar, die die anderen Damen um fast einen Kopf überragt?«
Philippe nickte. Abermals musterte er interessiert ihr Gesicht und für einen Moment keimte in ihm der Verdacht, dass er sie nicht persönlich kennengelernt hatte, aber vielleicht einen nahestehenden Verwandten.
»Bei der Lösung dieses Rätsels, mein Freund, vermag ich dir leider nicht zu helfen. Die Dame ist von Yvette Ledoux mitgebracht worden, da sie derzeit bei der Familie Ledoux zu Gast ist. Sie ist allerdings keine gebürtige Französin. Ihr Französisch ist zwar nicht schlecht, aber hörbar ungeübt.«
Noch während Philippe überlegte, ob er das Fräulein ansprechen wollte, stürmte Claudes dreizehnjähriger Bruder in den Raum, obwohl der zu dieser vorgerückten Stunde längst im Bett liegen sollte. Ungeachtet der wichtigen Gäste seiner Eltern rief er laut: »Deutschland droht mobilzumachen, falls Russland nicht innerhalb von zwölf Stunden demobilisiert!«
Die Musik brach ab. Die Tänzer verharrten auf der Stelle. Alle Gespräche verstummten. Ein Glas fiel zu Boden und zersprang mit nervenzerreißendem Klirren in unzählige Scherben. Die Stille hielt an; einzig von draußen klang das verhaltene Lachen und die nicht verständlichen Gesprächsfetzen derer herein, die auf der Terrasse Abkühlung suchten und die Mitteilung versäumt hatten.
Philippe schüttelte fassungslos den Kopf. Russland hatte zuerst in vier Militärbezirken mobilgemacht, was in Anbetracht des gefährdeten Serbien eine angemessene Reaktion auf die Agitation Österreich-Ungarns war, doch bereits am nächsten Tag folgte die Gesamtmobilmachung des riesigen Heers. Dies kam einer Provokation gleich und erzeugte weitere Überreaktionen bei den hochsensibilisierten Staaten und Staatenbünden.
Verhaltenes Murmeln erhob sich, als fürchteten die Anwesenden, durch zu lautes Sprechen neue Hiobsbotschaften anzulocken oder dem Feind Informationen preiszugeben. Präsident Poincaré verließ den Raum, gefolgt von den Militärs. Das rhythmische Donnern ihrer Stiefel auf dem Steinboden jagte Philippe einen Schauer über den Rücken und biss sich als stechender Schmerz in seinem Nacken fest. Die Geräusche erinnerten ihn erschreckend an das Marschieren Abertausender Soldaten in Richtung Front.
Die beiden Diener beim Büfett murrten halblaut über die vermaledeiten Deutschen. Die Gäste der Duponts, die allmählich aus ihrer Erstarrung erwachten, besprachen die Nachricht, wobei die wieder einsetzenden Gespräche einen wesentlich lauteren Geräuschpegel als zuvor erreichten. Erhitzte Gesichter spiegelten eine Mischung aus Verärgerung und kaum unterdrückter Begeisterung über die Verschärfung der politischen Entwicklungen wider. Sogar die Frauen diskutierten gestenreich, und Philippes Blick fiel erneut auf die vermutlich einzige Frau nicht französischer Herkunft. Er sah, wie sie nachdenklich und missbilligend zugleich die Nase rümpfte. An dieser Eigenheit erkannte er sie. Ihre Anwesenheit verblüffte ihn weitaus weniger als die Tatsache, dass aus der aufsässigen kleinen Demy van Campen eine hinreißende junge Dame geworden war.
***
Demy glaubte ihren Augen nicht zu trauen. Nur ein paar Schritte von ihr entfernt stand Philippe Meindorff und blickte sie mit seinen hellen Augen ebenso unverfroren an, wie er das bereits vor sechs Jahren getan hatte. Schon damals, bei ihren wenigen Begegnungen in Berlin, hatte er groß und stattlich ausgesehen, inzwischen wirkte er auch noch sehnig und kantig.
Philippe schien sie erkannt zu haben. Aber anstelle des süffisanten Lächelns, das sie erwartete, trat ein vorwurfsvoller, harter Zug um seinen Mund, ehe er sich dem ältesten Sohn des Gastgebers zuwandte.
»Demy, wen starrst du da so interessiert an?« Yvette stupste ihr leicht mit dem Ellenbogen in die Seite und erlangte somit ihre Aufmerksamkeit zurück.
»Was sucht Philippe Meindorff hier?«
»Philippe? Ein gut aussehender Mann, nicht? Aber ich muss dir dein Interesse an ihm ausreden.«
Demy winkte mit einer Hand ab. Die Frauengeschichten rund um den Zögling des alten Meindorff, des Schwiegervaters ihrer Schwester Tilla, kannte sie zu Genüge.
Unbeirrt fuhr Yvette fort: »Er hat kein großes Faible für Frauen. Für ihn gibt es ausschließlich seine Arbeit und die Fliegerei. Wie auch für Claude Dupont. Du siehst die beiden im Gespräch miteinander.« Sie seufzte theatralisch auf. »Außerdem macht mir dieser Philippe ein bisschen Angst. Er wirkt oft grimmig, unnahbar und kurz angebunden, allerdings ist er nie unhöflich, das muss ich zugeben.«
Die Querfalten auf Demys Nase vertieften sich. Yvettes Worte verhießen völlig neue Wesenszüge an Philippe. Aber immerhin hatte sie ihn seit dem Frühjahr 1908 nicht mehr gesehen. Damals hatte ihre Schwester sie gezwungen gehabt, mit ihr von den Niederlanden in die preußische Millionenstadt Berlin zu ziehen. Demy hatte gehört, dass Philippe in Deutsch-Südwestafrika schwer verwundet worden war und nach seiner Genesung seine Militärlaufbahn aufgegeben hatte, um in Stuttgart zu studieren. Den Kontakt zur Familie Meindorff hatte er vollständig abgebrochen, wobei sie von Hannes Meindorff wusste, dass er mit ihm zumindest einen losen Briefwechsel unterhielt.
Doch Hannes, der wegen seiner heimlichen Hochzeit mit Edith, einer Frau, die unter der Würde des Patriarchen Joseph Meindorff stand, aus dessen Haus und Leben verbannt worden war, schwieg sich ihr gegenüber über den Inhalt des Schriftverkehrs aus.
»Du kennst Philippe? Ich dachte, er unterhalte keine Verbindungen mehr zur Familie Meindorff, obwohl er bei ihnen aufgewachsen ist«, hakte Yvette nach.
»Ich bin ihm im vor einigen Jahren ein paarmal begegnet. Er hatte Urlaub von der Armee und war zu Tillas Hochzeit in Berlin.«
»Du bist mit ihm verwandt, nicht wahr?«
»Nein.« Diesmal war es an Demy zu seufzen. So viele Male hatte sie ihr Verwandtschaftsverhältnis schon erklären müssen. »Meine Schwestern Tilla und Anki sind mütterlicherseits mit den Meindorffs verwandt. Meine beiden jüngeren Geschwister Rika und Feddo und ich sind nur ihre Halbgeschwister.«
»Er kommt!«, warnte Yvette und Demy straffte unwillkürlich die Schultern.
Philippe verbeugte sich knapp vor den Damen und ergriff Demy am Unterarm, als sei sie seine Begleitung auf diesem Fest. Energisch entzog sie ihm ihren Arm und drehte sich mit aufgebracht blitzenden Augen zu ihm um. Noch ehe sie ihn rügen konnte, sagte er leise und sehr ruhig: »Sie dürfen sich gern hier in Anwesenheit der anderen Gäste mit mir streiten, Mademoiselle Demy, oder wir gehen erst ein paar Schritte.«
»Weshalb soll ich mich mit Ihnen streiten, Monsieur Meindorff?«
»Das taten Sie schon vor Jahren mit Begeisterung und Ihr Blick ließ mich vermuten, dass Sie diese temperamentvolle Eigenheit trotz des Unterrichts bei Fräulein Cronberg nicht abgelegt haben.«
»Wenn ich mich recht erinnere, entsprach das Ihrem der Gouvernante gegenüber angesprochenem Wunsch.«
Ihr Gesprächspartner lachte auf und nickte in Richtung der Terrassentüren. Sich der Tatsache bewusst, dass ihre bisherigen Gesprächspartnerinnen sie neugierig beäugten, folgte Demy, wenn auch widerwillig, seiner Aufforderung und trat an den im sanften Wind aufgebauschten Vorhängen vorbei auf die großzügig angelegte und mit allerlei Zierpflanzen und Palmen geschmückte Terrasse. Am nächtlichen Himmel prangte ein fast runder Mond und warf sein silbriges Licht auf die weitläufige Parkanlage des Schlosses. Die Nachtluft umfing sie mit angenehmer Wärme, und die Grillen zirpten lautstark.
»Über welches Thema soll ich mich mit Ihnen streiten?«, erkundigte sie sich nun auf Deutsch, wobei sich ihr leichter niederländischer Akzent nicht verbergen ließ.
»Was verleitet Sie und Ihre Schwester, sich in diesen unruhigen Zeiten in Frankreich aufzuhalten? Sie gelten als Deutsche! Ich nehme nicht an, dass Sie in den vergangenen Jahren Ihren Scharfsinn eingebüßt haben und nicht wissen, wie angespannt die politische Situation zwischen Deutschland und Frankreich derzeit ist.«
»Muss ich mir jetzt erst einmal Gedanken darüber machen, ob Sie mich gerade beleidigt haben?«
»Demy, Sie machen sich jetzt besser Gedanken darüber, wie Sie und die junge Frau Meindorff diesem Land schnellstmöglich den Rücken kehren.«
Demy rümpfte erneut die Nase. Philippes Tonfall klang für ihren Geschmack zu herrisch. Außerdem ärgerte es sie, dass er sie noch immer beim Vornamen nannte, wenngleich er sie nun zumindest mit »Sie« ansprach.
»Erstens, Herr Meindorff, bin ich nach wie vor Niederländerin und zweitens befindet sich meine Schwester seit drei Tagen in Berlin. Ich war wegen einer Erkrankung gezwungen, länger zu bleiben, doch meine Rückkehr ist für den vierten August geplant.«
»Bis dahin könnte zwischen Deutschland und Frankreich Krieg herrschen. Was glauben Sie, wie es dann an den Grenzen zugeht? Und soweit ich mich erinnere, haben Sie seit dem Tod von Erik van Campen keinerlei Besitztümer mehr in den Niederlanden.«
Bei dem grimmigen Tonfall, mit dem Philippe den Namen ihres Vaters aussprach, zuckte Demy zusammen. Mit leicht zur Seite geneigtem Kopf sah sie zu ihm auf. Seine Gesichtszüge spiegelten die Härte wider, mit der er den Satz ausgestoßen hatte. Ihre Irritation darüber zeigte sie durch neuerliche Falten auf ihrer Nase. Philippe kannte ihren Vater doch gar nicht. Oder etwa doch? Immerhin hatte sich Erik van Campen für einige Wochen in Deutsch-Südwestafrika aufgehalten, bevor er in die Niederlande zurückgekehrt und in der Gracht hinter ihrem Haus in Koudekerke ertrunken war. Waren Philippe und ihr Vater sich in Afrika begegnet? Hatten sie gar eine Auseinandersetzung ausgefochten?
Demy wollte an einen solchen Zufall nicht glauben und erwiderte schnippisch: »Ich besitze trotzdem noch immer meinen niederländischen Pass.«
Ihr Gesprächspartner wandte sich ab und ging über die sandfarbenen Steinplatten an die verschnörkelte schmiedeeiserne Brüstung, an der sich eine Glyzinie mit zartlila Blüten entlangrankte. Er legte die Hände fest um das Brüstungsgeländer und beugte den Oberkörper leicht nach vorn, als suche er etwas unterhalb der Terrasse.
Demy betrachtete abwartend seinen breiten Rücken, doch als er längere Zeit reglos verharrte, entschied sie, zu Yvette, der Freundin ihrer älteren Schwester, zurückzukehren. Sie schrak zusammen, als er ihr mit flinken Schritten nacheilte und sie am Oberarm ergriff.
»Wie alt sind Sie jetzt, Demy? Neunzehn, zwanzig?«
Ihre Antwort bestand aus einem herausfordernden Blick. Bei ihrer Ankunft in Berlin war Philippe tatsächlich die einzige Person gewesen, die Tillas falsche Altersangabe für Demy zu Recht angezweifelt hatte. In den vergangenen Jahren war ihr Alter nie wieder thematisiert worden, was vermutlich daran lag, dass sie sich in das Leben und die Regeln der Familie Meindorff eingefügt hatte. Zumindest hielt sie den Anschein aufrecht, eine wohlerzogene Dame zu sein, denn die Freiheiten, die sie sich nahm, waren weitaus größer, als die Mitglieder der in Berlin anerkannten Industriellenfamilie ahnten.
Auf ihr Schweigen hin lachte Philippe freudlos auf und ließ sie endlich los. »Sie schummeln demnach noch immer mit Ihrem Alter? Betrügereien liegen der Familie van Campen wohl im Blut.« Noch ehe Demy erbost einen Einwand anbringen konnte, fuhr Philippe fort: »Ich wundere mich in Anbetracht der falschen Altersangabe allerdings, dass Sie nicht längst gewinnbringend verheiratet wurden.«
»Ich bin eine van Campen, keine Meindorff. Vergessen Sie das nicht! Eine Eheschließung ist weder für den Familienpatriarchen noch für dessen ältesten Sohn von Nutzen.«
Philippe vollführte eine abweisende Handbewegung und deutete anschließend einladend in den überhitzten Saal, aus dem weiterhin aufgeregte Diskussionsfetzen zu ihnen drangen.
»Sie sind noch nicht volljährig, waren aber damals – und sind es heute erst recht – intelligent genug, um selbst über Ihr Leben zu bestimmen. Ich rate Ihnen, reisen Sie unverzüglich nach Berlin zurück. Gute Nacht.« Mit diesen Worten drehte Philippe sich um, schritt auf die Brüstung zu, stützte sich mit einer Hand auf und sprang hinunter auf die knapp zwei Meter tiefer gelegene Rasenfläche.
Demy sah ihm nach, wie er vom Mondlicht beschienen durch die akkurat geschnittenen Rosenbüsche schlenderte und schließlich hinter einer hohen Buchsbaumhecke verschwand.
Ärgerlich schüttelte sie den Kopf. Über sechs Jahre war sie diesem Philippe nicht mehr begegnet und ausgerechnet hier in Frankreich, abseits aller preußischer Konventionen und der sie einengenden Stellung als Gesellschafterin ihrer Schwester tauchte er wie aus dem Nichts auf und verdarb ihr den Abend. Er war älter geworden, ruhiger vielleicht, aber eines war noch immer gleich geblieben: Sie konnte ihn nicht leiden!
3 Herero-Namakrieg (1904 – 1908)
4 Abkürzung für: kaiserlich und königlich. Gemeint ist die Österreich-Ungarische Armee
Kapitel 2
Berlin, Deutsches Reich, August 1914
»Ich muss hier raus, Lina. Ich bekomme es mit der Angst zu tun.« Margarete Groß ergriff ihre Freundin Halt suchend am Unterarm.
Lina Barna nickte, wenngleich ihr gerötetes Gesicht und die munter blitzenden Augen deutlich verrieten, wie beschwingt sie sich ihrerseits in der berauschten Menschenmenge fühlte.
Nachdem die Antikriegsdemonstrationen abgeflaut waren, die dem Ultimatum Österreich-Ungarns an Serbien gefolgt waren, hatte am Vortag die Verkündung des Zustands drohender Kriegsgefahr erneut eine gewaltige Welle Menschen auf die Berliner Straßen und Plätze gespült. Dieses Mal schrien sie ihre Begeisterung für eine nahende kriegerische Auseinandersetzung hinaus.
An diesem ersten Augusttag nun hatten die reißerischen Worte in der Presse und die Plakate an den Berliner Litfaßsäulen den Pulsschlag der Stadt für einen Moment zum Stillstand gebracht: Das Deutsche Kaiserreich hatte die Mobilmachung ausgerufen, nachdem eineinhalb Stunden zuvor die Aufbietung der Truppen in Frankreich erklärt worden war.
Das deutsche Volk fand, es sei an der Zeit, dass dem ewigen Geplänkel zwischen dem Balkan und Österreich-Ungarn, Russland, England und Frankreich ein Ende gesetzt wurde. Die Zeit war reif! Das Deutsche Reich war eine Wirtschaftsmacht auf dem europäischen Kontinent, den anderen Ländern in so gut wie allen Bereichen überlegen. Wen oder was sollten sie fürchten?
Vor dem Stadtschloss versammelten sich Zigtausend singende und jubelnde Bürger, und auch Lina spürte Erleichterung darüber, dass die Anspannung der vergangenen Wochen endlich endete, die sich angefühlt hatte, als tanzten sie alle auf einem Vulkan. Nun entluden sich die aufgestauten Emotionen auf den Straßen Berlins.
Lina winkte kräftig mit ihrem Taschentuch. Wie alle anderen um sie her ließ sie den Kaiser und die deutschen Soldaten hochleben, die bald in einen ehrenvollen Kampf gegen die Feinde ins Feld ziehen wollten. Sie fühlte sich einfach großartig!
Über das Jauchzen der Menschen hinweg hörte Lina Margaretes erstickten Aufschrei. Erschrocken drehte sie sich nach ihr um. Ihre Freundin hielt sich die rechte Wange. Ob sie einen Schlag ins Gesicht bekommen hatte?
Tränen liefen Margarete über das blasse Gesicht. Der Hilfeschrei in ihren braunen Augen verleitete Lina endlich dazu, ihre zarte Freundin fest an der Hand zu nehmen und sich unter Einsatz ihrer Ellenbogen gegen die wogenden Massen anzustemmen. Sie stieß die dicht gedrängten Menschen rücksichtslos beiseite, um sich und Margarete eine Gasse zu schaffen.
Männer brüllten lauthals irgendwelche Parolen und schleuderten ihre hellen Strohhüte in die Höhe. Frauen winkten, jubelten, und ihre fast verzerrt wirkenden Gesichtszüge mussten einer zartbesaiteten Frau wie Margarete an grausige Fratzen erinnern und Angst einjagen.
Lina umklammerte die schmale Hand der Freundin noch kräftiger und zerrte sie nahezu gewaltsam hinter sich her. Die beiden traten auf Spitzentaschentücher, auf verbeulte, vom Straßendreck verschmutzte Canotiers5 und auf einen verlorenen Kinderschuh. In der Hoffnung, dass das Kind nicht ebenfalls irgendwo zwischen den Beinen der Menschenmenge lag, stieg Lina über ihn hinweg. Dabei verfinsterte sich ihr kantiges, nicht sehr weiblich anmutendes Gesicht.
Endlich sah sie die schmiedeeisernen Begrenzungen der Schlossbrücke vor sich, konnte sie aber nicht erreichen. Es war wie in einem Albtraum! Sie wollte weitergehen, doch unsichtbare Hände schienen sie zurückzuhalten, hinderten sie am Vorankommen. Zwei wild winkende Männer und eine Dame, die ihren matronenhaften Körper in ein hellgelbes Lampenschirmkleid mit Pelzverbrämung gezwängt hatte, versperrten ihr den Weg.
»Lassen Sie uns durch! Bitte lassen Sie uns durch«, schrie Lina gegen den Lärm an, fand jedoch keine Beachtung. Tosender Jubel brandete auf und setzte sich in den Kehlen der Menschen fort, wie eine Welle auf See, die unaufhaltsam vorwärtsschwappte. War der Kaiser beim Schloss vor die Menge getreten?
Noch mehr Neugierige stürmten herbei, drängten in den überfüllten Lustgarten und die an diesem Tag plötzlich viel zu engen Prachtstraßen Berlins. Die füllige Frau im gelben Kleid drückte sich gegen Lina, und der Knauf ihres Spazierstocks, aus weiß schimmerndem Elfenbein gefertigt und in Form eines Pferdekopfes, traf Lina unvorbereitet an der Schläfe. Fast zeitgleich stieß ihr jemand den Ellenbogen rüde zwischen die Schulterblätter. Der Schmerz, der in ihren Kopf schoss, zwang sie, Margarete loszulassen. Zwar nahm Lina den entsetzen Ruf der Freundin wahr, konnte aber nichts für sie tun. Ihre Knie gaben nach. Vor ihren Augen drehte sich alles. Sie taumelte zwei Schritte vorwärts und prallte gegen das rote Brückengemäuer. Weitere Personen rückten von hinten nach, pressten sie förmlich gegen den rauen, von der Augustsonne aufgeheizten Stein.
Lina war nicht in der Lage, einen Hilfeschrei auszustoßen. Heiße Schauer jagten durch ihren Körper. Sie wurde erdrückt! Ihr fehlte die Luft zum Atmen!
***
Anton Daul kletterte auf die Brüstung der Schlossbrücke und lehnte sich mit der Schulter an den weißen Marmorblock, auf dem eine von acht Statuen thronte. Von oben wirkte die versammelte Menschenmenge wie eine eingepferchte Viehherde, wobei ihr Brüllen diesen Eindruck noch verstärkte. Als Kaiser Wilhelm auf einen Balkon des Stadtschlosses trat, steigerten sich die Begeisterungsrufe der Umstehenden ins Unermessliche. Anton ahnte, dass sich unter die Feiernden auch diejenigen mischten, die zuvor noch gegen das Kriegstreiben protestiert, sich zumindest aber abneigend geäußert hatten. Die Geschehnisse überrollten die Menschen, formten sie zu einer Einheit und peitschten sie zu Begeisterungsstürmen auf, aus denen sie womöglich erst viel zu spät wieder erwachen würden.
Der Kaiser winkte und erntete tausendfache Zurufe, erneut in die Höhe geworfene Hüte, auch vonseiten der Damen, obwohl die es sich in diesem heißen Sommer nicht nehmen ließen, auch einmal ohne Hut ins Freie zu gehen. Gestandene Männer zollten der Hitze durch fehlende Jacketts und gar in aller Öffentlichkeit hochgekrempelte Hemdsärmel Tribut. Eine Freizügigkeit beiderlei Geschlechts, die noch vor ein, zwei Jahren undenkbar gewesen wäre. Die Gesellschaft befand sich im Wandel, doch die in diesen Tagen stattfindende Veränderung fühlte sich für Anton bedrohlich an.
Der Kaiser bemühte sich, die Menge zu beschwichtigen, indem er mit seinem nicht verkrüppelten Arm winkte. Schließlich drang seine Stimme bis zu Anton durch: » … danke ich euch für den Ausdruck eurer Liebe, eurer Treue. In dem jetzt bevorstehenden Kampfe kenne ich in meinem Volke keine Parteien mehr. Es gibt unter uns nur noch Deutsche. Und welche von den Parteien auch im Laufe des Meinungskampfes sich gegen mich gewandt haben sollten, ich verzeihe ihnen allen.«
Anton runzelte die Stirn. Wie wohl Vertreter der SPD diese Worte aufnahmen? Verflogen ihre politischen Erfolge der letzten Jahre und ihr Bestreben nach einem friedlichen Deutschland mit dem an Russland gestellten Ultimatum zur Einstellung der Mobilmachung, das in nicht ganz drei Stunden auslief? Allerdings war nicht einmal der Deutsche Reichstag zusammengetreten. Weder dem Kanzler noch dem Kaiser war es bisher ein Anliegen gewesen, die gewählten Volksvertreter zu befragen, was sie von einem Krieg hielten.
»Zivilisierte Anarchie« hatte sein Gönner, Professor Barna, wenige Stunden zuvor das momentane Geschehen in Berlin genannt. Kaiser Wilhelm fuhr langsam und deutlich akzentuiert fort: »Es handelt sich jetzt nur darum, dass alle wie Brüder zusammenstehen, und dann wird dem deutschen Volk Gott zum Siege verhelfen.«
Der Student blies die Wangen auf. In diesem Augenblick war sein Ruf als Friedenskaiser dahin.
»Anton, Anton, Hilfe!«
Angesichts der hysterisch klingenden Rufe runzelte Anton die Stirn. War er gemeint? Sein Blick glitt über die Köpfe der Menge unterhalb seines Standplatzes, dabei entdeckte er Margaretes rotblonde Locken und ihr zartes Gesicht.
Lina!, schoss ihm durch den Sinn. Wo Margarete sich aufhielt, war meist die Tochter von Professor Barna nicht fern. Margaretes von Kopf bis zu den Füßen ramponiertes Äußeres ließ ihn schnell reagieren. Er hangelte sich am Geländer entlang, bis er sich ihr genähert hatte. Tränen liefen über ihr schmutziges Gesicht und ihre aufgerissenen Augen sprachen von der Angst, die sie empfand.
»Ich habe Lina verloren! Sie ist gestürzt, gleich hier auf der Brücke!«, rief Margarete ihm gegen den erneut aufbrandenden Jubel der Menschen zu.
Anton beugte sich nach vorn, um an dem Marmorsockel vorbei in die Richtung zu schauen, aus der Margarete gekommen war. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Seit er vor rund sechs Jahren in die Dachkammer im Haus Barna einziehen durfte, liebte er Lina. Geraume Zeit hatte er seine Zuneigung für Dankbarkeit gehalten, da Lina ihm ermöglicht hatte, aus dem heruntergekommenen Scheunenviertel und einer schweren, aber brotlosen Arbeit in der Fabrik zu entkommen, um unter den Fittichen ihres Vaters Physik zu studieren. Obwohl er eines Tages erkannt hatte, wie tief seine Gefühle für sie gingen, hatte er es nie gewagt, sie darauf anzusprechen. Lina mochte fröhlich und unkompliziert sein, doch sie blieb die Tochter seines Gönners und dazu ein Mädchen aus der gehobenen Bürgerschicht. Sie war tabu für ihn, den einfachen Burschen, der früher nicht einmal eine eigene Wohnung besessen hatte, sondern gegen ein Entgelt als Schlafbursche bei einer Familie untergekommen war.
Kalte Angst griff nach seinem Herzen. Die Menschenmenge bewegte sich von links nach rechts, von vorne nach hinten, und immer mehr Berliner drängten herbei. Inzwischen versuchten Polizisten Ordnung in den unaufhaltsamen Strom eintreffender Bürger zu bringen, aber wie schnell konnte unter den Füßen der aufgepeitschten Menge ein Mensch zu Tode kommen?
Die Feiernden begannen zu singen. Während Tausende Kehlen Nun danket alle Gott6 intonierten, stockte Anton der Atem. An dem Sockel des nächsten Brückenpfeilers drängten sich mehrere Menschen und hinter ihnen, so eng an den Stein gepresst, als wolle sie mit ihm verschmelzen, glaubte er Lina zu sehen.
»Bleiben Sie hier, Frau Groß, direkt am Pfeiler. Notfalls klettern Sie hinüber, auf die andere Seite des Geländers«, rief er und sprang von der Brüstung mitten zwischen die Passanten. Dabei streifte er einen bulligen Mann derb an der Schulter. Dieser drehte sich mit wütendem Gesichtsausdruck nach ihm um und griff nach dem Störenfried.
Anton, zwar groß gewachsen, aber als ausschließlich mit dem Geiste arbeitender Mensch nicht gerade mit viel Muskelkraft ausgestattet, duckte sich und zwängte sich zwischen anderen Anwesenden hindurch. Zielsicher steuerte er den nächstgelegenen Brückenpfeiler an, obwohl er, eingekeilt in der Menge, nicht mehr sehen konnte, was dort vor sich ging. Sein langsames Vorankommen ließ ihn zunehmend verzweifelter, aber auch wütender werden. Schließlich stellte sich ihm ein kräftiger Jugendlicher mit herausforderndem Blick in den Weg. Offensichtlich war er dem rücksichtslos drängelnden Studenten gegenüber auf Streit aus.
Ohne lange nachzudenken schlug Anton dem Kerl die geballte Faust ins Gesicht. Aus der Nase seines Gegners schoss Blut, und noch ehe dieser seine Hände an den Quell des Schmerzes legen konnte, huschte Anton an ihm vorbei. Endlich erreichte er erneut das Geländer, hangelte sich an diesem entlang und entdeckte Lina, kaum zwei Schritte entfernt. Eingekeilt zwischen mehreren Männern schien sie den rötlichen Sockel zu umarmen. Ihre Augen waren geschlossen, und die bläuliche Farbe ihrer Lippen steigerte seine Angst um sie.
»Lina!«, rief er und boxte wild um sich, bis es ihm gelang, zu ihr vorzudringen. Anton rammte dem Hünen, der sie an die Brüstung quetschte, den Ellenbogen in die Seite, und als der Mann sich ihm eher verwundert als aufgebracht zuwandte, sackte Lina wie eine leblose Puppe in sich zusammen. Entsetzt sah der große Fremde sie an und bemühte sich, sie wieder auf die Beine zu stellen, dabei rief er aus: »Mein Gott, ich habe sie gar nicht bemerkt!«
Wieder drängte die Menge in ihre Richtung. Sowohl Anton als auch der erschrockene Mann mit der schlaffen Lina im Arm wurden rücksichtslos gegen die verzierte und mit Figuren bestückte Brüstung gedrückt.
Beherzt sprang Anton auf die Querverstrebung und kletterte auf die gegenüberliegende Seite der Absperrung.
»Geben Sie sie mir herüber!«, schrie er den bulligen Mann an.
»Aber …?«
»Los doch! Die Frau ist ohne Bewusstsein und muss hier weg!«
Der Hüne nickte, hob Lina hoch, als wiege sie nicht mehr als ein Kätzchen, und setzte sie rücklings auf der Brüstung ab, sodass ihr Rücken an Antons Brust lehnte. Der löste seine Hände zeitgleich vom Gatter, umgriff schnell Linas Körper und ließ sich mit ihr im Arm nach hinten fallen. Sekunden später schlugen die Fluten des Kupfergrabens über ihnen zusammen.
***
Anton blieb zum Schwimmen nur eine Hand und die Beine. Er versuchte, sich und Lina mit der Strömung an den Uferrand zu manövrieren. Rechts von ihnen erhoben sich die Museen majestätisch in die Höhe. Er wusste, gleich würde eine Brücke den Kupfergraben überspannen. Das war ihre Chance! Noch kräftiger arbeitete er mit den Beinen, obwohl der nasse Stoff seiner Hose jede Bewegung erschwerte. Seine Schuhe hatte er längst abgestreift.
Unsanft prallte er mit dem Rücken gegen ein Hindernis und schrammte an diesem entlang. Er griff mit seiner freien Hand nach der glitschigen, von grünen Algen bedeckten Steinwand und ließ sich bis unter der Brücke hindurch treiben, wo ihn die Strömung fast wie von selbst an einige in den Kupfergraben führende Stufen schwemmte.
Der Student setzte sich und zog Lina aus dem Wasser auf seinen Schoß. Mit einer hastigen Bewegung strich er ihr die nassen Strähnen ihres hellen Haars aus dem Gesicht und atmete befreit auf, als er sah, dass sie bei Bewusstsein war und die Augen geöffnet hatte.
Ihr Blick wanderte von den bemoosten Brückensteinen über die steil ansteigende betonierte Böschung zu seinem Gesicht. »Anton«, flüsterte sie und ihr Lächeln setzte sein Herz in Flammen. Er warf alle Vorbehalte über Bord, zog sie noch fester an seine noch immer von der Anstrengung kräftig arbeitende Brust und legte seine Hand an ihre nasse, kalte Wange.
»Als ich dich dort an dem Pfeiler sah … mein Gott, ich dachte, ich hätte dich verloren«, stieß er hervor.
»Du … mich verloren?« Lina schaute ihm prüfend in die Augen. Als er nickte, ergoss sich aus seinem Haar ein Tropfenregen über die Frau in seinen Armen. Behutsam wischte er ihr das Flusswasser aus dem Gesicht.
»Dann magst du mich also doch ein bisschen?« Sie hob die Hand, zögerte dann aber. Allerdings wäre sie nicht Lina Barna gewesen, wenn sie nicht mutig zu Ende gebracht hätte, was sie vorgehabt hatte. »Ich dachte immer, du machst dir nichts aus mir.« Federleicht legte sie ihre Hand an seine Wange.
Ihre Berührung schien seine Haut zu verbrennen und er stöhnte innerlich auf. Sechs endlos erscheinende Jahre hatte er seine Gefühle für Lina tief in seinem Herzen vergraben. Und nun war sie ihm so herrlich nah und offenbar bereit, seine Zuneigung zuzulassen.
»Du hast mir das Leben gerettet«, flüsterte sie. Er zuckte lediglich mit der rechten Schulter. Wusste sie nicht, dass er alles für sie tun würde? Langsam beugte er sich nach vorn und näherte sich mit seinem Gesicht dem ihren. Er wollte sie küssen; ausprobieren, wie ihre Lippen schmeckten.
»Margarete!«, stieß Lina in diesem Augenblick erschrocken hervor, ließ ihn dabei aber nicht aus den Augen.
»Sie hat mich auf deine missliche Lage aufmerksam gemacht. Es geht ihr bestimmt gut«, raunte Anton heiser und senkte seine Lippen auf die ihren. Die Intensität, mit der sie den Kuss erwiderte, erfüllte ihn mit unbändiger Freude, doch als er seine Hand über den nass an ihr klebenden Blusenstoff gleiten ließ, schob sie ihn von sich. Ihr Atem ging schwer, aber ihre Augen blitzten ihn nicht etwa vorwurfsvoll, sondern gewohnt heiter an. »Damit lassen wir uns noch etwas Zeit.«
Er nickte, unfähig zu sprechen, ahnte jedoch, dass ihre Zweisamkeit jetzt ein jähes Ende finden würde. Ob er heute noch den Mut aufbringen würde, Professor Barna seine Gefühle für Lina einzugestehen?
»Leihst du mir bitte dein Jackett? Ich denke, wir können von der Museumspforte aus Vater anrufen, und ihn bitten, uns mit dem Automobil abzuholen.«
Fürsorglich half Anton Lina auf und achtete darauf, dass sie auf den glitschigen Stufen nicht ausrutschte und zurück in den Fluss stürzte. Erst als sie sicher auf beiden Beinen stand, erhob er sich, entledigte sich seines Jacketts und legte es Lina um die schmalen Schultern. Die wegen der Nässe durchsichtige weiße Bluse machte das zwingend nötig.
»Geht es dir auch wirklich gut?«, forschte er besorgt nach.
»Mein Rücken schmerzt. Vater wird sicher auf einen Arztbesuch drängen. Und mir ist etwas schwindelig, deshalb bestehe ich auf deinem Arm.« Ihr Lächeln geriet leicht schief, weil sie tatsächlich unter Schmerzen und einem unangenehmen Schwindelgefühl litt.
Nur zu gern legte er seinen rechten Arm um sie und stützte sie, als sie langsam die Stufen erklommen und sich von dort hinüber zum Eingangsbereich des Museums wandten. Auch hier bevölkerten diskutierende und feiernde Menschentrauben den Platz.
Anton warf einen kritischen Blick über die Schulter in Richtung der Stadtschlosskuppel. Er konnte nur hoffen, dass es Margarete gelungen war, die Brücke und die verstopften Straßen unbehelligt zu verlassen.
5 Herrenstrohhut
6 Evangelisches Gesangbuch Nr. 321
Kapitel 3
Paris, Frankreich, August 1914
Philippe zog sich in den Schatten eines Gebäudes zurück und ließ den Trupp französischer Soldaten passieren. Akkurat gekleidet und in voller Bewaffnung marschierten sie die Rue d’Arcole hinab in Richtung Seine-Brücke. Mit grimmigem Gesicht sah er den Männern nach, wohl wissend, dass sie sich den Deutschen bei ihrem Marsch gen Paris in den Weg stellen würden und allesamt einem grauenhaften Moloch in die Arme liefen.
Nachdem die Division an ihm vorbeiexerziert war, entspannte er sich wieder, trat auf die Straße zurück und blickte über die Pont d’Arcole zum gegenüberliegenden Ufer.
An das Brückengeländer gelehnt wartete eine groß gewachsene, schlanke Frau, bis die Soldaten an ihr vorüber waren, und hastete dann in seine Richtung. Unwillig kniff er die Augen zusammen, doch es bestand kein Zweifel: Es handelte sich um Demy van Campen.
Philippe stieß einige halblaute Unfreundlichkeiten aus und zog sich erneut in den Schatten der Gebäude zurück. Hatte er Demy nicht vor ein paar Tagen nahegelegt, Frankreich zu verlassen? Inzwischen waren deutsche Heeresteile ohne diplomatische Vorbereitung in Luxemburg einmarschiert, da sie die dortigen Eisenbahnlinien sichern wollten, und hatten von Belgien das Durchmarschrecht verlangt. Die Kriegserklärung an Frankreich war am Vortag übermittelt worden und damit verbunden ein Einmarsch der deutschen Truppen ins neutrale Belgien, was zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Belgien und Deutschland und zu einer Kriegserklärung Großbritanniens an Deutschland geführt hatte. Daraufhin hatte auch Deutschland Belgien den Krieg erklärt. Das Geschehen glich einer Kettenreaktion, die niemand mehr zu durchbrechen imstande war. Jegliche Vernunft schien der Welt in diesen Tagen verloren gegangen zu sein. Einzig Italien, das sich weigerte, Deutschland und Österreich beizustehen, da es diese für die Aggressoren hielt und sich deshalb nicht zur Einhaltung seines Bündnisses verpflichtet sah, offenbarte noch einen Funken von Verstand.
Was würde in den nächsten Stunden und Tagen folgen? Kriegserklärungen einiger baltischer Staaten gegen Österreich-Ungarn und die Österreich-Ungarns an Russland? Damit würde der Grundstein für neue Krisenherde gelegt sein und einem Desaster im jungen Jahrhundert alle Wege geebnet.
Philippes Problem war momentan jedoch diese eigensinnige Deutsch-Niederländerin, die nicht nur meinte, trotz der brisanten politischen Lage fröhlich durch die Straßen von Paris flanieren zu müssen, sondern auch noch ausgerechnet vor dem Haus anhielt, das unter seiner Beobachtung stand. Soeben zog sie ein weißes Kuvert aus der Tasche ihres dunkelblauen figurbetonten Kostüms und überprüfte die Adresse darauf.
Philippe lehnte sich an die kühle Steinmauer und verschränkte die Hände hinter seinem Kopf. Zumindest tat sich jetzt endlich etwas, und er konnte möglicherweise einen Blick auf den Bewohner des Hauses erhaschen. Um Demy zur Rechenschaft zu ziehen blieb später noch Zeit. Sie trat zur Haustür und klopfte kräftig an das dunkle Holz. Sekunden verstrichen. Von links näherte sich ein schwarzes Automobil, das in einiger Entfernung am Straßenrand anhielt. Niemand stieg aus. Fast gleichzeitig fuhr auch von rechts ein Wagen in die Rue d’Arcole. Dieses Fahrzeug stoppte gut hundert Meter entfernt, ohne dass der Fahrer oder ein Insasse ausstieg.
Im gegenüberliegenden Gebäude öffnete jemand ein Fenster, dabei traf die Sonne für einen Moment auf die Scheibe und blendete Philippe. Ein ihm unbekannter jüngerer Mann mit struppigem Vollbart lehnte sich hinaus und sah sich prüfend um. Das Zuschlagen einer Autotür ließ Philippe endlich reagieren, wenn auch unwillig. Es war an der Zeit, Demy aus einer Gefahr zu retten, von der sie, so vermutete Philippe, nicht einmal etwas ahnte.
Kraftvoll stieß er sich von der Hauswand ab, überquerte betont lässig die Straße und ergriff Demy von hinten an den Schultern. Die junge Frau zuckte erschrocken zusammen.
»Versuchen Sie den Umschlag unauffällig verschwinden zu lassen und kommen Sie mit mir. Vermeiden Sie jede hektische Bewegung, es sei denn, Sie haben Lust, als Spionin verhaftet zu werden und unangenehmen Befragungen und Gefängnisaufenthalten ausgesetzt zu sein.«
»Was soll das?«, rief Demy ungehalten und wehrte sich gegen seinen festen Griff.
»Wir gehen nach links, in Richtung Notre Dame. Ich lege jetzt meinen Arm um Sie. Streiten können Sie später mit mir, sobald wir in Sicherheit sind.«
Philippe zog Demy das Kuvert aus der Hand, steckte es blitzschnell zwischen Türrahmen und Tür durch einen Schlitz und legte dann seinen Arm um ihre schlanke Taille. Mittlerweile näherten sich ihnen feste Männerschritte. Kleine Schweißperlen traten Philippe auf die Stirn. Um sich fürchtete er nicht. Er besaß einen französischen Pass, in dem Paris als sein Geburtsort eingetragen war, zudem sprach er fließend Französisch. Demy hingegen ging nur so lange als Niederländerin durch, bis die Behörden ihren Wohnsitz überprüften. Und das würden sie tun, wenn sie die Frau vor dem Haus eines wegen Spionage verdächtigten Deutsch-Franzosen aufgriffen.
Erfreulicherweise folgte Demy seinem Befehl, wenngleich sie für etwas mehr Abstand zwischen sich und ihm sorgte. Als sie an dem zweiten geparkten Automobil vorbeikamen, öffneten sich auch dort die Türen.
»Weitergehen, Demy. Legen Sie Ihren Kopf an meine Schulter. Es wäre angebracht, etwas mehr Vertrautheit auszustrahlen.«
Demy gehorchte seiner geflüsterten Anweisung und er zog sie näher an sich. Ihre schwarzen Locken kitzelten ihn am Hals. Er spürte ihr Zittern, konnte jedoch nicht einschätzen, ob es von Furcht oder Wut herrührte. Gespielt einträchtig schritten sie die Straße entlang und bogen schließlich in die Rue du Cloitre Notre Dame ein. Rechts von ihnen ragten die beiden quadratischen Türme des gotischen Kirchengebäudes in den beinahe wolkenlosen frühabendlichen Himmel. Während sie an Notre Dame vorbeischlenderten, fand Demy ihre Sprache wieder.
»Was soll das alles bedeuten? Wer sind die Männer, die uns verfolgen?«
Philippe blieb stehen, drehte sich zu ihr und zog sie in seine Arme. Für einen Moment überkam ihn ein flaues Gefühl. Seit Udakos Tod damals in der afrikanischen Kolonie hatte er keine Frau mehr in den Armen gehalten. Doch ihre Situation war nicht dazu angetan, sich Gedanken darüber zu machen, wann er sein Herz wieder für eine andere Frau öffnen konnte.
Demy hielt still, was für Philippe ein deutliches Zeichen dafür war, dass sie die Gefahr erfasste, in der sie steckten. Ob seine warnenden Worte ausreichend gewesen waren oder ob sie wusste, wer in dem Haus wohnte, blieb momentan ungeklärt.
Philippe legte seine Wange auf ihr Haar und konnte somit unauffällig zurückschauen. Nur ein paar Schritte hinter ihnen stand ein Mann in Zivil, der intensiv die Türme von Notre Dame begutachtete, sich aber zum Gehen wandte, als Philippe Demy aus seinen Armen entließ und sie sich in Richtung Ile Saint-Louis bewegten.
Demy ergriff Philippes Rechte, was ihn zu einem grimmigen Grinsen verleitete. Dieses Mädchen war beeindruckend! Durch ihre Geste spielte sie ihrem Verfolger noch immer die verliebte Frau vor, hielt ihn aber auf gebührendem Abstand.
»Was hat das alles zu bedeuten?«, zischte Demy und warf ihm einen unfreundlichen Seitenblick zu.
»Das müsste ich wohl besser Sie fragen. Was für eine Nachricht geben Sie bei einem Mann ab, der unter dem Verdacht steht, in Deutschland für die Franzosen zu spionieren?«
»Oh«, entfuhr es Demy.
Philippe kniff die Augen zusammen, während sie an der Grünanlage vorbei und auf die Pont Saint-Louis zugingen. War Demy so unschuldig, wie sie tat, oder wusste sie sehr genau, wem sie eine Nachricht hatte überbringen müssen? Dem Wildfang war das durchaus zuzutrauen, selbst wenn sie inzwischen erwachsen geworden war und sich stilvoll zu kleiden und angemessen zu benehmen wusste.
»Ein Mann bat mich, seiner Verlobten eine Mitteilung zu überbringen. Er hat sich freiwillig zur Armee gemeldet und ihm blieb nicht mehr genügend Zeit, sich von ihr zu verabschieden.«
Auf diese Erklärung hin lachte Philippe trocken auf, was sie mit einem wütenden Seitenblick quittierte. »Auf eine so sentimentale Geschichte kann nur eine Frau hereinfallen.«
»Hereinfallen? Was denken Sie, wie oft sich Geschehnisse wie diese momentan in Europa abspielen?«
»Das anzunehmen sind Sie bereit, nicht aber meine Warnung vor den drohenden kriegerischen Auseinandersetzungen vor ein paar Tagen?«
Demy schwieg und er drückte sie kurzerhand gegen die Brüstungsmauer. Unter ihnen floss die Seine gurgelnd dahin und verlor sich in vielen Schleifen und Windungen inmitten des Häusermeers. Während er die junge Frau, die sich unter seiner Berührung spürbar versteifte, nochmals in seine Arme schloss, wagte er erneut einen Blick zurück. Erfreulicherweise hielt ihr Verfolger nun deutlich mehr Abstand ein. Er hatte noch nicht einmal die Brücke erreicht.
»Gehen wir jetzt endlich weiter?«, fauchte Demy ihn an.
»Sie wissen doch, wie gern ich eine hübsche Dame im Arm halte.«
»Ich weiß nichts, was Sie betrifft. Immerhin haben Sie Ihrer Pflegefamilie sträflich den Rücken zugekehrt.«
»Sie haben mich doch nicht etwa vermisst?«
Ihr Knuff in seine Seite fiel harmlos aus, vermutlich, weil sie sich viel zu sehr vor ihrem Beobachter fürchtete.
»Wir überqueren die Brücke und wenden uns dann nach links zu den Stufen, die von dort ans Wasser führen. Unterhalb der Brücke sehe ich zwei Ruderboote liegen.«
Durch ein Kopfnicken an seiner Schulter gab Demy ihm zu verstehen, dass sie ihn verstanden hatte. Er trat zurück, ergriff erneut ihre Hand und gemeinsam schlenderten sie weiter, als täten sie das seit Jahren.
Kaum auf den Stufen am Brückenende angelangt und somit aus dem Blickfeld ihres Verfolgers verschwunden ließ Philippe Demy los und sprang, mehrere Stufen auf einmal nehmend, hinunter an das Ufer. Mit hastigen Bewegungen knotete er das kleinere Ruderboot los, befestigte es an dem größeren und bestieg dieses.
Demy folgte ihm, ohne dass er ihr seine Hilfe anbieten musste. Sie stieß mit dem Fuß das Holzboot vom Ufer ab, sodass die Strömung es sofort erfasste.
Während Philippe sich kräftig in die Riemen legte, nahm Demy rasch auf der hölzernen Sitzbank im Heck Platz. Dabei streckte sie ihre Beine weit von sich, stützte die Arme auf die Dollwand und lehnte den Oberkörper wie eine Sonnenanbeterin zurück. So beobachtete sie, wie ihr Verfolger an die Brückenbrüstung sprang und fluchend mit der Faust auf den Stein schlug.
»Ich bin am Meer aufgewachsen und liebe jede Art von Wasser«, lachte sie übermütig auf, ehe sie sich aufrecht hinsetzte.
Philippe ließ seinen weiblichen Passagier nicht aus den Augen. Demy betrachtete die von der Abendsonne umschmeichelten Prachtbauten entlang der Seine, bewunderte die mit Efeu umrankten Hausfassaden und Tordurchlässe und die im sanften Gold erstrahlenden Schmuckfenster. Schließlich rutschte sie zur Backbordseite und tauchte ihre linke Hand in die kühlen Fluten.
»Demy, welcher Name stand auf dem Kuvert?«, erkundigte Philippe sich endlich. Sie ließ ihre Finger weiterhin durchs Wasser gleiten und strich sich mit der anderen Hand eine widerspenstige schwarze Locke aus dem Gesicht.
»Keiner. Es war nur der Straßenname, die Nummer und die Wohngegend vermerkt. Aber was haben Sie mit der Angelegenheit zu schaffen? Woher wissen Sie, dass dort ein Spion wohnen soll, und was taten Sie vor seinem Haus? Spionieren Sie ebenfalls? Für die Deutschen oder für die Franzosen?«
»Die Fragen gebe ich sofort an Sie zurück. So professionell, wie Sie auf mein Erscheinen reagiert haben, müssen Sie über gewisse Erfahrungen verfügen, was Heimlichkeiten anbelangt.«
»Das ist doch Blödsinn!«, erwiderte sie, schüttelte die nasse Hand aus und setzte sich aufrecht hin.
»Ich soll Ihnen also die tragische Geschichte mit dem Soldaten und seiner Verlobten abkaufen?«
»Ich kann Sie nicht zwingen, mir zu glauben.«
»Wer war dieser Soldat, der Ihnen die Nachricht anvertraute? Kennen Sie seinen Namen?«
»Ich sage Ihnen nichts, bevor Sie mir nicht verraten haben, für wen Sie spionieren!«
Philippe lächelte amüsiert über ihren Kampfeswillen und versuchte abzuschätzen, wie weit sie die Seine inzwischen hinabgefahren waren. »Mir geht es ähnlich wie Ihnen, Demy. Ich habe keine deutschen Wurzeln, lebe aber seit vielen Jahren in Deutschland. Für welches Land also schlägt unser beider Herz?«
»Mir geht es kein bisschen wie Ihnen!«, entrüstete sie sich. »Zufällig befinden sich das Deutsche Reich und Frankreich im Krieg. Die Niederlande hingegen sind neutral. Und da ich einen Großteil meines Lebens in den Niederlanden verbracht habe, sehe ich dieses Land als mein Heimatland an.«
»Wer war dieser Mann, der Sie beauftragt hat?«, drängte Philippe auf eine Antwort auf seine vorrangigste Frage.
»Er hat mich gebeten, nicht beauftragt. Sein Name ist Clément Rouge, aber ich glaube nicht, dass Ihnen der von Nutzen ist.«
Philippe wandte den Blick von ihr weg auf auf das blaugraue Wasser, das an den Rumpf des Holzbootes schwappte. Clément Rouge, das klang nach Karl Roth. Hatte sich der Mann, den er – gemeinsam mit Eric van Campen, Demys Vater – für den Mörder seiner Verlobten hielt, also doch nach Frankreich abgesetzt und arbeitete jetzt als Informant für den französischen Geheimdienst? Philippe biss die Zähne zusammen. War es also kein Zufall, dass er vor einer Woche hier in Paris auf Karl Roth, seinen ehemaligen Unteroffizier im Dienste der kaiserlichen Schutztruppe Deutsch-Südwestafrikas gestoßen war? Roth hatte sich niemals gänzlich dem Vorwurf entziehen können, an dem Überfall auf die Missionsstation in Windhuk beteiligt gewesen zu sein. Nach diesem Vorfall, bei dem ein kleiner Junge und Philippes Verlobte Udako zu Tode gekommen und Philippe schwer verletzt worden war, war Roth ins Deutsche Reich zurückversetzt und dort unehrenhaft entlassen worden.
Nicht zum ersten Mal fragte sich Philippe, ob Roth etwas mit dem überraschenden Tod van Campens zu tun hatte. Vielleicht hatten die beiden noch eine offene Rechnung aus ihrem Diamantengeschäft zu begleichen gehabt?
Philippe warf einen flüchtigen Blick auf Demy, die versonnen die Spiegelungen der Sonne im Flusswasser beobachtete. Wusste Clément Rouge, wie Roth sich nun nannte, wer die Frau war, die er gebeten hatte, eine vermutlich hochbrisante Nachricht an seinen Spitzelkollegen zu überbringen? Hatte er geplant, eine van Campen-Tochter gezielt in Schwierigkeiten zu manövrieren, oder war ihr Zusammentreffen rein zufälliger Natur gewesen? Womöglich hatte Rouge bemerkt, dass er vom französischen Geheimdienst verfolgt wurde, und war auf diese Weise elegant seine Nachricht losgeworden, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen …
»Kennen Sie diesen Rouge schon länger?«, bohrte Philippe nach und beobachtete, wie das Mädchen aufschrak.
»Ich? Nein. Als ich das Stadthaus der Ledouxs verließ, kam er die Straße entlang geeilt und hielt mich mit der Bitte auf, einen Brief an seine Verlobte abzugeben.«
Philippe, der seinen Verdacht bestätigt sah, dass Roth der van Campen-Tochter bewusst aufgelauert hatte, verkniff sich die Frage, wohin ihr Weg sie ursprünglich hatte führen sollen. Er sah sie so lange nachdenklich an, bis sie den Kopf wegdrehte und wieder aufs Wasser blickte. »Ich werde Sie unverzüglich aus Paris hinaus und über die Grenze schaffen.«
»Unverzüglich? Wie stellen Sie sich das vor?«
»So, wie ich es sagte: sofort.«
Demy atmete laut aus und blitzte ihn herausfordernd an. »Der Grenzübertritt ist morgen bestimmt nicht wesentlich schwieriger als heute.«
»Demy, Sie sind in Gefahr!«, knurrte Philippe, aufgebracht über ihr zu ständigem Widersprechen aufgelegtes Wesen. Vielleicht sollte er sie einfach ihrem Schicksal überlassen! »Und das nicht nur, weil Sie als Deutsche fröhlich durch Paris spazieren und dabei das Augenmerk des Geheimdienstes auf sich ziehen, sondern auch, weil dieser Clément Rouge Sie gefunden hat.«
»Gefunden?«
Jetzt hatte er ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Mit ihren blauen Augen sah sie ihn verwirrt an und wirkte dabei erstaunlich verletzlich. Er holte die Paddel ein und legte die tropfenden Ruderblätter vorsichtig links und rechts von ihr auf dem Dollbord ab.
»Clément Rouge hieß vor sechs Jahren, als er in Afrika seine Pflichtdienstjahre ableistete, Karl Roth. Er steht im Verdacht, für einen erfolglosen Diamantschürfer in der Namib-Wüste Überfälle auf andere Minen und Diamanttransporte unternommen zu haben, bei denen es auch Tote gab.«
Die Querfalten, die auf Demys schmaler Nase entstanden, zeigten ihm deutlicher noch als ihre zusammengezogenen Augenbrauen, wie weit ihre Überlegungen vorausjagten und wie ungern sie ihm Glauben schenken wollte.
»Sein Auftraggeber van Campen verließ Afrika fluchtartig; Roth, dem nichts bewiesen werden konnte, wurde ins Deutsche Reich zurückgeschickt und verschwand dann. Kurze Zeit darauf zog man den Leichnam Ihres Vaters aus dem Kanal. Vermutlich schuldete Ihr Vater dem Kerl eine Menge Geld.«
Erneut presste er die Zähne fest zusammen. Er spielte mit dem Gedanken, einer Tochter van Campens ins Gesicht zu sagen, dass ihr Vater für den Tod seiner Verlobten verantwortlich war, doch er konnte es nicht. Die Erinnerungen nagten noch immer zu schmerzlich an ihm.
»Es kann kein Zufall sein, dass Roth mit der Bitte, seine geheime Botschaft weiterzureichen, ausgerechnet an Sie herantrat. Vielleicht besaß er sogar die Dreistigkeit, gleichzeitig den französischen Geheimdienst in die Rue d’Arcole zu schicken?«
Demy starrte ihn mit halb geöffnetem Mund fassungslos an. Schließlich schüttelte sie so entschieden den Kopf, dass ihre Locken wild um ihre Schultern tanzten. Täuschte er sich, oder schimmerten Tränen in ihren Augen? »So eine abstruse Geschichte kann sich nur jemand ausdenken, der selbst eine Menge Dreck am Stecken hat«, sagte sie ungehalten und erhob sich.
Philippe griff reaktionsschnell nach den Riemen. »Setzen Sie sich wieder hin, oder wollen Sie an Land schwimmen?«, fuhr er sie an.
»Sie rudern mich jetzt sofort an die nächste Anlegestelle und lassen mich aussteigen. Ich finde den Weg zum Haus der Familie Ledoux allein.«
»Sie dürfen nicht länger in Paris bleiben! Der Krieg, Roth und der französische Geheimdienst könnten Ihnen das Leben unerträglich machen.«
»Vielmehr sind es Ihre Hirngespinste, die …«
»Hinsetzen!«, kommandierte Philippe energisch. Seine geschulte Offiziersstimme ließ sogar Demy gehorchen, allerdings schwieg sie nun beharrlich und mit trotzig vor dem Oberkörper verschränkten Armen. Er ließ sie gewähren, war er doch froh darüber, in Ruhe seinen Überlegungen nachhängen zu können. Das, was dabei herauskam, würde dem streitbaren Mädchen helfen – aber sicher nicht gefallen!
***
Nachdem Philippe und Demy durch einige der Schleifen gerudert waren, die die Seine durch Paris zog, verließen sie in Issy-les-Moulineaux das Boot und stiegen in ein rotes Taxi. Der Renault ratterte über das Kopfsteinpflaster, während Demy sich darum bemühte, so weit wie möglich von ihrem Begleiter wegzurücken, was dieser lediglich mit einem Lächeln quittierte.
Im Augenblick quälte sie die Frage, ob es richtig war, Philippe zu vertrauen. Aber seine Worte hatten ihr Angst gemacht, was sie natürlich niemals zuzugeben bereit war. Hatte der verzweifelt wirkende Clément Rouge sie wirklich getäuscht? Waren Rouge und ihr Vater in Deutsch-Südwest tatsächlich Partner gewesen? Gehörte er einem Spionagenetzwerk an und hatte geplant, sie absichtlich in die Sache hineinzuziehen, um sich für seine verlorenen Investitionen im Diamantgeschäft ihres Vaters zu rächen?