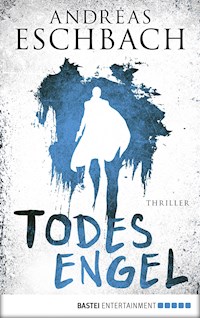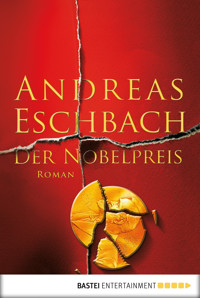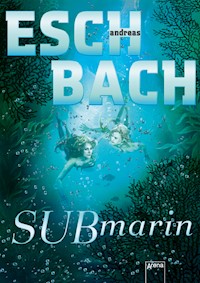
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Aquamarin-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Noch immer kann es Saha kaum glauben: Sie ist ein Submarine, halb Mensch, halb Meermädchen. Gemeinsam mit ihrem Schwarm erkundet sie den Ozean. Als Saha auf den mysteriösen Prinzen des Graureiter-Schwarms trifft und mit ihm auf seinem Wal reitet, ist sie wie verzaubert. Sie ist entschlossen, von nun an selbst über ihr Schicksal zu bestimmen. Doch der König der Graureiter hegt finstere Pläne für die Submarines, in denen ausgerechnet Saha als Mittlerin zwischen den Welten eine wichtige Rolle spielt. Saha gerät in große Gefahr und muss eine folgenschwere Entscheidung treffen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Andreas Eschbach
SUB marin
Roman
Weitere Bücher von Andreas Eschbach im Arena Verlag:
Aquamarin Black*Out Hide*Out Time*Out Perfect Copy Die seltene Gabe Gibt es Leben auf dem Mars Das Marsprojekt – Das ferne Leuchten (Band 1) Das Marsprojekt – Die blauen Türme (Band 2) Das Marsprojekt – Die gläsernen Höhlen (Band 3) Das Marsprojekt – Die steinernen Schatten (Band 4) Das Marsprojekt – Die schlafenden Hüter (Band 5)
1. Auflage 2017 © Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen Einbandgestaltung: Juliane Hergt unter Verwendung einer Illustration von Mia Steingräber Reihenkonzept Umschlaggestaltung: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80701-0
www.arena-verlag.dewww.andreaseschbach.de
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1
Irgendwann weiß ich nicht mehr, wo ich bin, wo ich herkomme, wo ich hinwill. Meine Schwimmbewegungen erlahmen. Ich schwebe in einer konturlosen azurblauen Unendlichkeit, die über mir heller wird und unter mir dunkler, aber ich sehe den Meeresgrund nicht mehr und auch keine Fische, nicht einen einzigen.
Ich höre auf, mich zu bewegen. Entsetzen erfüllt mich. Ich habe so etwas schon einmal erlebt. Damals, bei einem meiner ersten Tauchgänge. Kurz bevor der Hai aufgetaucht ist und mich angegriffen hat. Damals war der Ozean um mich herum genauso gestaltlos und leer.
Damals? Es kommt mir vor, als sei das Jahre her, dabei sind seit jenem Tag erst vier Wochen vergangen. Aber mir kommt es auch vor, als sei es Jahre her, dass ich von der Kaimauer von Seahaven ins Meer gesprungen bin. War das wirklich heute? Bin ich wirklich erst vor ein paar Stunden aufgebrochen, um mich auf die Suche nach meinem Vater zu machen? Meinem Vater, der irgendwo in den Ozeanen lebt – möglicherweise! – und von dem ich nichts weiß außer seinem Namen: Geht-hinauf.
Jetzt gerade kommt mir das vor wie die dümmste Idee aller Zeiten.
Ich verharre, drehe mich mit unmerklichen Schwimmbewegungen um mich selbst, halte Ausschau. Kein Hai. Bis jetzt jedenfalls.
Dann schreie ich.
Schall trägt unter Wasser weit und er bewegt sich darin mehr als dreimal so schnell wie in Luft. Zum Glück, denn so hat mein Schrei eine Chance, denjenigen zu erreichen, für den er gedacht ist: Schwimmt-schnell, der versprochen hat, mir bei der Suche nach meinem Vater zu helfen. Außerdem hat er versprochen, mich zu beschützen – aber er scheint ständig zu vergessen, dass ich nicht so schnell schwimme wie er. Meine Mutter hat mir die Schwimmhäute zwischen meinen Fingern am Tag nach meiner Geburt entfernen lassen, aber selbst wenn sie das nicht getan hätte, wäre es mir unmöglich, mit diesem Mann mitzuhalten, der durchs Wasser schießen kann wie eine Rakete.
Ich warte. Nach ein paar Augenblicken mache ich einen dunklen Fleck in der blauen Unendlichkeit vor mir aus, dann eine Bewegung, die sich zu meiner Erleichterung nicht in einen Hai, sondern in Schwimmt-schnell verwandelt. Er lacht mich frech an, obwohl er genau weiß, dass das heute schon zum dritten Mal passiert ist.
Tut mir leid, behaupten seine Hände, aber sein Grinsen erzählt eine ganz andere Geschichte.
Kein bisschen tut es dir leid, widerspreche ich ihm mit ärgerlichen Gebärden. Ich bin sicher, dass meine Augen reinen Zorn versprühen. Was, wenn ein Hai gekommen wäre? Du hättest nicht einmal gemerkt, wie er mich frisst!
Er gibt sich unbekümmert. Hier sind keine Haie, behauptet er.
Das kannst du nicht wissen.
Doch.
Nein. Das sagst du nur so, aber in Wirklichkeit hast du mich einfach wieder vergessen.
Er zuckt mit den Schultern, schaut sich gelassen um. An jenem Tag hat er mich gegen den Hai verteidigt. Wenig später habe umgekehrt ich ihm das Leben gerettet; damals hat er erheblich mehr Respekt gezeigt!
Was immer er in der Gefangenschaft durchgemacht hat, es scheint keine Spuren hinterlassen zu haben. Er ist immer noch groß und muskulös, hat lange, wallende Haare und natürlich bleiche Haut wie vermutlich alle Submarines. Er trägt nur eine Art Lendenschurz und die Kiemen in seinem Brustkorb flattern sanft im Rhythmus seines Atems. Wir haben, als alles vorüber war, seinen Knochenspeer wiedergefunden und auch den Gürtel mit den Beuteln, in denen er allerlei rätselhafte Dinge bei sich trägt, sodass er jetzt wieder genau so aussieht wie an dem Tag, an dem ich ihm zum ersten Mal begegnet bin.
Ich hebe meine Hände, um ihm in Erinnerung zu rufen, wie sie aussehen, und erkläre ihm dann: Ich bin Schwimmt-langsam! Denk bitte daran!
Er lacht wieder. Nein, nein. Du bist die Mittlerin zwischen den Welten, die uns prophezeit worden ist, sagen seine Gesten. Während er seinen Händen beim Reden zusieht, scheint er ein wenig ernster zu werden. Er wiederholt das Zeichen des Bedauerns und erklärt dann: Es dauert nicht mehr lange, dann sind wir da.
Das hast du heute schon oft behauptet, gebe ich zurück, aber nur, um den Moment noch ein wenig hinauszuzögern, in dem ich weiterschwimmen muss. Ich bin noch nie so lange am Stück geschwommen. Ich war auch noch nie so lange am Stück im Wasser, geschweige denn unter Wasser.
Tatsächlich ist es überhaupt erst einige Wochen her, dass ich mich zum ersten Mal in meinem Leben ins Meer gewagt habe.
Schwimmt-schnell neigt den Kopf und grinst. Heute früh habe ich auch noch nicht gewusst, wie langsam du schwimmst!
Diesmal bemüht er sich wirklich, mir nicht davonzuziehen. Er schwimmt ein Stück voraus, mit ruhigen, eleganten Bewegungen, und ich habe das Gefühl, ich muss für jeden Schwimmzug, den er macht, zwei machen.
Ich kann meiner Mutter nicht böse sein. Es hat mir zweifellos eine Menge Ärger erspart, nicht auch noch Schwimmhäute zwischen den Fingern zu haben. Die Kiemen an meinem Oberkörper waren schlimm genug, jedenfalls, solange ich geglaubt habe, es seien Wunden, die aus irgendeinem Grund nicht vollständig heilten.
Die azurblaue Unendlichkeit hört wieder auf, so konturlos zu sein. Ein Schwarm silberner, pfeilförmiger Fische taucht auf und schwenkt ab, als er uns bemerkt, was aussieht wie ein schimmernder Vorhang, der durchs Wasser gezogen wird. Ich kann den Meeresboden wieder sehen. Keine Ahnung, in welche Himmelsrichtung wir schwimmen. Es ist mir völlig schleierhaft, wie sich Schwimmt-schnell orientiert, aber er wirkt, als sei er sich seiner Sache sicher. Ich hoffe, der Eindruck täuscht nicht.
Es kommt mir immer noch ganz unglaublich vor, dass erst ein paar Stunden vergangen sein sollen, seit ich Seahaven verlassen habe. Am Anfang ist der Meeresboden flach gewesen und voller Kabel und Rohrleitungen und klobiger Geräte, aber das haben wir alles längst hinter uns gelassen. Wir sind weit draußen, zumindest für meine Begriffe.
Vor zwei Monaten hatte ich noch Angst vor dem Wasser!
Und jetzt bewege ich mich darin, als sei ich hier zu Hause.
Obwohl – wer weiß? Vielleicht bin ich das ja.
Ich verliere mich in Gedanken, während meine Arme und Beine unentwegt die immer gleichen Bewegungen vollziehen. Das Gefühl, mich dadurch vorwärtszubewegen, hat sich wieder eingestellt, allerdings kostet es mich spürbar viel Kraft und Anstrengung. Bei Schwimmt-schnell dagegen sieht alles elegant und mühelos aus.
Er schwimmt schräg unter mir, ich kann das Spiel seiner Muskeln beobachten. Er trägt seinen aus einem großen Knochen geschnitzten Speer auf dem Rücken, an einem dünnen, geflochtenen Gurt befestigt. Ich denke, dass er ihn eigentlich behindern müsste, aber es sieht nicht so aus.
Allerdings ist mein kleiner ParaSynth-Rucksack, in dem ich ein paar Sachen mit auf die Reise genommen habe, von denen ich glaube, nicht darauf verzichten zu können, eigentlich auch nicht hinderlich. Womöglich liegt das tatsächlich an seiner dreieckigen Form, wie die Verkäuferin behauptet hat. Die Gurte sitzen jedenfalls so gut, dass ich ihn überhaupt nicht bemerke.
Ich konzentriere mich auf die Atmung. Das Wasser riecht – oder sollte man besser sagen, schmeckt? – nein, eigentlich gibt es gar kein passendes Wort dafür, wie sich Wasser anfühlt, das man nicht trinkt, sondern atmet –, jedenfalls, es ist frisch und wohltuend. Das war bisher nicht immer der Fall; wir haben einen Streifen durchquert, in dem es nach Abwässern und Schmutz schmeckte, dumpf und stickig und unangenehm, ein andermal mussten wir einen Bereich passieren, in dem es stechend chemisch roch.
Aber jetzt, so weit draußen, schmeckt es so, wie es sollte.
Mein Plan kommt mir dagegen immer noch vor wie der reine Wahnsinn.
Ich glaube, ich habe mich von Schwimmt-schnells Zuversicht anstecken lassen. Als ich ihm erklärt habe, ich würde gerne meinen Vater kennenlernen, hat er gemeint, ja, warum nicht, er werde mir helfen, ihn zu finden. Das sei er mir schuldig. Und so, wie er mich dabei angeschaut hat, klang das alles machbar.
Aber vielleicht ist er einfach nur ein wenig naiv?
Auf jeden Fall war ich naiv. Ich hätte mir eigentlich klarmachen können, wie riesig die Ozeane sind! Und ich meine wirklich RIESIG! Die Ozeane bedecken siebzig Prozent der Erdoberfläche. Das sind mehr als 360 Millionen Quadratkilometer. Australien ist nicht mal acht Millionen Quadratkilometer groß, und von Australien habe ich in meinem ganzen Leben nur ein paar Ecken gesehen. Richtig auskennen tue ich mich nur in Seahaven, das mit Mühe vier Quadratkilometer Fläche bedeckt. Vier!
Aussichtslos. Vielleicht ganz gut, dass ich mir das vorher nicht überlegt habe, sonst wäre ich bestimmt gar nicht erst aufgebrochen.
Denn andererseits: Was hätte ich denn sonst tun sollen? Ich musste es wenigstens probieren, wenn sich schon die Chance dazu geboten hat. Alles andere hätte ich mir mein Leben lang nicht verziehen.
Und dann war da noch Frau Brenshaw. Sie ist Mitglied der Gipiui Chingu, der geheimen Organisation der Freunde der Tiefe, die die Submarines schützen, seit es sie gibt.
»Selbst wenn du deinen Vater nicht finden solltest«, hat sie mir erklärt, »wird alles, was du uns nach deiner Rückkehr über die Submarines erzählen kannst – wie sie leben, wie sie denken, was sie sich wünschen und wovor sie sich fürchten –, einfach alles wird ungeheuer nützlich sein. Wir wissen so wenig über sie. Wir kennen sie nur von kurzen Begegnungen, nur durch das Glas von Tauchermasken hindurch. Du aber wirst mit ihnen leben können – das ist eine einmalige Chance!«
Das hat mich auch überzeugt.
»Das Wichtigste«, hat sie mir eingeschärft, »ist, dass die Existenz der Submarines weiterhin geheim bleibt. Stell dir vor, was los wäre, wenn bekannt würde, dass es eine zweite Menschenart gibt – eine künstliche noch dazu! –, die unter Wasser leben kann. Was da für eine Jagd losbrechen würde!«
»Und was kann ich da tun?«, habe ich gefragt.
»Nun, zunächst musst du unterwegs den Kontakt zu Schiffen und so weiter meiden. Und vielleicht bietet sich dir die Gelegenheit, den Submarines zu erklären, warum sie es lassen sollen, Pipelines zu beschädigen und Minenanlagen zu bestehlen. Warum das viel zu riskant ist. Wir können ihnen alles geben, was sie wollen! Wirklich. Geld spielt keine Rolle. Alles, was uns fehlt, ist ein Weg, wie sie uns mitteilen können, was sie brauchen und wie wir es ihnen zukommen lassen können.«
Ich habe versprochen, mein Möglichstes zu tun. Vermutlich wird das, was Schwimmt-schnell immer wieder sagt – dass ich die Mittlerin zwischen den Welten sei –, darauf hinauslaufen, dass ich eine Art Lieferdienst aufziehe.
Jedenfalls verstehe ich inzwischen gut, warum meine Mutter so ein Geheimnis um meine Herkunft gemacht hat. Zu ihrer Zeit gab es auch schon Genmanipulierte in den freien Zonen und dieselben heftigen Diskussionen darüber wie heute. Aber wenn jemand blaue Haut hat oder nachtleuchtende Haare, dann sind das nur winzige Veränderungen seines Gen-Codes. Mit dem, was Professor Yeong-mo Kim vor über hundert Jahren gemacht hat – eine ganz neue Spezies zu erschaffen, Chimären aus Mensch und Fisch –, ist das überhaupt nicht zu vergleichen.
Wobei meine Mutter über diese Hintergründe nichts gewusst hat. Sie wollte einfach nur, dass ich in Ruhe aufwachsen kann, und sie hat sich gedacht, dass das ohne Tarnung und Maskerade nicht gehen würde. Wenn sie nicht so früh gestorben wäre, hätte sie mir bestimmt irgendwann gesagt, dass mein Vater ein Submarine war. So war es ihre Schwester, meine Tante Mildred, die mich nach dem Tod meiner Mutter großgezogen und das Geheimnis bewahrt hat – fast zu lange!
Überhaupt, Tante Mildred. Wenn ich es mir genau überlege, ist sie die Schlüsselfigur des Ganzen. Wäre sie gesund auf die Welt gekommen, gäbe es mich gar nicht.
Aber Tante Mildred wurde ohne Gehör geboren. In den meisten Fällen kann man so einen Geburtsfehler operativ beheben, durch ein Implantat oder eine Nervenverpflanzung, aber in ihrem Fall war das nicht möglich. Sie war also … nun, obwohl ihr Zustand so selten ist, gibt es dafür interessanterweise eine Menge verschiedener Begriffe. In neotraditionalistischen Zonen sagt man taubstumm dazu, was die Sache meiner Ansicht nach gut trifft, denn dadurch, dass sie taub war, hat sie auch nicht sprechen gelernt; sie ist also stumm durch ihre Taubheit. In anderen Zonen ist der korrekte Begriff gehörlos, stumpy, ohrlos (völlig daneben), inkorrektabel (geht’s noch unklarer?), akustisch herausgefordert oder schlicht no-hear.
In der Konzernzone, in der Tante Mildred geboren ist, sprach man offiziell von einem sensorischen Geburtsfehler Nummer 201 und ließ ihr die altehrwürdige internationale Gebärdensprache beibringen. Und dem Rest der Familie auch.
Deshalb beherrschte meine Mutter die Gebärdensprache, als sie an der Küste einer der indonesischen Inseln einem Menschen begegnete, der unter Wasser zu Hause war. Er konnte nicht sprechen, aber er benutzte die Gebärden, und so konnten die beiden miteinander reden, sich ineinander verlieben und … Tja, und ich war das Ergebnis: ein Mischling, jemand, der sowohl Luft als auch Wasser atmen kann. Der erste bekannte Mensch, der das kann, behaupten jedenfalls die Leute von den Gipiui Chingu.
Da mich meine Tante großgezogen hat, beherrsche ich die Gebärdensprache natürlich auch. Sie ist für mich sogar fast eine zweite Muttersprache, denn Englisch habe ich in den letzten zehn Jahren nur noch gesprochen, wenn ich das Haus verlassen habe. Manchmal träume ich sogar in Gebärden!
Trotzdem habe ich oft das Gefühl, Schwimmt-schnell nicht wirklich zu verstehen.
Wie wird es mir bei seinem Schwarm ergehen? Die Submarines verstecken sich seit weit über hundert Jahren vor den Menschen und sie haben allen Grund dazu. Die Landbewohner laden nicht nur ihren Müll in den Ozeanen ab, legen Kabel und Pipelines hindurch und bauen Bodenschätze am Meeresgrund ab, ohne sonderlich viel Rücksicht zu nehmen – manche von ihnen machen auch Jagd auf die Submarines!
Und nun komme ich, eine halbe Submarine, eine, die bisher an Land gelebt hat. Wie werden sie mir begegnen? Mir wäre bedeutend wohler, wenn ich das wüsste.
Ich schwimme und schwimme, und etwas Geheimnisvolles passiert: Irgendwann vergesse ich, dass ich schwimme, ich gleite nur noch durch das Wasser, durch die blaue Tiefe, bewege mich vorwärts und denke nicht mehr darüber nach, wie ich das mache.
Es ist der Zauber der Unterwasserwelt, der mich wieder in seinen Bann schlägt. Fische, die wie Schwärme funkelnder Edelsteine dahinzischen, Algen, die unter mir über den sandigen Meeresboden wogen, ätherische Medusen, denen wir in weitem Bogen ausweichen – es ist eine völlig andere Welt als die, aus der ich komme, die ich gewöhnt bin. Es ist eine Welt, in die ich schon immer gehört habe, ohne es zu ahnen, und die ich nun, endlich, für mich entdecke.
Jetzt gerade denke ich, es ist auch die Welt, die mir von beiden besser gefällt.
Wir haben jenen Bereich, der sich anfühlte wie Niemandsland, durchquert und befinden uns wieder in der Nähe eines Korallenriffs, das vermutlich ein Teil des Great Barrier Reef ist. Aber dieser Name ist etwas, das auf Landkarten steht, nicht etwas, das hier unten, angesichts der wirklichen Korallen und ihrer überwältigenden Pracht aus Farben und Formen, irgendeine Bedeutung hat. Hier ist es einfach ein Lebensraum für Fische, Krabben und anderes Getier.
Und für uns. Für uns Submarines.
Schwimmt-schnell sieht sich nach mir um, macht ein Zeichen mit der Hand. Ich muss nachdenken, was er gemeint haben könnte, denn seine Gebärdensprache und jene, die ich gelernt habe, sind nicht völlig identisch. Wie sollte es auch anders sein? Immerhin ist es über hundert Jahre her, dass die ersten Submarines diese Sprache erlernt haben; es ist im Gegenteil eher erstaunlich, dass ich den Dialekt, der sich in dieser Zeit entwickelt hat, doch relativ gut verstehe.
Schließlich dämmert mir, was er meint: dass wir gleich da sind.
Mit einem Schlag ist die Anspannung zurück. Ich vergesse das Staunen und Freuen, vergesse, in welcher Welt der Wunder ich mich befinde. Jetzt gilt es. Gleich werde ich einem ganzen Schwarm von Submarines begegnen.
Ich habe Geschenke dabei, wie es sich gehört: etliche Messer, mitsamt haltbaren Scheiden aus Kunststoff, um sie am Gürtel zu tragen, sowie eine Menge bunter Glasperlen, von denen Submarine-Frauen angeblich nicht genug kriegen können. Jedenfalls sagen das die Leute von den Gipiui Chingu, und Schwimmt-schnell hat es mir, als ich ihn am Anfang unserer Reise gefragt habe, bestätigt.
Also sollte ich eigentlich beruhigt sein.
Ich bin es nur nicht.
Ich versuche, zu Schwimmt-schnell aufzuschließen, aber das ist nicht so einfach, denn jetzt, so dicht vor dem Ziel, schwimmt er doch wieder schneller, als ich ihm folgen kann. Sosehr ich auch strample, er zieht mir davon und verschwindet hinter einer schräg aufragenden Riffkante etwa fünfzig Meter voraus.
Er ist bestimmt ein guter Kundschafter, so pfeilschnell, wie er durchs Wasser schießt. Aber er ist und bleibt ein miserabler Reiseleiter.
Ich mache weit ausholende, rasche Schwimmzüge und wundere mich über mich selbst, dass ich dazu noch imstande bin. Dass ich so ausdauernd bin, habe ich nicht geahnt. Dumpfe Erinnerungen an den Sportunterricht in der Mittelstufe tauchen vor meinem inneren Auge auf. Ich habe es immer gehasst, über eine Meile zu laufen.
An Land war es schmerzhaft, außer Atem zu kommen. Hier, im Wasser, passiert mir das nicht. Auch wenn die Muskeln zittern vor Anstrengung, das Wasser strömt in mich hinein und durch meine sanft flatternden Kiemen wieder hinaus, und ich habe alles, was ich brauche.
Endlich bin ich auch an der Riffkante, umrunde sie mit einem kraftvollen Schwimmzug. Dann sehe ich Schwimmt-schnell dicht über dem Boden schweben und sich umsehen.
Aber nur ihn, sonst niemanden. Da ist kein Schwarm.
Und als Schwimmt-schnell den Kopf hebt und mich ansieht, weiß ich, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte.
2
Ich halte inne, lasse mich langsam tiefer sinken.
Was ist los?, frage ich mit ungeduldigen Händen.
Er winkt ab. Die Stelle, an der wir uns befinden, eine natürliche Senke, erinnert mich an Fotos altgriechischer Amphitheater aus meinem Geschichtsbuch. Schwimmt-schnell betastet Steine, schaut sich um, bewegt die Hände auf eine Weise, die mir nichts sagt. Ich habe keine Ahnung, was er macht und was das soll.
Ich dachte, dein Schwarm ist hier?, frage ich rasch, als er zu mir herschaut.
Das waren sie, gibt er zurück. Aber sie sind weg.
Weg? Was soll das heißen? Ich sinke tiefer, bleibe aber auf Abstand zu Schwimmt-schnell, der mir in diesem Augenblick fremder denn je erscheint.
»Hey!«, rufe ich.
Er sieht auf, fast erschrocken. Submarines stoßen Laute nur in Momenten der Gefahr aus, hat er mir erklärt. Gut, aber ich bin nur eine halbe Submarine; er wird sich an meine Eigenheiten gewöhnen müssen.
Was ist los?, frage ich noch einmal.
Das hier war unser Lager, erklärt er und breitet die Arme aus, in einer Geste, die die gesamte Kuhle umfasst.
Und jetzt? Ich bleibe weiterhin auf Abstand. Du hast gesagt, wir schwimmen zu deinem Schwarm.
Er nickt, sieht besorgt aus. Sie sind geflohen, erklärt er. Heute früh. Männer in Taucheranzügen sind gekommen. Da hatten sie Angst, entdeckt zu werden.
Woher weißt du das?, frage ich.
Es steht in den Steinen, erwidert er.
Ich betrachte den Boden. Jetzt erst fällt mir auf, dass die Steine, die hier überall liegen, so etwas wie ein Muster bilden. Ist das eine Art Schrift? Eine Zeichensprache, um Nachrichten zu hinterlassen? Offenbar.
Mit dieser Art Schrift kann ich allerdings überhaupt nichts anfangen. Das muss eine ureigene Erfindung der Submarines sein.
Und was heißt das?, will ich wissen. Wo sind sie jetzt?
Er macht ein paar Gebärden, die ich nicht verstehe, und fügt dann hinzu: Da kommen wir heute aber nicht mehr hin. Nicht, ehe es dunkel wird.
So, wie er mich dabei anschaut, habe ich das deutliche Gefühl, dass er dabei denkt: nicht mit einer, die so langsam schwimmt wie ich.
Ich hebe den Blick. Stimmt, es ist dunkler geworden. Ohne groß nachzudenken, habe ich es darauf geschoben, dass wir einfach tiefer gegangen sind, aber das sind wir gar nicht. Ich kann das silberne Schimmern der Meeresoberfläche sehen und die Reflexe, die das schräg einfallende Sonnenlicht auf den Boden zaubert. Wir sind nicht tiefer gegangen, wir sind sogar in relativ flachem Gewässer.
Es wird schlicht und einfach dunkel, weil gleich die Dämmerung anbricht und dann die Nacht.
Mir wird mulmig.
Wir verbringen die Nacht hier, erklärt Schwimmt-schnell mit Gesten, die keinen Zweifel daran lassen, dass er denkt, er hat das Kommando. Es ist ein guter Platz.
Tatsache ist, dass ich noch nie eine Nacht unter Wasser verbracht habe. Nicht dass ich nicht daran gedacht hätte, aber die Zeit, um mich auf diesen Trip hier vorzubereiten, war einfach zu kurz dafür.
Und irgendwo in mir nagt immer noch ein leiser Zweifel, ob ich auch dann noch unter Wasser atmen kann, wenn ich schlafe.
Wie schläft man überhaupt unter Wasser? Ohne sich zuzudecken? Wie verhindert man, dass man einfach davontreibt, womöglich mitten hinein ins Maul eines vorbeikommenden Hais?
Und als wären das alles noch nicht genug Sorgen, soll ich nun meine erste Nacht unter Wasser auch noch allein mit einem nahezu fremden Mann verbringen!
Das Dumme ist: Ich habe keine Wahl. Ich schaffe es unmöglich heute noch zurück. Ich bin mehr als eine halbe Tagesreise von Seahaven entfernt und die Nacht bricht an.
Mein Kopf blubbert auf einmal vor panischen Gedanken.
Man kann nachts reisen, wenn der Mond hell genug scheint, erklärt mir Schwimmt-schnell, während er unbekümmert seinen Speer in den sandigen Boden bohrt und den Gürtel ablegt, aber es ist besser, man tut es nicht. Es ist anstrengender und es gibt viele Gefahren, die einem tagsüber nicht drohen.
Ich schwebe immer noch in einiger Entfernung von ihm, etwa einen Meter über dem Boden, und habe das Gefühl, mich nie wieder bewegen zu können. Was wissen Menschen, die ihr ganzes Leben unter Wasser verbringen, über den Mond, frage ich mich, weil es guttut, mich mit einer Frage zu beschäftigen, die nichts mit meinen Ängsten zu tun hat. Dummerweise ist die Antwort leicht: Man hat es ihnen beigebracht. Ihr Schöpfer hat die Submarines nicht nur großgezogen, er hat sie auch ausgebildet und Sonne, Mond und Sterne standen offenbar auf dem Lehrplan.
Schwimmt-schnell öffnet einen seiner Beutel, holt etwas heraus und winkt mir herzukommen. Ich zögere, dann ergebe ich mich meinem Schicksal und gleite mit einem kurzen Schwimmstoß zu ihm hinüber.
Er reicht mir, was er in der Hand hat. Es ist ein länglicher, flacher Streifen aus einem fast schwarzen Material, das sich anfühlt wie weicher Gummi. Schwimmt-schnell nimmt selber auch ein Stück, steckt es sich demonstrativ in den Mund und bedeutet mir, während er heftig kaut, es ihm gleichzutun.
Ich nehme es zögernd. Davon abbeißen klappt nicht, dazu ist es zu zäh, also folge ich seinem Beispiel und schiebe mir den Streifen in den Mund.
Was ist das?, frage ich, während ich kaue. Das Ding schmeckt zäh und salzig; es ist, als kaute ich ein Stück Gummischlauch aus einem untergegangenen Schiff.
Schwimmt-schnell macht eine Gebärde, die ich wieder mal nicht identifizieren kann. Er bemerkt, dass ich ihn nicht verstehe, und wiederholt sie langsamer, und diesmal erkenne ich, dass sie aus den Zeichen für reisen und essen zusammengesetzt ist. Reiseproviant, übersetze ich für mich.
Man macht das aus Algen, erklärt er.
Klar. Woraus auch sonst.
Es hält lange, fährt er fort. Und es gibt Kraft!
Davon bin ich noch nicht wirklich überzeugt, aber auf der anderen Seite ist der Knoten, den ich in meinem Bauch spüre, so dick und groß, dass ich nicht mal sagen kann, ob ich eigentlich Hunger habe oder nicht. Ich sage mir, ich müsste hungrig sein, nachdem ich mehr oder weniger den ganzen Nachmittag über geschwommen bin, mehr als in meinem ganzen bisherigen Leben zusammengenommen. Aber ich kann es nicht spüren, so stark ist die Angst, die mich befallen hat.
Wieso mache ich das alles hier eigentlich?
Um meinen Vater zu finden.
Ich hoffe bloß, er ist all die Mühe auch wert!
Wir vertilgen jeder drei von diesen Dingern. Nach einer Weile habe ich mich an den Geschmack gewöhnt und zu meiner Überraschung machen sie tatsächlich satt.
Während wir gegessen haben, ist es rasch dunkler geworden. Es ist kein Blau mehr, das uns umgibt, sondern ein fahles Schwarz, in dem ich nur noch Umrisse wahrnehme, und auch das nur, weil der Mond scheint.
Mir wird immer unheimlicher zumute, je dichter sich das Dunkel um uns schließt. Schwimmt-schnell und ich können uns kaum noch unterhalten, weil ich seine Gesten nicht mehr erkenne.
Ich zucke zusammen, als er mich plötzlich am Oberarm packt und mit sich zieht.
Er leitet mich hinab zur tiefsten Stelle der Kuhle, bis an einen Platz dicht neben einem steil aufragenden Felsbrocken. Dort lässt er mich los, klopft mit der Hand auf den sandigen Boden und erklärt mit einer ausholenden, langsamen Gebärde: Schlafen.
Dann schlägt er sich mit der Hand vor die Brust, zeigt auf einen Platz etwa einen Schritt weiter draußen und wiederholt: Schlafen. Er legt seinen Speer so ab, dass er ihn jederzeit greifen kann, anschließend legt er sich daneben, mit dem Rücken zu mir.
Ach so. Ich soll geschützt von dem Felsen hinter mir schlafen, und er bewacht mich von vorne. Sieht so aus, als wäre ich ganz umsonst in Panik geraten.
Ich lege mich ebenfalls hin, suche nach einer bequemen Lage. Es fühlt sich ungewohnt an, sich zum Schlafen nicht zuzudecken, aber erstaunlicherweise ist mir nicht kalt, jedenfalls nicht besonders. Und habe ich mir vorhin Sorgen gemacht, man könnte im Schlaf davontreiben? Jetzt merke ich, dass das Unsinn ist: Ich brauche nur alle Luft aus meiner Lunge entweichen zu lassen, schon bin ich schwer wie ein Stein.
Aber natürlich kann ich nicht einfach einschlafen, obwohl ich furchtbar müde bin. Mir geht schrecklich viel im Kopf herum und das unheimliche Dunkel um mich herum beruhigt auch nicht gerade. Immer wenn ich am Eindämmern bin, spüre ich auf einmal etwas, von dem ich sicher bin, dass es ein Krabbeltier sein muss, das über mich herfallen will … Um dann jedes Mal festzustellen, dass es einfach nur meine Kiemen sind und das Wasser, das ihnen entströmt und den Sand ein wenig aufwirbelt.
Ein weiches Kissen wäre hilfreich. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Kopf. Da ist ein flacher Stein, der die richtige Höhe hätte, aber er ist mir auf die Dauer zu hart. Ich häufe stattdessen etwas Sand auf, doch der fühlt sich nach einer Weile genauso hart an, nur nicht so sauber: Dauernd geraten mir Sandkörner in die Nase. Schließlich beginne ich, mit allerlei Stellungen zu experimentieren, bei denen ich den Kopf auf einem Arm ablegen kann. Was garantiert dazu führen wird, dass mir der Arm einschläft.
Schwimmt-schnell hat diese Probleme offenbar alle nicht. Es dauert keine fünf Minuten, bis er tief und fest schläft. Schöner Wächter! Er liegt da wie ein Sandsack, den Kopf auf dem angewinkelten Arm, und gibt nach einer Weile leise, seltsam summende Geräusche von sich: Hört es sich so an, wenn jemand unter Wasser schnarcht?
Wieder einer dieser Momente, in denen sich mir die Frage stellt, welcher Affe mich gebissen hat, mich auf dieses Abenteuer einzulassen. Hier liege ich nun, in zehn oder zwanzig Metern Tiefe auf dem Meeresgrund, und fühle mich wie der einsamste Mensch auf Erden. Es kommt mir einmal mehr völlig unglaublich vor, dass ich die Welt, die ich bisher gekannt habe – Seahaven, Tante Mildred, meinen besten Freund Pigrit, die Schule und so weiter –, erst heute Vormittag verlassen habe.
Na gut, versuche ich mich zu beruhigen, ein Abenteuer, bei dem es einem dauernd nur gut geht, ist keins. Und die Momente, in denen etwas schiefgeht, man verzweifelt oder panisch oder sonst irgendwie am Ende ist, sind genau die Erlebnisse, die sich später am besten erzählen lassen.
Falls man das Ganze überlebt.
Schwimmt-schnell verändert ab und zu im Schlaf seine Lage und ich zucke jedes Mal zusammen, wenn er das tut.
Ich werde kein Auge zutun, das weiß ich genau. Wie denn?
Und was, frage ich mich, während ich da im Sand liege und in die unheimliche dunkle Meeresnacht blicke, wenn ein hungriger Hai hier vorbeikommt? Haie schlafen nie, haben wir in der Schule gelernt. Sie müssen immer in Bewegung sein, sonst ersticken sie, und jemand, der immer in Bewegung ist, muss doch auch immer Hunger haben …
Dann fällt mir wieder ein, was Schwimmt-schnell aus den Steinen herausgelesen hat: dass Taucher hier gewesen sind, Männer in Taucheranzügen, vor denen Schwimmt-schnells Schwarm geflohen ist! Was ist denn mit denen? Was, wenn die wiederkommen und uns entdecken?
Ich überlege, Schwimmt-schnell wachzurütteln, um ihn danach zu fragen, aber ehe ich mich dazu durchringen kann, schlafe ich ein.
3
Als ich aufwache, ist es hell und ein neugieriger Fisch mit gelben und blauen Streifen schaut mir genau in die Augen. Ich fahre erschrocken hoch, was ihn verscheucht, und alles fällt mir wieder ein: Ich bin unter Wasser! Ich habe am Grund des Pazifischen Ozeans geschlafen!
Unfassbar. Und zugleich Furcht einflößend. Aber ehe ich mich entscheiden kann, wie ich das finde, registriere ich, dass etwas anderes ganz und gar nicht stimmt.
Ich bin nämlich allein. Schwimmt-schnell ist verschwunden.
Was hat das jetzt zu bedeuten? Ich strecke die Hand aus, taste über die Stelle im Sand, wo er gelegen hat. Man sieht nichts mehr, keinen Abdruck, keine sonstigen Spuren.
Ich atme tief ein, weite die Brust, lasse Luft in mir entstehen, die mir Auftrieb verleiht, steige höher und schaue mich um. Aber ich sehe ihn nirgends. Ich stoße einen Schrei aus, der aber auch nichts auslöst.
Was jetzt? Ist ein Unglück geschehen, ohne dass ich es mitbekommen habe? Oder hat er mich vergessen und ist ohne mich weiter? Und was soll ich nun tun? Werde ich den Weg zurück überhaupt alleine finden?
Da entdecke ich eine Bewegung in der Ferne: Schwimmt-schnell, der in aller Ruhe näher kommt.
Guten Morgen, signalisiert er schon von Weitem.
Ich bin erleichtert, aber immer noch leicht panisch. Wo warst du?, frage ich mit Gesten, die heftiger ausfallen, als es sein müsste.
Ich hab Frühstück besorgt, erwidert er und hebt etwas hoch, das er in einem Beutel an der Seite trägt: Ein riesiger Fisch ist darin, der silbern schimmert.
Du hättest mir was sagen sollen, beschwere ich mich, obwohl mein Magen bei dem Anblick voller Vorfreude knurrt.
Du hast so gut geschlafen und ich wollte den Fisch nicht entkommen lassen, gibt Schwimmt-schnell ungerührt zurück.
Wir suchen uns einen gemütlichen Platz auf dem Meeresgrund, dann holt Schwimmt-schnell sein neues Messer hervor und beginnt, den Fisch zu zerlegen. Man merkt, wie stolz er auf dieses Messer ist und wie glücklich es ihn macht, es zu besitzen. Er hantiert äußerst geschickt damit, zieht dem Fisch die Schuppenhaut ab, teilt das Muskelfleisch in appetitliche Stücke und bedeutet mir zuzugreifen. Also nehme ich eines, schiebe es in den Mund und …
Oh. Himmlisch! Vielleicht ist es einfach der Hunger, aber das glaube ich nicht. Es ist der Geschmack, so intensiv, so voll von all dem, was das Meer ausmacht, dass es mich überwältigt. Ich habe schon immer Sushi geliebt, das im Wesentlichen auch aus rohem Fisch besteht, aber gegen das hier kommt kein Sushi der Welt an!
Gut?, fragt Schwimmt-schnell mit der freien Hand.
Großartig!, versichere ich ihm und greife nach dem nächsten Stück.
Es gefällt ihm, dass es mir so schmeckt. Tatsächlich versöhnt mich das auch wieder mit allem. Nach dem zweiten Bissen kommt mir die lichtblaue Unendlichkeit um uns herum nicht mehr bedrohlich vor, sondern voller aufregender Möglichkeiten.
Wir lassen uns Zeit. Das beim Zerteilen des Fisches ausgetretene Blut lockt andere Fische an, die sich aber leicht vertreiben lassen. Wir müssten uns nicht beeilen, erklärt mir Schwimmt-schnell, der Schwarm sei nicht mehr so weit entfernt, wir würden ihn heute sicher erreichen.
Das hört sich gut an. Ich bin nämlich einigermaßen zerschlagen von der langen Schwimmerei gestern.
Ich hoffe, es wird dir bei uns gefallen, meint er.
Bestimmt, versichere ich ihm und in diesem Augenblick bin ich davon auch fest überzeugt.
Ich werde froh sein, wenn ich zurück bin und …, fügt Schwimmt-schnell hinzu, aber dann halten seine Hände plötzlich an.
Was ist?, frage ich.
Er mustert mich. Interessiert dich das überhaupt?
Ja, natürlich, gebe ich zurück. Wieso nicht?
Du bist die prophezeite Mittlerin, erklärt er und sieht zu Boden. Was sollten dich da die Sorgen eines einfachen Kundschafters interessieren?
Ich verdrehe die Augen. Obwohl ich ihm, seit wir uns kennen, bestimmt schon ein dutzend Mal erklärt habe, was ich von diesem »Du bist die prophezeite Mittlerin«-Ding halte (nämlich nichts), fängt er immer wieder davon an.
Erzähl einfach, sage ich. Ich beschwer mich schon, wenn mir was nicht passt.
Er muss grinsen. Stimmt, meint er. Das tust du. Und er stößt einen Laut aus, der ein bisschen klingt wie mein »Hey!«-Ruf.
Genau, bestätige ich.
Jetzt zappelt er herum, was mich zusammenzucken lässt, denn immerhin hat er eine rasiermesserscharfe Klinge aus bestem meerwassertauglichen Stahl in der Hand. Ich kann es kaum erwarten, dass du Lacht-immer kennenlernst, erklärt er voller Begeisterung. Ich hoffe bloß, es geht ihr gut. Ich mache mir nämlich Sorgen, weißt du?
Wer ist Lacht-immer?, frage ich.
Meine Frau, erwidert er. Sie ist schwanger. Unser erstes Kind. Weißes-Auge sagt, es wird nicht mehr lange dauern. Ich hoffe bloß, es wird den Atem haben …
Das ist wieder einer von den Momenten, in denen ich das Gefühl habe, dass sich die Gebärdensprache der Submarines von der, die ich gelernt habe, so weit weg entwickelt hat, dass ich mir nur einbilde, zu verstehen, was er sagt. Was zum Beispiel kann er meinen mit den Atem haben …?
Ich blinzle. Wer ist Weißes-Auge?
Unsere Älteste. Der Schwarm hört auf sie. Und sie hat sieben Kinder gehabt, sie kennt sich aus.
Also so etwas wie die Anführerin. Vielleicht verstehe ich ihn doch, ein bisschen zumindest. Es muss schlimm für Lacht-immer gewesen sein, als du gefangen warst, mutmaße ich und merke, wie gespannt ich auf die Frau bin, die zu diesem Mann gehört. Auf mich hat Schwimmt-schnell bis jetzt eher wie einer jener Männer gewirkt, die den Rest der Frauenwelt nicht vernachlässigen, nur weil sie mit einer fest zusammen sind.
Oh ja, versichert er und macht große Augen. Sie war sehr froh, als ich wieder aufgetaucht bin. Sie hat gesagt, am liebsten wäre sie selbst an Land gegangen, um nach mir zu suchen! Er lacht. Das wäre was gewesen, mit ihrem dicken Bauch …
Kann sie denn an Land gehen?, will ich wissen. Die Fähigkeit der Submarines, Luft statt Wasser zu atmen, ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Mein Vater konnte bis zu anderthalb Stunden an der Luft bleiben, hat meine Mutter in ihrem Tagebuch notiert. Schwimmt-schnell dagegen ist schon blau angelaufen, als wir ihn den kurzen Weg aus dem Becken, in dem James Thawte ihn gefangen gehalten hatte, bis zum Meer begleitet haben, und das waren alles in allem vielleicht fünf Minuten.
Er wiegt den Schädel hin und her. So wie ich ungefähr, meint er. Sie ist einmal an Land gegangen und hat eine Frucht gepflückt, von einem Baum … Er versucht, diese Frucht zu beschreiben, und ich schätze, er meint einen Apfel. Das ist aber schon lange her. Und die Frucht hat seltsam geschmeckt, viel zu süß!
Das muss nichts heißen. Die Submarines leben in Salzwasser, mit Süßem haben sie es wohl nicht so.
Wir haben den Fisch größtenteils vertilgt. Schwimmt-schnell hält mir den Kopf hin und fragt: Willst du die Augen?
Ich schüttle mich, lehne ab.
Während ich ihm zuschaue, wie er mit sichtlichem Genuss die Augen aus dem Fischkopf saugt, fällt mir etwas anderes ein. Diese Taucher, vor denen dein Schwarm geflohen ist – was ist mit denen? Meinst du nicht, die können sie verfolgt haben? Oder dass sie hierher zurückkommen?
Schwimmt-schnell sieht mich an, als müsse er erst nachdenken, wovon ich eigentlich rede. Dann schüttelt er den Kopf, amüsiert, wie es mir vorkommt. Die waren nicht gefährlich, erklärt er mit unbekümmerten Bewegungen.
Und wieso ist dein Schwarm dann geflohen?
Er hebt die Schultern, wirft die Überreste des Fischs fort. Die alte Lehre, meint er. Die Großen Eltern haben uns beigebracht, dass wir uns vor den Luftmenschen verbergen sollen. Also verbergen wir uns.
Die Großen Eltern? Ich schaue ihn verdutzt an. Die Submarines haben offenbar ihre eigene Mythologie, mit der sie sich ihren Ursprung erklären. Die Großen Eltern, damit können nur Professor Yeong-mo Kim gemeint sein und die Frauen, die bei seinen gentechnischen Experimenten mitgemacht haben.
Wir brechen auf und ich habe viel nachzudenken, während ich Schwimmt-schnell folge. Und ab und zu muss ich ihn, wenn er mir davonzieht, mit einem Schrei an meine Existenz erinnern …
Irgendwann am Nachmittag erreichen wir den Schwarm.
Schwimmt-schnell hört es vor mir – kein Wunder, er ist ja auch vorgewarnt, weil er weiß, wohin sie sich geflüchtet haben. Er dreht sich kurz zu mir um und macht ein rasches Zeichen, das ich nicht verstehe, aber ich merke auf und höre es plötzlich: helle, spitze Schreie. Ich sehe noch nichts, aber wie gesagt, Wasser trägt Schall sehr weit.
Das, was ich höre, klingt beunruhigend, nach Tumult und Aufruhr, aber Schwimmt-schnell hält unbekümmert darauf zu, also folge ich ihm. Was bleibt mir schon anderes übrig?
Und endlich sehe ich sie: viele Submarines, zwei, drei Dutzend und mehr, die im Schutz eines Felsens, der über ihnen aufragt, am lichtdurchfluteten Meeresgrund lagern. Die Hälfte davon sind kleine Kinder, und die sind es, die diesen Krach machen. Sie wirbeln umeinander herum wie blasse, wurmartige Fische, haschen einander und kreischen dabei.
Ist das nicht gefährlich? Machen sie damit nicht gefährliche Tiere auf sich aufmerksam, Haie zum Beispiel?
Offenbar nicht, denn niemand hindert sie daran. Vielleicht wirkt das Geschrei ja auch eher abschreckend.
Es gibt so viele Dinge über das Leben unter Wasser, die ich erst noch lernen muss.
Nun ist es an Schwimmt-schnell, einen Schrei auszustoßen. Es wird ein tiefer, lang gezogener Laut, der klingt wie »Hauuuwah!«
Sein Schrei wirkt wie ein Zauberspruch. Alle Gesichter drehen sich uns zu und im nächsten Moment kommen sie alle, der ganze Schwarm, wirbelnd, jubelnd und mit wedelnden Händen, zu viele, als dass ich etwas lesen könnte. Sie erreichen uns, umarmen Schwimmt-schnell. Mich dagegen umkreisen sie, mustern mich neugierig.
Das ist die Mittlerin, die uns prophezeit wurde, stellt mich Schwimmt-schnell vor. Schon wieder! Aber irgendwas muss er schließlich sagen. Und es löst zum Glück auch keine übertriebene Ehrfurcht aus; die anderen mustern mich nur ein weiteres Mal, noch etwas neugieriger und, so kommt es mir vor, freundlich.
Ich scheine willkommen zu sein.
Und das, fährt Schwimmt-schnell an mich gerichtet fort, ist Lacht-immer.
Ehe ich sehe, wen er meint, fällt mir eine Frau um den Hals, von der ich nur Arme spüre, die mich drücken, und einen ganzen Wald von Haaren, die sich über mein Gesicht verteilen. Sie schwenkt mich so wild hin und her, dass wir uns überschlagen, gibt dabei Laute von sich, die wie Weinen und Lachen gleichzeitig klingen, und scheint mich nicht mehr loslassen zu wollen.
Als sie es dann doch tut, sehe ich eine kugelförmige Submarine vor mir, mit einem fröhlichen Vollmondgesicht, mächtigen Brüsten, einem noch mächtigeren Bauch und langen, lockigen Haaren. Danke, sagt sie noch einmal, diesmal mit den Händen. Danke, dass du ihn gerettet hast.
Ich hebe verlegen die Schultern und antworte: Es war ein glücklicher Zufall.
Es sieht nicht so aus, als verstehe sie, was ich damit meine. Vielleicht wieder so ein Fall, wo die Gebärden, die ich kenne, nicht mehr mit denen übereinstimmen, die die Submarines verwenden. Aber es scheint ihr auch egal zu sein, denn sie erklärt kategorisch: Wir sind von nun an Freundinnen.
Ich muss lachen. Schön.
Ich bin Lacht-immer, fährt sie fort. Und du?
Ich habe auch einen Namen, erwiderte ich, aber ich weiß nicht, wie ich ihn euch sagen kann. Es ist ein Name aus Lauten, versuche ich zu erklären, aber das lässt sie auch nur stutzen.
Wir werden einen Namen für dich finden, meint sie.
Während dieser Unterhaltung treiben wir auf den Lagerplatz zu, den der Schwarm gewählt hat. Er ähnelt dem, an dem wir am Tag zuvor waren, nur liegen hier überall kleine Bündel und Beutel herum: die Besitztümer, die die Submarines bei sich tragen. Die Kinder paddeln aufgeregt um mich herum, grinsen sich an, wenn eines von ihnen die Hand ausstreckt, um mich zu berühren – ganz geheuer bin ich ihnen offenbar noch nicht. Die Älteren diskutieren heftig miteinander, geben dabei glucksende und quietschende Laute von sich, die sie fast wie Delfine klingen lassen. Immer wieder greift jemand nach meinen Händen, wie um sie mir zu schütteln, doch was tatsächlich vor sich geht, begreife ich erst, als Lacht-immer mir sagt: Ich glaube, sie einigen sich auf den Namen Ohne-Häute für dich.
Ich fahre entsetzt auf, so plötzlich, dass die Kinder erschrocken davonspritzen. Ohne-Häute? Ganz bestimmt will ich so nicht heißen!
Mir kommt eine Idee. Von-oben!, erkläre ich mit unübersehbaren Gesten und drehe mich dabei langsam um mich selbst. Nennt mich Von-oben! Und ich füge hinzu: Mein Vater heißt Geht-hinauf. Kennt ihr ihn?
Sie wechseln ratlose Blicke, schütteln die Köpfe. Diese Geste immerhin haben sie mit den Menschen an Land gemeinsam.
Nun, auf jeden Fall scheint die Anspielung auf meine fehlenden Schwimmhäute kein Thema mehr zu sein.
Übrigens auch die Taucher nicht, vor denen sie doch geflohen sind. Weder fragt Schwimmt-schnell danach, noch erwähnen sie sie von sich aus. Es scheint also tatsächlich keine dramatische Begegnung gewesen zu sein. Vielleicht waren es Sporttaucher oder Touristen, die Fotos von den Korallen machen wollten.
Sie entlassen mich nicht mehr aus ihrer Mitte, ziehen mich mit sich, umringen mich, als wir in der Mitte ihres Lagers ankommen und uns setzen.
Zeit, die Geschenke zu verteilen, die ich mitgebracht habe. Ich löse die Riemen meines Rucksacks, eine etwas umständliche Prozedur, der sie sichtlich fasziniert folgen. Er mag so gut anliegen, dass ich ihn beim Schwimmen völlig vergesse – aber es braucht regelrechte Akrobatik, ihn auszuziehen.
Endlich habe ich ihn im Schoß. Ich hole das Bündel mit den Messern aus dem vorderen Fach und reiche es Schwimmt-schnell. Verteil du sie, bitte ich ihn.
Er nickt freudig, hebt das Bündel empor und wackelt begeistert damit.
Nachdem Schwimmt-schnell die Verpackung geöffnet hat, eine stabile Plastiktüte, zählt er die Messer durch. Es scheint ihm nicht die geringste Mühe zu machen, bemerke ich. Mit anderen Worten, die Submarines können mit Zahlen umgehen. Das wird an Land einige Leute interessieren.
Es sind zehn Stück, die besten Unterseemesser, die man für Geld kaufen kann. Ich hätte mir nicht einmal eines davon leisten können, aber es war Frau Brenshaw, die sie gekauft und mir mitgegeben hat, im Namen der Freunde der Tiefe, und für sie spielt Geld keine Rolle. Schwimmt-schnell sieht sich um, verteilt die Messer mit sicherer Hand. Seine Entscheidungen werden nicht infrage gestellt – erst als er das letzte Messer einem drahtigen Mädchen geben will. Da hebt eine betagte Frau die Hand, eine Greisin mit flusigen weißen Haaren und einem linken Auge, das silbern schimmert. Sie macht ein paar rasche Gebärden, worauf das Messer an jemand anderen geht, einen schmächtigen Mann, der sich scheu im Hintergrund gehalten hat. Er ist merklich beeindruckt von seinem neuen Besitz, nickt mir schüchtern zu.
Ich stoße Lacht-immer an, meine neue Freundin, deute auf die alte Frau und frage mit kleinen Bewegungen: Wer ist das?
Weißes-Auge, antwortet sie mir ebenso verstohlen. Wir hören auf sie.
Mit anderen Worten, das ist tatsächlich die Anführerin des Schwarms. Gut zu wissen.
Der Plastikbeutel findet zu meiner Überraschung ebenfalls einen neuen Besitzer, einen Mann mit Glatze. Ich sehe, wie er ihn mehrfach hin und her wendet und das glatte Material prüfend zwischen die Finger nimmt. Er scheint überaus angetan zu sein.
Danach kommen die bunten Perlen an die Reihe. Als ich den Beutel herausziehe, schlägt die Begeisterung spürbare Wellen. Ich will Lacht-immer beauftragen, die Dinger gerecht zu verteilen, aber sie lehnt lachend ab: Es seien ja schließlich meine Perlen!
Und jetzt? Es kommt mir albern vor, Glasperlen zu verteilen, also halte ich den gierig blickenden Mädchen und Frauen einfach die ganze Packung hin, damit sie sich nehmen können, was sie wollen. Aber sie begreifen gar nicht, was ich will, sondern gestikulieren nur: Verteilen! Verteilen!
Ein paar Tage später werde ich kapieren, wie das bei den Submarines läuft: Wenn jemand zum Beispiel einen Fisch erlegt, teilt er ihn zwar immer mit allen anderen, aber es ist trotzdem sein Fisch, sein Besitz also, über den allein er zu bestimmen hat. Nur bei Dingen aus Metall – Dingen aus der Welt über dem Wasser, die für das Überleben des Schwarms wichtig sind – gelten andere Regeln.
Also gut. Ich nehme die erste Schmuckperle heraus, ein grünes Stück Glas mit einer dicken Öse und einem Dutzend Facetten, und drücke es in die nächstbeste Hand, die sich mir entgegenstreckt. Die nächste ist rot und kommt in eine andere Hand und so weiter. Immerhin sagt Lacht-immer nicht Nein, als ich ihr ebenfalls eine Perle anbiete. Die blauen und violetten, merke ich, sind am begehrtesten, die roten werden eher als Trostpreise verstanden.
Aber es bleiben keine übrig, und auch dieser leere Beutel findet wieder einen enthusiastischen Abnehmer. Die Mädchen fangen sofort an, sich die Perlen in die Haare zu knüpfen, zu all dem anderen Schmuck dazu, den sie schon darin tragen: diverse Muscheln, andere Glasperlen und, hier und da, Dosenverschlüsse aus Aluminium.
Anschließend bringen sie mir etwas zu essen, ihrem seltsamen Gast aus Gefilden, die sie sich nicht wirklich vorstellen können. Von überallher tauchen Algenstücke, Fischhäppchen, Austern und andere Leckerbissen auf; von manchen Sachen weiß ich gar nicht, worum es sich handelt. Aber es schmeckt alles gut – na ja, fast alles: Der Inhalt einer kegelförmigen kleinen Muschel, den man mir zum Schluss aufdrängt, als ich mehrfach erklärt habe, genug zu haben, kaut sich nur schwer. Doch so scheint das auch gedacht zu sein: eine Art Kaugummi, der zugleich der Zahnpflege dient.
Während alles um mich herum kaut, muss ich Fragen beantworten. Sie sind unglaublich neugierig, fragen mich die sonderbarsten Dinge. Ob es stimme, dass man in Luft nicht schwimmen könne, will ein Mädchen wissen. Ja, sage ich, worauf sie sich wundert: Und wie bewegen sich die Luftmenschen dann fort?
Sie gehen, erkläre ich und zeige es, indem ich die Finger meiner rechten Hand über den Rücken der anderen Hand marschieren lasse: Das finden die Submarines zum Schießen komisch. Die Kinder fangen an, auf dem Meeresboden umherzulaufen, was natürlich viel alberner aussieht, als wenn sie es an Land täten, und kriegen sich kaum ein vor Lachen.
Einige der Erwachsenen lachen nicht. Schwimmt-schnell zum Beispiel.
Dann muss ich erklären, wie Luftmenschen wohnen (in Höhlen, die sie selbst bauen), was sie essen (schwierig, die Gebärden für Obst und Gemüse sagen den meisten nichts) und was das für Dinge sind, die immer wieder dunkel und laut über den Himmel fahren: den Himmel? Ich brauche eine Weile, bis ich begreife, dass sie damit die Wasseroberfläche meinen, und bemühe mich dann, zu erklären, was Schiffe sind.
Verrückt, denke ich zwischendurch, da habe ich Schulferien, und was mache ich? Ich spiele Lehrerin!
Aber ich stehe Rede und Antwort; es macht Spaß, wie neugierig sie mich anschauen und wie begeistert sie auf alles reagieren, was ich erkläre. Noch nie im Leben habe ich so lange mit den Händen geredet.
Ich rede noch, als die Nacht hereinbricht und die Dunkelheit meine Gebärden verschluckt. Zeit, schlafen zu gehen. Lacht-immer nimmt mich am Arm, zieht mich mit sich, und das ist ganz gut so, denn mich erwartet die nächste Überraschung: Alle Frauen und Kinder kuscheln sich nämlich zum Schlafen an der tiefsten Stelle des Lagers zusammen, von der einen Seite geschützt durch den großen Felsen, auf der anderen durch die Männer, die sich entlang eines Halbkreises um uns herum legen, mit dem Rücken zu uns, die Speere und Messer griffbereit.
So liege ich, ehe ich recht begriffen habe, was vor sich geht, inmitten einer Traube von Submarines, mein Kopf auf den Schenkeln eines Mädchens, das nicht viel älter sein kann als ich, Lacht-immers dicken Bauch im Rücken, und zwei Kindern, die sich ihrerseits an meine Hüfte schmiegen. Ich spüre so etwas wie Panik in mir aufsteigen. Ich bin das nicht gewöhnt! Zu Hause habe ich ein Bett für mich alleine und eine warme Decke; ich habe, seit ich ein Baby war, nie anders geschlafen als alleine!
Aber ich widerstehe dem Impuls, mich ins Freie zu kämpfen. Irgendwie hat es auch etwas, hier mit all diesen freundlichen, fröhlichen Frauen und Mädchen zu liegen, die noch immer hin und her ruckeln auf der Suche nach der richtigen Schlafposition und dabei leise, glucksende Laute von sich geben. Ich werde natürlich kein Auge zutun, aber es fühlt sich trotzdem nett an. Tatsächlich könnte ich mir keine bessere Weise vorstellen, jemandem das Gefühl zu geben, willkommen zu sein.
Es wird immer dunkler und das Gewimmel, in dem ich liege, immer ruhiger. Ich lausche dem Pulsschlag des Mädchens, auf dessen Bein mein Kopf liegt, schaue in die allumfassende Schwärze und erwarte die lange Nacht.
4
Das Nächste, was ich wahrnehme, sind viele nackte Körper, die um mich herumwimmeln. Es ist taghell und einen Moment lang weiß ich nicht, wo ich bin und was vor sich geht. Dann fällt mir alles wieder ein und ich begreife, dass ich doch geschlafen haben muss.
Ein rundes, fröhliches Gesicht taucht vor mir auf. Lacht-immer, die beschlossen hat, meine neue beste Freundin zu sein. Guten Morgen, sagen ihre Hände. Gut geschlafen?
Ich nicke. Ja, gebe ich zu. Nicht nur das, ich habe sogar so gut geschlafen wie schon lange nicht mehr!
Aber ich muss dringend pinkeln.
Das kommt mir gerade vor wie ein Problem, bei so vielen Leuten um mich herum. In der Welt über dem Wasser, in der ich sechzehn Jahre meines Lebens zugebracht habe, würde ich jetzt jedenfalls nach dem Weg zur Toilette fragen.
Als ich mich damit meiner neuen besten Freundin anvertraue, merke ich, dass sie nicht mal erkennt, was das Problem daran ist, denn sie sagt nur: Ich auch. Gehen wir zusammen!
Witzig, dass die Mädchen unter Wasser das auch so machen, denke ich und schließe mich Lacht-immer an.
Sagen wir so: Man muss einfach auf die Strömung achten. Das, was man von sich gibt, soll ja nicht ins Lager getrieben werden.
Während wir zurückschwimmen, meint sie: Schwimmt-schnell sagt, dass du die Mittlerin bist, die uns prophezeit wurde. Stimmt das?
Immer wieder dieses Thema! Ich weiß es nicht, erwidere ich. Wer hat das überhaupt prophezeit?
Eine weise alte Frau, vor langer Zeit, erklärt Lacht-immer. Sie hieß Weiß-alles.
Ich muss unwillkürlich lachen, weil ich das so abstrus finde. Na, dann muss es ja wohl stimmen!
Lacht-immer zuckt mit den Schultern, eine Geste, die Wasser- und Luftmenschen gemeinsam haben. Ist eigentlich egal. Mir ist viel wichtiger, dass du meinen Mann gerettet hast. Er hat uns alles erzählt. Du hast den bösen Luftmenschen besiegt, der Schwimmt-schnell töten wollte.
Ich nicke unbehaglich. Das fasst es gut zusammen. Tatsächlich war Schwimmt-schnell nicht der Einzige, den der „böse Luftmensch“ töten wollte, und das hat mir seither einige Albträume beschert. Aber damit werde ich keine schwangere Frau belasten, die sich einfach nur auf ihr Baby freut.
Der Schwarm versammelt sich wieder in der Mitte des Lagers. Geflochtene Netze mit gesammelten Algen gehen herum, jeder nimmt sich, so viel er essen mag, und während die ganze Runde kaut, wird besprochen, wie man den Tag gestalten will.
Wobei – es kauen nicht alle. Die kleineren Kinder liegen an den Brüsten ihrer Mütter und saugen in aller Ruhe, ein Anblick, der mich einen Moment lang durcheinanderbringt: Zwar kriegt man natürlich auch in Seahaven stillende Mütter zu sehen, aber nie so viele auf einem Haufen.
Dabei ist es natürlich sehr praktisch so. Das sehe ich ein. Und eigentlich sieht es niedlich aus, wie hingebungsvoll all diese kleinen Würmchen an ihren Müttern hängen.
Ich kaue Algen, habe Sehnsucht nach einem Kaffee und versuche, den Gesprächen der anderen zu folgen. Es geht darum, wer auf die Jagd gehen soll; es scheint hier eine bestimmte Fischart zu geben, die sie sich nicht entgehen lassen wollen, wobei ich nicht verstehe, welche sie meinen. Dummerweise habe ich im Unterricht nicht besonders gut aufgepasst, als wir die Fische in den Gewässern Australiens durchgenommen haben – ich erinnere mich nur, dass es endlos viele waren –, sodass mir ein Name wie Rot-Flink-Streifen nichts sagt.
Lacht-immer sinkt neben mir herab, ich rutsche ein Stück zur Seite, damit sie Platz hat, und Schwimmt-schnell, der auch noch dazukommt, ebenfalls.
Wir bleiben auf jeden Fall hier, meint Lacht-immer zu mir.
Und ich gehe auf jeden Fall mit, ergänzt Schwimmt-schnell.
Wann suchen wir eigentlich nach meinem Vater?, frage ich ihn.
Er nickt bedächtig. Das habe ich nicht vergessen.
So, wie er mich dabei ansieht, komme ich mir dumm vor, die Frage gestellt zu haben. Natürlich muss ich erst einmal ankommen. Mich einleben. Wie will ich meinen Vater finden, wenn ich die Welt der Submarines nicht verstehe?
Ich bin ungeduldig, merke ich. Ich weiß nicht, wohin ich gehöre, wer ich eigentlich bin, wo mein Platz im Leben ist, und die einzige Hoffnung, die ich habe, ist die Vorstellung, dass ich meinem leiblichen Vater begegne und … nun ja, dadurch alles besser wird. Irgendwie.
Ein hochgewachsener Mann erzählt mit großen Gebärden, er und ein gewisser Hört-gut hätten nicht weit entfernt einen »Strom« gefunden, der »herrlich stark« sei: Den könnten wir alle reiten, schlägt er vor.
Ich habe keine Ahnung, was er meint, sehe aber, dass sein Vorschlag auf allgemeine Begeisterung stößt.
Au ja!, meint ein hübsches Mädchen in etwa meinem Alter, dem ein seltsamer, schmaler Streifen Fell auf der rechten Bauchseite wächst. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht!
Lacht-immer stößt mich an. Das ist Strich-am-Bauch, erklärt sie mir. Und das sind ihre Kinder. Sie deutet auf zwei Jungs, die mitten in der Runde am Boden sitzen und ein vielgliedriges Krabbeltier ärgern, das sich dorthin verirrt hat. Der eine heißt Brav-brav, der andere Großer-Mann.
Ich mustere die beiden. Brav-brav kommt mir wie ein ziemlich frecher Kerl vor, und Großer-Mann ist erst ein Dreikäsehoch. Aber wie ich auch rechne, Strich-am-Bauch kann kaum älter als zwölf gewesen sein, als sie das erste Kind gekriegt hat. Irgendwie finde ich das gewöhnungsbedürftig, vor allem, wenn ich daran zurückdenke, wie ich in dem Alter war.
Der ominöse »Strom« ist immer noch Thema; die Aussicht, ihn zu »reiten« – was immer das bedeuten mag –, begeistert alle.
Lacht-immer macht unverdrossen damit weiter, mir zu erklären, wer wie heißt. Der Hochgewachsene, der von dem »Strom« angefangen hat, heißt Zwölf-Kiemen, und als ich ihn mir daraufhin genauer anschaue, stelle ich fest, dass er tatsächlich an jeder Brustseite sechs Kiemen hat statt fünf wie alle anderen. Die Frau neben ihm heißt Wildes-Haar, was sowohl ein passender wie auch ein leicht merkbarer Name ist, aber dann gibt es noch einen Taucht-tief, einen Kurze-Nase, eine Lange-Frau, eine Isst-viel, einen Flinker-Flechter, und dann streckt mein Namensgedächtnis alle viere von sich. Sowieso kann ich mir Namen nur schlecht merken; als ich damals nach Seahaven in die Schule gekommen bin, habe ich zwei Monate gebraucht, ehe mir die Namen meiner Mitschüler einigermaßen geläufig waren.
Ein kleines Mädchen, das bis jetzt an der Brust seiner Mutter gelegen hat, macht sich los, kommt zu mir geschwommen und kuschelt sich in meinen Schoß, als würden wir uns schon ewig kennen.
Hallo, lasse ich meine Hände sagen. Wie heißt du denn?
Kluge-Frau, erwidert sie, dann steckt sie einen Daumen in den Mund und legt den Kopf an meinen Bauch.
Ich lege ratlos die Arme um sie. Es berührt mich seltsam. Wie kommt sie dazu, mir zu vertrauen, mir, einer Fremden, die zudem ein Mischwesen ist, halb Luft-, halb Wassermensch? Ich begreife es nicht.
Ich sehe, wie Weißes-Auge, die greise Anführerin des Schwarms, die sich bis jetzt nicht gerührt hat, die Hand hebt, und wie im selben Moment alle Gespräche zum Stillstand kommen und sich alle Gesichter ihr zuwenden.
Erst die Jagd, bestimmt sie. Und wenn wir genug Fische haben, reiten wir den Strom.
Das löst stummen Jubel aus. Die Gesichter strahlen, die Hände wirbeln begeisterte Zustimmung.
Mich dagegen befällt auf einmal ein ganz schlechtes Gefühl.
Angst. Ich habe Angst, aber ich kann nicht sagen, warum oder wovor. Nur eben – Angst.
Aus irgendeinem Grund finde ich es überraschend, dass es nicht nur Männer sind, die zur Jagd aufbrechen. Bis jetzt kam mir die Lebensweise der Submarines sehr altmodisch vor, aber die, die sich Knochenspeere schnappen und losziehen, sind einfach die Jungen und Flinken. Unter den Frauen, die auf die Jagd gehen, ist auch Strich-am-Bauch, die mir imponiert, auch wenn ich noch kein Wort mit ihr gewechselt habe.
Die, die zurückbleiben, beschäftigen sich damit, die wenigen Habseligkeiten, die die Submarines mit sich herumtragen, instand zu halten. Es sind ein paar geflochtene Netze zu reparieren, was ein älterer Mann erledigt – war das der, der Flinker-Flechter hieß? Wenn ich ihm zusehe, kann es eigentlich nicht anders sein. Andere verarbeiten Algen, Muscheln und Fischreste zu irgendwelchen Dingen, die man essen kann; sie »kochen« sozusagen, nur eben ohne Feuer, sondern mit Steinen und Messern, durch Schaben, Schneiden und Mischen.
Diejenigen, die ihre Hände frei haben, unterhalten sich – oder spielen. Die Kinder sowieso; die älteren paddeln unermüdlich hin und her, spielen Fangen und Verstecken und anderes.
Lacht-immer, die es übernommen hat, auf Strich-am-Bauchs Kinder aufzupassen, versucht, den wilden Brav-brav zu bändigen, der im Wettschwimmen mit den anderen regelrecht ausflippt. Brav-brav!, wedelt sie mit weit ausholenden Gesten. Hör auf, andere am Fuß zu ziehen, wenn sie schneller sind als du! Das macht man nicht!
Brav-brav bemüht sich, nicht in ihre Richtung zu schauen, und drückt einem Mädchen, das ihn zu überholen droht, die Hand auf den Kopf.
Er weiß genau, dass ich zu langsam bin, um ihm nachzuschwimmen, erklärt mir Lacht-immer. Ich glaube, wir müssen ihn künftig Brav-brav-brav nennen!
Ich sehe dem Treiben zu. Jetzt streiten die Kinder, wollen nicht mehr, dass Brav-brav mitmacht.
Tragen alle Kinder so unpassende Namen?, frage ich.
Am Anfang soll der Name einem sagen, was man werden soll, erklärt sie. Später soll der Name sagen, was man ist. Als Kind hieß ich Wildes-Mädchen, weil ich so ruhig war.
Ich betrachte sie, versuche, das Kind in ihr zu erkennen, das einmal Wildes-Mädchen hieß. Oben tragen die Menschen ihr ganzes Leben lang denselben Namen, erzähle ich ihr.
Wirklich? Das befremdet sie sichtlich. Wozu soll das gut sein?
Das kann ich ihr auch nicht sagen. Es ist eben so. Ich habe noch nie zuvor darüber nachgedacht, ob das überhaupt sinnvoll ist.
Es sind nicht nur die Kinder, die spielen. Ich sehe einen Mann und eine Frau, ein altes Paar, die Muschelschalen auf dem sandigen Boden hin und her schieben; es scheint dabei Regeln zu geben, aber vom Zusehen alleine begreife ich nicht, was für welche. Es sieht aus wie eine Mischung aus Mühle und Dame und dann doch wieder wie etwas ganz anderes.
Lacht-immer ist nicht die einzige Schwangere, aber diejenige, deren Schwangerschaft am weitesten vorangeschritten ist. Mir kommt es vor, als müsse die Geburt praktisch jeden Augenblick stattfinden, aber als ich ihr das sage, winkt sie nur ab und meint, ach was, nein, das dauere noch lange.
Nebenher ist sie damit beschäftigt, seltsame Fasern zu länglichen Strängen zu flechten. In einem Netz hat sie einen ganzen Vorrat davon.
Was ist das?, frage ich.
Sie versucht, es mir zu erklären, aber ich verstehe es nicht wirklich. Eine Art Unterwassergras, glaube ich.
Davon kann man gar nicht genug haben, meint sie. Wir machen alles Mögliche daraus – Netze, Gürtel, Lendenschurze, Halsketten …
Bring mir bei, wie man das macht, bitte ich. Ich möchte dir helfen.
Und es ist gar nicht schwer: Man nimmt drei oder vier der Fasern, verknotet die Enden und flicht sie anschließend zu einer Art engem Zopf. Das Kniffligste ist, rechtzeitig eine neue Faser einzufügen, wenn die vorige zu Ende geht, und zwar, ohne dass das Ganze hinterher auseinanderfällt.