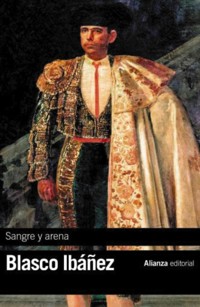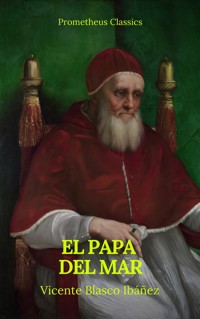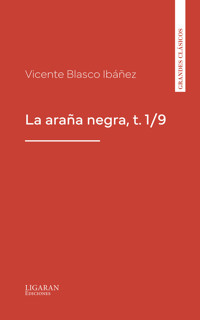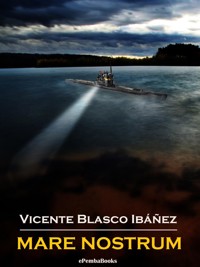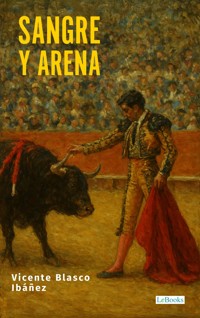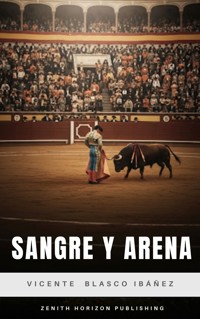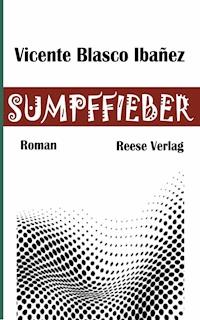
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sumpffieber ist einer der besten naturalistischen Romane des valencianischen Schriftstellers Vicente Blasco Ibañez. Der Roman schildert die soziale Realität im ländlichen Valencia (in der Lagunenlandschaft Albufera) des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Ibañez zeichnet den Aufstieg und Fall einer bescheidenen Familie, die mit Jagen, Fischen und Reisanbau ihr tägliches Auskommen verdienen muss. Inhaltlich stehen der Kampf der Geschlechter sowie die großen Ambitionen einer jungen Frau (Neleta) im Mittelpunkt, an deren Ehrgeiz und kühler Berechnung, um zu möglichst viel Ruhm und Ansehen zu kommen als Hauptperson, sowie ihr Freund Tonet, der am Ende sein tragisches Ende findet. "Eine spanische Dorfgeschichte, geschrieben mit jener Farbigkeit und Plastik, die Vicente Blasco Ibañez so kultiviert hat. Köstlich und erschütternd zugleich." (Berliner Tageblatt)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Zwischen hohem Dickicht folgte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Über den Autor
Impressum
Hinweise und Rechtliches
E-Books im Reese Verlag:
E-Books Edition Loreart:
Vicente Blasco Ibañez
Sumpffieber
Aus dem Spanischen von Otto Albrecht van Bebber
Zwischen hohem Dickicht folgte
er allen Windungen des schmalen Kanals, und als
sein Boot, frei von jedem Gewicht, endlich in die
offene Albufera hinausstieß, atmete er auf. Am
Horizont lag der bläuliche Streifen des anbrechenden
Tages. Gleich darauf streckte sich Tonet
auf dem Boden seines Fahrzeugs aus und versank
in jenen todesähnlichen Schlaf, der auf die großen
Nervenkrisen folgt und fast immer nach
einem Verbrechen eintritt.
1
Wie an jedem Nachmittag verkündete die Postbarke ihre Ankunft in Palmar durch verschiedene Hornstöße. Der Barkenführer, ein mageres Männchen mit einem amputierten Ohr, holte, von Tür zu Tür gehend, Aufträge für Valencia ein, und wenn er die unbebauten Stellen der einzigen Dorfstraße erreichte, tutete er von neuem, damit auch die am Rand des Kanals verstreuten Hütten seine Anwesenheit erführen. Eine Herde halbnackter Kinder folgte ihm mit einer gewissen Bewunderung - er flößte ihnen Respekt ein, dieser Mann, der viermal täglich die Albufera (=Küstensee, Haff südl. von Valencia.) kreuzte, um die besten Fische des Sees nach Valencia mitzunehmen und von dort die tausend Artikel einer Stadt zu bringen, der für diese auf einer Insel von Schilf und Schlamm aufwachsenden Kleinen etwas Geheimnisvolles und Phantastisches anhaftete.
Aus der Taverne des Cañamel (=Dialektform von Cana de miel: Zuckerrohr.), dem ersten Etablissement Palmars, kam eine Gruppe von Schnittern, ihren Sack auf dem Rücken, die auf der Barke die Heimfahrt antreten wollten, und von überall eilten neugierige Frauen zum Kanal, den Hütten und zum Aufbewahren der Aale bestimmte Fischkasten umsäumten.
In dem toten, wie Zinn blitzenden Wasser lag reglos die Postfähre: ein großer Sarg, mit Leuten und Bündeln derart beladen, daß der Rand kaum aus dem Wasser ragte. Ihr dreieckiges, flickenbesätes Segel krönte ein farbloser Lappen, einstmals eine spanische Flagge, der den offiziellen Charakter des alten Fahrzeugs kundtat.
Ein unerträglicher Geruch verbreitete sich um das Boot herum. Seine Bretter waren vollgesogen von dem Schleim der Aalkörbe und dem Schmutz Hunderter von Menschen, ein Übelkeit erregendes Gemisch von schlüpfrigen Häuten, Fischschuppen und von unsauberen Kleidern, deren ewiges Scheuern das Holz der Bänke allmählich poliert hatte.
Die Passagiere, in ihrer Mehrzahl Schnitter, die von Perello kamen, dem an das Meer grenzenden Ende der Albufera, skandalierten:
«Los! Die Fähre ist voll, es geht niemand mehr herein!»
So war es. Doch das Männchen drehte ihnen, als wollte es ihr Geschrei nicht hören, seinen unförmigen Ohrstumpf zu und fuhr bedächtig fort, die ihm vom Ufer gereichten Körbe und Säcke unterzubringen. Jedes neue Stück forderte neuen Einspruch heraus; immer mehr mußten sich die Fahrgäste zusammendrängen. Die Nachzügler aus Palmar jedoch nahmen die Flut grober Worte mit evanglischen Betrachtungen auf:
«Nur ein bißchen Geduld! Im Himmel werdet ihr später so viel Platz haben!» Noch tiefer sank die Barke ein, ohne daß ihr an verwegene Fahrten gewohnter Führer die geringste Unruhe gezeigt hätte. Jeder Fleck war besetzt, zwei Männer standen, die Hände am Mast angeklammert, auf dem Außenbord; ein anderer hockte wie eine Galionsfigur auf dem Bug. Und nochmals ließ der Führer sein Horn ertönen, unempfindlich gegen den allgemeinen Protest. «Cristo! Hat dieser Gauner noch nicht genug? Sollen wir uns hier den ganzen Nachmittag von der Sonne schmoren lassen?»
Plötzlich wurde es still. Am Kanal entlang näherte sich ein von zwei Frauen gestützter Mann, ein weißes, bebendes Gespenst, eingehüllt in eine wollene Bettdecke. Die Wasser schienen in der Hitze dieses Sommertages zu kochen; jeder auf der Barke schwitzte und machte verzweifelte Anstrengungen, um sich von dem klebenden Kontakt der Nachbarn zu befreien, und dieser Mann zitterte, klapperte vor Kälteschauern mit den Zähnen, als wäre die Welt für ihn in eisige Nacht versunken. Die beiden Frauen baten, ihm, der sich beim Reisschneiden die verfluchte Terciana (=Fieber.) der Albufera geholt hatte, ein Plätzchen zu gönnen.
«Ihr seid doch Christen? Aus Barmherzigkeit!»
Und seine zitterige Stimme wiederholte wie ein Echo:
«Per caritat! Per caritat!» (=Aus Mitleid.)
Gehoben und gestoßen kam er aufs Boot, ohne daß die egoistische Menge Platz machte, und da er keinen Sitzplatz fand, ließ er sich zwischen die Beine der Fahrgäste gleiten, mit dem Kopf auf ihren lehmbedeckten Hanfsandalen. Man war an dergleichen Szenen gewöhnt. Dieses Fahrzeug diente für alles: brachte Nahrung, führte ins Hospital und führte zum Kirchhof. Starb ein Armer, der kein eigenes Boot besaß, so wurde der Sarg unter eine Bank geschoben, und man lachte und plauderte, mit den baumelnden Füßen an die düstere Kiste klopfend, gleichmütig weiter.
Der Fieberkranke hatte sich kaum versteckt, da brach die Empörung wieder los.
«Worauf wartet der Ohneohr denn nur? Fehlt noch jemand?»
Doch über alle Gesichter breitete sich ein freundliches Lächeln, als jetzt ein Paar aus der Taverne heraustrat.
«Ah, der Onkel Paco! Der Onkel Paco Cañamel!»
Der Besitzer der Taverne, ein Riese mit aufgeschwemmtem Bauch, kam, wie ein Kind leise vor sich hin jammernd, Schrittchen für Schrittchen näher, wobei er sich fest auf seine Frau stützte, die kleine Neleta, mit dem rebellischen roten Haar, deren muntere grüne Augen weich wie Samt zu liebkosen schienen. Dieser Cañamel! Ständig krank, ständig seufzend, während seine Frau, täglich hübscher und liebenswürdiger, von ihrem Büfett aus über ganz Palmar und die Albufera herrschte. Woran er litt, das war die Krankheit der Reichen: zu viel Geld und zu gutes Leben. Man brauchte nur seinen Wanst und das rosige Gesicht anzusehen, in dessen Speckfalten die kleine Nase und die Augen ertranken. Ah, wenn er sich, bis zur Hüfte im Wasser stehend, das tägliche Brot mit Reisschneiden verdienen müßte, würde es ihm nicht einfallen, krank zu sein!
Mühsam setzte Cañamel, ohne Neleta loszulassen, einen Fuß auf die Barke und brummelte gegen diese Leute, die sich über sein Leiden lustig machten, ihm aber nichtsdestoweniger mit einer Dienstbeflissenheit, wie sie auf dem Land dem Reichen gegenüber üblich ist, einen Sitzplatz einräumten, während seine Frau durchaus nicht schüchtern den Komplimenten über ihr gutes Aussehen die Stirn bot.
Sie half ihrem Mann einen großen Sonnenschirm aufzuspannen, stellte für eine Reise, die kaum drei Stunden währte, einen Binsenkorb mit Proviant zwischen seine Füße und wandte sich schließlich an den Barkenführer:
«Gebt gut acht auf meinen armen Paco! Es geht ihm schlecht; er soll eine Zeitlang in seinem Landhäuschen in Ruzafa verbringen, wo ihn gute Arzte behandeln werden.» Dabei streichelte sie den stöhnenden Giganten, dessen wabbliges Fleisch beim ersten Schwanken des Bootes wie Gallert erzitterte. Der Führer stemmte die ungefüge Stange zum Staken gegen das Ufer, und schwerfällig begann das Fahrzeug den Kanal entlangzugleiten. Sein Bug, vor dem die Enten flügelschlagend zur Seite stoben, trübte den Wasserspiegel, der die auf dem Kopf stehenden Hütten, die schwarzen Kähne und die strohgedeckten Fischkasten widerspiegelte, deren Enden Holzkreuze schmückten, als wollte man die Aale drinnen dem göttlichen Schutz und Schirm anvertrauen.
Sobald die Postbarke aus dem Kanal heraus war, suchte sie sich ihren Weg zwischen den Reispflanzungen, ungeheuren, mit bronzefarbenen Ähren bedeckten Inseln aus flüssigem Schlamm. Die Sichel in der Hand, plantschten Schnitter durch das Wasser, denen die Nachen, schwarz und schmal wie Gondeln, folgten, um die Garben zu sammeln und nach den Tennen zu schaffen. Inmitten dieser aquatischen Vegetation erhoben sich hie und da die kleinen weißen, von Schornsteinen überragten Gebäude für die Maschinen, die je nach Erfordernis die Felder trockenlegen oder überschwemmen konnten.
Die hohen Ufer verbargen das Netz der Kanäle, breite Gassen, wo die mit Reis beladenen Barken fuhren. Ihr Rumpf blieb unsichtbar, und die großen dreieckigen Segel glitten über dem Grün der Felder hin, als machten sie ihren Weg auf festem Land.
Mit Kenneraugen betrachteten die Fahrgäste die Pflanzungen, gaben ihre Meinungen über die Ernte ab und bedauerten das Unglück des Bauern, dem Salpeter den Reis vernichtet hatte.
Weiter schob sich die Fähre durch stille Wasserarme mit dem goldgelben Ton des Tees. Vom Grund aufstrebende Pflanzen neigten ihren Haarschweif unter dem Druck des Kiels. Das Schweigen der regungslosen Gewässer vergrößerte jeden Laut, und wenn die Unterhaltung zeitweise aussetzte, hörte man deutlich das mühsame Atemholen des Fieberkranken am Boden, das asthmatische Schnaufen Canamals, das Knirschen von Masten und Stimmen auf unsichtbaren Booten, die sich vor den Krümmungen der Kanäle ankündigten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.
Der Barkenführer ließ die Stange für einen Moment im Stich, hüpfte auf den Knien der Fahrgäste zum Heck und machte das Segel los. Die schwache abendliche Brise sollte ihm helfen.
Man war am See angelangt, und der Horizont erweiterte sich. Auf einer Seite die dunkle Wellenlinie der Pinien der Dehesa (=Viehweide; in Südspanien auch: gelichteter Wald.), die die Albufera vom Meer trennt, fast jungfräulicher, sich meilenweit hinziehender Wald, in dem die wilden Stiere weiden und in dessen Schatten die großen Schlangen leben, von wenigen gesehen, aber das gruselige Thema der Unterhaltungen an Winterabenden. Auf der anderen Seite floß die unendliche Fläche der Reisfelder hinter Sollana und Sueca mit den fernen Bergen zusammen. Die Sicht geradeaus war noch durch Inselchen verdeckt, zwischen denen die Barke, das Röhricht mit dem Segel streifend, sich vorsichtig hindurchwand. Strähnen dunkler Pflanzen, gallertartige, klebrige Fühlfäden, stiegen bis zur Oberfläche und wickelten sich um die Stange des Führers, und vergeblich sondierte man diese faulige Vegetation, in der es von den Tieren des Schlammes wimmelte. In aller Augen konnte man denselben Gedanken lesen: wer hier hineinfiel, kam schwerlich wieder heraus.
Durch die binsenbesetzten Tümpel am Strand patschte gemächlich eine weidende Stierherde. Einige Tiere waren zu den nächsten Inselchen geschwommen, wo sie, zwischen dem Röhricht bis zum Bauch im Morast versunken, träge wiederkäuten. Ab und zu zogen sie schwerfällig einen Huf aus dem laut schwappenden Sumpf. Es waren große, schmutzige Tiere mit krustenbedecktem Rücken, riesigen Hörnern und ständig sabberndem Maul. Wild hoben sie den massigen Kopf nach der Barke, wobei eine Wolke dicker Moskitos aufschwärmte, um sich gleich darauf von neuem auf dem faltigen Nacken niederzulassen.
Ein Stückchen weiter kauerte auf einer Anhöhe, die nichts anderes war als eine schmale Schlammzunge zwischen zwei Wasserflächen, ein Mann.
«Es ist Sangonera!» (=Blutegel.)riefen die Leute von Palmar, «der Säufer Sangonera!» Und ihre Hüte schwenkend fragten sie ihn, wo er den Rausch erwischt hätte und ob er dort zu schlafen gedächte.
Sangonera machte keine Bewegung. Da ihm aber schließlich das Geschrei doch lästig wurde, erhob er sich, drehte der Barke den Rücken zu und versetzte sich zum Zeichen seiner Verachtung ein paar Kläpse auf den Hosenboden.
Das Gelächter auf der Fähre verdoppelte sich, als er aufstand. Ein wunderlicher Anblick! Seinen Hut krönte ein großer Feldblumenstrauß; auf die Brust herunter hing ein Gewinde von Glockenblumen, und ein anderes schlang sich um seine Taille.
Ah, tüchtiger Sangonera! Es gab keinen zweiten wie ihn in den Dörfern am See. Er hatte sich fest vorgenommen, nicht zu arbeiten wie die anderen Männer, denn Arbeit, sagte er, sei eine Beleidigung Gottes. Dafür verbrachte er den Tag auf der Suche nach einer guten Seele, die ihn zum Trinken einlüde. Er betrank sich in Perello, um in Palmar zu schlafen; soff in Palmar, um am nächsten Morgen in Saler aufzuwachen. Und feierten die Dörfer an der Küste des Festlandes ihre Schutzheiligen, so suchte er auch in Silla oder Catarroja irgend jemandes habhaft zu werden, der in der Albufera Reis baute. Ein Wunder, daß sein Leichnam noch nicht in einem der Kanäle aufgetaucht war, nach so vielen Fußmärschen über den See, total betrunken den Grenzscheiden der Reisfelder, schmal wie der Rücken einer Axt, folgend, bis zur Brust im Wasser durch die Schleusen der Kanäle und quer über die Stellen von Saugschlamm stolpernd, die niemand, außer im Boot, zu passieren wagte. Die Albufera war sein Haus. Sein Instinkt als Sohn des Sees holte ihn aus jeder Gefahr heraus, und manche Nacht tauchte er, um ein Glas Wein zu erbetteln, in Cañamels Taverne auf mit dem schleimigen Kontakt und dem Schlammhauch eines wirklichen Aals.
«Dieser Schamlose! Wie oft habe ich ihm nicht mein Lokal verboten!» grunzte Cañamel, während die Leute sich weiter über die Manie des Vagabunden amüsierten, sich mit Kränzen zu schmücken, sobald in seinem hungrigen Magen die Gärung des Weins anfing.
Man stieß in den See hinaus. Zwischen zwei Röhrichtmassen, ähnlich den Wellenbrechern eines Hafens, zeigte sich eine weite, glitzernde, bläuliche Wasserfläche: der Lluent, die wahre Albufera mit ihren verstreuten Inseln, den Zufluchtsstätten des von den Jägern Valencias so verfolgten Federwildes. Jetzt segelte die Barke an der Dehesa entlang, wo gewisse unter Wasser stehende Moräste sich langsam in Reisfelder verwandelten.
In einer kleinen, von schmalen Lehmwällen eingefaßten Lagune schüttete ein kräftig gebauter Mann die in seinem Kahn aufgestapelten Binsenkörbe aus. Es war Toni, der Sohn des alten Paloma, der es sich in den Kopf gesetzt hatte, Grundbesitzer zu werden, Reisfelder sein eigen zu nennen, nicht vom Fischfang zu leben wie sein Vater, dem ältesten Kahnfischer vom See; und ganz allein, denn die Seinigen wurden müde angesichts der Größe dieser Arbeit, mühte er sich ab, den tiefen Tümpel mit Erde zu füllen, die er von weither anfahren mußte.
Eine Arbeit von Jahren, vielleicht die eines ganzen Lebens, für einen Mann allein! Sein Vater machte sich über ihn lustig; der eigene Sohn Tonet, der Kubaner, streikte, wenn er bisweilen half, nach wenigen Tagen. Aber Toni setzte mit unerschütterlichem Glauben sein Werk fort, nur unterstützt von Borda, einen von seiner verstorbenen Frau angenommenen Findelkind, das, schüchtern gegen jedermann, bei der Arbeit die gleiche Zähigkeit wie er selbst an den Tag legte.
«Salud, Onkel Toni! Hoffentlich gibt’s bald die erste Reisernte!»
Doch nur für einen Moment hob der hartnäckige Froner den Kopf, um für die Wünsche der Fahrgäste zu danken.
Nicht weit von ihm entfernt legte der alte Paloma an einer Reihe von Pfählen Netze aus, die er am nächsten Tag aufholen wollte, und sogleich begann auf der Postbarke die Diskussion, ob er näher an neunzig oder an hundert Jahren wäre.
Was hatte dieser Mann nicht erlebt, obwohl er nie aus der Albufera herausgekommen war! Mit was für Persönlichkeiten hatte er nicht verkehrt! Und voll Behagen erzählten sie sich seine frechen, von der Leichtgläubigkeit des Volkes noch übertriebenen Vertraulichkeiten mit dem General Prim, dem er bei seinen Jagden auf dem See als Bootsführer diente, und seine Grobheiten gegenüber großen Damen, ja sogar Königinnen. Ohne von der Barke Notiz zu nehmen, beugte sich der Alte über seine Netze und zeigte nichts als die großkarierte Bluse und die schwarze, bis auf die eingeschrumpften, weit abstehenden Ohren gezogene Mütze.
Der Wind frischte auf. Stoßweise blähte sich das Segel, und die überladene Barke stellte sich so schräg, daß die auf dem Bord sitzenden Leute naß wurden. Am Bug sang das ungestüm geteilte Wasser mit immer stärkerem Gluck-Gluck: man war mitten in dem ungeheuren Lluent, blau und poliert wie ein venezianischer Spiegel, auf dessen Grund die Wolken als Flocken weißer Wolle wanderten. Einige von ihren Hunden gefolgte Jäger am Strand der Dehesa marschierten im Wasser auf dem Kopf, und die fernen Dörfer der Küste schienen auf der blanken Fläche zu schwimmen.
Doch der ständig stärker wehende Wind veränderte die Oberfläche der Albufera. Der See nahm die Farbe des Meeres an, sein Grund verbarg sich, und der mehr und mehr fühlbare Wellengang warf auf den dickkörnigen Muschelsand des Strandes gelblichen Schaum, in der Sonne schillernde Seifenblasen.
Am Steuer rauschte das Wasser hoch, und in schneller Folge glitten die Hügel der Dehesa mit den Hütten der Feldhüter vorbei, die dichten Vorhänge des Buschwerks, die Gruppen gekrümmter Pinien in den grausigen Verzerrungen gefolterter Glieder. Um die Barke herum schwammen zwei dunkelgefiederte Taucher, die endlose Zeit unter Wasser blieben. Näherte sich die Fähre einer der großen Inseln, so flogen Schwärme von Wasserhühnern und Krickenten auf, langsam, als ahnten sie, daß friedliche Menschen kamen.
«Prachtvoller Schuß!» äußerten die Männer an Bord begeistert. «Warum ist es uns armen Teufeln verboten, auf all dies Federvieh Jagd zu machen?» Und während sie weiter murrten, klang vom Boden herauf das Stöhnen des Fieberkranken und das Seufzen Cañamels, der sich kindisch über die Strahlen der sinkenden Sonne beklagte, die unter seinen Schirm glitten.
Zwischen dem zum Meer fliehenden Wald und der Albufera öffnete sich jetzt eine weite Ebene, deren wilde Vegetation dann und wann durch die metallene Platte kleiner Lagunen zerrissen wurde.
Eine Ziegenherde weidete im Gestrüpp unter der Obhut eines Hirtenknaben, und sein Anblick weckte bei den Kindern der Albufera die Erinnerung an die Legende, von welcher der Name der Ebene herrührte.
«Die Pampa der Sancha!» sagten die Frauen in ängstlichem Ton, worauf ein Fischer den neugierig gewordenen fremden Reisschnittern bereitwilligst die Geschichte erzählte, die jedem Einheimischen von Kindesbeinen an vertraut war.
Ein junger Hirte wie der, der dort am Ufer stand, weidete zu anderen Zeiten seine Ziegen auf dieser selben Stelle. Aber das war vor vielen, vielen Jahren, so vielen, daß keiner der Greise, die noch in der Albufera leben, den Hirten gekannt hatte, nicht einmal der alte Paloma.
Wie ein Wilder hauste der Junge in der Einsamkeit, und die Fischer auf dem See hörten an stillen Tagen häufig seinen Ruf:
«Sancha! Sancha!»
Sancha war eine kleine Schlange, die einzige Freundin, die ihn begleitete. Sobald er rief, kam sie herbei, und der Hirte melkte seine beste Ziege, um ihr einen Napf Milch anzubieten. Dann schnitt er sich Rohr zu einer Schalmei und spielte sanfte Weisen, während die Schlange zu seinen Füßen sich aufrichtete, den Körper wiegend, als wollte sie zum Takt der weichen Töne tanzen. Andere Male unterhielt er sich damit, ihre Ringe auseinander zu winden und sie in einer geraden Linie auf den Sand zu legen, denn der nervöse Ruck, mit dem die Schlange sich sofort wieder zusammenrollte, machte ihm Vergnügen. Trieb er seine Herde nach einer anderen Stelle der großen Pampa, so folgte ihm Sancha wie ein Schoßhund oder ringelte sich an seinen Beinen aufwärts bis zum Hals, wo sie regungslos, erstarrt, liegenblieb, die diamantenen Augen ihres dreieckigen Kopfes fest auf die seinigen gerichtet, den Flaum seines Gesichts mit ihrem Hauch kosend.
Die Leute hielten ihn für einen Hexenmeister, und mehr als eine der im Wald Holz stehlenden Frauen bekreuzigte sich, wenn er mit Sancha um seinen Hals auftauchte. Es war ihnen allen sehr verständlich, daß der Hirt ohne Furcht vor den großen Reptilien, von denen das Dickicht wimmelte, im Freien schlief: Sancha, die der Teufel selbst sein mußte, beschützte ihn vor jeder Gefahr.
Die Schlange wuchs, und der Knabe hatte sich zum Mann entwickelt, als die Bewohner der Albufera ihn plötzlich nicht mehr sahen. Später erfuhr man, daß er Soldat geworden war und an den Kriegen in Italien teilnahm.
Keine andere Herde suchte die wilde Pampa auf, und auch den Fischern, die am Strand anlegten, behagte es nicht, sich zwischen die hohen Binsen am Rand der trägen Lagunen zu wagen. In Ermangelung der Milch, mit der sie der Hirte gelabt hatte, mußte Sancha die unzähligen Kaninchen der Dehesa verfolgen.
Acht oder zehn Jahre verflossen, und eines Tages bemerkten die Einwohner von Saler auf dem Weg von Valencia einen dürren, zitronengelben Grenadier mit weißem Rock, roten Pumphosen und schwarzen Gamaschen bis übers Knie; doch der mächtige Schnurrbart hinderte nicht das Wiedererkennen. Der Hirte war zurückgekommen, von dem Wunsch getrieben, das Land seiner Kindheit wiederzusehen.
Den See umgehend, schlug er den Pfad zum Wald ein und gelangte mittags zu der einsamen Pampa, dem alten Weideplatz seiner Ziegen. Nichts regte sich. Leise surrend spielten Libellen über dem schweigenden Schilf, während die Frösche, entsetzt über die Nähe des Grenadiers, in die grünüberzogenen Tümpel klatschten.
«Sancha! Sancha!» lockte sanft der frühere Hirt.
Vollkommene Stille. Nur vom See herüber drang das schläfrige Lied eines Fischers.
«Sancha! Sancha!» rief er mit aller Kraft.
Und als er den Ruf viele Male wiederholt hatte, sah er, wie das Gebüsch sich bewegte, vernahm er das Knacken von brechendem Rohr: zwischen den Binsen blitzten zwei Augen in Höhe der seinigen. Unstet spielte in dem abgeplatteten Kopf die gespaltene Zunge, und ein grauenhaftes Zischen ertönte, das sein Blut gefrieren ließ. Es war Sancha, aber riesig, prachtvoll. Mannshoch hatte sie den bunten Leib, dick wie ein Pinienstamm, emporgereckt, dessen nachschleifender Schwanz sich im Gebüsch verlor.
«Sancha!» schrie der Soldat und wich ängstlich zurück. «Wie bist du gewachsen!»
Er versuchte zu fliehen. Doch die alte Freundin - nach dem ersten Staunen schien sie ihn wiederzuerkennen - wickelte sich um seine Schultern, schloß ihn in einen unter nervösen Zuckungen vibrierenden Ring.
Der Mann machte verzweifelte Anstrengungen.
«Laß los, Sancha! Laß los! Du bist zu groß für diese Spielerei!»
Ein neuer Ring fesselte seine Arme. Und wie in früheren Zeiten koste der Hauch der Schlange sein Gesicht. Enger umschnürten ihn die Ringe, immer enger, bis seine Knochen krachten, bis er, in der Rolle bunter Reifen erstickt, auf die Erde fiel.
Tage später fanden Fischer seinen Leichnam: eine unförmige Masse Fleisch, blauschwarz angelaufen unter Sanchas unwiderstehlichem Druck.
So starb der Hirte, ein Opfer der Umarmung seiner alten Freundin.
Den Reisschnittern auf der Barke entlockte diese tragische Legende nur ein spöttisches Lachen, aber die Frauen bewegten unruhig ihre Füße, als sei das, was sich stöhnend am Boden wälzte, die an Bord geschlüpfte Sancha.
Inzwischen war man am Ende des Sees angelangt. Wieder drang die Postfähre in ein Netz von Kanälen ein, und fern, sehr fern hoben sich über der ungeheuren Reisfläche die Häuser Salers ab, des Valencia am nächsten liegenden Dörfchens der Albufera, mit seinem von unzähligen Kähnen und großen Barken vollgestopften Hafen, deren unbehauene Masten, geschälten Pinien gleichend, den Horizont verdeckten.
Der Abend kam.
Die Fahrt verlangsamte sich in dem toten Wasser des Kanals, und als dunkle Wolke huschte der Schatten des großen Segels über die Reisstauden, die die letzten Sonnenstrahlen rötlich färbten.
Unaufhörlich stakten heimkehrende Leute im winzigen schwarzen Nachen vorbei, dem Pferd dieser Bauern, mit dem jeder Angehörige des im Wasser und vom Wasser lebenden Stammes von klein auf umzugehen verstand, war er doch unentbehrlich für die Arbeit auf den Feldern, für den Besuch beim Nachbarn, für die Gewinnung des täglichen Brotes. Frauen, alte Männer, Kinder gebrauchten, aufrechtstehend, mit gleicher Geschicklichkeit die lange Stange, um diesen Holzschuh, der nur fingerbreit aus dem Wasser ragte, in flinker Fahrt zu halten.
Ab und zu waren in die Uferdämme Breschen geschlagen, durch die sich ohne Geräusch oder Bewegung das unter einer Decke von glitschigem Grün schlafende Wasser des Kanals auf die Felder ergoß. Aalnetze, an Pfählen befestigt, versperrten diese Einschnitte. 'Beim Vorbeigleiten der Barke huschten enorme Ratten fort und verschwanden im Schlamm der Rieselgräben.
«Feines Abendessen!» hörte man auf der Fähre.
Die Leute vom Festland spuckten voller Widerwillen aus, was einen Protest der Einheimischen zur Folge hatte.
«Wie könnt ihr darüber sprechen, ohne probiert zu haben? Unsere Sumpfratten, die nur Reis fressen, sind wirklich ein leckerer Happen. Dutzendweise baumeln sie vor den Metzgertischen auf dem Markt von Sueca, schön abgehäutet und an ihren langen Schwänzen aufgehängt. Die Reichsten, die Vornehmsten in den Stranddörfern essen nichts anderes.»
Das Elend einer Bevölkerung, die Schlachtvieh nur insofern kennt, als sie es von weitem auf der Weide sieht, und die ihr Leben lang verdammt ist, sich von Aalen und Schlammfischen zu ernähren, enthüllte sich in dieser Großtuerei, mit der man dem Ekel der Landfremden entgegentrat. Und hitzig zählten die Frauen alle Vorzüge der als arroz de la paella zubereiteten Ratte auf, den sich schon viele, erstaunt über den angenehmen Geschmack des Fleisches, hatten munden lassen, ohne zu wissen, was sie aßen. Sogar Cañamel hielt es für unerläßlich, seine Meinung zu äußern, und sein Seufzen einen Moment unterbrechend versicherte er mit Nachdruck:
«Ich kenne auf der Welt nur zwei Tiere ohne Galle: die Taube und die Ratte.»
Damit war alles gesagt.
Es wurde Nacht. Die Felder dunkelten, der Kanal schimmerte im Dämmerlicht weiß wie Zinn. Auf dem Grund des Wassers erzitterten die ersten Sterne.
Saler war jetzt ganz nahe. Uber den Dächern seiner Hütten reckte sich zwischen zwei Mauerpfeilern die Glocke des Demaná-Hauses, in dem sich am Vorabend der großen Jagden Jäger und Bootsführer zur Verteilung der Stände versammelten. Neben dem Haus erwartete eine riesige Postkutsche die Fahrgäste vom Boot, um sie nach der Stadt zu befördern.
Die Brise hatte aufgehört. Schlaff hing das Segel am Mast, und zum letztenmal griff Ohneohr zur Stange.
In der Richtung zum See glitt ein kleiner, mit Erde beladener Kahn vorbei. Am Bug stakte hurtig die junge Borda, wobei sie der hinten stehende Tonet, der Kubaner, der stattlichste Bursche am ganzen See, unterstützte. Ein Mann, der die Welt gesehen hatte und allerlei zu erzählen wußte!
«Hallo, Bigot!» grüßten ihn die Fahrgäste familiär mit seinem Spitznamen, den er seinem Schnurrbart verdankte, einem ungewohnten Schmuck in der Albufera, wo jeder glatt rasiert ging. «Seit wann arbeitest denn du?»
Doch Tonet begnügte sich damit, nach einem raschen Blick auf die Fähre weiterzustaken, während die Passagiere jetzt Cañamel mit denselben derben Späßen hänselten, die er in seiner Kneipe über sich ergehen lassen mußte.
«Aufgepaßt, Onkel Paco! Du fährst nach Valencia, und Tonet hat das Reich für sich in Palmar!»
Anfänglich stellte sich der Kneipwirt, als hörte er nicht die groben Anzüglichkeiten. Als sie jedoch gar kein Ende nahmen, richtete er sich auf, in den Augen ein zorniges Funkeln.
Die Fettmasse seines Körpers aber war zu groß, belastete so sehr seinen Willen, daß er von der Anstrengung zermürbt auf seine Bank zurücksank und zwischen zwei Seufzern murmelte:
«Unanständige Bande!»
2
Die Hütte des alten Paloma stand am äussersten Ende von Palmar. Eine große Feuersbrunst, bei der das halbe Dorf in Flammen aufging, hatte sein ursprüngliches Aussehen vollkommen verändert. Rapide waren die Strohhütten zu Asche geworden, und da in Zukunft ihre Besitzer ohne Furcht vor Feuer leben wollten, errichteten sie auf den ausgeglühten Baustellen Gebäude aus Ziegelsteinen, wobei viele ihre bescheidenen Mittel erschöpften, denn der Tansport über den See verteuerte das Material erheblich. So bedeckte sich der abgebrannte Teil Palmars mit kleinen Häusern, deren Fassaden rosa, grünen oder blauen Anstrich zeigten, während der Rest des Dorfes den früheren Charakter bewahrte: hohe, vom First nach beiden Seiten rund ausbuchtende Dächer, als hätte man umgekehrte Barken auf die Lehmmauern gestülpt.
Von dem kleinen Kirchplatz bis nahe zur Dehesa standen die Häuschen wie vom Zufall gesät wirr durcheinander, eines möglichst weit vom anderen entfernt, im Gedanken an einen etwaigen neuen Brand.
Palomas Hütte war die älteste. Sein Vater hatte sie erbaut zu einer Zeit, als es in der ganzen Albufera kein menschliches Wesen gab, das nicht vor Fieber zitterte.
«Damals», erzählte der Alte, «reichte das Dickicht bis an die Wände der Hütten. Die Hühner verschwanden unmittelbar vor der Haustür, und wenn sie nach Wochen wieder auftauchten, rannte hinter ihnen ein Gefolge flaumiger Küken her. In den Kanälen machte man Jagd auf Fischottern, doch die Bevölkerung am See war so spärlich, daß die Fischer nicht wußten, was sie mit ihrem Fang beginnen sollten. Valencia lag am Ende der Welt, von wo nur bisweilen der Marschall Suchet kam, den König José zum Herzog von Albufera ernannt hatte, zum Herrn über Wald und See mit all ihren Reichtümern.»
Weiter als bis zur Person des Marschalls reichten die Kindheitserinnerungen des alten Paloma nicht zurück. Noch glaubte er ihn vor sich zu sehen mit seinem wirren Haar und dem breiten Backenbart, angetan mit einem grauen Überrock, während Männer in prunkhaften Uniformen seine Flinten luden. Der Marschall benutzte zur Jagd das Boot von Palomas Vater, und der am Bug kauernde Junge betrachtete ihn voll staunender Bewunderung, wenngleich er manchmal auch über das Kauderwelsch lachen mußte, in dem der große Heerführer den Rückstand des Landes beklagte oder die Ereignisse im spanisch-englischen Krieg, für die Albufera ein vages Ereignis, kommentierte. Einmal fuhr der Knirps mit seinem Vater nach Valencia, um dem Herzog von Albufera einen Aal von ungewöhnlicher Größe zu verehren. Lachend empfing sie der Marschall, diesmal in großer, von Goldstickereien strotzender Uniform, neben der seine Offiziere wie Satelliten seines Glanzes wirkten. Als Paloma mit dem Tod seines Vaters Besitzer der Hütte und zweier Boote wurde, gab es keine Herzöge von Albufera mehr, sondern Landvögte, die im Namen des Königs regierten - ausgezeichnete Señores, die niemals zum See kamen und den Fischern freie Hand ließen, sowohl aus der Dehesa zu holen, was ihnen beliebte, als auch alles Federwild im Röhricht zu jagen. Das waren die guten Zeiten! Und wenn der Alte mit seiner knarrenden Stimme in Cañamels Taverne von ihnen erzählte, kroch über den Rücken der Jugend ein Schauer der Begeisterung. Man fischte und jagte zu gleicher Zeit, ohne Angst vor Feldhütern oder Strafen. Kehrten die Leute abends heim, so sah man außer Dutzenden von Kaninchen, mit Frettchen im Wald gefangen, auch noch Körbe voll Fisch und Bündel aufgeschnürter Wasservögel. Alles gehörte dem König, und der König war weit fort.
Wie hatte sich das geändert! Jetzt gehörte die Albufera dem Staat - wer mochte nur dieser Señor sein? -, jetzt gab es Jagdpächter im Wald und auf dem See, und die kleinen Leute konnten keinen Schuß abgeben oder ein Stück Holz auflesen, ohne daß sofort der Feldhüter mit dem Bandelier über der Brust und dem angeschlagenen Karabiner erschien.
Paloma hatte die Vorzugsstellung seines Vaters zu bewahren verstanden. Er war der erste Kahnfischer des Sees, und keine große Persönlichkeit kam zur Albufera, der er nicht bei einer Fahrt durch die Röhrichtinselchen alles Sehenswerte im Wasser und am Land zeigte. Von der jungen Isabella II. wußte er zu erzählen, deren weite Röcke das ganze Heck des geschmückten Bootes füllten; von ihrer strammen Büste, die sich bei jedem Ruck des fortgestakten Kahnes bewegte. Und wie lachten die Leute, wenn sie an seine Fahrt mit der Kaiserin Eugenie dachten! Sie am Bug, schlank, im kurzen Rock, schußbereit für die Vögel, die in dicken Schwärmen von gewandten Treibern aufgescheucht wurden, am Heck der Schelm von Paloma mit seiner alten Flinte zwischen den Beinen. In einem phantastischen Spanisch machte er die hohe Dame auf die von ihr außer acht gelassenen Collverts aufmerksam:
«Eure Majestät, auf gepaßt! Von hinten kommt Ihnen ein Grünkragen rein!»
Alle Herrschaften stellte er zufrieden. Frech, ja, und grob wie nur ein Sohn der Lagune; doch die seiner Zunge mangelnde Lobhudelei steckte in seiner Flinte, einer ehrwürdigen Waffe mit so vielen Reparaturen, daß man nicht mehr wußte, was an ihr eigentlich von der ursprünglichen Fabrikation noch vorhanden war, denn der alte Paloma schoß wundervoll. Wollte er einem mittelmäßigen Schützen schmeicheln, so stellte er sich hinter ihn und feuerte im selben Moment; so präzise, daß der Knall beider Flinten verschmolz und die hohe Persönlichkeit beim Fallen des Wildes über ihre eigene Geschicklichkeit erstaunte, während der Fischer in ihrem Rücken den Mund boshaft verzog.
Die meiste Freude machte dem Alten die Erinnerung an den General Prim, den er in einer stürmischen Nacht über den See gebracht hatte, damals, in den Zeiten des Unglücks. Die Häscher des Königs suchten schon in nächster Nähe Valencias, und der General mußte nach einem vergeblichen Versuch, die Garnison der Stadt aufzuwiegeln, im Arbeiterkittel die Flucht ergreifen. Paloma führte ihn in seinem Boot bis ans Meer. Als er nach Jahren den General wiedersah, war aus dem Flüchtling der Chef der Regierung und Spaniens Abgott geworden. Wenn er die Politik satt hatte, ließ er zuweilen Madrid im Stich, um auf dem See zu jagen, wobei ihn Paloma, nach dem gemeinsamen Abenteuer keck und äußerst familiär, wie einen Schuljungen abkanzelte, sobald ein Schuß danebenging. Für Paloma gab es keine Granden, nur gute und schlechte Schützen. Und als der Nationalheros wieder einmal vorbeischoß, wurde der Fischer so wütend, daß er ihn duzte:
«Du Sch...general! Sollte man glauben, daß du all diese großen Dinge in Marokko getan hast? Paß jetzt auf! Paß auf und lerne!»
Der glorreiche Schüler lächelte; Paloma aber zog ab, fast ohne zu zielen. Klatschend fiel eine Ente ins Wasser.
Diese Anekdoten verschafften dem Alten ein ungeheures Prestige unter den Leuten am See. Was hätte nicht aus ihm werden können, wenn er den Mund aufgetan haben würde, um von seinen Kunden etwas zu erbitten! Ihn aber befriedigte das Leben, das er führte, trotzdem es sich, je älter er wurde, immer härter und schwieriger gestaltete. Kahnfischer, nichts als Kahnfischer! Menschen, die Reisfelder bebauten, verachtete er. Das waren Landleute! - ein Wort, das für ihn die schwerste Beleidigung bedeutete.
Stolz darauf, ein Mann des Wassers zu sein, folgte er lieber im Boot den endlosen Windungen der Kanäle, als diese Umwege durch einen Fußmarsch abzukürzen, und betrat aus freien Stücken keinen anderen Erdboden als den der Dehesa; auch diesen nur, um heimlich ein paar Kaninchen zu schießen. Am liebsten hätte er im Boot, das ihm dasselbe war wie der Auster die Schale, auch noch gegessen und geschlafen.
Am vollkommenen Glück, wie ein Vogel im Röhricht zu leben mit einem Nest auf irgendeinem Inselchen, hinderte ihn die Familie. Sein Vater, der die Hütte, das Werk seiner Hände, nicht verlassen sehen wollte, zwang ihn zur Heirat, und der Wasserstrolch mußte fortan mit seinesgleichen leben, unter einem Strohdach schlafen, seinen Anteil für den Unterhalt des Pfarrers bezahlen und dem Alkalden (=Bürgermeister, Dorfrichter.) der Insel gehorchen, einem Mann, wie er sagte, ohne jedes Schamgefühl, der die Protektion der großen Herren in Valencia suchte, um sich vor der Arbeit zu drücken.
Von seiner Frau gewahrte er nur ein vages Bild. Viele Jahre hatte sie neben ihm gelebt, ohne andere Erinnerungen zu hinterlassen als die an ihre Geschicklichkeit im Netzestopfen und ihre hübsche Haltung beim Kneten des wöchentlichen Brotteigs, den sie an jedem Freitag nach der runden weißen Kuppel des am äußersten Ende der Insel stehenden Backofens schleppte, der aussah wie ein afrikanischer Ameisenhaufen.
Sie hatten viele Kinder gehabt, sehr viele, aber mit Ausnahme eines einzigen waren alle «zu gelegener Zeit» gestorben: bleiche, kränkliche, blutlose Wesen, von fieberschauernden Eltern gezeugt, die einzig der Wunsch nach Wärme zusammenführte. Die einen, geschwächt durch die einseitige, fade Fischnahrung, starben an Auszehrung; andere fielen in die nahen Kanäle und ertranken.
Nur der Jüngste klammerte sich zäh genug ans Leben, um allen Fiebern standzuhalten, saugte gierig die paar Tropfen Milch, die die schlaffen Brüste eines immer kranken Körpers geben konnten.
Paloma fand diese Todesfälle logisch und unerläßlich. Man mußte dem Herrn danken, daß er sich der Armen erinnerte! War es nicht widerlich zu sehen, wie sich die im Elend lebenden Familien vermehrten? Ohne die Güte Gottes, der von Zeit zu Zeit diese Pest von Kindern klärte, hätte der See nicht alle ernähren können, hätte einer den anderen auffressen müssen.
Als die Mutter starb, übernahm der kleine siebenjährige Toni ihre Arbeit. Nicht minder umsichtig und arbeitsam als sie, kochte er das Essen, bastelte an schadhaften Stellen der Hütte und holte sich Rat bei den Nachbarinnen, damit der Vater das Fehlen einer Frau nicht bemerken sollte, alles mit schwerem Ernst, als hätte das unentwegte Bemühen, die Mutter zu ersetzen, jeglichen Frohsinn ausgelöscht.
Unter einem Berg von Netzen ganz verborgen, folgte er dem Vater zum Boot, und Paloma blickte stolz auf seinen kräftigen Jungen, der behende die Reusen einholte oder das Boot über den See stakte.
«Ein Kerl wie kein zweiter!» meinte Paloma zu seinen Freunden. «Sein Körper rächt sich jetzt für alle früheren Krankheiten.»
Die Frauen von Palmar lobten vor allem seine guten Sitten. Weder beteiligte sich Toni an dem Unfug der jungen Leute in den Tavernen, noch gesellte er sich zu den Burschen, die nach beendigtem Fischfang hinter irgendeiner Hütte auf dem Bauch lagen, um stundenlang ein schmuddeliges Kartenspiel zu mischen.
Stets willig zur Arbeit, bereitete Toni seinem Vater nicht den geringsten Verdruß. Paloma, der mit niemandem gemeinsam fischen konnte, weil er bei der kleinsten Unaufmerksamkeit mit den Fäusten auf seinen Kameraden losging, fand an Toni niemals etwas zu tadeln. Mehr noch! Häufig sah der Alte, wenn er im Begriff war, eine Anweisung zu geben, daß sein Sohn, die Absicht erratend, schon Hand ans Werk gelegt hatte.
Als Toni ein Mann geworden war, vollzog sich in der Seele seines Vaters trotz seiner Vorliebe für das Vagabundieren auf dem Wasser und trotz fehlenden Familiensinns dasselbe wie einst beim Großvater. Was sollten zwei Männer allein in der einsamen Hütte? Es stieß ihn ab, seinen Sohn, diesen robusten Burschen, das Feuer anblasen und Essen kochen zu sehen, und nicht ohne Gewissensbisse blickte er auf die kurzen, behaarten Hände mit den eisernen Fingern, die Töpfe scheuerten und Fische schuppten.
An den langen Winterabenden glichen sie zwei auf eine wüste Insel verschlagenen Schiffbrüchigen. Kein Wort fiel zwischen ihnen, kein Lachen erklang, keine Frauenstimme heiterte sie auf. In der Mitte der düsteren Hütte glühte zu ebener Erde der Herd: ein kleines viereckiges Loch, eingefaßt von Ziegelsteinen. Ihm gegenüber eine alte Anrichte, auf deren rissigen Fliesen armseliges Geschirr stand, und zu beiden Seiten die wie die ganze Hütte aus Lehm und Rohr erbauten, nur mannshohen Innenwände von zwei Zimmern. Darüber gähnte das rußige Strohdach, geschwärzt von dem Herdrauch vieler Jahre, dem sich kein anderes Abzugsloch bot als eine Öffnung am First.
Von den Sparren herab hing das wasserdichte Zeug von Vater und Sohn für nächtliche Fahrten: die steifen, schweren Hosen und die Jacken, durch deren Ärmel ein Knüppel gesteckt war - grobe, gelbe Leinwand, die die vielen Einreibungen mit Öl glänzend gemacht hatten. Der durch das Loch im Dach hereinpfeifende Sturm schaukelte die seltsamen Puppen, deren fettige Außenseite die rote Herdglut widerspiegelte, und es schien, als hätten sich die beiden Bewohner der Hütte an ihren Balken aufgehängt.
Paloma langweilte sich. Er schwatzte gern, und in der Taverne konnte er nach Herzenslust fluchen und mit den andern Fischern räsonieren; zu Hause jedoch wußte er nicht, was er sagen sollte. Seine Worte verloren sich in einem erdrückenden, respektvollen Schweigen, denn der untertänige Sohn hatte nie etwas zu entgegnen. Der Alte pflegte dies beim Wein auf seine Weise zu erklären:
«Ein guter Junge, aber immer stumm, gar nicht wie ich! Meine Verstorbene muß mich irgendwie betrogen haben.»
Eines Tages wandte er sich an Toni mit der gebieterischen Miene des spanischen Vaters, der bei seinen Kindern keinen eigenen Willen anerkennt und über ihre Zukunft beschließt, ohne sie um ihre Meinung zu befragen.
«Du mußt heiraten! Im Haus fehlt eine Frau.»
Und Toni nahm diesen Befehl ebenso auf, als hätte der Alte ihn beauftragt, das große Boot klar zu machen, um in Saler einen Jäger aus Valencia abzuholen:
«Gut! Ich werde das so bald wie möglich in Ordnung bringen.»
Und während Toni auf eigene Faust suchte, machte sein Vater alle Gevatterinnen Palmars zu Mitwisserinnen dieser Absicht.
«Mein Junge wünscht sich zu verheiraten. Alles, was ich besitze, wird sein: die Hütte, das große Boot mit dem neuen Segel sowie das alte, das noch besser läuft; zwei Kähne und ein Haufen Netze. Dabei ist der Kleine arbeitsam, brav und dank einer guten Nummer bei der Auslosung frei vom Militärdienst. Schließlich keine große Partie, aber immerhin auch nicht nackt wie eine Pogge im Schlamm! Und für die Mädchen, die es in Palmar gibt …»