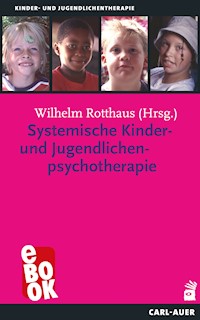
Systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kinder- und Jugendlichentherapie
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch lotet die Besonderheiten der systemischen Therapie mit Kindern bzw. Jugendlichen und ihren Familien gleich in mehreren Dimensionen aus: Es vermittelt wichtige Grundlagen im Hinblick auf Entwicklungspsychologie und -psychopathologie. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird in unterschiedlichen Settings wie stationärer, aufsuchender und Gruppentherapie beschrieben. Neue Wege zeigt die Kombination mit anderen therapeutischen Methoden, etwa der Spiel- oder Kunsttherapie, auf. Am deutlichsten sichtbar wird der systemische Ansatz, wo es um konkrete Anlässe für eine Therapie geht. ADHS, posttraumatische Belastungsstörungen, Legasthenie und Dyskalkulie, Sucht und delinquentes Verhalten werden jeweils in gesonderten Beiträgen von ausgewiesenen Experten behandelt. Mit Beiträgen von: Helmut Bonney, Kurt Ludewig, Siegfried Mrochen, Klaus Mücke, Mechthild Reinhard, Susy Signer-Fischer, Gunther Schmidt, Jochen Schweitzer-Rothers, Charlotte Wirl u. v. a.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
Wilhelm Rotthaus (Hrsg.)
Fünfte Auflage, 2021
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Umschlaggestaltung: Uwe Göbel
Satz: Drißner-Design u. DTP, Meßstetten
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Fünfte Auflage, 2021
ISBN 978-3-89670-526-6 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8287-0 (ePUB)
© 2001, 2021 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/
Wenn Sie Interesse an unseren monatlichen Nachrichten haben, können Sie dort auch den Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. + 49 6221 6438-0 • Fax + 49 6221 6438-22
Inhalt
Wilhelm Rotthaus
Zur Einführung: Systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie – eine Erweiterung der therapeutischen Handlungskompetenz
Allgemeine Aspekte
Gaby Derichs und Christoph Höger
Informierte Zustimmung: Eine ethische Herausforderung bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen
Michael Kusch
Entwicklungspsychopathologie
Systemische Kinderpsychotherapie
Wolfgang Burr
Wozu brauchen wir eine systemische Kindertherapie?
Siegfried Mrochen
Die Arbeit mit dem Kind im Kreise seiner FamilieÜberlegungen zu einer hypno-systemisch begründeten Kinderpsychotherapie
Charlotte Wirl
Das bedürftige Kind
Karl Heinz Pleyer
Systemische Spieltherapie – Kooperationswerkstatt für Eltern und Kinder
Systemische Jugendlichenpsychotherapie
Kurt Ludewig
„Junge Menschen lügen nicht, Erwachsene dagegen sehr.“Über den Umgang mit Selbstverständlichkeiten und Besonderheiten in der Therapie mit Jugendlichen
Jochen Schweitzer
Systemische Jugendlichenpsychotherapie: Ein Multi-System-Ansatz bei dissozialem, delinquentem und gewalttätigem Verhalten Jugendlicher
Sylvia Roderburg
Systemische Familientherapie bei Jugenddelinquenz
Joachim Hesse
Ressourcenförderung bei Jugendlichen mit Suchtproblemen
Klaus Mücke
Die schizophrene Krise als Lösungsversuch existenziell erlebter Loyalitätsambivalenz – Ein systemisches und entwicklungspsychologisches Erklärungsmodell
Stationäre systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
Gerhard Walter
Vom Problemland zum Lösungsland – Stationäre systemische Kinder- und JugendlichenpsychotherapieWie Kinder und ihre Familien den stationären Aufenthalt als Übergang erleben können
Ingo Spitczok von Brisinski
Ist die Zukunft das Land, das der Station gehört?Oder ist die Station das Land, das niemandem gehört?Ethnologische und politische Metaphern zur Kontextgestaltung stationärer systemischer Kinderpsychotherapie
Günther Geiken
Systemisch ressourcenorientierte Interventionen in der stationären Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Gunther Schmidt
Kompetente jugendliche Kunden und Familien als kotherapeutische Helfersysteme – das Hardberg-Modell einer stationären systemisch-hypnotherapeutischen Jugendlichen-Psychosomatik
Systemische Gruppentherapie
Filip Caby
Aspekte einer systemischen Gruppentherapie
Michael Reinhardt
Systemische Kunsttherapie in Gruppen
Spezielle Probleme und Settings
Helmut Bonney
Systemische Therapie bei ADHD-Konstellationen
Mechthild Reinhard
Legasthenie und Dyskalkulie – Mögliche Muster ihrer Selbstorganisation
Susy Signer-Fischer
Die Bedeutung der Erinnerung für das Individuum – Umgang mit traumatischen Erlebnissen
Dorothea Irmler
„Mein Zimmer hier heißt Schmerz“ Überleben und Leben – Systemische Therapie mit schwersttraumatisierten minderjährigen Flüchtlingen
Angelika Großmann
Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt – Familientherapie im aufsuchenden Setting
Über die Autoren
Zur Einführung: Systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie – eine Erweiterung der therapeutischen Handlungskompetenz
Wilhelm Rotthaus
In der systemischen Therapie nimmt die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als Indexpatienten einen großen Raum ein. Ihre Wirksamkeit gerade bei dieser Klientel ist inzwischen durch zahlreiche Studien bestätigt worden. Von den 27 kontrollierten Wirksamkeitsstudien, die in der „Stellungnahme zum Fragenkatalog ‚Psychotherapieverfahren‘ in Ergänzung zum Antrag auf Anerkennung der Systemischen Therapie“ von Günter Schiepek (1998) aufgeführt wurden, betrafen 18 Studien Kinder und Jugendliche, ggf. noch Heranwachsende, als identifizierte Patienten, während in sieben Studien Patienten aller Altersgruppen (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) die Problemträger waren. Bei zwei Studien handelte es sich um Paartherapien. Auch bei den dort referierten 32 nicht kontrollierten Studien waren in 14 Untersuchungen Kinder und Jugendliche die identifizierten Patienten, während es sich in 18 Studien wiederum um Patienten aller Altersgruppen handelte.
Ganz eindeutig steht die Behandlung der Kinder und Jugendlichen in ihrem relevanten System, sei es in der so genannten vollständigen Familie, in Teilfamilien, Stieffamilien, Pflegefamilien, Adoptivfamilien und sonstigen unterschiedlichen Lebensgemeinschaften wie auch Heimgruppen, im Vordergrund. Dies entspricht der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen und bietet den Vorteil mehrpersonaler Veränderungsimpulse im System.
Warum dann dieses Buch über systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie? Ist es nicht ein großer Fortschritt gewesen, die Familie oder das anders zusammengesetzte Problemsystem als Ganzes zu betrachten, die Beziehungen, die Muster, die handlungsleitenden Prämissen und Glaubenssätze in diesem System zu fokussieren und eben nicht das einzelne Mitglied, hier: das Kind oder den Jugendlichen? Führt es nicht zu einer Trennung und Spaltung, einer Gefährdung des einmal Erreichten, eine systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie zu postulieren?
Ohne Zweifel ist die System-Perspektive gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine heute nur noch schwer fortzudenkende Erweiterung der Verstehens- und Behandlungsmöglichkeiten. Und unzweifelhaft ist das Setting Familientherapie in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen die Methode der Wahl. Aber bei genauem Hinsehen fällt doch auf, dass es in diesem Setting zuweilen nicht besonders gut gelingt, die Kinder aktiv mit einzubeziehen. Gerade in Familien mit einer langen Problemgeschichte haben die Eltern oft ein hohes, auch verständliches Bedürfnis, ausführlich über die schlimmen Probleme mit dem Kind zu berichten; das Kind, der Sündenbock, sitzt dann häufig unglücklich daneben und schweigt. In anderen Familientherapien reden die Erwachsenen über das Kind in einer Sprache, die nicht die des Kindes ist und die ihm wenig Anschlussmöglichkeiten bietet. Zur stationären Therapie kommen Kinder und Jugendliche nicht selten nur als Besucher im Sinne von Steve de Shazer, seltener als Klagende, geschweige denn als Kunden.
Viele dieser nicht gelingenden Konstellationen haben damit zu tun, dass Therapeutinnen und Therapeuten zu wenig die anthropologisch und entwicklungspsychologisch begründeten Besonderheiten von Kindern und Jugendlichen berücksichtigen. In Abhängigkeit von Alter und Entwicklungsstand haben Kinder spezielle Formen und Wege des Kommunizierens. Ihre Sprache ist vorwiegend konkret, anschaulich und reich an Bildern. In ihren Gedanken sind sie (noch) freier und flexibler. Viele Kinder sind voll von kreativen Ideen, wenn man sie denn anzusprechen weiß. Kinder lieben Ausflüge in imaginäre Welten und schätzen es, eigene Gefühle, Ängste und Befürchtungen, Hoffungen und Erwartungen, eigene Schwächen und Stärken in Geschichten über Tier- und Menschengestalten gespiegelt zu sehen. Kinder verfügen häufig über sehr eigene Denkmuster und Bewältigungsstrategien. Ihre Motivation zur therapeutischen Arbeit hängt davon ab, ob es gelingt, ihre speziellen Kinder- und Jugendlichenressourcen anzusprechen und zu wecken.
Psychotherapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erfordert deshalb
– spezielle, vor allem entwicklungspsychologische und entwicklungspsychopathologische Kenntnisse und Erfahrungen,
– spezielle Haltungen und Einstellungen, beispielsweise resultierend aus der Wahrnehmung des Kindes und des Jugendlichen als eines gleichwertigen Partners, der zwar vieles noch nicht kann und nicht weiß, aber grundsätzlich das gleiche Recht auf Meinungsäußerung und Respekt hat wie der Erwachsene (vgl. Rotthaus 2000),
– spezielle pädagogische Kenntnisse und Erfahrungen,
– spezielle Kenntnisse und Erfahrungen sowohl im Bereich der typischen Auffälligkeiten des Kindes- und Jugendalters in Abhängigkeit von der jeweiligen Altersstufe als auch im Bereich der typischen Probleme und Konflikte im Lebensumfeld des Kindes und Jugendlichen sowie
– spezielle therapeutische Techniken und Vorgehensweisen.
Selbstverständlich basiert eine systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie auf denselben Grundannahmen wie die allgemeine systemische Psychotherapie. So trägt sie der Tatsache besonders Rechnung, dass Individuen sich sowohl aktuell als auch lebensgeschichtlich in einem Möglichkeitsraum verhalten, der durch die Handlungen der relevanten Bezugspersonen bestimmt wird. Die individuelle Entwicklung (z. B. die Entwicklung von Selbstkonzepten, von persönlicher Identität, von Kompetenzen u. a.) ebenso wie die Entstehung und Aufrechterhaltung von seelischen Krankheiten findet innerhalb sozialer Interaktionsprozesse und gegenüber relevanten Bezugspersonen statt.
Ebenso basiert die systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie auf einem Menschenbild, das sehr entschieden einen weiten Bogen spannt zwischen den Polen der Autonomie des Einzelnen auf der einen Seite und seiner Umweltabhängigkeit auf der anderen Seite. Beide Positionen werden in einer radikalen Deutlichkeit beschrieben: Die autopoietische Struktur jedes Lebewesens und die Tatsache, dass es nicht zielsicher beeinflusst werden kann, sind notwendige Voraussetzungen dafür, dass dieses Lebewesen nicht Manipulationen jedweder Art hilflos ausgesetzt ist, ist somit Voraussetzung für Identität und Identitätserleben auf der einen Seite. Zugleich aber wird auf der anderen Seite ebenso deutlich gemacht, dass das Lebewesen Mensch, gerade als ein Wesen mit Sprache, ohne Bezug auf den anderen nicht lebensfähig ist und dass es eine im Grunde unzulässige Abstraktion darstellt, den Menschen als Individuum zu denken. Erst in Bezug auf den anderen kann der Mensch Ich-Bewusstsein entwickeln. In der immer wieder unsicheren Balance zwischen diesen Polen Autonomie und soziale Gebundenheit entwickelt sich der „gesunde“ Mensch.
Eine weitere Basis der systemischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie ist die systemische oder, wie häufiger formuliert wird, interaktionistische Entwicklungspsychologie. Wichtige Vorläufer waren die Theorien von Jean Piaget und Heinz Werner, die Entwicklung als einen Konstruktionsprozess ansehen, der weitgehend selbstgesteuert ist. Beide Aspekte, die Selbstgestaltung und die Tatsache, dass all unsere Wirklichkeiten gemeinsame Konstruktionen sind, die grundsätzlich auch anders sein könnten, haben in der systemischen Theorie einen wichtigen Platz gefunden. Die Kernaussage der interaktionistischen Entwicklungstheorien besteht im Übrigen in der Antwort auf die Frage, ob der Mensch Produkt oder Gestalter seiner Umwelt sei. Interaktionistische Modelle nehmen an: Er ist beides. Sie billigen sowohl dem Entwicklungssubjekt als auch dem Entwicklungskontext gestaltende Funktionen zu. Als gemeinsame Annahme der in den Details durchaus differenten interaktionistischen Modelle formuliert Montada (Oerter u. Montada 1995, S. 9), „daß der Mensch und seine Umwelt ein Gesamtsystem bilden und daß Mensch und Umwelt aktiv und in Veränderung begriffen sind. Die Aktivitäten und die Veränderung beider Systemteile sind verschränkt. Die Veränderungen eines Teils führen zu Veränderungen auch anderer Teile und/oder des Gesamtsystems und wirken wieder zurück“.
Auch in ihren Vorstellungen über die Ätiologie von Problemverhaltensweisen und Krankheiten unterscheidet sich die systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie nicht. Schiepek schreibt dazu (1998, S. 77): „Die systemische Therapie setzt an ätiologisch zentralen Punkten der Entstehung und Aufrechterhaltung seelischer Krankheiten an … Zu unterscheiden ist dabei zwischen Langzeitgenese und Aktualgenese, wobei sich die Langzeitgenese auf die historisch-biografische Entwicklung einer seelischen Krankheit bezieht …, die Aktualgenese dagegen auf die gegenwärtigen Stabilitätsbedingungen des als ‚krank‘ bezeichneten biopsychosozialen Funktionsmusters. Solche Funktionsmuster spielen – im Sinne der Synergetik – die Rolle von Ordnern, welche die Verhaltensmöglichkeiten eines Individuums bzw. die Beziehungsgestaltung eines Paares oder einer Familie gestalten und auch restringieren … Die Stabilisierung pathologischer Funktionsmuster beruht u. a. darauf, daß diese Muster Verhaltensspielräume einengen, die zu weiteren Restriktionen führen und schließlich auch das Selbstkonzept und die Verhaltenserwartungen eines Individuums bzw. einer Personengemeinschaft in entsprechender Weise prägen. Ätiologisch gesehen indiziert sind daher Interventionen, die dazu geeignet sind, Handlungsspielräume zu erweitern und auch kognitiv einen flexibleren Umgang mit verhaltensprägenden Konzepten zu ermöglichen. Es gilt, neue und alternative Verhaltens-, Erlebnis- und Wahrnehmungsweisen zu entwickeln … Ein Rückgriff auf die Vergangenheit hat dann Sinn, wenn damit Bedingungen für die Neuentwicklung von Funktionsmustern geschaffen werden, z. B. durch die Aktivierung alter Ressourcen oder durch die Lösung (Verbindung) bestehender emotionaler Bindungen … Die Orientierung an der Zukunft hat in diesem Ätiologiemodell nicht nur therapietechnische Bedeutung, sondern ist für die Selbstorganisation biopsychosozialer Funktionsmuster von grundsätzlichem Stellenwert …“
Schließlich zeichnet sich auch die systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie durch ihre Offenheit für Handlungsansätze aus anderen psychotherapeutischen Verfahren aus. Sie stellt, wie Schiepek es ausdrückt (1998, S. 225), „für den Ansatz spezifischer Methoden anderer Therapierichtungen günstige Bedingungen und Voraussetzungen bereit …“, sodass förderliche, den Wirkungsgrad steigernde Synergieeffekte zu erwarten sind. „Die Orientierung an Anliegen und Auftrag, an Ressourcen und Kompetenzen des/der Patienten“, so fährt Schiepek fort, „sowie die Berücksichtigung und evtl. der Einbezug relevanter sozialer Systeme macht spezifische Techniken, z. B. solche der verhaltenstherapeutischen Angstbehandlung und der Suchtbehandlung, besonders effektiv.“
Diese Offenheit der systemischen Therapie für Elemente aus anderen Therapieverfahren basiert auf einer radikalen Relativierung von Objektivität und der Überzeugung, dass alle Wirklichkeiten Konstruktionen sind, die grundsätzlich auch anders sein könnten. Das bedeutet, dass alle Prämissen und Festlegungen – auch die, die durch Sprache erfolgen – hinterfragt werden müssen, was selbstverständlich auch die eigene „Lehre“ betrifft. Dieser Verzicht auf Objektivität und Wahrheit impliziert eine Haltung des Respekts vor dem anderen, dessen Ansichten, Ideen und Wirklichkeitskonstruktionen prinzipiell die gleiche Berechtigung haben wie die eigenen. Im Hinblick auf Psychotherapie bedeutet das, dass die Klärung des Anliegens und die gemeinsame Erarbeitung eines Auftrags mit klar definiertem Ziel und erkennbaren Merkmalen der Zielerreichung Grundlage jeder Therapie sein müssen. Abgeleitet aus dem Prinzip der Autonomie hat der Begriff „Verantwortung“ und die Beachtung der unterschiedlichen Verantwortungsbereiche der am therapeutischen Prozess beteiligten Personen für mich hohe Bedeutung bekommen.
Systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie basiert also auf demselben theoretischen Fundament wie die allgemeine systemische Therapie und setzt dieselben Vorgehensweisen und Techniken ein. Darüber hinaus erfordert sie, wie oben dargestellt, spezielle Erfahrungen und Kenntnisse über die Besonderheiten von Kindern und Jugendlichen in Abhängigkeit von ihrem Entwicklungsalter sowie über spezielle Techniken, beispielsweise den Einsatz von Medien, die den Zugang zu Kindern erleichtern, wie Puppen oder Märchen. Dazu haben beispielsweise Trana, Johannesen und Rieber (2000) sowie King (2000) sehr anschauliche Vorschläge gemacht. Viele Anregungen findet man zudem in dem Band „Kinderleichte Lösungen“ (Vogt-Hillmann u. Burr 1999). Mit einer Fülle an Beispielen stellen Jennifer Freeman, David Epston und Dean Lobovits (2000) dar, wie man narrative Systemtherapie in spielerischer Weise mit Kindern durchführen kann, wenn man die Einzigartigkeit ihrer Sprache und ihrer Problemlösungsmuster nutzt, Puppen als Ko-Therapeuten einsetzt, sie zur Externalisierung des Problems anregt oder sie Unterstützung bei Fantasiefreunden suchen lässt. Die systemisch-hypnotherapeutischen Methoden nutzen die Nähe kindlichen Denkens zu magisch-mythischen Imaginationen und damit die besondere Fähigkeit von Kindern zur Utilisation autosuggestiver Vorstellungen (vgl. Mrochen, Holtz u. Trenkle 1997).
Grundsätzlich wird in der systemischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie großer Wert gelegt auf die Stärkung des Selbstwertgefühls und die Förderung der Selbstverantwortung. Michael White (1990) nutzt dafür den Einsatz von Briefen und Urkunden, und Michael Durrant (1996) hat viele bestechende Ideen zusammengetragen, wie man der Tatsache begegnen kann, dass üblicherweise bei ambulanter und stationärer Therapie das Versagen Thema der Gespräche ist, und wie man stattdessen dafür sorgen kann, einen Kontext des Gelingens, einen Kontext der Kompetenz zu schaffen, statt „problem-talk“ und „solution-talk“ zu führen. In der stationären Therapie von Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die systemische Perspektive sehr geeignet sowohl für das therapeutische als auch das pädagogische Konzept, was ich vielfach versucht habe darzustellen (u. a. Rotthaus 1997, 1999a, 1999b, 2000). Ein entscheidender Gewinn – neben den oben aufgeführten – liegt in der Bereitstellung eines konsistenten Rahmenmodells, innerhalb dessen Vielfältigkeit erwünscht ist und unterschiedliche therapeutische Handlungsstrategien auch aus anderen Therapieschulen eingesetzt werden.
Generell ist die systemische Therapie mit Kindern und Jugendlichen – die therapeutische Praxis bestätigt dies ganz offensichtlich – aus folgenden Gründen besonders geeignet:
1. Sie wendet sich nicht nur an den identifizierten Patienten, sondern bezieht die Familienmitglieder bzw. die Bezugspersonen als Ressourcenpersonen mit in die Behandlung ein – sei es im Mehrpersonen-Setting, sei es im Einzelkontakt gedanklich-imaginierend.
2. Sie stellt geringe Anforderungen an die Kommunikationsund Reflexionskompetenzen der jungen Patienten, weil es für Kinder und Jugendliche relativ einfach ist, über Beziehungen zwischen vertrauten Personen zu sprechen.
3. Sie richtet aufgrund ihrer Kontextorientierung sehr viel Aufmerksamkeit auf die Gestaltung eines förderlichen Lebensraumes, um Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Kinder und Jugendliche sich angemessen entwickeln können, wodurch sich lange Einzeltherapien häufig erübrigen.
4. Sie entspricht mit ihrer ausgeprägten Zukunftsorientierung der Lebensorientierung von Kindern und insbesondere von Jugendlichen.
5. Sie konfligiert mit ihrer kurzzeittherapeutischen Ausrichtung am wenigsten mit den Entwicklungsaufgaben des Jugendalters, die Eigenständigkeit, Autonomie und vor allem Erwachsenenunabhängigkeit einschließen.
Wie bereits gesagt, findet systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in weitem Umfang als Familientherapie statt. Wünschenswert ist jedoch eine hohe Flexibilität der TherapeutInnen in der Gestaltung des Settings im Verlaufe einer Therapiestunde und im Verlaufe der Gesamtbehandlung. So kann es sich oft empfehlen, das Gespräch mit der ganzen Familie zu beginnen, dann aber eine Trennung vorzunehmen, indem eine Therapeutin mit dem Kind allein in einem Nebenraum spricht, während eine andere das Gespräch mit den Eltern weiterführt, um gegen Ende noch einmal zusammenzukommen. Im Therapieverlauf können reine Geschwistergespräche, Einzelgespräche mit dem Kind oder Jugendlichen vor den Eltern als Zuhörer, reine Elterngespräche und auch Paartherapien, Einzeltherapien mit dem Kind oder eher noch dem Jugendlichen mit einigen begleitenden Elterngesprächen, systemische Gruppentherapien mit Kindern und Jugendlichen, Reflecting-Teamsitzungen in unterschiedlicher Besetzung o. Ä. sinnvoll sein.
Der vorliegende Band soll Anregungen für die systemische Therapie mit Kindern und Jugendlichen als Indexpatienten bieten, nicht zuletzt aber auch die Leser anregen, selbst aktiv kreative Lösungen zu suchen. Es gibt noch viele Entwicklungsmöglichkeiten und – notwendigkeiten. Wenn es gelungen ist, beide Aspekte aufzuzeigen, ist die wichtigste Aufgabe vielleicht schon erfüllt.
Die Beiträge der Autorinnen und Autoren zeigen ein sehr unterschiedliches Realisierungsniveau zwischen einem angestrebten konkreten Praxisbezug und einer notwendigen theoretischen Reflexion. Ich hoffe, dass eine gute Mischung, eine angemessene Vielfalt gelungen ist. Bei der Frage der weiblichen und männlichen Schreibweise wurden die individuellen Lösungen der Autorinnen und Autoren übernommen und keine Einheitlichkeit angestrebt.
LITERATUR
Durrant, M. (1996): Auf die Stärken kannst Du bauen. Lösungsorientierte Arbeit in Heimen und anderen stationären Settings. Dortmund (Modernes Lernen).
Freeman, J., D. Epston u. D. Lobovits (2000): Ernsten Problemen spielerisch begegnen. Narrative Therapie mit Kindern und ihren Familien. Dortmund (Modernes Lernen). [am. Orig. (1997): Playful approaches to serious problems. Narrative therapy with children and their families. New York (Norton).]
King, B. (2000): Frau Meier, die Trauergiraffe. Ein Konzept zur Arbeit mit Handspielpuppen vor dem Hintergrund systemischer Ideen. Zeitschrift für systemische Therapie 18: 216–223.
Mrochen, S., K.-L. Holtz u. B. Trenkle (1997): Die Pupille des Bettnässers. Hypnotherapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Heidelberg (Carl-Auer-Systeme).
Oerter, R. u. L. Montada (Hrsg.) (1995): Entwicklungspsychologie. Weinheim (Psychologie Verlags Union).
Rotthaus, W. (1997): Fünfzehn Jahre systemische Kinder- und Jugendpsychiatrie. Versuch einer Bilanz. heilpädagogik 40 (4): 22–31.
Rotthaus, W. (1999a): Stationäre systemische Kinder- und Jugendpsychiatrie (2. Aufl.). Dortmund (Modernes Lernen).
Rotthaus, W. (1999b): Kundenorientierung in der stationären systemischen Therapie. Vom Kontext des Versagens zum Kontext der Kompetenz. In: M. Vogt-Hillmann u. W. Burr (Hrsg.): Kinderleichte Lösungen. Dortmund (Borgmann), S. 159–170.
Rotthaus, W. (2000): Wozu erziehen? Entwurf einer systemischen Erziehung (3. Aufl.). Heidelberg (Carl-Auer-Systeme).
Schiepek, G. (1998): Stellungnahme zum Fragenkatalog „Psychotherapieverfahren“ in Ergänzung zum Antrag auf Anerkennung der Systemischen Therapie. [überarb. in G. Schiepek (1999): Grundlagen der Systemischen Therapie. Theorie – Praxis – Forschung. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht).]
Trana, H., T. Johannesen u. H. Rieber (2000): Die reflektierenden Handpuppen. Ein neuer Weg der Kommunikation mit Kindern in der Familientherapie. Zeitschrift für systemische Therapie 18: 68–80.
Vogt-Hillmann, M. u. W. Burr (Hrsg.) (1999): Kinderleichte Lösungen. Lösungsorientierte kreative Kindertherapie. Dortmund (Borgmann).
White, M. u. D. Epston (1990): Die Zähmung der Monster. Literarische Mittel zu therapeutischen Zwecken. Heidelberg (Carl-Auer-Systeme).
Allgemeine Aspekte
Informierte Zustimmung: Eine ethische Herausforderung bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen
Gaby Derichs und Christoph Höger
Einleitung
Historische Entwicklung von Kinderrechten
Entwicklungspsychologische Einflüsse auf den Entscheidungsprozess und korrespondierende ethische Anforderungen
Kognitiver Entwicklungsstand
Emotionale Verfassung
Persönlichkeitsentwicklung
Art und Ausmaß der Störung des Kindes oder Jugendlichen
Sozialer Kontext
Aspekte des Entscheidungsprozesses
Informierte Zustimmung als Prozess
Das Problem der Macht
Therapeutische Schlussfolgerungen
Fallbeispiel
Problemkonstellation
Entwicklung einer gemeinsamen Basis für den Entscheidungsprozess
Informierte Zustimmung zur Therapie
Zusammenfassung
Literatur
EINLEITUNG
Ethische Aspekte der Psychotherapie rücken in letzter Zeit zunehmend in den Blickpunkt des Interesses. Dazu liefern die von Beauchamp und Childress (1994) formulierten bioethischen Prinzipien eine gute Orientierungshilfe; sie lauten:
1) Respekt vor der Autonomie,
2) Hilfe leisten,
3) Schaden vermeiden,
4) Gerechtigkeit walten lassen.
In den folgenden Ausführungen soll der Fokus auf einem Teilaspekt des Prinzips „Respekt vor der Autonomie der Patienten“ liegen: der informierten Zustimmung („informed consent“) zu einer Therapie. Eich, Reiter und Reiter-Theil (1997) verstehen darunter das „Einverständnis zu einer Heilbehandlung durch den Patienten bzw. Klienten, nachdem wesentliche Informationen über Art, Risiken und Ziele der Behandlung sowie über adäquate Alternativen mitgeteilt und verstanden worden sind“. Heigl-Evers und Heigl (1989) fügen diesen Kriterien noch die Pflicht zur Information über Diagnose, Therapieindikation und Prognose hinzu. Sie plädieren dafür, das Erarbeiten der informierten Zustimmung der Patienten nicht nur als eine ideelle Forderung anzusehen; sie trage auch wesentlich zum Aufbau und Erhalt einer konstruktiven therapeutischen Beziehung und dadurch zur Effektivität einer Therapie bei.
Bei der informierten Zustimmung zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen ergeben sich aber grundlegende Fragen:
1) Verfügen Minderjährige über die notwendigen Fähigkeiten, die an sie herangetragenen Informationen entsprechend zu verstehen und zu verarbeiten?
2) Welchen Einfluss haben Art und Ausmaß der Störung des Kindes auf seine Einwilligungsfähigkeit?
3) Wie autonom können Kinder und Jugendliche überhaupt in ihrem sozialen Kontext sein?
4) Welche Bedeutung wird einem Therapieangebot von den Beteiligten zugeschrieben?
5) Wer trägt letztendlich die Verantwortung für die Zustimmung oder Ablehnung eines Therapieangebots?
Wir werden solchen Fragen vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung von Kinderrechten sowie der entwicklungspsychologischen Beurteilung von Kompetenzen, Bedürfnissen und psychosozialen Lebensumständen von Kindern nachgehen und dabei besondere Probleme und Möglichkeiten der Informationsvermittlung und der Entscheidungsfindung aufzeigen.
HISTORISCHE ENTWICKLUNG VON KINDERRECHTEN
Auf die historische Entwicklung von Kinderrechten soll hier nur zusammenfassend eingegangen werden (ausführliche Literaturangaben finden sich in Hungerige u. Päßler 1999); dabei wird nach einem kurzen allgemeinen Teil eine Verbindung zur Thematik der informierten Zustimmung hergestellt. Die speziellen Rechte von Kindern rückten erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts ins Blickfeld. Indem im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auf die unantastbare Würde des Menschen abgehoben wird, steht auch Kindern das Recht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu. Das Recht auf Autonomie erfährt nur da seine Einschränkung, wo es um den Schutz elementarer Rechte für das Individuum selbst oder für andere geht. Beispielsweise ist eine Freiheitseinschränkung des Kindes oder Jugendlichen im Rahmen einer stationären Aufnahme nach dem § 1631b BGB ohne dessen Zustimmung nur mit richterlicher Erlaubnis möglich (Amelung 1996). Das Kinder- und Jugendhilfegesetz von 1991 ermöglicht differenzierte Hilfen für Bezugspersonen bezüglich der gesunden und autonomen Entwicklung für Kinder und Jugendliche. Im neuen Kindschaftsrecht von 1998 wird ausdrücklich das Recht der Kinder auf Kontakt zu beiden Elternteilen betont, während in frühen Gesetzestexten eher der Schwerpunkt auf den elterlichen Rechten und Pflichten (§1626) lag.
In der 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedeten „Konvention über die Rechte des Kindes“ wird ein individuelles Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Religionsfreiheit, auf eine geschützte Intimsphäre, auf soziokulturelle Rechte, auf Gesundheit, Familienplanung und Bildung festgeschrieben. Kindheit wird als Entwicklungsprozess betrachtet, in dem das Kind vor schädlichen Einflüssen geschützt und in seiner Autonomie gestärkt werden soll.
Philosophisch betrachtet vollzieht sich somit ein Wandel vom Paternalismus mit der Vorstellung, „die Erwachsenen wissen a priori, was für die Kinder gut ist“, zu einem demokratischeren Verständnis. Dabei erhält die Entscheidungsautonomie von Kindern und Jugendlichen mehr Gewicht, während die Erwachsenen eher die Aufgabe haben, die Kinder vor gravierendem Schaden zu bewahren. Ein solcher Schaden könnte dann drohen, wenn es den Minderjährigen z. B. noch an dem notwendigen Überblick über die längerfristigen Folgen ihrer Entscheidung fehlen sollte. Die frühere Vorrangigkeit des Prinzips „das Beste für Kinder tun“ tritt im Laufe der Entwicklung hinter dem Primat des „nil nocere“ zurück.
Der Nürnberger Kodex, der 1947 während der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse gegen NS-Ärzte entwickelt wurde, beschrieb erstmals auf internationaler Ebene das zentrale Konzept des „informed consent“ als Voraussetzung für ethisch verantwortbare medizinische Forschung am Menschen. 1976 wurden vom Europaparlament in Straßburg allgemeine Kriterien für die Rechte von Patienten aufgestellt, die Maßstäbe über Information vor einer Therapie und die Forderung nach Zustimmung von Patienten zur Behandlung beinhalten.
Bezogen auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen weisen Reder und Fitzpatrick (1998) auf die wachsende Autonomie eines Kindes mit zunehmender Reife hin, wobei genaue Altersgrenzen für die rechtliche Festlegung von Entscheidungsfreiheit und entsprechender Verantwortung nicht klar zu definieren sind. Entsprechend gibt es weder in der nationalen noch in der internationalen Gesetzgebung allgemein verbindliche Altersangaben zur Einwilligungsfähigkeit (vgl. Koch, Reiter-Theil a. Helmchen 1996). Parallel zum Ausbau der Rechte von Kindern und Jugendlichen wächst deren Verantwortung für wichtige Entscheidungen in ihrem Leben. Jugendliche sind nicht nur mit 14 Jahren strafmündig, sondern sind auch gefordert, ethische Entscheidungen (z. B. Abtreibung bei einer Schwangerschaft) mit zu treffen. Auch im Hinblick auf Zustimmung oder Ablehnung einer Therapie wird unter Umständen die Mitentscheidung von Kindern ab sieben Jahren, spätestens aber ab zwölf Jahren erwartet. Jugendlichen wird Eigeninitiative beim Aufsuchen einer Therapeutin zugestanden und im Gegenzug ein hohes Maß an Entscheidungsarbeit bezüglich der Zustimmung oder Ablehnung von Therapie abverlangt (Morrison, Morison a. Holdridge-Crane 1979).
Schowalter (1978) weist darauf hin, dass Behandlung einen Vertrag zwischen Therapeuten und mündigen Patienten voraussetzt. Minderjährige sind juristisch deshalb nicht berechtigt, einen solchen Vertrag allein abzuschließen. Unter therapeutischen und ethischen Gesichtspunkten sind sie aber stets in Abhängigkeit von ihrem Entwicklungsstand, dem Grad ihrer Eigenständigkeit in ihrem sozialen Umfeld und dem Ausmaß der Behandlungsbedürftigkeit neben den juristisch verantwortlichen Bezugspersonen an der Kontraktbildung zu beteiligen (vgl. Corder, Haizlip a. Spears 1976; Langer 1985; Lewis 1982; Miller 1977).
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE EINFLÜSSE AUF DEN ENTSCHEIDUNGSPROZESS UND KORRESPONDIERENDE ETHISCHE ANFORDERUNGEN
Entwicklungspsychologen wie Bühler (1911/1967) oder Stern (1920) gingen davon aus, dass auch Vorschulkinder unter bestimmten Bedingungen zu schlussfolgerndem Denken fähig seien. Piaget (1969) betonte dagegen in seinen Ausführungen eher die Defizite von Kindern unter elf bis zwölf Jahren in Bezug auf ihre intellektuellen Fähigkeiten und bestimmte damit lange Zeit die Fachmeinung über die kognitive Entwicklung von Kindern. Diese einseitige und zum Teil falsche Einschätzung der Fähigkeiten jüngerer Kinder wurde in den vergangenen 20 Jahren revidiert: Entwicklungspsychologen wiesen erneut auf besondere Kompetenzen der Kinder im Vorschulalter zu schlussfolgerndem Denken hin (Donaldson 1982; Goswami 1992; Oerter u. Montada 1995). Je nach ihrem erworbenen Erfahrungsschatz und dem Abstraktionsgrad der vorgegebenen Aufgaben können Kinder demnach schon früh Zusammenhänge erschließen oder Konsequenzen ableiten. Sie sind also grundsätzlich auch in der Lage, altersentsprechend dargebotene Informationen zu Therapieart, Therapiezielen und -risiken zu verstehen.
Im Einzelnen wird die Materie jedoch komplex, wenn Probleme der Informationsverarbeitung und des Entscheidungsprozesses im Hinblick auf Zustimmung oder Ablehnung einer Behandlung genauer analysiert werden. Reiter-Theil, Eich und Reiter (1993) verwenden für die Beschreibung einer schrittweisen Vorbereitung von informierter Zustimmung durch die Kinder und Jugendlichen ein Modell von Faden und Beauchamp, das diesen Prozess untergliedert in Aufnahme der notwendigen und hinreichenden Information in einer dem Entwicklungsstand des Kindes angemessenen Weise, Verstehen des dargebotenen Informationsmaterials sowie dessen Verwendung, die durch sozialpsychologische Variablen wie entwicklungstypische Abhängigkeit von Autoritäten eingeschränkt sein kann. Reder und Fitzpatrick (1998) greifen von Pearce (1994) aufgeführte Voraussetzungen für eine informierte Zustimmung auf und fordern deren genauere Überprüfung: „… a clear concept of themselves in relation to others, including an ability to recognize their own needs and the needs of others; an ability to understand the nature of the disorder and how and why treatment is considered necessary; an ability to understand the significance of the risks and benefits of not having the treatment; and an ability to understand these issues in relation to time.“ Pearce bezieht zudem die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung und der Arzt-Patient-Beziehung sowie die protektiven oder belastenden Beziehungen des Kindes zu anderen Personen (z. B. auch spezifische Konfliktkonstellationen) in die Erhebung der grundlegenden Variablen für die Validität einer informierten Zustimmung mit ein.
Wir möchten im Folgenden eine eingehendere Betrachtung unter den Aspekten kognitiver Entwicklungsstand, emotionale Verfassung, Persönlichkeitsentwicklung, Art und Ausmaß der Störung und sozialer Kontext vornehmen. Wir werden jeweils Vorschläge machen, wie fachlich auf diese Entwicklungsaspekte eingegangen werden kann, um dem Ziel der Achtung vor der Autonomie des Kindes unter Berücksichtigung seines Entwicklungsstandes und seines Anrechts auf Hilfe und Schadensvermeidung näher zu kommen.
Kognitiver Entwicklungsstand
Intakte Wahrnehmungsfähigkeiten stellen eine unabdingbare Voraussetzung für interaktives Lernen dar. Dabei steigt im Laufe der Entwicklung die Unterscheidungsfähigkeit; Aufnahme- und kritische Verarbeitungsmöglichkeiten nehmen zu. Kleinkinder erproben immer mehr ihren eigenen Willen, sie können Vergleiche anstellen, sehen Unterschiede zwischen ihren Bedürfnissen und dem Verhalten anderer und entwickeln allmählich die Fähigkeit, sich auch nicht direkt gegenwärtige Personen und Dinge vorzustellen. Sie lernen erste kausale Verknüpfungen und wägen oft schon intuitiv ab, ob sich ihre Anstrengungen, etwas zu tun, auch lohnen werden (Bullock 1979; Oerter u. Montada 1995). Oft schon vor dem Schuleingangsalter können sie sich in die Rolle anderer hineinversetzen, deren Bedürfnisse und Argumente verstehen und sich kritisch damit befassen („Theory of mind“ in Oerter u. Montada 1995).
Mit steigendem Alter können Kinder mehr Reize verarbeiten, zum Teil parallel oder auch in schneller Abfolge. Der verkraftbare Komplexitätsgrad in der Informationsvermittlung hängt aber auch von der Möglichkeit ab, an gesichertes Wissen anknüpfen zu können: Bekannte Informationen können zügig aufgenommen, mit dem vorhandenen Wissen abgeglichen und dann mit neuen Inhalten ergänzt werden, wenn diese einigermaßen nahtlos eingefügt werden können. Völlig neue oder auch den bisherigen Erfahrungen widersprechende Informationen können dagegen nur in Maßen aufgenommen und verarbeitet werden. Der Aufbau innerer Kognitionen bei Kindern setzt sich fort, wenn sie zunächst den vertrauten, später auch außerfamiliären Bezugspersonen bestimmte Einstellungen, Urteile oder Gefühle attribuieren und daran ihr Verhalten und ihren Selbstwert orientieren.
Thompson (1990) hat in diesem Kontext entwicklungsabhängige sensible Punkte aufgeführt, die in der diagnostischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu respektieren sind, wenn deren Integrität und Autonomie gewahrt werden sollen:
1) Je jünger die Kinder sind, umso größer ist die Gefahr von irritierenden Erfahrungen bei einer Vorstellung in psychosozialen Einrichtungen.
2) Mit steigendem Alter erwerben Kinder ein umfassendes Selbstbild, suchen nach überdauernder Identität und brauchen dazu das feinfühlige Verständnis der für sie relevanten Bezugspersonen (Beurteilungen durch Eltern und Therapeuten).
3) Mit steigendem Alter wächst das Bedürfnis, sich mit Gleichaltrigen zu messen, damit auch die Empfindsamkeit gegenüber Zuschreibung von Krankheit oder Auffälligkeiten.
4) Im Alter von acht bis zwölf Jahren differenzieren sich Vorstellungen von Motiven, Einstellungen und emotionaler Befindlichkeit anderer. Kinder bemühen sich um die Erfüllung der Erwartung relevanter Bezugspersonen und geraten unter Spannung bei sich davon unterscheidenden autonomen Bewertungen.
5) Emotionen wie Scham und Schuldgefühle werden von kleineren Kindern generalisiert und erst von älteren Kindern situationsspezifisch erlebt.
6) Jüngere Kinder sind aufgrund ihrer Abhängigkeit anfällig gegenüber manipulativen Eingriffen Erwachsener.
7) Mit steigendem Alter wächst der Umfang privater Interessen und Bedürfnisse. Der Respekt davor bildet eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau eines tragfähigen Selbstbildes.
8) Mit steigendem Alter wächst die Sensitivität von Kindern und Jugendlichen gegenüber kulturellen, sozioökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen, ebenfalls ein wichtiger Baustein für den Aufbau des Selbstbildes im Kontext der psychosozialen Bedingungen.
Die Beachtung dieser Punkte stellt eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau einer positiven therapeutischen Beziehung dar (vgl. Reder u. Fitzpatrick 1998). Wenn wir mit Kindern kommunizieren möchten, müssen wir uns zuerst vergewissern, ob sie uns ihre Aufmerksamkeit überhaupt schenken, ob sie aufnahmebereit sind, welche Wahrnehmungsinhalte sie mehr oder weniger genau verarbeiten können und welcher Wahrnehmungskanal gerade von ihnen bevorzugt wird. Grundsätzlich gilt, dass Kinder vermehrt nichtsprachliche Signale auffassen, unabhängig davon, ob sie schon der Sprache mächtig sind oder nicht.
Bei verbalen Äußerungen sollten wir vom Sprachniveau und insbesondere vom Sprachmilieu des Kindes ausgehen, ohne dass wir es imitieren müssten. Wir haben aber darauf zu achten, über welchen Wortschatz ein Kind verfügt, wenn wir uns ihm verständlich machen wollen. Wir sollten uns vergewissern, ob die gebrauchten Begriffe für das Kind eine ähnliche Bedeutung haben wie für uns, und dazu gegebenenfalls auch die Bezugspersonen als Dolmetscher einbeziehen. Bei längeren Ausführungen ist auf die zum Teil noch geringe Speicherkapazität von Kindern zu achten. Das bedeutet: keine langen Monologe ohne ständige Rückkopplung mit dem Kind. Sonst wird es uns nicht lange zuhören! Sattler (1982) formulierte kognitive Faktoren, die in diesem Zusammenhang über standardisierte Leistungstests bei Kindern gemessen werden können: Wissen, Offenheit und Aufmerksamkeit für die Umwelt, Fähigkeit zur Konzeptbildung, Ideenreichtum (Kreativität), Problemlösungsfähigkeit, soziale Urteilsfähigkeit, Fähigkeit, bestimmte Situationen zu analysieren bzw. Einzelheiten in größere Zusammenhänge einzuordnen (Synthese), Fähigkeit zur Aufnahme verschiedener Wahrnehmungsinhalte, Merkfähigkeit und Fähigkeit, das gespeicherte Wissen abzurufen und in späteren Situationen adäquat einzusetzen, sowie Planungsfähigkeit (vgl. Towbin 1995). Die Durchführung spezieller Testverfahren ist zur Prüfung der kognitiven Voraussetzungen eines Kindes für seine Fähigkeit, sich kompetent zu entscheiden, zwar nicht zwingend notwendig, vorhandene Untersuchungsergebnisse sollten aber zur Beurteilung herangezogen werden.
Wenn wir ein Kind über den möglichen Nutzen und die möglichen Gefahren einer Therapie aufklären möchten, sollten wir seine kognitiven Möglichkeiten beachten und uns in der Kommunikationsform auf unser Gegenüber einstellen. Ebenso wichtig ist es, sich zu informieren, welche Vorstellungen das Kind von den (meist von den Bezugspersonen beschriebenen) Problemen hat, wie es diese Probleme erklärt und welches Maß an Änderungsmotivation es deutlich machen kann.
Emotionale Verfassung
Ob wir davon überhaupt etwas, beziehungsweise wie viel wir erfahren, ist aber nicht nur eine Frage des kognitiven Entwicklungsstandes eines Kindes, sondern auch seines emotionalen Befindens. Das Aufsuchen eines Therapeuten oder einer Therapeutin entspricht einer außergewöhnlichen Situation. Veränderte Räumlichkeiten, ein anderes Verhalten der Eltern und die Begegnung mit fremden Menschen können Kinder ebenso verunsichern wie ermutigen, in ihrer Kommunikationsfähigkeit öffnen oder auch verschließen. Manche Kinder reagieren ängstlich, andere wiederum neugierig. Verlockende Spielsachen in der neuen Umgebung können das eine Kind begeistern, das andere jedoch beschämen (z. B. wenn es das alles zu Hause nicht hat). Wenn wir bewusst mit allen Beteiligten versuchen, Kontakt herzustellen, sie als eigenständige Persönlichkeiten zu achten und ihre jeweiligen Bedürfnisse in dieser Begegnung zu respektieren, tragen wir unseren Teil zu einer förderlichen Atmosphäre als Grundlage für angemessene Informations- und Entscheidungsprozesse bei (Reiter-Theil, Eich u. Reiter 1993). Besonders nonverbale, oft auch kaum bewusste und nur wenig überlegte Botschaften sind zu beachten; sie prägen die Atmosphäre und fördern oder blockieren die Kommunikation mit den Kindern vom ersten Augenblick an.
Persönlichkeitsentwicklung
Kinder begegnen uns mit ihrem ureigenen Temperament und mit einer bereits mehr oder weniger ausgebildeten individuellen Identität. Sie haben zumindest implizit ein Bild von sich. Sie bringen Bedürfnisse und Wünsche, Erwartungen oder Befürchtungen mit, die in der aktuellen Interaktion darauf ausgerichtet sind, ihr Selbstbild zu bestätigen oder es in einer von ihnen erwünschten Richtung zu verändern. Solche Motivationen sind meist nicht auf Anhieb zu erkennen. Sie lassen sich im Laufe des Kontaktes oft nur erschließen, müssen dann aber offen angesprochen und überprüft werden, wenn es nicht zu ungerechtfertigten Unterstellungen, Missverständnissen und so zu Kommunikationshindernissen kommen soll (Oerter u. Montada 1995; Specht 1993).
Art und Ausmaß der Störung des Kindes oder Jugendlichen
Psychische Störungen von Kindern und Jugendlichen können vorübergehend oder anhaltend alle beschriebenen Entwicklungsbereiche beeinflussen. Die Kommunikation im therapeutischen Feld muss sich fachkompetent daran ausrichten. Das kann bedeuten, dass das Kommunikationsniveau verändert, der Umfang der Wissensvermittlung der augenblicklichen Verarbeitungskapazität angepasst, das Setting variiert oder erst andere Voraussetzungen für ein angemessenes Informations- und Entscheidungsgespräch geschaffen werden müssen. Dies gilt insbesondere für Ratsuchende, mit denen aufgrund ihrer Störung aktuell kein konstruktives Gespräch möglich oder bei denen sofort verantwortliches Handeln zum Schutz von Leib und Leben erforderlich ist. Solche Situationen sind oft nicht einfach zu bewältigen, da ein ethisches Dilemma zwischen den gleichrangigen Prinzipien der Achtung der Autonomie einerseits und der Notwendigkeit der Hilfegewährung und der Schadensvermeidung andererseits bestehen kann (z. B. Höger u. a. 1997). Aber auch solche Notwendigkeiten entheben nicht von der Verpflichtung, die wesentlichen Informationen baldmöglichst nachzuliefern und die Erörterung von Zustimmung oder Ablehnung der weiteren Therapieschritte zu gegebener Zeit zu versuchen (Green a. Stewart 1987; Kanzow 1994; Knölker 1997; Koch, Reiter-Theil a. Helmchen 1996; Towbin 1995).
Sozialer Kontext
Kinder lernen nach und nach, die Ressourcen ihrer sozialen Umgebung zu nutzen, aber auch, sich allmählich mehr oder weniger davon zu emanzipieren. Viel mehr als Erwachsene sind Kinder in ihrem täglichen Befinden und in ihrer gesamten Entwicklung abhängig von ihrem sozialen Umfeld. Therapie kann daher nie unabhängig davon geplant und vereinbart werden.
Wird die Kontaktaufnahme mit einer therapeutisch arbeitenden Institution als Bekräftigung der innerfamiliären Regeln erlebt, wird ein Kind zunächst keine neuen Impulse für seine Entwicklung erwarten. Stellt sie aber einen neuen Schritt dar, kann dies vom Kind als beginnende Phase der Neuorientierung angesehen werden und es entweder zu vermehrtem Rückzug in den ihm bekannten psychosozialen Rahmen veranlassen – möglicherweise mit der Folge einer eingeschränkten Verwertungsmöglichkeit der dargebotenen Informationen (vgl. Reiter-Theil, Eich u. Reiter 1993) – oder aber zum Wagnis eines Veränderungsschrittes und zu mehr Eigenständigkeit herausfordern. Im therapeutischen Dialog gilt es deshalb, dem Kind sowohl den notwendigen Schutz durch den Kontakt mit den Bezugspersonen, als auch den für die Entwicklung eigenständiger Ideen gebührenden Abstand von diesen zu ermöglichen.
Besondere Probleme können sich aufgrund elterlicher Konstellationen ergeben: zum einen bei psychischen Störungen der Eltern, sofern diese Störungen die Aufnahmefähigkeit bei Eltern und Kindern und deren Informationsverarbeitung beeinträchtigen oder verzerren; zum anderen bei elterlichen Konfliktlagen, wenn eine Lösungsmöglichkeit darin gesehen wird, sich auf kindliche Störungen zu konzentrieren – eine in familiendynamischer Sicht häufige Konstellation. Die schwierige, aber notwendige Aufgabe von Therapeuten besteht dann darin, die Anliegen und Sorgen der elterlichen Bezugspersonen im Hinblick auf eine positive Entwicklung ihrer Kinder aufzunehmen und mit der eigenen elterlichen Lage in Beziehung zu setzen sowie mögliche Diskrepanzen und Konflikte aufzuzeigen, um so die Voraussetzungen zu verbessern, zu einer für Eltern, Kinder und Therapeuten tragfähigen Entscheidung zu gelangen.
ASPEKTE DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES
Im vorigen Kapitel haben wir Voraussetzungen auf der Seite der Klienten sowie förderliche Bedingungen seitens der Therapeuten für mehr oder weniger autonome Entscheidungen benannt. Im zweiten Schritt soll es nun um wesentliche zusätzliche Bedingungsfaktoren und Schritte im aktuellen Entscheidungsprozess gehen.
Informierte Zustimmung als Prozess
Wir können von unseren Patienten eine explizite oder auch eine implizite Zustimmung zu einer Therapieplanung erhalten oder von ihrer Zustimmung einfach ausgehen, solange sie dem Vorgehen nicht klar widersprechen. Speziell Kinder und Jugendliche stimmen oft verbal oder nonverbal einem Vorgehen zu, ohne dass sie sich wirklich eine authentische Meinung dazu gebildet haben. Sie brauchen nicht nur Zeit, sondern auch fortlaufend die Versorgung mit für ihre Meinungsbildung relevanten Informationen und die Möglichkeit, ihre Entscheidung im Laufe der Zeit überprüfen und gegebenenfalls revidieren zu dürfen (Eich, Reiter u. Reiter-Theil 1997; Lewis 1982; Reiter-Theil, Eich u. Reiter 1993). Dieses Verständnis des Prozesscharakters der informierten Zustimmung bedeutet auch, dass es bei jedem neuen Schritt einer neuen Entscheidung bedarf. Wenn Patienten zum Beispiel freiwillig zu uns kommen, bedeutet dies noch nicht automatisch, dass sie auch der ihnen angebotenen Behandlung zustimmen.
Das Problem der Macht
Knölker (1997) geht auf das Prinzip Verantwortung nach Jonas ein und verlangt von Therapeuten, dass sie insbesondere bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen den Gebrauch ihres Wissens und ihrer Autorität (Macht) reflektieren. Den oft nicht explizit ausgedrückten Befürchtungen und Hoffnungen der jungen Klienten müsse sensibel und verantwortungsbewusst begegnet werden. Specht (1993) zitiert in diesem Zusammenhang Masson (1991): „Allein aus der Struktur der Psychotherapie ergibt sich, daß der Therapeut – auch wenn er mit den besten Absichten an seine Aufgabe herangeht – gezwungen ist, die Würde, die Autonomie und die Freiheit der Person zu beeinträchtigen, die hilfesuchend zu ihm kommt.“ Experten haben auf der fachlichen Ebene immer einen Vorsprung gegenüber den Ratsuchenden allgemein und gegenüber Kindern und Jugendlichen in besonderen Maße: Das Aufsuchen einer Institution, die Diagnostik und Therapie anbietet, erfolgt in der Regel erst dann, wenn die Betroffenen mit ihren Kompetenzen für die Lösung der vorhandenen Probleme am Ende sind. Für Kinder und Jugendliche kann dies eine mehrfache Einschränkung ihrer Autonomie bedeuten: Zum einen sind sie allein von ihrem Status her noch abhängig von ihren Eltern; zum zweiten erleben sie sich gemeinsam mit ihren Bezugspersonen in einer Sackgasse, in der ihnen die konstruktive Weiterentwicklung nicht mehr gelingt. Schließlich kommt für Eltern und Kinder die Begegnung mit einem Experten oder einer Expertin dazu, die ihre Fachkompetenz mehr oder weniger stark herausstellt, was ein Gefühl der Unterlegenheit hervorrufen kann.
Therapeutische Schlussfolgerungen
Beim Abwägen zwischen dem Bestreben, das Beste für die Patienten zu ermöglichen, und dem Respekt vor ihrer Autonomie können unserer Ansicht nach folgende Fragen hilfreich sein: Was möchte der Patient; was ist das Anliegen seiner Bezugspersonen? Welche Motive liegen diesen Wünschen zugrunde? Was wäre aus fachlicher Sicht eine optimale, was eine noch akzeptable Entscheidung? Zu wem hat die Patientin Vertrauen, um evtl. ihre inneren Ambivalenzen mit dieser Person unabhängig vom aktuellen Beziehungsfeld zu klären?
Wenn eine Entscheidung für die Aufnahme einer Therapie gefällt wurde, geht es im nächsten Schritt um die Definition einer gemeinsamen Zielsetzung. Im Sinne der Allparteilichkeit und des Respekts vor der Autonomie aller Beteiligten sollte der Therapeut oder die Therapeutin alle vorgebrachten Ideen zu einer Veränderungsplanung gelten lassen und gleichwertig zur Diskussion stellen. Dabei kann eine wichtige Aufgabe darin bestehen, die handlungsleitenden Motive von Kindern und Eltern herauszuarbeiten und diese allen Beteiligten verständlich zu machen. Kindern und Jugendlichen bleibt das Recht, sich den Leitlinien ihrer Bezugspersonen anzuschließen oder nicht. Bei fortgeschrittener moralischer Entwicklung, ausreichendem Überblick über die möglichen Risiken bzw. den möglichen Nutzen der vorgeschlagenen Therapie und einem im Beziehungsfeld akzeptierten Maß an Unabhängigkeit kann der Entscheidung eines Kindes oder Jugendlichen mehr Gewicht zukommen als der eines Erwachsenen. Ethische Konflikte sind an diesem Punkt des Zustimmungsprozesses nicht auszuschließen: zum einen in Form einer nicht auflösbaren Meinungsverschiedenheit zwischen Eltern und Kind, ob eine indizierte Therapie nun begonnen oder fortgesetzt werden soll; zum anderen in Form einer Ambivalenz zwischen Zustimmung und Ablehnung.
Als Therapeutinnen und Therapeuten tragen wir die Verantwortung für die korrekte Übermittlung des erforderlichen Fachwissens und für eine fachlich kompetente Unterstützung der Kommunikation über die weiteren Schritte des Entscheidungsprozesses. Nur in seltenen Fällen ist es notwendig, eine verantwortliche Entscheidung zunächst in Vertretung oder ohne ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen zu fällen oder eine adäquate Vertretung der Interessen eines Kindes über familiengerichtliche Maßnahmen in die Wege zu leiten (Knölker 1997; Koc, Reiter-Theil a. Helmchen 1996; Specht 1993).
FALLBEISPIEL
Im Folgenden sollen anhand eines Fallbeispiels einige der oben ausgeführten Faktoren auf dem Weg zu einem Behandlungskontrakt konkretisiert werden. Dabei betrachten wir die unterschiedlichen Perspektiven aller Beteiligten bei der Kontaktaufnahme, den Informations- und Entscheidungsprozess bis hin zur informierten Zustimmung aller Beteiligten und den Verlauf der ersten therapeutischen Schritte.
Problemkonstellation
Der fünfjährige A. lebt nach der jüngst vollzogenen Trennung seiner Eltern bei der Mutter. Er kann seit zwei Wochen den Kindergarten nicht mehr besuchen, da er abends erhebliche Einschlafstörungen zeigt, morgens dann rechtzeitiges Aufstehen und Bereitmachen für den Kindergarten vehement verweigert und bei konsequenter Forderung der Mutter Bauchschmerzen entwickelt, die dann einen Arztbesuch statt des Kindergartenaufenthaltes zur Folge haben.
Die Mutter, Frau B., sucht am Ende ihrer Kräfte eine Beratungsstelle auf. Sie sieht das oppositionelle Verhalten ihres Sohnes als Auswirkung der Trennung und des negativen Einflusses des Vaters auf ihn seither. Bei gleichzeitig juristischem Vorgehen gegen den Vater mit dem Ziel der zumindest vorübergehenden Einschränkung des Umgangsrechtes wünscht sie eine Therapie für den Jungen, damit dieser die Trennung vom Vater besser verarbeiten könne. Der Vater, Herr B., sieht eine mangelnde Konsequenz im Erziehungsverhalten seiner Frau als Ursache für die Probleme an und möchte lieber den Jungen ganz in seine Obhut nehmen, als dass er einer Therapie für ihn zustimmen würde.
Der Sohn A. stellt seine Situation anhand des Familienbrettes (Ludewig 1983, 2000) folgendermaßen dar: Erst lebten Mama, Papa und er zufrieden zusammen. Da waren die Wut, die Angst und die Bauchschmerzen noch nicht da. Als Papa wegging, kam abends die Angst und sagte: Wenn du jetzt einschläfst und nicht aufpasst, geht vielleicht Mama auch weg und dann bist du ganz allein auf dieser Welt. Morgens drängelte Mama dann immer so. Sie konnte mich nicht schnell genug loswerden und war gar nicht mehr so lieb wie früher zu mir. Da holte ich meinen Freund, die Wut, und ärgerte sie auch. Aber sie wurde dann echt böse und drohte mir, mich allein zu lassen. Da war gleich die Angst wieder da, machte mir Bauchschmerzen, und ich konnte einfach nicht in den Kindergarten gehen.
Befragt nach seinem Änderungswunsch holt er als Mittel gegen die Angst die Vaterfigur zurück und stellt als Gegenkraft zur Wut die Mutterfigur näher zu sich heran und lässt sie liebevoll auf ihn schauen.
Entwicklung einer gemeinsamen Basis für den Entscheidungsprozess
Die erste Kontaktaufnahme geht von der Mutter aus. A. willigt implizit in die Vorstellung ein. Der Vater ist nach Angaben der Mutter nicht zu einer Konsultation bereit, wird aber von Mutter und A. als am Problem mit beteiligte Person eingeführt. Sowohl aus juristischer als auch aus therapeutischer Sicht ist nun eine Einbeziehung des Vaters notwendig.
Solange beide Eltern das Sorgerecht haben, müssen auch beide über eine Therapie für ihren Sohn entscheiden. Auf der psychotherapeutischen Ebene ist eine Klärung des Kontextes nötig, in dem die Probleme und Auffälligkeiten des Kindes stehen, bevor aus fachlicher Sicht eine Therapieindikation geprüft werden kann. Für diesen Klärungsprozess ist die Sicht beider Eltern wichtig. Es stellt sich also als Erstes die Frage, ob vor dem Hintergrund der beginnenden juristischen Auseinandersetzung zwischen den Eltern überhaupt eine Kooperationsbereitschaft beider Eltern möglich ist und zustande kommt.
Herr B. ist von Frau B. über deren Kontaktaufnahme mit der Therapeutin wegen A.s Problemen informiert worden. Nach Angaben der Mutter habe er mit heftigen Vorwürfen ihr gegenüber und mit einer eindeutigen Ablehnung des Therapieansinnens reagiert. Frau B. äußert wenig Hoffnung auf eine Zusammenarbeit mit A.s Vater, ist aber mit einer Kontaktaufnahme der Therapeutin zu ihm einverstanden. Daraufhin ergeht eine schriftliche Einladung an den Vater, der sich zur Mitarbeit bereit erklärt, aber um ein Gespräch ohne A. und dessen Mutter bittet.
Sowohl Frau B. als auch A. erlauben der Therapeutin, mit dem Vater über die bisher erörterten Inhalte offen zu sprechen. Die Mutter schließt daran den Wunsch an, ihrerseits dann auch über die Gesprächsinhalte mit dem Vater in Kenntnis gesetzt zu werden. Die Therapeutin nimmt diesen Wunsch auf und signalisiert in diesem Zusammenhang beiden Eltern gegenüber ihre Vorstellung, einen solchen Informationsaustausch auch gern direkt zwischen den Erwachsenen in einem späteren gemeinsamen Gespräch begleiten zu können.
A. erkennt die Lage der Familie, kann sowohl das Bild seiner augenblicklichen Situation als auch sein Wunschbild klar in darstellendem Handeln mit begleitenden verbalen Kommentaren äußern. Er kann für sein Alter erstaunlich gut seine inneren Gefühle und deren Stellenwert im Umgang mit der Mutter beschreiben. Dabei zeigt er bereits ein relativ hohes Maß an moralischer Entwicklung, da er nicht nur seine individuellen Bedürfnisse allein als Orientierung verwendet, sondern auch schon über mögliche Motive seiner Mutter nachdenkt. Auch im Hinblick auf seine Veränderungswünsche hat er klare Vorstellungen und vermag diese der Therapeutin zu vermitteln.
Zu diesem Zeitpunkt erfolgt noch nicht die fachlich begründete explizite Information an die Eltern, dass eine Kooperation der erwachsenen Bezugspersonen zur Lösung der Probleme mit A. sinnvoll sei, da der Vater bis zu dieser Zeit weder die Chance hatte, seine Definition der Lage überhaupt einzubringen, noch nach einer Stellungnahme der Therapeutin gefragt hatte. Sollte er z. B. gar keine Schwierigkeiten in A.s Entwicklung sehen oder auch längst die Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten für sich beschlossen haben, würde er eine Aufforderung zur Mithilfe bei der Lösung von Problemen in diesem Kontext mit großer Wahrscheinlichkeit als Missachtung seines autonomen Urteils erleben. Die Andeutung eines gemeinsamen Gesprächs zur Koordination der jeweiligen Perspektiven von Mutter und Vater hat in diesem Stadium aus der Sicht der Therapeutin lediglich das Ziel, den Blick für den anderen zu öffnen und Hoffnung auf Verständigung als einen möglichen Weg aus der augenblicklich festgefahrenen Konfliktlage zu wecken. Für A. könnte eine solche Äußerung der Therapeutin allerdings nicht nur eine Anerkennung seines Wunsches bedeuten, den Vater näher heranzuziehen, sondern evtl. auch gleichzeitig eine Gefahr darstellen, wenn dadurch seine übergroßen Hoffnungen auf Wiedervereinigung der Familie gestärkt und dann umso mehr enttäuscht werden würden.
Bis hierher erfolgten stets nur punktuelle Entscheidungen zu konkreten Fragen, nicht aber eine Zustimmung zum Einstieg in eine professionelle Zusammenarbeit. Dies gelingt erst nach weiterer Vorarbeit: A.s Eltern stimmen nach getrennten Vorgesprächen dem Vorschlag der Therapeutin zu, den juristischen Weg zunächst einmal zu verlassen und im therapeutischen Rahmen auf die Suche nach dem besten Weg für die weitere Entwicklung ihres Sohnes zu gehen. Dabei gilt es, an den unterschiedlichen Sichtweisen der Betroffenen anzuknüpfen, einen tragfähigen Minimalkonsens im Hinblick auf die Definition der Problemlage zu erlangen und davon ausgehend gegebenenfalls einen Therapieauftrag und einen Therapieplan mit möglichst klar vereinbarten Zielen zu erarbeiten.
Die Therapeutin schlägt den Eltern zunächst ein Gespräch ohne A. zum Austausch ihrer unterschiedlichen Sichtweisen der Problemdefinition vor. A. erhält im Ausgleich dazu das Angebot einer weiteren Spielstunde, in der er der Therapeutin zeigen könne, was seine Angst und seine Wut inzwischen machen. Die Therapeutin versichert ihm, ihn rechtzeitig über die für ihn wichtigen Beschlüsse seiner Eltern bzgl. der weiteren Therapieplanung zu informieren und dann auch nach seiner Meinung dazu zu fragen. Den Eltern gegenüber begründete die Therapeutin diesen Schritt mit mehreren Argumenten: zum einen mit dem Risiko für A., bei einem gemeinsamen Treffen zu diesem Zeitpunkt die wahrscheinlich unrealistische Hoffnung auf eine Versöhnung der Eltern zu nähren und ihn durch die dann unvermeidliche Enttäuschung zusätzlich zu verletzen, zum zweiten mit dem notwendigen Schutz für A. vor weiterer emotionaler Belastung, die durch die mögliche Aktualisierung der Streitigkeiten der Eltern in dem geplanten Kontakt hervorgerufen werden könnte, sowie schließlich mit ihrem Respekt vor der autonomen Entscheidung der Eltern, sich zu trennen.
Informierte Zustimmung zur Therapie
Das Erklärungsmodell für die Schwierigkeiten enthält bei allen Beteiligten die gleichen Protagonisten, schreibt diesen aber unterschiedliche Bedeutungen und Motive im Interaktionsfeld zu. A. führt mit der Unterstützung der Therapeutin externalisierte Gefühle als relevante Wirkfaktoren in die Systembeschreibung mit ein, die aufgrund ihrer emotionalen Verankerung bei Eltern und Kind zu einer Brücke bei der Annäherung der konträren Sicht von Mutter und Vater werden. Über diesen Weg gelingt es, die Hoffnung auf den Aufbau einer gemeinsamen Verständigungsbasis zwischen den Eltern zu wecken, eine substanzielle Voraussetzung für die Zustimmung beider zur Fortsetzung der Kontakte.
Von diesem Vorhaben wird A. sowohl von seinen Eltern als auch von der Therapeutin in Kenntnis gesetzt und reagiert spontan erfreut darauf. Er will zur nächsten Sitzung unbedingt mit beiden Eltern zusammen kommen. Diese Stellungnahme entspricht einer eindeutigen expliziten Zustimmung zum nächsten Treffen, nicht aber allgemein zur therapeutischen Arbeit.
Dies macht eine Phase der genaueren Information über die Art, Dauer und mögliche Risiken der Therapie mit allen Familienmitgliedern erforderlich. Als erstes Therapieziel wird eine deutliche Reduktion der Verlassenheitsängste von A vorgeschlagen. Dazu wird das von Petermann entwickelte Angstbarometer zur jeweiligen Quantifizierung der Angst und zur Bestimmung der Zielgröße eingeführt. A. und seinen Eltern wird angeboten, unter der Anleitung der Therapeutin Schritte zu überlegen, wie A. die Angst nach und nach besiegen könne. Es ist anzunehmen, dass er das in vier bis fünf Therapiestunden mit zusätzlichem Ausprobieren zu Hause in den Zwischenphasen schaffen wird.
Dem Risiko, dass A. in den gemeinsamen Kontakten mit Mutter und Vater der Illusion erliegen könnte, sie würden am Ende sicher beide versöhnt mit ihm nach Hause gehen, begegnete die Therapeutin mit einer speziellen Formulierung des Therapiezieles: „Auch wenn deine Eltern nun nicht mehr zusammenleben möchten, haben sie sich beide bereit erklärt, dir bei deinem Kampf gegen die Angst zu helfen.“ Den Eltern gegenüber benennt sie das Risiko, dass evtl. bei einem erfolgreichen Kampf gegen die Angst die Wut A.s mehr zum Vorschein kommen könnte. Trotz der aufgezeigten Risiken stimmen A. und seine Eltern explizit der Aufnahme der Therapie mit dem oben formulierten Ziel zu. Es werden Kontakte in 14-tägigem Abstand gemeinsam mit A. und beiden Eltern vereinbart.
Beide Eltern entwickeln im weiteren Therapieverlauf Verständnis für die Gefühle ihres Sohnes und erklären sich einig darin, mithilfe des therapeutischen Settings Bedingungen auszuhandeln, unter denen sich A. der Bindung und Zuwendung seiner Eltern sicherer sein kann als bisher (feste Absprachen zu Besuchen, Telefonaten). Phasen von immer mehr Selbstständigkeit und Selbstsicherheit aufseiten A.s werden von beiden Eltern positiv bekräftigt, machen A. stolz und emotional so ausgeglichen, dass auch bei abnehmender Trennungsangst keine verstärkte Wut mehr auftritt.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Achtung der Persönlichkeitsrechte von Kindern und Jugendlichen stellt Therapeutinnen und Therapeuten vor die Aufgabe, ihre jungen Klienten angemessen über vorgesehene Behandlungsschritte zu informieren und sich um ihr Einverständnis zu bemühen. Dabei sind folgende Herausforderungen zu meistern: zum Ersten die Berücksichtigung des Entwicklungskontexts von Kindern und Jugendlichen, zum Zweiten die Einbeziehung familiärer und sozialer Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung insgesamt und auf das aktuelle Befinden und Verhalten sowie schließlich die Abwägung zwischen den gleichrangigen ethischen Prinzipien der Achtung der Autonomie auf der einen Seite und der Hilfestellung beziehungsweise Schadensvermeidung auf der anderen Seite.
Der fachliche Umgang mit diesen Herausforderungen erfordert Fähigkeiten und Fertigkeiten in mehreren Bereichen:
1) Das notwendige Eingehen auf den Entwicklungsstand des betreffenden Kindes setzt neben Empathie und Sensibilität entwicklungspsychologische Kenntnisse voraus.
2) Die Beachtung und Einbeziehung des familiären und sozialen Kontextes entspricht originär systemischem Denken; die Relevanz haben wir am Fallbeispiel verdeutlicht: Ohne eine solche Sichtweise wäre weder eine gemeinsame Basis für den Entscheidungsprozess hin zu einer informierten Entscheidung aller Beteiligten gefunden worden, noch hätten der Problemkonstellation angemessene Lösungsperspektiven entwickelt werden können.
3) Durch die gelungene Einbeziehung aller Problemprotagonisten konnte zudem ein ethisches Dilemma vermieden werden, das bei fehlender informierter Zustimmung hätte entstehen können, sofern die psychische Situation des Kindes (oder auch eines anderen Familienmitglieds) dringenden Behandlungsbedarf signalisiert hätte. Ein solches Dilemma zwischen gleichrangigen ethischen Prinzipien blockiert konstruktive Lösungen und legt deshalb die Inanspruchnahme einer Ethik-Konsultation nahe.
4) Notwendig ist schließlich die Realisierung therapeutischer Basisvariablen, sowohl in der Begegnung mit den Kindern und Jugendlichen als auch mit ihren Bezugspersonen oder anderen relevanten Interaktionspartnern. Dazu gehören insbesondere das Eingehen auf das Entwicklungs- und Sprachniveau des Kindes, die Beachtung nonverbaler Signale, eine allparteiliche Haltung, die Orientierung an den Anliegen aller beteiligten Personen und die Reflexion der eigenen Position im Hilfesystem, der durchaus auch Macht- und Kontrollaspekte zugeschrieben werden können. Somit setzt der konstruktive Umgang mit dem ethischen Postulat der informierten Zustimmung auch von Kindern und Jugendlichen Kompetenzen voraus, die eine enge Verknüpfung zwischen ethischer und psychotherapeutischer Ebene verdeutlichen.
LITERATUR
Amelung, K. (1996): Germany. In: H. G. Koch, S. Reiter-Theil a. H. Helmchen (eds): Informed consent in psychiatry. European perspectives of ethics, law and clinical practice. Baden-Baden (Nomos).
Beauchamp, T. L. a. J. F. Childress (1994): Principles of biomedical ethics. Oxford (Oxford University Press).
Bühler, C. (1967): Kindheit und Jugend. Genese des Bewußtseins. Göttingen (Hogrefe).
Bullock, M. (1979): Aspects of the young child’s theory of causation. Unpublished ph.th. University of Pennsylvania. [zitiert in R. Oerter, u. L. Montada (Hrsg.) (1995): Entwicklungspsychologie. Weinheim (Beltz).
Corder, B. F., T. M. Haizlip a. L. D. Spears (1976): Legal issues in the treatment of adolescent psychiatric inpatients. Hospital & Community Psychiatry 27 (10): 712–715.
Donaldson, M. (1982): Wie Kinder denken. Bern (Huber).
Eich, H., L. Reiter u. S. Reiter-Theil (1997): Informierte Zustimmung in der Psychotherapie. Psychotherapeut 42: 369–370.
Goswami, U. (1992): Analogical reasoning in children. New York (Hove).
Green, J. a. A. Stewart (1987): Ethical issues in child and adolescent psychiatry. Journal of Medical Ethics 13: 5–11.
Heigl–Evers, A. u. F. S. Heigl (1989): Ethik in der Psychotherapie. Psychotherapie und Medizinische Psychologie 39: 68–74.
Höger, C., S. Reiter-Theil, L. Reiter, G. Derichs, M. Kastner-Voigt u. T. Schulz (1997): Fallbezogene ethische Reflexion. Ein Prozeßmodell zur Ethikkonsultation in der Kinderpsychiatrie und Psychotherapie. System Familie (10): 174–179.
Hungerige, H. u. D. Päßler (1999): Ethische Aspekte der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. In: M. Borg-Laufs (Hrsg.): Lehrbuch der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen. Band 1: Grundlagen. Tübingen (Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie).
Kanzow, W. T. (1994): Der „schwierige Patient“. In: T. Kruse u. H. Wagner (Hrsg.): Ethik und Berufsverständnis der Pflegeberufe. Berlin (Springer).
Knölker, U. (1997): Von der Verantwortung des Kinder- und Jugendpsychiaters. In: D. von Engelhardt (Hrsg.): Ethik im Alltag der Medizin. Basel (Birkhäuser).
Koch, H.-G., S. Reiter-Theil a. H. Helmchen (eds) (1996): Informed consent in psychiatry. Baden-Baden (Nomos).
Langer, D. h. (1985): Child psychiatry and the law. Children’s legal rights as research subjects. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 24: 653–662.
Lewis, M. (1982): Comments on some ethical, legal, and clinical issues affecting consent in treatment, organ transplants and research in children. Annual Progress in Child Psychiatry and Child Development 40: 651–666.
Ludewig, K. (1983): Das Familienbrett. Hamburg (Selbstverlag).
Ludewig, K. (2000): Das Familienbrett. Ein Verfahren für die Forschung und Praxis mit Familien und anderen sozialen Systemen. Göttingen (Hogrefe).
Miller, B. D. (1977): The ethics of practice in adolescent psychiatry. American Journal of Psychiatry 134: 420–424.
Morrison, K. L., J. K. Morison a. S. Holdridge-Crane (1979): The child’s right to give informed consent to psychiatric treatment. Journal of Clinical Child Psychology (Spring): 43–47.
Oerter, R. u. L. Montada (Hrsg.) (1995): Entwicklungspsychologie. Ein Lehrbuch. Weinheim (Beltz).
Pearce, J. (1994): Consent to treatment during childhood. The assessment of competence and avoidance of conflict. British Journal of Psychiatry 165 (6): 713–716.
Piaget, J. (1969): Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde. Stuttgart (Klett).
Reder, P. a. G. Fitzpatrick (1998): What is sufficient understanding? Clinical Child Psychology and Psychiatry 3: 103–113.
Reiter-Theil, S., H. Eich u. L. Reiter (1993): Der ethische Status des Kindes in der Familien- und Kinderpsychotherapie. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 42: 14–20.
Sattler, J. M. (1982): Assessment of children’s intelligence and special abilities. Boston (Allyn & Bacon).
Schowalter, J. E. (1978): The minor’s role in consent for mental health treatment. Journal of the American Academy of Child Psychiatry 17: 505–513.
Specht, F. (1993): Zu den Regeln des fachlichen Könnens in der psychosozialen Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 42: 113–124.
Stern, W. (1928): Die Intelligenz der Kinder und Jugendlichen und die Methoden der Untersuchung. Leipzig (Barth).
Thompson, R. A. (1990): Vulnerability in research: A developmental perspective on research risk. Child Development 61: 1–16.
Towbin, K. E. (1995): Evaluation, establishing the treatment alliance and informed consent. Pediatric Psychopharmacology 4: 1–14.
Entwicklungspsychopathologie
Michael Kusch
Einleitung
Grundlagen der Entwicklungspsychopathologie
Komplexe Entwicklungsmodelle
Biopsychosoziale Selbstregulation und -organisation
Kontrollparameter der psychischen Entwicklung
Modellvorstellungen der Entwicklungspsychopathologie
Ätiopathogenetisches Modell der Entwicklungspsychopathologie
Entwicklungsabweichung im biopsychosozialen Kontext
Entwicklungsbezogene Intervention
Literatur
EINLEITUNG
Die Entwicklungspsychopathologie ist eine relativ junge akademische Disziplin, die aus den traditionellen humanwissenschaftlichen Disziplinen entstanden ist und sich gegenwärtig von ihnen emanzipiert (Cicchetti 1999). Sie versucht die Komplexität des normalen und abweichenden Entwicklungsgeschehens zu betrachten, ohne dabei den Beitrag einer einzelnen Disziplin überzubewerten bzw. zu ignorieren. Dieses Vorhaben führte dazu, dass die Entwicklungspsychopathologie bislang keine eigenen Modelle und Konzepte erarbeitet und diskutiert hat. Vielmehr greift sie auf die bereits vorhandenen Modellannahmen zurück und versucht, diese miteinander zu verbinden. Gerade dieser Prozess hat emanzipatorischen Charakter, da er zunehmend deutlicher macht, dass vereinfachende Einzelperspektiven des Entwicklungsgeschehens uns an die Grenzen des Verständnisses und der Veränderbarkeit individueller Muster angepassten und fehlangepassten Verhaltens geführt haben. Zugleich wird auch deutlich, dass die bislang vorliegenden Entwicklungsmodelle sich nicht ohne weiteres miteinander verknüpfen lassen, sondern eine neue Perspektive der menschlichen Entwicklung gefunden werden muss.
Es geht in dieser Arbeit nicht um die vollständige Darstellung der „Entwicklungspsychopathologie“ (Sroufe a. Rutter 1984; Cicchetti 1989; Cicchetti a. Cohen 1995; Petermann, Kusch u. Niebank 1998) oder der mit ihr eng verbundenen „Klinischen Entwicklungspsychologie“ (Noam 1997; Oerter, von Hagen, Röper u. Noam 1999), sondern um eine knappe Einführung sowie die Darstellung und ansatzweise Diskussion kritischer Punkte und Fragestellungen dieser neuen akademischen Denk- und Forschungsrichtungen. Für manchen Leser wird die Arbeit zu mehr Fragen als Antworten führen, für den anderen mag sie als Anregung dienen, sich dem Gebiet der Entwicklungspsychopathologie intensiver nähern zu wollen. Ziel dieser Arbeit ist es, die Komplexität und Tiefe des gesamten Themas aufzuzeigen und gerade dort hinzuzeigen, wo Zusammenhänge nicht oder nur schwer verstanden werden.
GRUNDLAGEN DER ENTWICKLUNGSPSYCHOPATHOLOGIE
Seit den frühen achtziger Jahren ist eine Wende in der akademischen Entwicklungspsychologie und klinischen Psychologie zu beobachten, die als eine Abkehr von den einfachen Modellannahmen zur Entstehung und zum Verlauf normalen und fehlangepassten Verhaltens beschrieben werden kann. Die menschliche Entwicklung und das Verhalten werden im Kontext genetischer, ontogenetischer, biochemischer, kognitiver, affektiver und sozialer Einflüsse betrachtet und ihre „Abweichungen“ vor dem Hintergrund des „Normalen“ erforscht. Diese Wendung brachte ein neues Koordinatensystem in der Psychologie menschlichen Erlebens und Verhaltens mit sich, welches den Begriff „Entwicklungspsychopathologie“ erhielt (Sroufe a. Rutter 1984; Cicchetti 1989; Kusch 1993; Kusch u. Petermann 1998).
Komplexe Entwicklungsmodelle
Die Entwicklungspsychopathologie beschäftigt sich mit den Ursachen und dem Verlauf individueller Muster fehlangepassten Verhaltens, ungeachtet des Alters bei Störungsbeginn, der einzelnen Ursachen und der Veränderungen im beobachtbaren Verhalten und





























