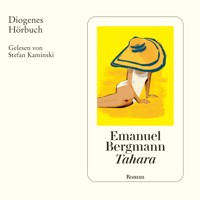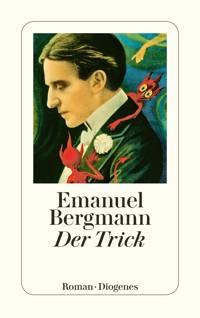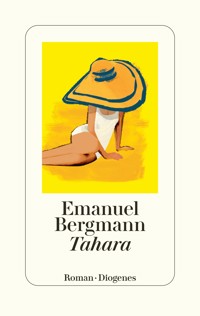
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine ›amour fou‹ unter der Sonne der Côte d'Azur. Als Marcel Klein, der berühmte Filmkritiker, in Cannes am ersten Festivalmorgen einen Espresso trinkt, lernt er die verführerische Französin Héloïse kennen. Jedes Mal, wenn sie sich zwischen Presse-Events, Partys und Premieren begegnen, streiten sie sich leidenschaftlich. Als Marcels Geheimnisse ihn einzuholen drohen, verlassen die beiden Hals über Kopf die Stadt. Denn auch Héloïse hat ein abgrundtiefes Geheimnis. Ein berührender und temporeicher Roman über die Lügen und die Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Emanuel Bergmann
Tahara
roman
Diogenes
1
An einem sonnigen Morgen im Mai landete Marcel Klein, der berüchtigte Filmkritiker, am Flughafen von Nizza. Als er das Terminal verließ, war weit und breit kein Taxi zu sehen. Schweißperlen sammelten sich auf seiner Stirn. Mit einer Mappe fächelte er sich Luft zu. Trotz des herrlichen Wetters war er angespannt, ja geradezu gereizt, als könnte er bereits jetzt den Sturm spüren, der sein Leben bald in Schutt und Asche legen würde. Endlich kam ein Wagen. Marcel stieg ein. Während der ruckeligen Fahrt nach Cannes blätterte er in seinem Notizbuch – er sollte sich Fragen für ein Interview ausdenken, aber er war zu müde. Seit fünf Uhr früh war er auf den Beinen, noch dazu hatte er im Flugzeug seinen Fensterplatz aufgegeben, damit eine gestresste Mutter bei ihrer Tochter sitzen konnte. Den Anflug von Selbstlosigkeit hatte er sofort bereut. Ein guter Journalist sollte knurrig sein, wie er fand. Je knurriger, desto besser, das zeichnete den Profi aus. Dabei war Marcel Klein im Grunde nur ein Mensch, der die Kunst des Glücklichseins nie erlernt hatte.
Unerträglich, diese Hitze. Das Fenster klemmte. »On ne peut pas ouvrir la fenêtre?«, rief er dem Taxifahrer zu. Der Mann ignorierte ihn, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve. Marcel fluchte leise. Als das Taxi endlich vor dem Hôtel de Provence anhielt, zahlte er und ging mit seiner Reisetasche durch den malerischen Vorgarten auf den Eingang zu.
Dann sah er sie. Sie trat aus dem Hotel in die Sonne und schaute sich suchend um, hielt eine Hand über ihr Gesicht. Blasser Teint, schwarzes Haar, das ihr in dichten Locken auf die Schultern fiel. Sie war schlank, für Marcels Geschmack sogar ein wenig zu schlank. Was ihm jedoch auf Anhieb gefiel, war die Melancholie, die sie umgab. Wie die meisten Männer fand er den Schmerz schöner Frauen unwiderstehlich.
Sie schulterte ihre Handtasche und ging wieder hinein. Als Marcel das klimatisierte Foyer betrat, füllte sie gerade am Empfangsschalter ein Formular aus. Marcel stellte sich an, in der stillen Hoffnung, sie möge sich umdrehen. Er hatte Sehnsucht nach ihrem Gesicht. Doch sie drehte sich nicht um. Als sie fertig war, ging sie mit ihrem Rollkoffer zum Aufzug und verschwand. Er schaute ihr so lange hinterher, bis ihn der Mann an der Rezeption fragte, ob er ihm helfen könne?
Natürlich. Désolé.
Beim Einchecken gab es ein kleines Problem – Marcels Zimmer war noch nicht bereit. Er könne aber sein Gepäck hier abstellen und sich solange ins Bistro setzen. Vielleicht etwas frühstücken?
Marcel nickte und ließ sich den Weg zur Toilette in der Lobby zeigen. Beim Händewaschen schaute er in den Spiegel und war enttäuscht. Er hatte mal gut ausgesehen, aber jetzt? Sein Haarwuchs nahm ab und seine Taille zu. Früher hatte man ihn mit George Clooney verglichen, aber das kam nur noch selten vor. Immerhin hatte er Stil. Heute trug Marcel einen hellen Anzug mit einem schwarzen Hemd und – statt einer Krawatte – einen Schal, den er jetzt dandyhaft über die Schulter warf. Dazu seine Ray-Ban und den Strohhut, mit dem er die Stirnglatze zu verbergen suchte.
Er ging ins Bistro des Hotels. Der Kellner, ein hochgeschossener Mann mit gepflegtem Vollbart, wies ihm den letzten freien Platz zu, einen Zweiertisch auf der Terrasse, im Schatten einer rotweißen Markise. Marcel gab seine Bestellung auf und schaute dem Kellner missbilligend hinterher. Er mochte keine Bartträger. Sein Vater hatte einen Bart gehabt. Gelegentlich hatten darin Eidotter oder andere Essensreste geklebt.
Er blickte auf seine Tissot. In anderthalb Stunden wurde er im Carlton erwartet. Ein neuer Actionfilm mit John Travolta in der Rolle eines Rennfahrers, der in ein Mordkomplott verwickelt wird. Das Übliche eben. Marcel musste hin, obwohl es bei Pressekonferenzen eigentlich nie viel zu holen gab. Man war dort nur ein Ferkel am Trog, umringt von Kollegen, die alle um dieselben Bröckchen wetteiferten. Aber wenigstens gab’s da was zu essen. Das war einer der Pluspunkte des Jobs, man konnte sich gelegentlich auf Kosten anderer durchfuttern. Übermäßig viel verdiente man nicht. Und damit war Marcel wieder bei der unerfreulichen Mahnung, die gestern ins Haus geflattert war. Er war mit der Abzahlung eines Kredits im Rückstand, eine Nichtigkeit, aber seine Bank war in letzter Zeit so pingelig. Er überlegte, ob er seine Mutter um eine Finanzspritze bitten sollte, aber sie würde ihm nur wieder Vorwürfe machen. Sie wusste immer alles besser. Also beschloss er, das Thema erst mal beiseitezuschieben. Im Verdrängen unbequemer Wahrheiten war er ein Meister.
Jetzt bekam er seinen Espresso. Allerdings nur lauwarm. Auch das noch. War heißer Kaffee zu viel verlangt? Er war schließlich nicht irgendwer. Er war der »Große Klein«. Der »Promi-Flüsterer«. Vor allem war er Perfektionist. Die Fehler anderer waren unverzeihlich. Er schaute sich nach dem Kellner um.
In dem Moment trat die schöne Fremde auf die Terrasse. Sie hielt nach einem Sitzplatz Ausschau. Das Sonnenlicht ließ ihre Augen tiefgrün aufleuchten. Ihre Blicke trafen sich. Einer Eingebung folgend deutete er auf den freien Stuhl an seinem Tisch. Als sie auf ihn zukam, erhellte ein Lächeln ihr Gesicht.
»Cette place serait-elle libre, Monsieur?«, fragte sie höflich.
»Oui«, sagte Marcel. Seine Schläfen pochten. »Oui, of course, bien sûr. Yes.«
»Merci.«
Sie setzte sich mit einer leichten, fließenden Bewegung. Marcel selbst war ungeschickt und daher neidisch auf anmutige Menschen. Sie trug einen schlichten weißen Rock und eine marineblaue Bluse, die oben aufgeknöpft war. Marcel sah in ihrem hübschen Ausschnitt ein kleines, silbernes Kruzifix aufblitzen, auf das er innerlich so reagierte wie ein Vampir in einem Gruselfilm.
Sie hängte ihre Handtasche über die Stuhllehne und überkreuzte die Beine. In ihrer Linken hielt sie ein Festivalprogramm. Marcel schätzte sie auf Ende dreißig oder Anfang vierzig. War sie beim Film? Oder bloß eine Zivilistin?
»Il y a du monde, ce matin«, sagte sie mit einem Blick über die Gartenterrasse – viel los heute Morgen.
Marcel mochte den tiefen Klang ihrer Stimme. »Oui«, erwiderte er.
Sie schauten einander kurz an, dann wandte Marcel den Blick verlegen wieder ab. Dabei war er an sich nicht schüchtern. Er stand gerne im Mittelpunkt.
»Le festival, c’est populaire«, sagte er. Es war ihm peinlich, Französisch zu sprechen. Sein Vater hatte in Straßburg gelebt, und obwohl Marcel in seiner Kindheit dort viel Zeit verbracht hatte, war ihm die Sprache fremd.
Dann sagte sie: »Votre français est horrible.«
»Sorry. Désolé.« Marcel errötete ein wenig.
»Allez, je vous pardonne.« Sie lachte, glockenhell und gut gelaunt. Dann fragte sie ihn, woher er komme. Aus Amerika?
Marcel schüttelte den Kopf. »Allemagne. Berlin.«
Ihr Blick erhellte sich. »Ah, oui?«
Diese Reaktion überraschte ihn. In der Regel rief sein Outing als Deutscher keinen übermäßigen Enthusiasmus hervor.
Die Fremde blickte ihn nun unverwandt an: »Dann können wir Deutsch sprechen«, sagte sie mit einem charmanten Akzent. Sie sei Lehrerin am Lycée. Deutsch und Englisch, Letzteres aber nur für die Unterstufe. Ihr Spezialgebiet sei eben Deutsch. Sie liebe die Sprache, vor allem wegen Wim Wenders, dessen Filme sie sehr bewundere.
»Ach? Und woher kommen Sie?«, fragte Marcel, der das Thema wechseln wollte.
Aus Metz kam sie. Und sie freute sich über jede Gelegenheit, ihre Deutschkenntnisse an Eingeborenen auszuprobieren. Sie hielt ihm die Hand entgegen: »Héloïse Becker.«
»Marcel Klein«, sagte er.
Mit gespielter Formalität schüttelten sie einander die Hände. Héloïses Finger waren kalt. Marcel merkte, dass er eine Erektion bekam. Er räusperte sich, schlug unauffällig die Beine übereinander und bemühte sich, an unangenehme, langweilige Dinge zu denken: Eidotter, bärtige Männer, Wim Wenders.
»Was machen Sie hier in Cannes … Monsieur Klein?«
Er quittierte das Filmzitat mit einem anerkennenden Lächeln: Monsieur Klein mit Alain Delon und Jeanne Moreau, aus den Siebzigern. Es ging um Betrug und Doppelmoral. Solche Filme machte heute keiner mehr.
Er zuckte die Achseln. »Ach, nichts Besonderes«, erwiderte er. Er müsse einfach nur viel arbeiten: »Und Sie können ruhig Marcel zu mir sagen.«
Dann schwieg er – ein Schachzug, um sie aus der Reserve zu locken. Bei Interviews war er ein alter Hase.
»Und was arbeiten Sie … Marcel?«
»Je suis journaliste.«
»Ah, oui?« Ihre Miene erhellte sich. Wenn die Leute »Journalist« hörten, dachten sie immer an Tim und Struppi. »Vous écrivez sur …« Ihre Stimme brach mitten im Satz ab, dann sprach sie auf Deutsch weiter: »Sie schreiben über das Festival? Über Film?«
»Oui, c’est ça.«
Er nippte an seinem inzwischen kalten Kaffee. Vor allem, damit seine Finger etwas zu tun hatten, und weil seine Erektion nur langsam nachließ. Er überlegte, ob er sich später auf dem Hotelzimmer einen runterholen sollte. Das wäre strategisch klug. Wer will schon vor John Travolta mit einem Ständer auftauchen?
»Und was schreiben Sie?«, fragte Héloïse.
»Na ja, so … Filmkritiken, Kolumnen, Features und so weiter. Aber in den letzten Jahren habe ich mich vor allem auf Interviews spezialisiert.«
Ihr Blick machte ihn nervös. Marcel fand attraktive Frauen bedrohlich. Immer fürchtete er, etwas Falsches zu sagen. Schöne Menschen gehörten auf die Leinwand, nicht ins Leben.
»Ah, da sind Sie bestimmt oft in Hollywood?« Ihm gefiel, wie sie es aussprach: »Olly-wut«.
Er schüttelte den Kopf. »Jetzt nicht mehr. Ich habe lange in L.A. gelebt. Bis vor ein paar Jahren. Aber jetzt wohne ich in Berlin. Ich bin nur noch selten dort.«
»Und hier in Cannes? Sie machen hier Interviews?«
»Ja, genau. Haben Sie von A Light in the Dark gehört?«
Ihre Augen strahlten. »Mais oui. Der neue Film mit Eva Vargas!«
»Ich gehe morgen Abend zur Premiere«, sagte er.
Jetzt schaute sie ihn neidisch an. Betont beiläufig erzählte er ihr, dass er auch noch ein Round-Table-Interview mit dem ausführenden Produzenten habe … Steven Spielberg.
»Wie aufregend. Und die Vargas? Treffen Sie die auch?«
Er nickte zögerlich.
»Sie mögen sie nicht?«
»Ein hübsches Gesicht, mehr nicht. Flavor of the month. Wenn man den Job eine Weile macht, kennt man das schon. Schauspieler sind alle gleich. Ich war fünf Jahre mit so einer verheiratet.«
Sie hob die Augenbrauen. »Ah bon?«, sagte sie mit plötzlichem Interesse, doch Marcel hatte wenig Lust, über seine gescheiterte Ehe mit Allison zu sprechen.
»Da fällt mir ein Witz ein«, meinte er stattdessen. »Trifft ein Schauspieler einen anderen und sagt: ›Übrigens, ich hab dich gestern im Bus gesehen.‹ Darauf der andere: ›Und? War ich gut?‹«
Héloïse lachte auf, und das Lachen verlieh ihrem Gesicht einen so offenherzigen Glanz, dass Marcel wehmütig wurde. Er hatte schon lange nicht mehr so gelacht. Ihm war etwas abhandengekommen im Lauf der Jahre, obwohl er ein aufregendes Leben führte, durch die Welt reiste und die Stars von Hollywood umschwirrte. Er war unempfänglich geworden für das Schöne. Außer es fand im Kino statt. Als Illusion. Das war sicherer.
Héloïse hingegen wirkte auf ihn unverbraucht. Selbst als ihr Lachen abklang, blieb das wunderbare Leuchten. Er fragte sie, ob sie beruflich in Cannes sei.
»Nein, nur so«, sagte sie. »Das Festival, ich wollte es schon immer sehen.«
»Vous aimez le cinéma.« Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. Natürlich liebte sie Kino, sonst wäre sie nicht hier.
»Bien sûr«, sagte sie. »C’est mieux.«
»Mieux? Wie meinen Sie das? Besser als was?«
»Mieux que tout«, sagte sie. »Besser als alles. Le cinéma, c’est la véracité de nos rêves.« Das Kino ist die Wahrhaftigkeit unserer Träume.
2
Schon in seiner Jugend hatte Marcel Klein sich in Träume geflüchtet. Er war ein unglückliches Kind gewesen. Also schaute er sich Filme an. Dabei ahnte er, dass es auch Menschen geben musste, die ihre Sommernachmittage nicht in dunklen Sälen verbrachten, die stattdessen die Nähe anderer suchten. Für Marcel war Kino mehr als ein Hobby. Es war eine Sucht. Er wollte der Wirklichkeit entfliehen. Umso wundersamer waren ihm die fremden Welten, die mit vierundzwanzig Bildern pro Sekunde vor seinen Augen abliefen.
Marcels Mutter, Miriam, war Schauspielerin, allerdings am Theater, nicht beim Film. Sein Vater René, ein eleganter, großgewachsener Mann, besaß eine Kette chemischer Reinigungen im Elsass. Die »Kette« – R. Klein Pressing, laver et plier – bestand aus nur drei Filialen. Das Hauptgeschäft lag in der Straßburger Altstadt, in der Rue des Orfèvres. Im Erdgeschoss war die Reinigung, im ersten Stock Renés Büro. Dort saß auch seine Sekretärin, die mollige Valérie, die deutlich mehr Geschäftssinn hatte als ihr Chef. René Klein, ein Hasardeur alter Schule, träumte von Expansion, über das Elsass hinaus, bis nach Lothringen und sogar ins ferne Saarland. So hatte alles angefangen.
Bei einem Geschäftsessen in Saarbrücken mit einem dicken deutschen Investor im schwarzen Pelzmantel hörte René immer wieder ein entzückendes Lachen durch das Restaurant perlen – das Lachen Miriams.
Zu fortgeschrittener Stunde ließ er, stets der Charmeur, eine Flasche Champagner an den Nebentisch bringen. Man stellte Stühle zusammen, kam ins Gespräch.
Die gebürtige Berlinerin Miriam entstammte einer deutsch-jüdischen »Künstlerdynastie«, wie sie es nannte. Surrealisten, Kubisten, Dadaisten. Allesamt verkannt, glücklos, entartet. Viele von ihnen fanden den Tod in den Vernichtungslagern deutscher Kunstbanausen, anderen war die Flucht nach London oder Zürich gelungen, wo sie weiterhin verkannt wurden.
René Klein kam ebenfalls aus einer jüdischen Familie, allerdings einer gutbürgerlichen, in der man sich von der Kunst fernhielt wie von einer ansteckenden Krankheit. Die Kleins waren seit Generationen im Elsass ansässig. Auch von ihnen hatten nur wenige überlebt.
An diesem Abend also tranken René und Miriam auf das Schicksal, das ihre Wege in Saarbrücken zusammengeführt hatte, jener Wiege westlicher Zivilisation. Das konnte nicht nur ein Zufall sein, hier war die Fügung am Werk. Man rauchte, man trank Rotwein, man tanzte eng umschlungen zu Mireille Mathieu.
Miriam trat im Staatstheater Saarbrücken auf, in einer undankbaren Nebenrolle als Sekretärin in einer Boulevardkomödie. Doch sie hielt sich für die nächste Romy Schneider. René mietete für sie eine kleine Dachwohnung im Nauwieser Viertel an. Dort verbrachte René gelegentlich die Nächte. Vorgeblich wollte er sich hier um die neue Dépendance kümmern, in Wirklichkeit jedoch um die hübsche Miriam, die hin und weg war von ihrem René mit seinem dunklen Haar und dem gepflegten Bart. Als ihr Theaterengagement auslief, wollte sie ihm nach Straßburg folgen, aber René fand immer wieder Gründe, wieso das gerade jetzt keine so gute Idee war. Warum nicht erst mal in Saarbrücken bleiben, meinte er, wo doch alles so gut lief? Miriam war verwirrt, aber sie fügte sich.
Schließlich fand sie eine Stelle beim Saarländischen Rundfunk. Allerdings nicht als Schauspielerin, sondern als Sekretärin, diesmal in echt. Besonders gut war sie nicht in dem Job. Sie konnte nur mit zwei Fingern tippen und fauchte am Telefon nicht selten die Anrufer an.
Dann wurde sie schwanger. René war wenig erfreut und drängte sie zu einer Abtreibung, aber Miriam zögerte die Entscheidung hinaus. Warum, das hätte sie nicht sagen können. Sie hatte lediglich das unbestimmte Gefühl, dass sie es bereuen würde. René beschwor sie: Ein Kind? Ausgerechnet jetzt? Er müsse sein Geschäft aufbauen. Später vielleicht, ja?
Doch Renés Bitten hatte den gegenteiligen Effekt. Miriam gefiel es, bekniet zu werden. Sie dachte an die einsamen Nächte, die sie in der kleinen Dachwohnung verbrachte. Wie oft hatte René sie schon versetzt, wie oft einen angekündigten Besuch verschoben? Doch jetzt wollte er etwas von ihr. Er lächelte, flirtete, strahlte. Es war fast wie am Anfang. René gab ihr Geld für die Abtreibung, aber Miriam kaufte davon einen Plattenspieler. Einen Grundig.
Als er davon erfuhr, kam es zum Streit. René war nervös. Die Zeit wurde knapp, bald wäre es zu spät. Schlimmstenfalls müsse man nach Forbach, zu einem »Spezialisten«, der nicht so viele Fragen stellte, René kannte da einen. Doch Miriam blieb standhaft. Endlich fand sie den Mut auszusprechen, was sie bereits seit Wochen wusste – dass sie das Kind auf jeden Fall behalten wollte.
René war fassungslos. »Ist nicht dein Ernst!«
»Doch«, erwiderte Miriam. »Und willst du wissen, warum?«
»Nein. Es interessiert mich auch nicht.«
»Weil jedes jüdische Baby ein Tritt in die Eier der Deutschen ist«, sagte Miriam.
Das imponierte René. Gerührt nahm er ihre Hand in die seine. »Das hast du schön gesagt.«
Miriam schaute ihn mit großen Augen an. Sie war eine hübsche Frau. Sie war klug und witzig und voller Leben. Mit ihr konnte man Pferde stehlen. Früh am nächsten Tag gingen die beiden zum Standesamt und heirateten.
Sieben Monate später kam der kleine Marcel zur Welt. Anfangs herrschte Euphorie. Miriam liebte ihr Kind, auch wenn sie sich eigentlich eine Tochter gewünscht hatte. Aber das war kein Problem, die rosa Babykleider tauschte René einfach bei Karstadt um.
Marcel hatte Koliken. Niemand wusste so recht, was das eigentlich war, auch nicht der Kinderarzt. Marcel schrie ganze Nächte lang. Miriam gab sich Mühe, aber trotz der bedingungslosen Liebe, die sie ihrem kleinen Marcel entgegenbrachte, war sie überfordert.
Von ihrem Mann kam kaum Hilfe. Renés Geschäfte liefen schlecht, er stand unter Druck. Ständig pendelte er hin und her. Doch selbst wenn er in der Stadt war, kam er selten zu seiner kleinen Familie. Er zog um die Häuser. Die Grenzstadt Saarbrücken war bekannt für ihre Bordelle, immerhin mussten hier jede Nacht anspruchsvolle Franzosen verköstigt werden.
Miriam wusste es oder ahnte es zumindest. Ihr Mann betrog sie und ließ sie wochenlang mit dem Baby allein. Allmählich schlief Marcel besser, aber er war weiterhin schwierig, hing ständig an ihrem Rockzipfel. Sie opferte sich auf, bis sie innerlich abgezehrt war. Sie begann sogar die Tipparbeit beim Rundfunk zu vermissen, was sie nie gedacht hätte. Und die Bühne war für sie in unerreichbare Ferne gerückt. In Zeitlupe zerschellten ihre Träume an den Klippen der Wirklichkeit. René schien mittlerweile jedes Interesse an ihr verloren zu haben. So trank sie hin und wieder heimlich ein Glas Rotwein. Dann noch eines. Und noch eines.
Als Marcel zwei Jahre alt war, wollte Miriam die Aufmerksamkeit ihres Mannes mit einem halbherzigen Selbstmordversuch erzwingen. Sie schluckte eine Handvoll Schlaftabletten, aber das war ein Eigentor – von nun an sah René sie als schwach an. Er nahm sie kaum noch wahr. Zu sehr war er damit beschäftigt, seine Reinigungen in die Insolvenz zu treiben.
Schon früh entwickelte Marcel eine eigenwillige, ungesunde Bindung zu seiner Mutter. Sie war sein Ein und Alles, er vergötterte sie. Den Vater sah er ohnehin nur selten. Doch je mehr seine Mutter trank, umso mehr entfernte sie sich von ihm. Sie trank die Nächte hindurch und schlief dann tagsüber. Sie trank mit Freunden, später mit Liebhabern, drehte gern die Musik auf: Reinhard Mey, Supertramp oder Rod Stewart. Marcel konnte dann nicht schlafen. Er lag im Bett und starrte still an die Decke.
Die Jahre vergingen. Marcel war ein Schlüsselkind, er hatte viel Auslauf, er kaufte ein, er kochte. Und kaum war er alt genug, zog es ihn ins Kino. Der Moment, in dem der Vorhang aufging, jener Moment der Erwartung war für ihn heilig. Von seinem Taschengeld kaufte er sich Kinokarten und Eiskonfekt. Das Eis schmolz immer viel zu schnell, aber die Kinokarten klebte er sorgfältig in ein Notizbuch, in dem er auch seine Gedanken über die gesehenen Filme verzeichnete. Im UT-Kino sah er die wesentlichen Action- und Horrorstreifen der frühen Achtziger: Freitag der 13.,Rambo,Delta Force und wie sie alle hießen. Die Kassiererin, eine Rentnerin, die sich zu Hause langweilte und ein bisschen schwarzarbeiten wollte, drückte ein Auge zu und ließ ihn auch dann in den Saal, wenn die Filme ab sechzehn oder gar ab achtzehn waren.
Doch sein Herz schlug für die Sommerferien – da wurden im Passage-Kino an der Bahnhofstraße sechs Wochen lang Filmklassiker gezeigt: Fenster zum Hof,Frankenstein Junior,Spider-Man gegen den goldenen Drachen,Es war einmal in Amerika,Zwölf Uhr mittags, Dracula jagt Mini-Mädchen … Jeden Tag etwas anderes. Und jeden Tag saß Marcel in der ersten Reihe und starrte verzückt auf die weiße Leinwand, die sich mit herrlichen Träumen füllte.
3
Jetzt saß er an einem Tisch in Cannes, schaute einer schönen Frau in die Augen und malte sich seine eigenen herrlichen Träume aus. Dann stellte er ihr die alles entscheidende Frage:
»Quel est votre film préféré? Ihr Lieblingsfilm?«
Von der Antwort hing viel ab. Wim Wenders war noch zu verzeihen, aber wenn sie ihm jetzt beispielsweise mit Fassbinder käme, wäre er gezwungen, aufzustehen und zu gehen.
Doch zu seiner Erleichterung sagte Héloïse, ohne nachzudenken: »Les temps modernes.«
Marcel atmete auf. Moderne Zeiten, ein Glück! Dagegen war nichts einzuwenden. Ganz im Gegenteil. Wer Chaplin nicht mag, hat einen schlechten Charakter. Wann hatte er den Film eigentlich das erste Mal gesehen? Vermutlich beim Schauspielstudium, als er frisch mit Allison zusammen war.
»Chapeau«, sagte er zu Héloïse.
Ihr Lächeln blendete ihn. Er rührte nervös in seinem Kaffee. Doch das klirrende Geräusch, das der Löffel dabei machte, irritierte ihn, also legte er ihn auf die Untertasse. »Aber warum Modern Times? Warum nicht … je ne sais pas … The Kid oder Circus? The Great Dictator?«
Die Antwort kam sofort: »Kein Film hat das zwanzigste Jahrhundert besser erfasst als Les temps modernes. Es ist eine Prophezeiung, aber gleichzeitig brüllend komisch.«
»Haben Sie eine Lieblingsszene?«
Héloïses Lächeln wurde noch breiter. »Erinnern Sie sich an die … wie sagt man … en allemand? Die, äh, manifestation?«
»Die Demo?«
»Oui, merci. Die Arbeiter marschieren die Straße entlang.«
»Je me souviens.«
»Dann kommt ein Lastwagen. Hinten ist eine rote Fahne, als Warnsignal.«
»Und die Fahne fällt runter«, sagte Marcel.
»Ja. Der Tramp kommt zufällig vorbei und hebt sie auf. Er will sie dem Fahrer zurückgeben und läuft hinter dem Lastwagen her, schwenkt die Fahne.«
Marcel musste grinsen. »Und die Demonstranten denken, der Tramp ist einer von ihnen, ein Kommunist. Ohne es zu merken, wird Chaplin zum Anführer einer Arbeiterbewegung.«
»Voilà! Und dafür kommt er ins Gefängnis. Dabei wollte er doch nur die Fahne zurückgeben.« Héloïse beugte sich vor. »Aber wissen Sie, was das Beste ist?«
»Sie werden es mir sicher gleich sagen.«
»Woher wissen wir, dass die Fahne rot ist? Der Film ist schwarz-weiß.«
»Der Kontext?«
»Mais oui«, sagte sie. »Wir meinen, eine Farbe zu sehen, die gar nicht da ist. C’est génial!«
»C’est Chaplin«, stimmte er ihr zu.
Ein Räuspern ließ Marcel zusammenfahren. Der schöne Kellner stand mit einem Kaffee am Tisch, herbeigezaubert durch einen Wink von Héloïse. Er stellte die Tasse ab und fragte, was Madame wünsche.
Sie wünschte zwei Eier und ein Brötchen mit Butter und Marmelade. Als der Kellner nickte, lächelte ihn Héloïse ein wenig zu lang an. Marcels Neid erglühte zur Eifersucht. Er beugte sich scheinbar konzentriert über seine Unterlagen, blätterte aber nur hin und her, machte mit seinem teuren Montblanc bedeutungslose Notizen. Innerlich kämpfte er gegen ein unerklärliches Gefühl von Verletztheit an. Er war erleichtert, als der Kellner endlich ging.
»Ich traue ihm nicht«, sagte Marcel.
»Pourquoi pas?«, fragte Héloïse. Die plötzliche Schärfe in seiner Stimme nahm sie nicht wahr. »Warum nicht?«
»Der Bart«, sagte Marcel. »C’est dégueulasse. Männer mit Bärten haben immer etwas zu verbergen, meinen Sie nicht auch?«
»Ah oui?« Verschmitzt fügte sie hinzu: »Und Sie? Haben Sie auch etwas zu verbergen?«
»Ich?«
»Ja. Sie.«
Marcel lachte gekünstelt und starrte auf seine Hände. Er fühlte sich ertappt. Noch vor wenigen Sekunden war er angriffslustig gewesen. Jetzt wurde es ungemütlich.
Ihr schien klar zu werden, dass etwas nicht stimmte, dass Marcel nicht mitmachte bei ihrem Scherz. »Ist … ist alles in Ordnung?«
Er nickte, ohne den Blick von ihr abzuwenden. »Sie machen sich lustig über mich.«
Héloïse bemühte sich um ein Lächeln. »C’est que vous êtes drôle.«
»Sie haben nicht die geringste Ahnung.« Marcel hatte heiter klingen wollen, doch sie konnte die Wut hören, die in seinen Worten mitschwang, so klar und rein, dass sie erschrak.
Marcel sah ihre Reaktion und schämte sich. Sein Ärger war verflogen. Er wandte den Blick ab. »Es tut mir leid …«
Einige Sekunden saßen sie beide betreten am Tisch. Dann schaute Héloïse mit einer übertriebenen Geste auf ihre Uhr und sagte, sie müsse jetzt wirklich los. Marcel stammelte ein paar hilflose Worte, aber es gelang ihm nicht, sie aufzuhalten. Mit vollendeter Höflichkeit empfahl sie sich, nahm ihre Handtasche und ging.
Marcel schaute zu, wie sie aus seinem Blickfeld verschwand. Er sackte in sich zusammen. Er überlegte, ob er ihr hinterhergehen sollte, besann sich dann aber eines Besseren.
Wieder ein Räuspern. Vor ihm stand der Kellner mit einem Tablett. Gewandt trug er Héloïses Frühstück auf: »Et voilà, m’sieurs-dames.«
Marcel fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Er tat so, als blende ihn die Sonne, in Wirklichkeit wollte er nicht gesehen werden in seiner Scham. Der scheinbar wohlwollende, unterschwellig jedoch spöttische Blick des Kellners brannte sich ihm ein. Er wusste, dass der Mann ihn verachtete, dass er heimlich über ihn lachte. Wie könnte es auch anders sein? Nichts auf der Welt ist so amüsant wie die Verzweiflung anderer.
4
Sein Chef rief in genau dem Moment an, als Marcel vor dem Badezimmerspiegel erfolglos versuchte, zu masturbieren. Fluchend zog er die Hose hoch und griff nach dem Handy. Er hatte Dampf ablassen wollen, aber die misslungene Begegnung mit dieser Héloïse hing ihm nach. Normalerweise ging es bei ihm schnell. Allison, seine Exfrau, hatte sich in Los Angeles immer darüber beschwert, dass der Sex mit ihm so »effizient« sei. So »deutsch«.
Er nahm den Anruf entgegen. »Ja?«
»Marcel?«, fragte Thilo Sondermann. »Alles in Ordnung, Alter? Du klingst so gehetzt.«
»Ach so, ja …« Marcel räusperte sich. »Ich war … äh … im Stress.« Er wurde auf einmal von einem diffusen Schuldbewusstsein geplagt. Wie so oft, wenn er mit seinem Chefredakteur sprach. »Läuft bei euch in Berlin?«
»Das übliche Irrenhaus«, sagte Thilo. »Und du? Partys und Schampus?«
Marcel lachte gekünstelt. Er klemmte das Handy zwischen Ohr und Schulter, dann knöpfte er die Hose zu. Während Thilo die Planung für das nächste Heft erläuterte, wusch sich Marcel die wohlriechende Lotion, die es in Hotels immer gratis gab, von den Händen. Zufällig erhaschte er einen Blick im Spiegel. Sein Anblick beschämte ihn jedes Mal. Der junge Mann, der er einst gewesen war, war kaum noch zu erkennen. Er war sich selbst ein Fremder.
»… und wegen A Light in the Dark …« Thilo hatte gerade mit den Publicityleuten des Studios gesprochen, es gab grünes Licht für das One-on-one morgen mit Eva Vargas.
»Supi«, meinte Marcel mit sarkastischem Unterton und verließ das Bad. »Mal sehen, was die so beizutragen hat zum kulturellen Dialog.«
»Werd nicht rotzig«, mahnte Thilo lachend. »Die Kleine ist die halbe Miete. Die machen wir aufs Cover. Titelstory, acht Seiten.«
»Ja, schon klar. So was geht immer. Weltkrieg und so.«
Marcel ging durch das Hotelzimmer und suchte seine Unterlagen für heute zusammen. Das Zimmer war karg. Ein Bett, zwei gepolsterte Stühle und neben der Balkontür ein schmuckloser Tisch, auf dem seine Olivetti-Schreibmaschine stand. Aber wenigstens gab es eine Minibar, dem Herrn sei gedankt.
»Besser Weltkrieg als Superhelden«, sagte Thilo. »Und wann ist das RT mit Spielberg? Der ist zwar nur als Producer dabei, aber egal, ist halt Spielberg.«
»Morgen. Keine Sorge, ein paar gute O-Töne bringe ich dir mit.« Er schaute zu den drei neonfarbenen Pop-Art-Porträts, die über seinem Bett hingen, die Heilige Dreifaltigkeit des Kinos: James Dean, Humphrey Bogart und Audrey Hepburn. Wo war sie, die Audrey Hepburn von heute? Warum waren die Stars alle so … so fad?
»Wir stecken mitten in der Abgabewoche«, sagte Thilo abschließend, »also tipp bitte gleich alles ab und mail es uns rüber, okay? Nicht wie damals in Toronto, als du …«
»Fick dich!«, unterbrach Marcel. »Toronto!«
Thilo lachte. »Und nicht so viel saufen!«
Marcel grinste und beendete das Telefonat. Er griff nach seiner Aktentasche, verließ das Zimmer, fuhr mit dem Aufzug nach unten und … erstarrte.
Denn am Empfangsschalter sah er Rudi Müller, seinen Erzfeind. Müller war ein im Solarium gebräunter Erfolgsmensch, der die Arbeit von unbezahlten Praktikantinnen erledigen ließ und dann nur noch seinen Namen unter die Artikel setzte. Und natürlich das Geld kassierte.
Dass Müller offenbar auch im Hôtel de Provence wohnte, war zwar unschön, aber nicht weiter überraschend. Die Studios brachten die Journalisten gerne am selben Ort unter, das machte es für alle einfacher. Marcel wollte sich vorbeischleichen, aber ihre Blicke trafen sich. Beide zwangen sich zu einem übertriebenen Lächeln.
»Rudi, mein Lieber.«
»Marcel, mein Guter.«
Die Kontrahenten fielen sich in die Arme, klopften sich auf den Rücken und lachten laut. Müller fragte, ob Marcel nachher noch zur PK mit Scorsese komme, dem diesjährigen Jurypräsidenten, der heute die Filmfestspiele offiziell eröffnen sollte. Marcel winkte ab. Um Gottes willen! Marty Scorsese! Der Giftzwerg! Er hatte Marcel mal bei einem Interview vor versammelter Mannschaft beschimpft, woraufhin Marcel vor Schreck sein Mikro hatten fallen lassen. Ein Schmock!
»Na, dann sehen wir uns gleich bei Big Boy II?«, fragte Müller.
»Aber ja doch«, sagte Marcel und lächelte den Feind strahlend an. Lächeln konnte er. So hatte er sich bisher immer gut durchs Leben gemogelt. Lächeln bis zum Umfallen.
Er winkte zum Abschied, dann floh er ins Freie, durch den Vorgarten des Hotels. Auf der Rue Molière wurde er von einer Geräuschkulisse empfangen – wütendes Hupen, knurrende Autos, knatternde Vespas. Er ging in Richtung Croisette, vorbei an prunkvollen Apartmenthäusern des Fin de Siècle. Schweißtropfen standen auf seiner Stirn. Beim Gehen nahm er den Hut ab und fächelte sich Luft zu. Eine Hitzewelle hielt die Côte d’Azur umschlungen.
Die Menschenmenge wurde dichter. Marcel bog um eine Ecke und war plötzlich auf der Croisette, der berühmten Promenade, die man aus dem Fernsehen kannte. Er kämpfte sich durch in Richtung des Festival-Palais, ein schmuckloser Klotz aus weißem Beton und blauen Glasfronten. Zu seiner Linken lag der Strand mit den Beachclubs, wo die Menschen unter Sonnenschirmen saßen und Rosé tranken. Das tiefblaue Meer funkelte hinter ihnen, darüber der unendliche Himmel … Jedes Mal ein hinreißender Anblick, obwohl Marcel, der schon ein paar Mal in Cannes gewesen war, immer so tat, als sei er abgebrüht.
Die Leute um ihn herum waren beladen mit Tüten und Taschen, Papieren und Prospekten. Die Filmfestspiele zogen eine bunte Menagerie an, die Komparsen des Metiers. Marcel liebte und hasste sie, die Jungs und Mädels von den Studios und Produktionsfirmen, die vom Verleih und den Kinoketten, die großen und kleinen Macher, und natürlich die Starlets … Jede Menge Starlets, die in freizügiger Kleidung für die Kameras posierten. Er schlängelte sich durch das Gewühl verschwitzter Körper. Ihm kam das alles wie ein Fiebertraum vor … die Sonne, der Lärm, die halbnackten Girls, die Paparazzi, die Fans, die Cosplayer – die Fauna des Festivals.
Plötzlich versperrte ein Mann ihm den Weg. Auf dessen Schulter krallte sich ein Äffchen fest, das Marcel anfauchte. Erschrocken trat er zurück, bevor das Mistvieh noch auf die Idee kam, ihn mit Kacka zu bewerfen. In solchen Momenten beneidete er die Filmstars um ihre Limousinen und Privatjets, die sie vor dem Pöbel schützten. Er hingegen war umwabert von fleischgewordenem Surrealismus – von Fellini, von Buñuel. Und offenbar auch von Affen.
5
Als er endlich seinen Presseausweis hatte, ging er weiter zum Carlton. Vor dem Eingang huschten die Türsteher beflissen zu den Luxusschlitten. Marcel betrat den protzigen Belle-Époque-Palast und ließ das Gedränge hinter sich, atmete wieder klimatisierte Luft. Im Foyer lungerten attraktive Menschen auf unbequemen Sofas und tippten auf ihren Smartphones. Man sprach im Flüsterton. Der Klassenfeind war überall. Marcel wusste, dass er niemals dazugehören würde. Er war ein ewiger Zaungast.
Am Empfang erkundigte er sich nach der Pressekonferenz zu Big Boy II. Der Concierge verwies ihn in den Grace-Kelly-Konferenzsaal im ersten Stock – benannt nach der legendären Schauspielerin, die ihren Weltruhm vor allem Alfred Hitchcock verdankte und die mit ihrem Auto bei Monaco in einen Abgrund gestürzt war. Posthum hatte man sie dadurch geehrt, dass man das Krankenhaus, in dem sie gestorben war, nach ihr benannte. Und offenkundig auch einen Konferenzsaal im Carlton. Eine kurzhaarige junge Dame rief den Aufzug herbei und hielt Marcel die Tür auf. Als sich die Aufzugstür schloss, war er erleichtert, allein zu sein. Die Unterwürfigkeit der Angestellten war ihm peinlich.
Im ersten Stock begrüßte ihn ein Pappständer mit dem Filmplakat zu Big Boy II – John Travolta lehnte sich verschwitzt und mit Knarre in der Hand an einen roten Ferrari. Das Filmplakat wies den Weg zur ›Hospitality Suite‹, dem Nervenzentrum bei solchen Veranstaltungen. Der weiche Teppich im Gang dämpfte Marcels Schritte. Im Vorraum des Konferenzsaals drängelten sich schon die Kollegen. Sie umringten einen Schreibtisch, hinter dem zwei Praktikantinnen verkrampft lächelnd die Namen der Teilnehmer auf einer Liste abhakten. Marcel kannte ihren Typus – jung, weiß, sexy und gestresst. Sie lebten in ständiger Angst vor ihren Chefs und vor den Pranken der Journalisten, die oftmals einen Tick zu lang auf Schulter oder Rücken verharrten.
Hinter den beiden stand Stevie Hoang, ein gutaussehender, etwas einfältiger Typ in einem weißen Anzug und Schlupfschuhen ohne Socken, was Marcel ekelhaft fand. Stevie Hoang war früher mal US-Korrespondent bei einem britischen Kinomagazin gewesen, aber dann war er zur dunklen Seite der Macht übergelaufen. Es hatte sich wohl gelohnt, denn jetzt leitete er die Publicity-Abteilung des Studios. Er strahlte Marcel an. »How are you? How was your flight?«, fragte er, wollte es dann doch nicht so genau wissen. Er hakte Marcels Namen auf der Liste ab und gab ihm eine Geschenktüte vom Gabentisch hinter ihm. Es war üblich, die Journalisten mit kleinen Aufmerksamkeiten zu bestechen. ›Swag‹ nannte man das. Meistens war es Tinnef: Basecaps, Notizblöcke, Thermosflaschen und so weiter. Marcel schaute in die Tüte. Diesmal handelte es sich um ein T-Shirt und einen Spielzeug-Ferrari, versehen mit dem Titel des Films. Marcel schaute sich das Plastikauto enttäuscht an.
»For your kids«, sagte Stevie Hoang lächelnd. »You have kids, don’t you?«
Marcel schüttelte den Kopf. Kinder waren eines der großen Streitthemen in seiner Ehe gewesen. Er bedankte sich und ging in den Konferenzsaal.
Fünfzig Klappstühle standen präzise aufgereiht vor einem Podium, ganz hinten im Saal war das allseits beliebte Büfett. Auf einem Flatscreen an der Wand liefen Ausschnitte aus Big Boy II: Autoverfolgungsjagden, Schusswechsel und natürlich Travolta, der in Zeitlupe vor Explosionen wegrannte.
Ein paar Kollegen standen herum und unterhielten sich. Auch Rudi Müller war bereits hier. Sie warfen sich einen gequälten Blick zu und wandten zeitgleich den Kopf ab. Die anderen konnte Marcel besser leiden. Yoko aus Japan, María aus Spanien, Didier aus Belgien (ausnahmsweise nüchtern), der blinde Sérgio aus Brasilien und natürlich die alte Francesca aus Italien. Marcel gehörte zu einer internationalen Clique, die sich alle paar Wochen bei Filmfestspielen und Presseveranstaltungen traf, sogenannten ›Junkets‹. New York, Los Angeles, Berlin, Venedig, Toronto, sie reisten um die ganze Welt. Für Marcel waren seine Kollegen schemenhafte Gestalten, die nur kurz in seinen Fokus gerieten und danach, wenn er wieder ins normale Leben zurückkehrte, unscharf wurden. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, war es immer eine Freude, sie zu sehen. Man umarmte sich, man aß und trank gemeinsam, man tratschte über das Kino und die Branche. Man war Mischpoche.
Marcel begrüßte die anderen mit unbeholfenen Umarmungen, dann suchte er sich einen Sitz vorm Podium. Wer