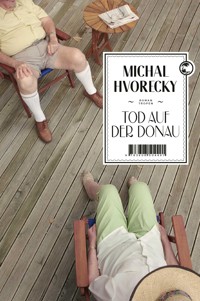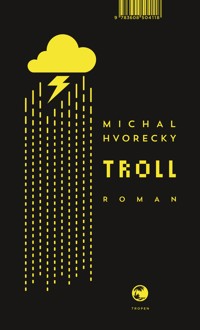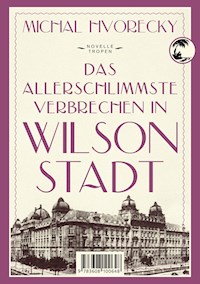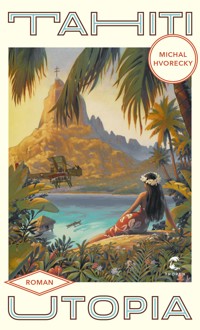
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Mensch braucht eine Utopie und die Welt ist zum Verändern da. Willkommen auf Tahiti! Wie sähe die Welt aus, wenn es Großungarn noch geben und die Slowakei nicht existieren würde? Was wäre mit den Slowaken? Man würde sie auf Tahiti finden, dieser kleinen Insel mitten im Pazifik, mit ihren schönen Stränden, weit weg von der westlichen Zivilisation. Denn wer will nicht ein Stück vom Paradies? Wir schreiben das Jahr 2020, Großungarn existiert noch und mittlerweile leben drei Generationen Slowaken auf Tahiti. Wie kam es dazu, was hat sie dorthin verschlagen? Haben sie das Abenteuer und ein besseres Leben gesucht oder wurden sie doch aus Großungarn vertrieben, wie manche behaupten? Andere erzählen, dass sie einst von Milan R. Stefanik, dem berühmten Diplomaten, Astronomen, Dichter und General dorthin geführt wurden, um der Unterdrückung zu entfliehen und die Slowakei neu zu gründen. Was man weiß, ist, dass auch sie ein Stück des paradiesischen Atolls für sich wollten. Doch der Traum, in der Südsee ein freies Leben zu führen, entpuppte sich im Aufeinanderprallen der Kulturen schnell als Luftschloss … Ein Roman, der die Geschichte auf den Kopf stellt, und eine Betrachtung des neuen Nationalismus. Die mitteleuropäische Geschichte wurde noch nie so unterhaltsam erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michal Hvorecký
Tahiti Utopia
Roman
Aus dem Slowakischen von Mirko Kraetsch
Impressum
Die Übersetzung wurde gefördert durch SLOLIA, das Literarische Informationszentrum in Bratislava
Der Autor dankt dem Slowakischen Nationalmuseum in Martin für die Erlaubnis zwei Fotografien von M. R. Štefánik verwenden zu dürfen.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Tahiti« im Verlag Marenčin Media, Bratislava
© 2019 by Michal Hvorecký
Für die deutsche Ausgabe
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover unter Verwendung der Daten des Originalverlags
Design: © Palo Bálik 2019
Datenkonvertierung: Tropen Studios, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-50475-0
E-Book: ISBN 978-3-608-12106-3
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Gewidmet Radana
An Tahitis Küsten tobt die Wellengischt.
Doch rudert weiter, Brüder, die Wellen werden müder, Land ist schon in Sicht.
Lange hat Tahiti wie im Schlaf verbracht, doch die Naturgewalten helfen durch ihr Walten, dass es nun erwacht.
Noch wuchert auf Tahiti dichtes Dschungelgrün.
Wir haben uns verpflichtet: Das Dickicht wird gelichtet in eifrigem Bemüh’n.
Wer wahrhaft als Slowake fühlt, hat das Surfbrett stets zur Hand.
Die Stunde hat geschlagen.
Lasst’s uns gemeinsam wagen!
Tahiti, Ruhm dem Heimatland!
TRADITIONELLER HYMNISCHER NATIONALGESANG
Der Himmel ist die Schale. Auch der Mann ist eine Schale.
Die Frau ist die Schale des Mannes. Der Mann ist die Schale der Frau.
Schalen gibt es so viele, dass man sie nicht zählen kann.
Vor langer, langer Zeit passte die ganze Welt in eine Kokosnuss.
Auf ihrem Grund war das erste lebendige Wesen zu Hause. Es existierte für sich alleine, in tiefer Verwirrung und Unsicherheit.
Das Geschöpf schwebte am Grund im Nichts und war umgeben von endloser Dunkelheit. Es dauerte unermesslich lange, bis eines Tages die Schale endlich platzte. Ein Lichtschein zeigte sich.
Über dem Ozean kreiste der treue Bote des Himmels, ein blauer Vogel, und suchte verzweifelt nach Festland. Er hatte das dringende Verlangen, sich zu setzen und zu verschnaufen. Die Schale war zu seiner ersten Behausung geworden und gleichzeitig zum Himmelsgewölbe.
Auf einmal fiel ein großer Felsen vom Himmel ins Meer und bildete die erste Insel. Dann kamen weitere hinzu, noch rau und unwirtlich. Steine und Klippen trafen aufeinander und freundeten sich an, sie stießen gegeneinander und wälzten sich herum, einer mit dem anderen, schwarze und weiße, spitze und flache, von der Küste und vom Gebirge, Kap und Bucht.
Der Vogel beschwerte sich, dass man sich auf dem nackten Felsen nicht vor der Sonne verbergen konnte. Daher begannen Regentropfen zu fallen, es entstand die Erde und aus ihr wuchsen nach einiger Zeit die ersten Rankenpflanzen hervor. Als die abgestorben waren und verrotteten, schlüpften aus dem Abfall Würmer und aus denen entstand später der Mensch.
Aus den Tiefen quoll Sand hervor und deckte Ebenen und Strände zu. Durch eine schmale Öffnung in der Erde strömte Wasser, rechts Süßwasser ins Landesinnere, und links Salzwasser, das immer mehr wurde. Die Urheimat befand sich auf den Irrlichternden Inseln, die immer wieder einmal am Horizont auftauchten, aber sobald irgendwer mit dem Finger auf sie zeigte, verschwanden sie gleich wieder.
1923
Viele hatten ihn zu überreden versucht, er möge nicht fliegen. Doch niemandem war es gelungen, weder seinen engsten Mitarbeitern noch seinen Geliebten. Für die Parade hatten sie ihm ein Schnellboot und eine Droschke als Ersatz angeboten, beides hatte er abgelehnt. Sie hatten ihm einen erfahrenen Co-Piloten vorgeschlagen, womit sie ihn regelrecht beleidigt hatten. Er war fest entschlossen, die Maschine bei den ersten Nationalfeierlichkeiten auf Neu-Slowakien allein zu steuern.
Vor den versammelten Journalisten verkündete er während des Aufmarschs: »Unsere Körper haben wir bereits hierher befördert. Jetzt geht es darum, unsere Seelen zu verwandeln. Und das wird ein neuer Sieg, den wir erringen müssen, denn jeder weitere Fortschritt hängt davon ab.«
Er liebte das Abenteuer, die Höhe, die Geschwindigkeit, die Bewegung. Er gehörte zu den ersten Spitzenpiloten auf der Welt. Flüge über Russland nutzte er, um die Einwohner vor dem drohenden Bolschewismus zu warnen. Seine Flugerfahrungen baute er an den Fronten des Ersten Weltkriegs aus. Eine Vielzahl an Erkundungsflügen führte ihn bis weit ins gefährliche Hinterland.
Aus der Luft sah er das dichte Netz der Schützengräben, die sich von Belgien im Norden bis zu den Alpen im Süden erstreckten, entlang der russischen Grenze zu Deutschland und Österreich-Ungarn bis auf den Balkan. In Westeuropa überflog er zerbombte Geländestreifen, die mit endlosen Reihen aus Kreuzen übersät waren. Tausende von Häusern, von denen nur verkohlte, leere Gerippe übrig geblieben waren. In der Umgebung der Festung von Verdun, Ort der schlimmsten Kämpfe auf französischem Territorium, wuchs nichts mehr, und die Vögel waren verschwunden. Die Flussufer der Marne waren dicht mit Leichen übersät.
Das sumpfige Gebiet der Champagne mit den Rot-Kreuz-Zelten, überflutete Kohlebergwerke, von denen die französische Wirtschaft abhängig war, die Fabriken in Schutt und Asche oder nach Deutschland abtransportiert. Ob seine Hände von selbst zitterten oder durch die Vibrationen des Flugzeugs, wusste er nicht. Er überbrachte wichtige Berichte über feindliche Truppenbewegungen. Er war der Begründer der Militärmeteorologie und lieferte seinen Befehlshabern die ersten Wetterberichte, die auch zutrafen und für zahlreiche Einheiten eine große Hilfe waren, womit er viel Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Er wies auf aktuelle oder anstehende gefährliche Witterungsbedingungen hin, wertete Frontensysteme aus und beobachtete Gewitterwolken. Die Meteorologie betrachtete er für das Flugwesen als genauso unabdingbar, wie es die Atemluft für das Leben der Menschen war. Über österreichisch-ungarischen Schützengräben warf er Flugblätter ab und animierte die Soldaten zum Desertieren:
Slowaken! Slawen! Teure Brüder!
Die Stunde der Befreiung naht! Eure politischen Vertreter haben in Frankreich, England, Rußland und Amerika eine große Organisation geschaffen, die eifrig auch an der Befreiung unseres Volkes arbeitet.
Gerade jetzt bauen wir unsere erste eigene Armee auf. Burschen, Männer, die ihr uns lieb und teuer seid, helft auch Ihr uns! In Euren Händen liegt heute die Zukunft. Kämpft nicht für den Erzfeind! Laßt ab von Italien, das heute ebenfalls auf unserer Seite steht und für die Befreiung der Völker in Mitteleuropa kämpft.
Paris, im Juni 1916.
Für das Slowakische Auslandskomitee: Dr. Milan Štefánik
Für seine außerordentlichen Manövrierfähigkeiten in der Luft ernannten ihn die Franzosen strategisch zum ersten General slowakischer Herkunft und verliehen ihm den höchsten militärischen Rang.
Die Beförderung nahm er konsterniert zur Kenntnis, sie war ihm erstaunlich schnell zuteilgeworden, für den hohen Rang hatte er weder genügend Fähigkeiten vorgewiesen noch die entsprechende Qualifikation oder Praxis. Er begriff, dass nur der akute Mangel an slowakischen Führungskräften ihm solch einen atemberaubenden Aufstieg ermöglicht hatte.
Schon als er Offizier geworden war, hatte er sich zum Ziel gesetzt, seine Kenntnisse der Militärwissenschaften, des strategischen Planens und Führens möglichst weit zu perfektionieren. Immer ging es ihm um den Erfolg, in allem, was er im Leben anfing. Er wollte gelobt und bewundert werden. Bereits an der Universität in Prag war ihm sein früheres stilles, provinzielles Leben als etwas weit Zurückliegendes erschienen. Er studierte so lange, bis er belobigt und den anderen als Vorbild hingestellt wurde.
Sobald er eine Sache erreicht hatte, stürzte er sich sofort in eine neue. Und machte so lange weiter, bis er auch darin erstklassig war.
Alles in der Metropole kam ihm bunt und neu vor und alles wurde durch seine Gegenwart so hell erleuchtet. Früher hatte er nichts, und jetzt entdeckte er die mannigfaltigsten Reichtümer. Er erlebte die Höhepunkte seiner Welteroberung.
Schädlich waren für ihn lediglich seine Frauengeschichten und die Schulden, die er überall machte, um sich seinen kostspieligen Lebensstil leisten zu können. Er wohnte prinzipiell in Luxushotels und kaufte teure Kleidung, die er gern mit seinen Auszeichnungen schmückte.
Seit jeher hatte er ein Faible für Nervenkitzel, Gefahr und Selbstaufopferung. Er quoll regelrecht über vor Energie. Er brauchte Bewegung, kein ruhiges Dahindümpeln. Keine Position, die er erlangte, konnte ihn voll zufriedenstellen. Hals über Kopf stürzte er sich auch in Aufgaben, um die andere einen Bogen machten.
Mehrere Male kehrte er von riskanten Missionen mit Schäden an seiner Maschine zurück. In einem Archiv fand ich eine handschriftliche Notiz von ihm: »Ich fliege über feindliche Positionen. Bei jedem Flug schießen sie auf mich. Bis jetzt bin ich nicht verwundet. Meine Pflicht erfülle ich eifrig, um dem slowakischen Volk alle Ehre zu machen und meine aufrichtige Liebe gegenüber Frankreich und Polynesien zum Ausdruck zu bringen.«
Die Piloten fingen zu jener Zeit gerade erst an, größere Entfernungen in der Luft zurückzulegen. Die Strecken wurden immer länger, oft zum Preis von Verletzten und Todesopfern. Es kam zu internationalen Wettbewerben darum, wer es weiter schaffte. Für die Überwindung von Rekordentfernungen wurden attraktive Preise ausgeschrieben. Jeder Flug bedeutete ein Risiko und eine körperliche Belastung, bei schlechtem Wetter besonders, denn die ungeschützte Besatzung war im Cockpit stundenlang den Witterungsbedingungen ausgeliefert.
Die zum Schwimmerflugzeug umgerüstete Caproni 450 mit der Registriernummer 11 495 bestand aus einer mit hellbraunem Leinen überzogenen Holzkonstruktion. Der dreimotorige schwere Doppeldecker-Bomber gehörte zu den modernsten Maschinen der alliierten Luftstreitkräfte. Die Baureihe litt allerdings unter gravierenden Mängeln, die auf die Entstehungszeit und auf Beschränkungen in technischer Hinsicht zurückzuführen waren.
Stolz hatte er sich die Maschine direkt vom Entwickler Giovanni Caproni aus Italien einmal über die halbe Erdkugel liefern lassen. Zwei der Motoren mit einer Leistung von je hundertfünfzig Pferdestärken hatten die Konstrukteure in seitlichen Gondeln auf den unteren Tragflächen platziert, der dritte trieb den Schubpropeller an.
Der Pilot saß hinter dem Navigator, und im rückwärtigen Teil, noch hinter den vollen Treibstofftanks, wurde die Besatzung durch einen Mechaniker komplettiert. Für Kampfhandlungen bestand die Ausrüstung aus zwei Fiat-Revelli-Maschinengewehren und Zweihundert-Kilo-Bomben, die unter der mittleren Gondel eingehängt wurden.
Warum war er so wild entschlossen, wieder zu fliegen? Vielleicht wollte er sich das Ergebnis seiner jahrelangen Bemühungen detailliert von oben anschauen. Vermutlich lag ihm daran, auf der ersten Feierlichkeit im Exil zu sehen, wohin er seine Landsleute geführt hatte, vom Himmel aus zu verfolgen, wie die Kolonisierung voranschritt, wie sich die Kokosplantagen ausdehnten, wie schnell neue Strohhütten hinzukamen, hier und da mit den für Čičmany typischen weißen Verzierungen oder mit Mustern aus Detva.
Oder er wollte das Observatorium sehen. In den Himmel eintauchen und die langen Dschungelstreifen betrachten, die einander ähnelten und unter ihm als Reihen aus uralten, von Rankenpflanzen aneinander gefesselten Bäumen vorbeiglitten.
Štefánik, ein kleiner, kränklicher Mann, aus dessen zerfurchtem Gesicht dennoch klare Augen strahlten, litt an Bauchschmerzen und Krämpfen und hinkte. Seine alltäglichen gesundheitlichen Strapazen hielt er kraft seines Willens in Schach und verbarg sie mit größter Anstrengung vor der Öffentlichkeit. Sich auszuruhen und zu regenerieren, war ihm fremd.
Nach dem Krieg wurde er oft von Schwächeanfällen heimgesucht, plötzlichen Bewusstseinsverlusten, ausgelöst von einer ungenügenden Durchblutung des Gehirns. Anfänglich fiel er nur sporadisch in Ohnmacht, seit 1918 allerdings bis zu zehnmal am Tag. Sein Zustand verschlechterte sich rapide, was es ihm unmöglich machte, auch nur die grundlegendsten militärischen und politischen Aufgaben zu erfüllen.
Seinen letzten Winter in Sibirien verbrachte er fast durchgängig im Dämmerzustand, ihn störte schon das geringste Geräusch oder plötzliches grelles Licht. Er aß fast nichts. Nur unter Einfluss starker Betäubungsmittel fand er Schlaf. Sein Leibarzt konnte ihm lediglich ein paar Löffel Tee oder Kaffee am Tag einflößen.
Diese Gebrechlichkeit schwächte auch seine labile Psyche. Im Oktober 1918 verlor er das Bewusstsein, als er in Japan gerade die Hauptvertreter der Legionäre aus Sibirien empfing, ein paar Monate später wiederum auf einem Schiff, mit dem er nach Tahiti unterwegs war, als ihn nämlich die telegraphische Nachricht in Aufregung versetzte, dass in Prag französische und italienische Soldaten mit Edvard Beneš an der Spitze eingezogen waren.
Auf einem Foto, das die Besatzung der Caproni kurz vor dem Start zeigt, sieht man etwas Ungewöhnliches: Männer in sommerlicher Montur unweit des Flugzeugs – und hinter Štefánik in seiner Sommer-Feiertagsuniform mit Tressen und Auszeichnungen steht ein Stuhl. Der geschwächte General konnte sich nicht auf den Beinen halten, vor dem Abflug musste er sitzen und war nur für das Foto aufgestanden. Aber auch seinen schlechten Gesundheitszustand wusste er noch geschickt zur Selbstdarstellung auszunutzen: Wenn es um die Freiheit und das Wohl des Volkes ging, würde er unter allen Umständen arbeiten.
Ich kann mich an dem Foto gar nicht sattsehen. Die Augen mit der strahlenden Iris und den auffälligen weißen Ecken blicken müde in die Welt. Dabei fühlte er sich auf dem Pilotensitz seit jeher in seinem Element. Als wäre er in der Höhe sicherer unterwegs als mit den Füßen auf dem Boden. Vermutlich brauchte er einen gewissen Abstand von seinem Planeten – ein Phantast, Dichter und Schwärmer, der gleichzeitig Wissenschaftler, Pragmatiker und Staatsmann war. Vielleicht zog es ihn deswegen so stark zur Astronomie, zu den Sternen, dank derer er Polynesien entdeckt hatte.
Auf Tahiti war verständlicherweise noch kein Flugplatz gebaut worden, doch dank der Stabilisierungsschwimmer konnte seine Maschine auf dem Meer starten und landen. Der Militärattaché kümmerte sich ums Vorbereiten der Navigationspunkte.
Im Verlauf der letzten drei Tage waren in der Hauptstadt und auf dem Land Gebäude und Freiflächen in allen Farben erblüht. Aus den Fenstern hingen slowakische und französische Fahnen und über die Hauptverkehrsader spannten sich Ehrenpforten. An den ramponierten Mauern der Zentralpost wehte das Stadtwappen, weitere flatterten in dichtem Gewirr an Fahnenstangen. Gegenüber der Nationalbank war unter einem blau-weiß-roten Baldachin eine Tribüne mit vergoldetem Geländer aufgestellt. Auf der kleinen Bühne ein Stück weiter würde am Abend eine Laientheatergruppe ihre Vorstellung von der Donaukarawane noch einmal aufführen.
An einer erhöhten Stelle würden schon bald der General und Regierungsvertreter erscheinen. Gegenüber auf dem Vorhof waren zwei weitere Holzpodien für die Veteranen zusammengezimmert worden, damit sie von dort aus die Parade verfolgen konnten. Daneben hatten sich die vereinigten slowakischen und französischen Blaskapellen versammelt, die jedoch beim Stimmen nicht auf einen Nenner kamen.
Straßen, Fenster und Balkone hatten sich schon vor dem Beginn mit neugierigen Gesichtern gefüllt. Passanten lehnten sich auf die Geländer oder hielten sich an Laternen fest. Die Patrioten hatten auch die Statue dicht umlagert. Bei fast allen Männern in der Menge strahlten an den Revers Kokarden in den Nationalfarben oder Mini-Fähnchen.
Die Feierlichkeiten würden jeden Moment beginnen. Ideales Wetter, schwacher Wind, ausgezeichnete Fernsicht. Ein Junge war auf einen Elektromast geklettert und schrie hysterisch: »Er ist gestartet!«
Gewaltiger Jubel brach los.
Štefánik zog drei große Schleifen über den Inseln, er umflog Tahiti-Liptavi und Tahiti-Tatrai und segelte längere Zeit über dem Ozean dahin. Für einige Zeit war er außer Sicht, offensichtlich wollte er wieder einmal alleine sein.
Das Azurblau des Himmels war gestochen scharf. Über dem flachen Horizont strahlte jetzt am Vormittag eine kräftige Sonne. Es war brüllend heiß. Schwärme weißer Reiher flogen in Richtung Wasser. Das Dickicht aus Büschen und vorsintflutlichen Farnen zog sich bis in endlose Ferne. Die Katen am Ufer, die dort in kleinen Grüppchen standen, waren jetzt fast leer, nur die Säufer waren zurückgeblieben und lagen in ihren Hängematten, den Schnaps immer in Reichweite, als wäre das Schwitzen zum Sinn ihres Lebens geworden.
Wer nur irgend konnte, war gekommen, um den Kommandeur zu begrüßen und hochleben zu lassen, der demnächst landen würde. Tausende Slowaken, aber überraschenderweise auch Hunderte Eingeborene, sogar Dutzende Chinesen und ein paar Franzosen hatten sich eingefunden und erwarteten den Anflug des berühmten, legendenumrankten Giganten und Sonderlings.
Von den Alteingesessenen hörte man oft: »Kaum sind wir diesen perversen Nichtstuer los gewesen, diesen versoffenen Faulpelz und Parasiten, diesen Paul Gauguin, ist der nächste suspekte Fremde aufgetaucht, mit eigenartigen Gelüstchen und einer Schwäche für Sterne und Kometen und vor allem für die hiesigen Mädchen.« Ersterem waren nur ein paar Verzweifelte gefolgt, Letzterem allerdings ungebetene Menschenmassen …
Die Leute stellten sich auf die Zehenspitzen und reckten sich unter den auffliegenden Hüten, um ihn endlich sehen zu können. In der dichten Menge wimmelte es nur so. Unter unablässigen Hurra-Rufen konnte man undeutliches Trommelschlagen heraushören. Das Gedränge wurde immer größer, die begeisterten Menschen wollten zumindest einen kleinen Blick aus der Nähe auf die berühmte Persönlichkeit erhaschen.
Draußen auf dem Meer war deutlich ein Schiff zu sehen, offenbar mit weiteren Zuwanderern aus Ungarn. Früher einmal hatte das Auftauchen einer solchen Silhouette am Horizont unter den hier Ansässigen Panik ausgelöst. Partikel einer anderen Welt, Vorbote großer Veränderungen, Eroberungen, Massaker und Terrorregimes. Auch jetzt waren die Einwanderer nicht bei allen willkommen. Die Entwicklung ließ sich jedoch nicht mehr aufhalten.
Endlich ging das Flugzeug in den Sinkflug über. Tausende Augen verfolgten jede Bewegung der Maschine, die ratterte und fauchte, mit den großen Propellern die Luft verwirbelte und schwarzen Qualm ausstieß. Die Kapellen spielten beide Hymnen.
Es sah so aus, als hätte der General die Menge mit einem Winken gegrüßt. Hunderte Hände antworteten begeistert. Die Hurra-Rufe wurden lauter.
Die Einheiten an der Spitze der Parade kamen unter einem flatternden Gewölbe aus Fahnen heranmarschiert. Burschen mit Gesichtern aus Granit auf edlen, tänzelnden Pferden. Es wehten die Flaggen mit dem Doppelkreuz, sowie die rot-weißen tahitianischen, ähnlich den österreichischen, auch die französische Trikolore war zahlreich vertreten. Auch eine reich geschmückte Ehrenpforte wurde im Zug getragen. Das Getöse wurde immer lauter.
Aber es kam auch zu Rangeleien. Die Tahitianerinnen saßen auf dem Boden, meist mit Babys an den braunen Brüsten, und tranken beim Stillen Kokosmilch. Auch viele junge Slowakinnen hatten es sich bereits angewöhnt, oben ohne zu gehen, was die französischen Missionare und die slowakischen Konservativen störte. Nonnen versuchten, den Wagemutigen mit Gewalt weiße Habits überzustreifen, die sie den Eingeborenen bereits seit einigen Jahrzehnten aufgedrängt hatten. Viele Slowakinnen gingen auch im Exil traditionell verschleiert, obwohl sie in der Wärme litten. Die alten Frauen trugen anlässlich der Feierlichkeiten Leinenunterhemden, Blusen mit weiten Doppelärmeln, Mehrfachröcke und spitzenbesetzte Westen, breite zweiteilige Schürzen aus schwarzem Perkal, und über die Schultern und kreuzweise über die Brust hatten sie sich dreieckige Tücher gebunden.
Weltanschauliche Konflikte wurden auf der Insel fast täglich ausgetragen. Die ledigen Burschen standen in Trachten aus Terchová und Leinenhosen mit breiter grüner Zierschnürung herum. In den weißen Lodenhemden schwitzten sie unerträglich und fluchten. So manch einer legte das Oberteil lieber ab und lief mit freiem Oberkörper am Strand herum. Den braungebrannten Männern glühten die Wangen und auf ihren Stirnen glänzten Schweißtropfen, durch die Mägen hatten sich Mikroben ihre Gänge gebohrt, jeder Zehnte litt an Syphilis oder Tuberkulose, und die meisten hatten wegen des Vitaminmangels bereits die Torturen des Skorbuts durchlebt.
Grüppchen von Tahitianern stießen gemeinsam in regelmäßigen Intervallen Wortkaskaden aus, die weniger an menschliches Sprechen erinnerten, als an ein tiefes Murren, unbegreifliche Litaneien.
Der Doppeldecker kam aus einer Höhe von sechshundert Metern allmählich immer tiefer herab.
Der Flugoffizier zündete zur Markierung der Windrichtung eine Rauchbombe.
Die Musik nahm an Intensität zu. Die Kapellen intonierten ein mitreißendes patriotisches Lied und die Menschen stimmten ein, ganze Familien sangen eine Weile lang im Chor mit, doch die zweite und die dritte Strophe kannten sie schon nicht mehr auswendig.
Plötzlich zog die Maschine wieder aufwärts. Der Pilot hatte es in letzter Sekunde offenbar für besser befunden, noch eine Schleife über den Strand zu ziehen, um sich für das Aufsetzen auf dem Meer einen geeigneteren Platz auszuschauen und den Anflugwinkel besser zu wählen. Allerdings war das Flugzeug viel zu schwer, die Motoren schafften es nicht mehr, es nach dem heftigen Höhenverlust wieder nach oben zu ziehen.
In ihrem vergeblichen Steigflug verlor die Caproni an Geschwindigkeit, für den Bruchteil einer Sekunde fror sie sogar ein, in den Himmel verkeilt, um sich dann rapide Richtung Erdboden zu bewegen, regelrecht im Sturzflug. Die Massen jaulten auf vor Entsetzen.
Die Landevorrichtung mit den vorderen Schwimmern, die durch zwei Sporen am hinteren Teil der seitlichen Gondeln ergänzt wurden, fing zischend Feuer. Als die Maschine aufkam, brannte sie vorne lichterloh. Die Tragkonstruktion prallte mit ohrenbetäubendem Getöse auf die Grenze von Sand und Wasser, wo sie von den Flammen verschlungen wurde.
Aus einer erhaltenen Skizze, die Soldaten anhand von Zeugenaussagen in eine Landkarte eingezeichnet haben, kann man ziemlich genau herauslesen, was sich zugetragen hatte. Štefánik war offenbar beim Landemanöver ohnmächtig geworden. Das wäre eine Erklärung für den plötzlichen freien Fall und auch für die Position des Flugzeugs, das die Vertikale überschritten und sich sogar auf den Rücken gedreht hatte, als hätte der bewusstlose Pilot im Sturzflug den Steuerknüppel immer weiter nach vorn gedrückt.
Der Schock brachte für einen Moment alle zum Schweigen. Das Land erstarb in einer Stille, die den Blick begleitete, wohin auch immer man ihn richtete. Der vor Leben strotzende Urwald verwandelte sich in eine reglose Kulisse.
Dann waren mehrere starke Detonationen zu hören, als die Treibstofftanks mit dem Vorrat an Benzin und Schmiermittel explodierten. Das metallische Knirschen und Scheppern betäubte die Menge, die in Panik nach allen Seiten davonrannte. Über die schwarze Meeresoberfläche verbreitete sich das Feuer in einem Höllenkreis. Aus der Sicherheit des Urwalds ertönte das Flüstern ungezählter Stimmen. Viele Hände zeigten zum Himmel, die Leute riefen und sangen. Von den Leibern floss der Schweiß, die Augäpfel glänzten weiß und die Gesichter erinnerten an groteske Masken. Einem schockstarren Fahnenträger klatschte in dem Strom aus heißer Luft die Flagge immer wieder gegen die Wangen.
Die Behauptungen der Augenzeugen gingen erheblich auseinander, widersprachen sich sogar. Einige erzählten, aus den Trümmern seien noch Stimmen gekommen und man habe gesehen, wie sich die Gliedmaßen der eingeklemmten Opfer noch bewegt hätten. Ein langgezogenes Wimmern habe eine Ahnung von der kläglichen Angst und extremen Verzweiflung gegeben, die wohl bleiben würden, wenn die letzte Hoffnung einst die Welt für immer verlässt. Andere berichteten, die Besatzung habe keinen Laut mehr von sich gegeben, keinen Mucks mehr gemacht, so schnell und tragisch seien die Ereignisse abgelaufen.
Manchmal stelle ich mir vor, was er als Letztes gesehen haben mag. Die flimmernden Kreuze der Propeller. Den Widerschein der Sonne zwischen den Flügeln. Den reglosen Ozean. Den vom Wind zu Wellenform gewehten Sand. Die kantigen Felsen, die wie die buckligen Rücken von Urzeittieren aussahen? Oder schoss ihm durch den Kopf, ganz bestimmt irgendwo seine Tahitianerin gesehen zu haben?
Er fand sich im Reich der Toten wieder. Die Seelen der Eingeborenen begrüßten ihn mit schwarzen Blüten. Ich weiß, was die Verstorbenen für Tahitianer bedeuten.
Aus der vorausgegangenen Welt ist in der heutigen nur noch die Krake übriggeblieben. Entstanden ist sie aus Trümmern, aus Schalen, sie tauchte zwischen Felshalden auf, als sich zwischen den Elementen ein unbarmherziger Kampf entsponnen hatte. Den gewann das Wasser und die Welt versank in einer Sintflut.
Der erste Tahi vollbrachte viele gute Taten. Er eignete sich Weisheiten an. Kannte sich mit Zauberei aus. Fischte das Festland aus dem Meer. Zähmte die Sonne, zwang sie, sich langsamer über den Himmel zu bewegen, und verlängerte den Tag, wodurch er den Menschen Ernte und Essen sicherte. Er besorgte auch das Feuer, das zuvor lediglich in der Unterwelt zu Hause gewesen war. Er selbst kam kurz danach bei einem Feuer ums Leben, das er entfacht hatte.
Die Krake taucht immer dann auf, wenn etwas Wichtiges untergeht. Mit ihren langen Tentakeln holt sie die Toten zu sich in die Tiefen der unterseeischen Welt. Viele Leute von hier, Eingeborene und auch Zuwanderer, beschwören bis heute bereitwillig, dass ihre Vorfahren an jenem unendlich traurigen Tag dicht unter der Wasseroberfläche den riesigen, rosig glänzenden Körper des Kopffüßers gesehen haben, seine acht ewig langen, scharfen Gliedmaßen, wie sie sich nach den schwelenden Trümmern reckten und darin herumtasteten. Als die Krake mit ihrer Beute im Wasser verschwunden war, breitete sich sowohl am Himmel als auch auf seinem Spiegelbild, der Erde, das weite, offene Meer aus.
2020
Früh um neun erschienen vor meinem Haus Mitglieder der Jugend-Landwehr. Sie trugen ihre dunkelblauen Uniformen mit den schwarzen Kreuzen auf den Schultern und der Trikolore im Dornenkranz am Revers. Direkt vorm Fenster hatten sie eine Pressekonferenz organisiert. Sie skandierten: »Wir sind hier zu Hause! Für Gott und Nation! Tahiti ist Slowakien!«
Das alles wurde live ins Netz gestreamt und auch im öffentlich-rechtlichen, oder besser gesagt: im staatlich-propagandistischen Fernsehen ausgestrahlt. Die Moderatorin beschuldigte mich der Kollaboration mit fremden Mächten. Dann versahen die jungen Leute die Fassade meines Hauses mit einer Tafel: Ausländische Agentin.
Jetzt war es also offiziell.
Ich bekam nicht die Möglichkeit, meinen Standpunkt zu äußern. Der Redakteur sagte mir am Telefon, das sei nicht nötig, denn die Organisatoren der Aktion würden nur eine gesetzliche Anordnung erfüllen. Er empfahl mir, lieber nicht nach draußen zu gehen. Wer weiß, was mir zustoßen könnte.
In stummer Verblüffung zog ich die Vorhänge zu. Mein Herz klopfte. Was vor meinem Fenster geschah, sah ich mir lieber im Netz an. Das Video auf dem Hauptnachrichtenkanal hatte blitzartig die meisten Klicks auf sich vereint. Die Kommentare vermehrten sich in schwindelerregendem Tempo.
Uniformierte junge Männer warfen Exemplare meines Buches, das vor Kurzem aus allen Buchhandlungen und Bibliotheken aussortiert worden war, auf einen großen Haufen. Den übergossen sie mit Benzin und zündeten ihn an. Die Flammen schlugen überraschend hoch, sie krochen über die Umschläge und blätterten mit dem Wind rasend schnell die Seiten um, die im Handumdrehen zu Asche wurden. Ich hatte Angst, dass auch das Haus Feuer fangen könnte.
Ich schaute auf den Bildschirm und doch ins Leere, Mund und Augen sperrangelweit aufgerissen. Das war keine Halluzination, nicht der Hauch von Wahnsinn, ich war nach wie vor bei Sinnen und bei vollem Verstand.
Meine Vorfahren, Uroma, Oma, Uropa, Opa, Vater und Mutter, verzweifelte Männer und Frauen, waren zu allem fähig gewesen. Praktisch alles Schlimme, was einem lebenden Menschen passieren konnte, war ihnen zugestoßen. Einem Menschenleben maßen sie keinen besonderen Wert bei. Und trotzdem würde sie das hier gewiss schockieren.
◆
Die Geschichte des Buchs namens Tahiti, das vor meinem Fenster brannte, begann an Štefániks Ehrengrab. Unweit der Stelle, an der er ums Leben gekommen war. 1928 wurde dort ein Denkmal nach einem Entwurf des Architekten Dušan Jurkovič eingeweiht. Die terrassenartige Anlage mit vier hohen Obelisken ist aus Travertinblöcken gebaut. Ich bin oft dorthin gegangen.
Ursprünglich sollte der General einen Ehrenplatz auf dem Friedhof von Papeete bekommen. Der Architekt überzeugte jedoch die hinterbliebene Familie und die Amtsträger, in die Grabstelle auf der Anhöhe einzuwilligen. Dadurch wurde Štefániks Ausnahmestellung im symbolischen National-Pantheon gestärkt. Unter den bedeutenden Slowaken ist er der einzige, der seine letzte Ruhestätte oben gefunden hat. Der Trauerzug schritt aufwärts, aus dem Tal auf die Hügelkuppe.
Am Tag der Einweihung legten die Menschen trotz der Hitze nach geraumer Zeit erstmals wieder ihre Trachten an. Angehörige dreier Generationen strebten in Richtung Grabmal. Eine so zahlreiche Versammlung von Slowaken hatte es in der Geschichte noch nicht gegeben. Zum ersten – und einige wohl auch zum letzten – Mal erlebten sie das erhebende Gefühl von Eintracht und Zusammengehörigkeit, das von dem tragischen Ereignis ausgelöst worden war. Der schwarze Trauerschmuck deutete an, dass dem Nationalhelden und Befreier die gleiche Ehre gebührte wie einem König.
Alte Gewohnheiten vermischten sich bereits mit hiesigen, sodass die Slowaken auch Opfergaben dabei hatten, um Oro zu erfreuen, den Kriegsgott. Die Seelen der tahitianischen Toten weilen seit Menschengedenken auf dem Gipfel des Temehani, der immer von einer weißen Wolke verhangen ist, denn die Verstorbenen mögen Sonne und Licht nicht.
Unter den Slowaken war auch schon die Mode des Tätowierens mit polynesischen Techniken verbreitet. Nach dem tragischen Zyklon von 1926 hatten die Männer in größerem und die Frauen in geringerem Ausmaß begonnen, sich Motive aus der verlorenen Heimat in die Haut zu gravieren. Alle versuchten auf jeweils eigene Weise, ihr Heimweh zu heilen.
Männer ließen sich nach Vollendung des zwölften Lebensjahres den ganzen Körper mit Zeichnungen bedecken, Gesicht und Zunge inklusive. Frauen meist nur die Schultern, den oberen Rücken, die Arme und die Mundwinkel. So ließ sich auf den ersten Blick abschätzen, wer aus welcher Gegend stammte. Wenn bei Auseinandersetzungen zwei zeigen wollten, wie unterschiedlich sie waren, streckten sie einander die Zunge heraus oder reckten sich die Schulter mit einem charakteristischen Bild aus ihrem Geburtsort entgegen. Wenn sie trauerten, ritzten sich die Slowaken auch die Stirn mit Messern aus Haifischzähnen, wie es ihnen die Eingeborenen beigebracht hatten.
Beim Grab des Generals, den auch die Sieger im Großen Krieg verehrten, wurden sie sich wahrscheinlich besser als jemals zuvor ihrer selbst bewusst, glaubten an ihre eigenen Kräfte.
Das erhöhte Plateau erinnerte an einen Aussichtspunkt, von dem aus sich ein atemberaubender Blick auf die Bucht und den Ozean eröffnete. Unweit des von Basaltblöcken gesäumten Ufers ragte der Urwald auf, ein dichtes Gewirr aus Wurzeln, Pflanzenranken, Bäumen und Laub. Der Dschungel übergoss das Denkmal mit seiner Frische, begleitet vom durchdringenden Duft nach Blüten und Waldhonig. Auf dem höchsten Punkt des Ehrengrabs saß besonders gern ein Papageienpärchen. Die schwerfällig im Boden steckenden Gipfel des Binnenlandes mit ihren buckeligen Hängen flimmerten in üppigem Grün.
Štefánik. Mein Urgroßvater. Er hat viele Kinder gezeugt, auf Tahiti besonders. Eine weitere Tatsache, über die wenig gesprochen wird. Verführer und Zerstörer der Frauen.
Antoinette, die Tochter seines Chefs, des Astronomen Jules Janssen. Die tschechische Studentin Marie Neumannová, genannt Marienka. Die dreizehn Jahre jüngere französische Journalistin und Politikerin Louise Weiss, Praktikantin beim Inhaber der Zeitung Le Radical. Claire Boas de Jouvenel. Auf Tahiti dann Temana, Maranie, Ranitea, Vanina, Taute, Raitahi, Hina, Moe, Minihoa, Nunui … Um nur ein paar der Namen zu nennen, die ich ausfindig machen konnte.
Am Denkmal knirschte bei jedem Schritt der Sand unter meinen Füßen. Ich hörte das Rascheln von Eidechsen. Die Stimme der Brandung klang, als würde mir meine Schwester etwas sagen. Das Donnern der Wellen kam in fast gleichmäßigem Rhythmus wie ein Atmen. Ich blickte zum Himmel und auf das immergrüne Gebirge. Immer wieder stellte ich mir dieselben Fragen. Wer war Milan Rastislav Štefánik? Wie sollte man ihn glaubwürdig darstellen?
Er ist der Grund, dass ich Historikerin geworden bin. In unserer Sprache: Rauti, Geschichtenerzählerin. Für ihn habe ich mich entschieden, mich der Wissenschaft zu widmen. Damit ihn die Menschen nicht nur als Skulptur, Symbol oder Monument wahrnehmen, sondern endlich als Menschen.
Zum Symbol war er allzu früh geworden. Sein plötzlicher Tod setzte die Mythenbildung in Gang. Kurz nach dem Flugzeugabsturz wurde sein Opfer idealisiert. Die Gesellschaft litt unter einem Mangel an Helden und Vorbildern, und so wurde Štefánik zum ersten Slowaken der Geschichte, dessen Kult von der staatlichen Verwaltung geschaffen wurde. Denkmäler von ihm wuchsen auf den Inseln wie Pilze nach dem Regen, und in jeder tahitianischen Ortschaft wurde nach ihm eine Straße oder eine Schule benannt.