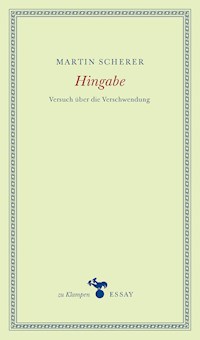Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Bildung
- Serie: zu Klampen Essays
- Sprache: Deutsch
Allerorten wird der Verlust der Mitte beklagt. Auch in unseren Umgangsformen offenbart er sich: Moralismus auf der einen Seite, narzisstische Selbstentblößung und Verrohung auf der anderen. Vielleicht schlägt gerade jetzt die Stunde der lange gescholtenen »Sekundärtugenden«? Das Taktgefühl ist eine von ihnen. Es gewährt mentalen Schutz, lässt uns dem anderen mit Verständnis begegnen, ohne dass wir seine Motive zwangsläufig nachvollziehen müssen. Obgleich es auf Konventionen beruht, ist es doch mehr Improvisation als Spiel nach Noten. Mit diesem Essay legt Martin Scherer eine Analyse des Taktgefühls vor. Es ist zugleich eine Hommage an die Höflichkeit und ein Lob der distanzierten Nächstenliebe. Denn nur Abstand und Ritual bieten Schutz vor Verletzung und vermögen jene hochaggressive Spezies namens Mensch zu kultivieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARTIN SCHERER
Takt
Über Nähe und Distanz im menschlichen Umgang
Reihe zu Klampen Essay
Herausgegeben von
Anne Hamilton
Martin Scherer,
1966 in München geboren, studierte Philosophie, Psychologie und Alte Geschichte. Nach der Promotion arbeitete er als Magazinredakteur. Von dort wechselte er in die Buchbranche und ist ab 2010 als Verlagsleiter tätig gewesen. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht. 2021 erschien bei zu Klampen sein Essayband »Hingabe. Versuch über die Verschwendung«.
Der magischen C.
Inhalt
Prolog
Ausweitung der Schonzone
Die Kunst des Verhehlens
Flüchtige Intensität
Kleines Leporello der Taktlosigkeiten
Schleichweg nach Urbino
Literatur
Impressum
Warum ist nichts ewig außer der Lüge? Die Lüge, die Antwort zu kennen, die Dinge beim Namen zu nennen.
Hildegard Knef (»Werden Wolken alt?«)
Prolog
Es wird unentwegt moralisiert. Aber nimmt die Verrohung deshalb ab? Eher scheint das Gegenteil der Fall.
In den digitalen Mitteilungsmaschinen tobt ein Nahkampf am Menschen. Verachtung und Verleumdung, ungehemmt und feige, weil zumeist anonym, wuchern vor sich hin. Ein Narzissmus der enthemmten Äußerung scheint am Werk. Aus Politik, Kultur, Medien und den Überresten der Kirche hallt es simultan: Belehrung, Ermahnung und Appell. Ständig Schrilles über Werte, Tabus und überhaupt die bedrohte Zukunft von allem. Aber bekundet sich in ständiger Empörung und Moralpredigt nicht bereits ein tiefes Ohnmachtsgefühl? Kontrolle und Trieb, Über-Ich und Es arbeiten sich gerade besonders verbissen aneinander ab. Wer könnte es dem Ich verdenken, wenn es diesem Tumult entfliehen und eine Affäre mit der Eleganz wagen will?
Eleganz – im Ernst? Aber ja, und zwar verstanden als Gespür für Stil, Vorsicht und Distanz, als Code der Zurückhaltung, der gerade dadurch an Strahlkraft gewinnt, dass er sich der allgegenwärtigen Selbsthervorhebung, Bewertungssucht und Übergriffigkeit enthält. Eleganz im Umgang heißt Takt. Sie gründet in der Freiheit. Wir haben als Existenzen die Möglichkeit, uns eine Form zu geben, die im Zweifel alle Diktate des Zeitgeistes unterläuft. Würde kann auch ästhetisch verteidigt werden.
Die folgenden Kapitel wollen eigentlich nur an etwas Altes und Bewährtes erinnern, an eine Form von Begegnung und Austausch nämlich, die man Kunst der stilvollen Verhehlung nennen könnte. Diese ist in den frühesten Werken des Abendlandes ebenso bezeugt wie in der Renaissance-Literatur oder im modernen Chanson. Die Rede ist von einem Esprit, dem ein knochentrockener Moralismus ebenso fremd bleibt wie die läppische Pose, hinter der das pure Nichts dröhnt. In disruptiven Zeiten mag es sinnvoll sein, sich an Kulturtechniken des Respekts und des umsichtigen Abstandhaltens zu erinnern. Dazu gehört auch ein Sprachspiel der Zwischentöne im Kontrast zum brüsken Klartext. Es lügt noch lange nicht, wer Zweifel und Befremdung verhehlt.
Das Thema Takt ist zwischen Ethik und Ästhetik, dem Richtigen und dem Schönen, angesiedelt. So anziehend seine Wirkung, so ernsthaft der darin enthaltene Anspruch. Takt wahrt, wie Höflichkeit auch, Distanz. Aber darin erschöpft er sich, wie zu zeigen sein wird, gerade nicht. Er lässt vielmehr ein Momentum der Nähe, ja sogar der Intensität aufblitzen.
Wer hier eine Prise Anachronismus wahrnimmt, wird kein Nein ernten. Man kennt aus der Wohnkultur dieses Unbehagen: Räume, die keine Spur des Alten tragen, wirken oftmals seelenlos und durchgeplant. Auch in den Remisen der Reflexion könnte es so etwas wie einen Vintage-Faktor geben.
Ausweitung der Schonzone
Es gibt Wichtigeres als Höflichkeit. Wer würde sie schon in eine Reihe mit Grundwerten wie Frieden, Gerechtigkeit, Gesundheit oder Prosperität stellen? Zeigt ein Verbrecher sich nebenbei höflich, dann relativiert dies seine Schuld keineswegs. Fehlt es umgekehrt einem hilfsbereiten oder gar altruistischen Menschen an freundlicher Art, so wird man es ihm gerne nachsehen. Verdienstvolles Handeln braucht kein Ornament, verwerfliches gerät damit sogar zur Perversion. Höflichkeit ist keine Kardinaltugend im christlichen Sinne, Unfreundlichkeit wird entsprechend nicht zu den Todsünden gerechnet. Weder in der Antike noch im Mittelalter noch zu Zeiten der Aufklärung zählte sie zu den Primärtugenden. Dafür hatte sie wirkmächtige Feinde. Rousseau zum Beispiel wurde nicht müde, Herzensgüte gegen Höflichkeit auszuspielen, um letztere als Äußerlichkeit und Verstellung herabzuwürdigen. Der Pietismus verachtete sie folgenreich als Scheinheiligkeit. Jede Jugendkultur sah und sieht in Manieren eine Art natürlichen Feind. Reglements, Floskeln, Förmlichkeiten – alles Chiffren der Erstarrung, die es mal fröhlich, mal zornig wegzuspülen gilt. Hinzu kommt die vermeintliche Passivität, auf der das gesamte Höflichkeitsinventar beruhe. Fängt nicht jede Befreiung mit dem Bruch althergebrachter Konventionen an? Sticht Handeln nicht Verhalten aus? Jahr für Jahr werden die Deutschen demoskopisch befragt: Was halten Sie persönlich für besonders wichtig und erstrebenswert? Von Höflichkeit keine Spur, überhaupt fehlt es an soft skills in den Antworten. Der teutonische Michel mag’s lieber kantig, so will es scheinen. Gewiss, ein distinguiertes Auftreten lässt noch lange nicht auf Feingefühl schließen. Aber umgekehrt will man auch nicht unbedingt die »inneren Werte« all derer kennenlernen, für die »oberflächlich« ein Schimpfwort ist.
»Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist«: In diesem bekannten Vers aus dem zweiten Teil des »Faust« bekundet der mentale Südländer Goethe sein Befremden über den typisch protestantischen Vorbehalt gegen gefälliges, schmeichelhaftes Benehmen. Ist Höflichkeit eine Maske? Ohne Zweifel. Doch aufschlussreicher als der Streit darüber, ob diese Maskerade Lebenskunst oder vielmehr Sünde sei, scheint die Frage nach ihrem Sinn und ihrer Funktion. Höflichkeit ist insofern eine Tugend, als sie zu etwas taugt. Höflichkeit kann als Ausweitung der Schonzone definiert werden. Sie dient dazu, den Einzelkampf von interessengesteuerten Individuen in eine Art Gesellschaftsspiel zu verwandeln. Dessen Pointe besteht darin, dass es eigentlich nur Gewinner kennt. Man muss noch gar keinem Pessimismus anhängen, um den Egoismus für ein Erkennungsmerkmal des Menschen zu halten. Ritualisierte Umgangsformen können immerhin wie ein blickdichter Vorhang das hässliche Antlitz der Spezies verbergen. Dieses Spiel wurde und wird mit Vorliebe von nervösen Temperamenten verdorben, die um jeden Preis authentisch wirken wollen. Die höfliche Geste indes kann ehrlich gemeint sein, aber sie muss es nicht. Und genau darin besteht ihre grandiose Kulturleistung. Ausgehend vom je eigenen Bedürfnis nach Integrität des Selbstgefühls, nach Respekt und Anerkennung, stellt Höflichkeit eine Technik der Kränkungsprophylaxe dar. Ob ein bestimmtes Kompliment, eine Gastfreundschaft oder ein Vortrittlassen echter Sympathie entspringt oder diese nur simuliert, bleibt nachrangig. Das symbolische Handeln wirkt, als ob es genau auf das konkrete Gegenüber abzielt. Im besten Fall fühlt man sich tatsächlich gemeint, im zweitbesten verbreitet sich Freude am schönen Schein.
Im Konflikt zwischen Sittlichkeit und dem Kampf ums Dasein entpuppt sich die Höflichkeit als »Muse des Mittelwegs« (Walter Benjamin). Sie ist weder Postulat noch Waffe; zugleich kann sie aber, je nach Blickwinkel, beiden Zwecken dienlich sein. Hier wie dort weicht sie Zudringlichkeiten auf. Das Moralgesetz mag Demut, Nächstenliebe, Mitleid oder Durchsetzung fordern – im Gewand der Höflichkeit gleicht es mehr einer Einladung zum besseren Leben und mag so auch jene erreichen, die sonst taub sind für die Sprache der Moral. Andererseits entschärft Höflichkeit die brachiale Präsenz eines sich Bahn brechenden Egos, sie tarnt vielmehr dessen rein eigennützige Motive und könnte ihnen auf diesem Umweg gerade zum Erfolg verhelfen.1 Ein chinesisches Sprichwort besagt: »Der höfliche Mensch vermeidet es, seinen Fuß auf den Schatten seines Nachbarn zu stellen.« Die Verschonung der Schatten, das darf wohl als zeremonielle Praxis in Vollendung gelten.
Das deutsche Wort Höflichkeit erinnert daran, dass dieses Verhalten einem sehr spezifischen sozialen Umfeld entstammt, nämlich Europas Fürstenhöfen. »In der höfischen Welt der frühen Neuzeit«, so formuliert Aleida Assmann, »ist die neue Verhaltenskunst zuerst erprobt und entwickelt worden, die in der Nähe den Schutz der Ferne und unter Fremden Bedingungen der Familiarität herstellt.«2 Erst im 18. Jahrhundert sollte sie in die bürgerliche Schicht einsickern und damit zu einem allgemeinen Kodex für das Zusammenleben in der Stadt werden. Höflichkeit hilft Menschen, eine räumliche Nähe, die nicht durch gewachsene Bande geprägt ist, erträglicher zu machen. Das schien bei Hofe nicht minder angebracht als später in der urbanen Gesellschaft.
Unter einem Habitus darf man allgemein die Verkörperung einer bestimmten Denk- und Sichtweise verstehen. Sprache und Benehmen einer Person drücken dann eine mentale Disposition aus. Höflichkeit als Habitus meint es ernst mit dem Verzicht auf Verletzung oder Bloßstellung von anderen. Der auftrumpfende Gestus verbietet sich dabei ebenso wie der Vorschein persönlicher Ressentiments. Höflichkeit verlangt nicht die Überwindung der Antipathie, sondern bloß ein gutes Versteck für sie. Die Erfahrung der eigenen Verletzlichkeit führt habituell zum Prinzip Verschonung. Es versteht sich von selbst, dass damit kein Benimmtipp gestreut, sondern vielmehr eine Verhaltenslehre begründet werden soll. Sie gilt es individuell einzuüben, ins Spielerische zu verfeinern – aber eben auch dann durchzuhalten, wenn Ignoranz ihr entgegenschlägt.
Aus der Menge der Anstandsbücher, Hofmeisterlehren, Komplimentierwerke und politischen Breviere, die seit dem 16. Jahrhundert in Europa zirkulieren, ragen drei Titel heraus, die den höflichen Habitus auf je eigene Art und Weise zu begründen suchen.
Baldassare Castigliones Klassiker »Il Libro del Cortegiano« (»Das Buch vom Hofmann«) erschien 1528 und erzählt sehr plastisch von der lebendigen, feinsinnigen und geistreichen Debattierkunst im Palazzo Ducale zu Urbino. An mehreren Abenden trifft sich die bessere Gesellschaft in den Salons der Herzogin Elisabetta Gonzaga, um allerlei Lebenswerte und Fragen des guten Geschmacks zu verhandeln. Dank der neu entwickelten Buchdruckkunst konnten diese Etüden höfischen Benehmens rasch auch in andere Kontexte einwirken. Der »Cortegiano« stimmt das Hohelied des schönen Scheins an. Anmut (grazia), nicht Konvention, sei das Signum einer Gesellschaft. Vierzehn Jahre vor Erscheinen hat Raffael den Autor und persönlichen Freund porträtiert: weiches, fließendes Gewand in gedeckten Farbtönen aus Pastell, Grau und Schwarz. Das Gesicht, umrahmt von Vollbart und dunklem, renaissancetypischem Barett, wirkt geprägt von einem sanften, wiewohl wachen Blick, der auf eine keineswegs gefühlsarme Wesensart schließen lässt. Hier liegt nichts eng an, vielmehr scheint der Stoff über den Körper zu fließen. Man gewinnt eine Ahnung von Esprit und Eleganz jener Abendgesellschaften im »Salone delle feste« oder dem »Sala delle veglie« des herzoglichen Palastes.
Castigliones Werk, insgesamt vier Bücher umfassend, steht wie sein Verfasser für die Durchmischung von höfischem Leben und Humanismus, von Adel und Bildung, welche sich seit dem Ende des Quattrocento in Europa verbreiten sollte. Diese eigenwillige Collage aus Novellen, Charakterskizzen, Anekdoten, Sottisen und Debatten überträgt die Leitmotive der Renaissancekunst in die Praxis der Lebensgestaltung. Gleichmaß, Ausgewogenheit und Harmonie, aber auch eine nachgerade metaphysische Lust am Spiel kennzeichnen einen vortrefflichen Menschen. Erotische Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen: So erfahren wir, welche Phantasien eine mit feinem Leder überzogene Hand wecken oder wie verführerisch das Raffen eines Kleides wirken kann.
Aber was sollte uns ein fiktives Gespräch unter Adligen nach einem halben Jahrtausend noch sagen können? Einiges sogar. Castigliones Werk darf als erste und wohldurchdachte Proklamation in Sachen Höflichkeit verstanden werden. Als »Ästhetik des Benehmens« (Peter Burke) moralisiert es mit keinem Wort, um statt dessen ganz auf die Macht der Suggestion zu setzen. Wo Schema war, soll Spiel werden. Das Ungezwungene, Improvisierte kommt postscholastisch als runderneuerter Lebensgeist daher. Höfliches Verhalten schützt vor dem Zusammenprall diverser Identitäten, Befindlichkeiten und Gesinnungen. Es überspielt die Differenz und gibt einer gesunden Skepsis das freundliche Gesicht. Wenn die Umstände es verlangen, so soll sich der Hofmann gar »einen anderen Menschen anziehen«. Weniger Identitätspolitik war wohl nie.
»Da ich aber schon häufig bei mir bedacht habe, woraus die Anmut entsteht, bin ich immer, wenn ich diejenigen beiseitelasse, die sie von den Sternen haben, auf eine allgemeine Regel gestoßen, die mir in dieser Hinsicht bei allen menschlichen Angelegenheiten, die man tut oder sagt, mehr als irgendeine andere zu gelten scheint: nämlich so sehr man es vermag, die Künstelei als eine raue und gefährliche Klippe zu vermeiden und bei allem, um vielleicht ein neues Wort zu gebrauchen, eine gewisse Art von Lässigkeit anzuwenden, die die Kunst verbirgt und bezeigt, dass das, was man tut oder sagt, anscheinend mühelos und fast ohne Nachdenken zustande gekommen ist. Davon rührt, glaube ich, großenteils die Anmut her.«3