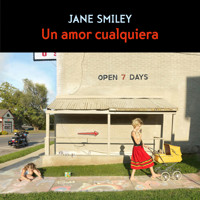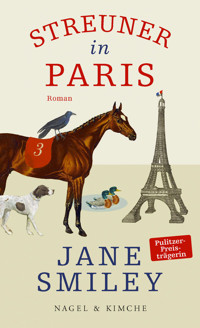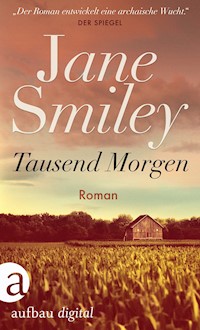
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der tyrannische Laurence Cook lebt mit seinen Töchtern Ginny und Rose auf einer Farm in Iowa. Um die Erbschaftssteuer zu sparen, beschließt er, ihnen den Millionenbesitz noch zu Lebzeiten zu überschreiben. Für die Töchter ist das der Augenblick der Rache und der Befreiung: Gewalt, Mißhandlung, Inzest, alles, was der Vater ihnen angetan hat, wollen sie ans Licht der Öffentlichkeit bringen ...
Jane Smileys dramatischer Roman mit seinen präsize gezeichneten Charakteren wurde mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.
„Mit dem Aufstieg und Niedergang der Farmerfamilie Cook beschreibt Jane Smiley zugleich die Geschichte des amerikanischen Traums: von der Euphorie des Aufbaus, des Anbruchs einer glücklichen Zukunft bis zum vorläufigen Scheitern dieser Idee im letzten Jahrzehnt.“ Der SPIEGEL.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Jane Smiley
Jane Smiley, wurde 1949 in Los Angeles geboren, wuchs in St. Louis auf, studierte Volkskunde und Skandinavische Sprachen und unterrichtet Literatur an der Universität von Iowa. Sie lebt in Nordkalifornien. Für ihren Roman Tausend Morgen wurde Jane Smiley sowohl mit dem Pulitzer Preis wie auch mit dem National Book Award ausgezeichnet.
Informationen zum Buch
Mit dem Aufstieg und Niedergang der Farmerfamilie Cook beschreibt Jane Smiley zugleich die Geschichte des amerikanischen Traums: von der Euphorie des Aufbaus, des Anbruchs einer glücklichen Zukunft bis zum vorläufigen Scheitern dieser Idee im letzten Jahrzehnt. Der SPIEGEL.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Jane Smiley
Tausend Morgen
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Hannah Harders
Inhaltsübersicht
Über Jane Smiley
Informationen zum Buch
Newsletter
BUCH 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
BUCH 2
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
BUCH 3
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
BUCH 4
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
BUCH 5
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
BUCH 6
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
Epilog
Anmerkungen
Impressum
Für Steve, einfach so
Der Körper wiederholt die Landschaft. Sie sind eines die Quelle des anderen, und sie erschaffen einander. Wir sind vom jahreszeitlichen Körper der Erde gezeichnet, von den schrecklichen Wanderungen der Völker, von der geschwinden Wende eines Jahrhunderts, die an einen Wandel grenzen, wie er nie zuvor auf diesem grünenden Planeten erfahren wurde.
Meridel Le Sueur
»The Ancient People and the Newly Come«
Buch 1
1
Mit sechzig Meilen in der Stunde konnte man in einer Minute an unserer Farm vorbeifahren, und zwar auf der County Road 686, die genau nach Norden bis zur Kreuzung Cabot Street Road verlief. Cabot Street Road war eigentlich nichts weiter als eine gewöhnliche asphaltierte Landstraße, nur dass sie nach fünf Meilen westwärts in die Stadt Cabot hinein- und wieder hinausführte. Am Westrand von Cabot ging sie in den Zebulon County Scenic Highway über und folgte drei Meilen lang der Biegung des Zebu-Ion River, bis der Fluss sich nach Süden wandte und der Scenic Highway weiter nach Westen bis Pike führte. Die Kreuzung CR 686 lag auf einer kleinen Anhöhe, einer Anhöhe, die man nur so ganz eben wahrnehmen konnte, wie den Buckel in der Mitte eines billigen Tellers.
Von diesem Buckel aus war die Erde unzweifelhaft flach, der Himmel unzweifelhaft gewölbt, und als Kind kam es mir so vor, als hätten die antiken Völker Recht gehabt, auch wenn der Lehrer in der Schule von Kolumbus etwas anderes erzählte. Kein Globus und keine Landkarte konnten mich restlos davon überzeugen, dass Zebulon nicht der Mittelpunkt des Universums war. Bestimmt war Zebulon, wo die Erde wirklich flach war, der eine Punkt, an dem ein kugelförmiger Körper (ein Samenkorn, ein Gummiball, ein Kugellager) zu vollkommener Ruhe kommen musste. Und war er erst einmal zur Ruhe gelangt, schickte er sicher eine Pfahlwurzel durch die zehn Fuß dicke Ackerkrume nach unten.
Weil die Kreuzung auf dieser winzigen Anhöhe lag, konnte man unsere Gebäude in einer Meile Entfernung am südlichen Rand der Farm sehen. Eine Meile ostwärts konnte man drei Silos sehen, die die nordöstliche Ecke markierten, und wenn man seinen Blick von den Silos zu dem Haus und der Scheune schweifen ließ und dann wieder zurück, konnte man das unermessliche Land in sich aufnehmen, das mein Vater besaß, sechshundertundvierzig Morgen, ganz bezahlt, keine Belastungen, so flach und fruchtbar, schwarz, locker und so offen daliegend, wie ein Stück Land auf dem Antlitz dieser Erde es nur sein kann.
Wenn man von der Kreuzung aus nach Westen sah, gab es weit und breit nichts, das auch nur im Entferntesten landschaftlich beeindruckend war. Das lag daran, dass der Zebulon River Ackerboden und Kalkstein durchschnitten und seinen hübschen Verlauf in ein Tal verlegt hatte, tiefer als das umliegende Farmland. Auch war, außer in der Nacht, nichts von Cabot zu sehen. Das Einzige, was man sah, waren zwei Gruppen von Farmgebäuden, umgeben von Feldern. In der Gruppe weiter vorne wohnten die Ericsons, die Töchter im Alter von meiner Schwester Rose und mir selbst hatten, und in der Gruppe weiter hinten wohnten die Clarks, deren Söhne, Loren und Jess, noch in die Grundschule gingen, als wir gerade in die High School kamen. Harold Clark war der beste Freund meines Vaters. Er hatte fünfhundert Morgen und keine Hypothek. Die Ericsons hatten dreihundertundzwanzig Morgen und eine Hypothek.
Land und Finanzierung waren in Zebulon ebenso elementare Tatsachen wie Name und Geschlecht. Harold Clark pflegte mit meinem Vater an unserem Küchentisch darüber zu debattieren, wer das Land der Ericsons kriegen würde, wenn die schließlich ihre Hypothek nicht mehr bezahlen könnten. Ich dachte daran, jedes Mal, wenn ich mit Ruthie Ericson spielte, jedes Mal, wenn meine Mutter, meine Schwester Rose und ich hinübergingen, um beim Einmachen von Obst und Gemüse aus dem Garten zu helfen, jedes Mal, wenn Mrs Ericson Pies oder Donuts herüberbrachte, jedes Mal, wenn mein Vater Mr Ericson ein Werkzeug auslieh, jedes Mal, wenn es in der Küche der Ericsons ein Sonntagsessen gab. Ich sah ein, dass Harold Clark mit seiner Meinung, dass das Land der Ericsons auf seiner Straßenseite lag, Recht hatte, aber trotzdem fand ich, es sollte unser sein. Erstens hatte Dinah Ericsons Schlafzimmer im begehbaren Wandschrank einen Fenstersitz, den ich haben wollte. Zweitens fand ich es angemessen und wünschenswert, dass der große Kreis der flachen Erde, der sich von der Kreuzung County Road 686 und Cabot Street Road aus erstreckte, unser sein sollte. Tausend Morgen. So einfach war das.
Wir schrieben 1953, und ich war acht, als ich die Farm und die Zukunft in diesem Licht sah. Es war das Jahr, in dem mein Vater sein erstes Auto kaufte, einen Buick Sedan mit kribbligen grauen Samtsitzen, die an den Kanten so abgerundet und so glatt waren, dass man bei einem Huckel oder einer scharfen Kurve leicht vom Rücksitz auf den Fußboden rutschen konnte. Es war auch das Jahr, in dem meine Schwester Caroline geboren wurde, zweifellos der Grund, weshalb mein Vater das Auto kaufte. Die Ericson-Kinder und die Clark-Kinder fuhren weiterhin hinten auf dem Pick-up, der zur Farm gehörte, aber die Cook-Kinder stießen mit den Füßen gegen einen Vordersitz und sahen gebannt aus den hinteren Fenstern, schön geschützt vor Staub. Das Auto war der Ausdruck von sechshundertvierzig Morgen im Verhältnis zu dreihundert oder fünfhundert.
Trotz der Benzinkosten unternahmen wir in jenem Jahr viele Autofahrten, was Farmer selten tun und mein Vater auch nie wieder tat, nachdem Caroline auf der Welt war. Ich hatte daran ein Vergnügen wie an einem geheimen Hort Münzen – wenn Rose, die ich sehr liebte, an mich gelehnt in dem heißen, muffigen Samtluxus des Autoinneren saß, wenn man den Kies unten gegen das Fahrgestell knistern hörte und das Gefühl hatte, als schwömme das Auto in dem gefurchten Weg, wenn jede Minute eine Farm vorüber zog und unsere Geschwindigkeit sie von ungeheurer Größe zu unbedeutender Winzigkeit schrumpfen ließ; wenn einen dieses ungewohnte Gefühl von Müßiggang überkam; wenn, was am allerwichtigsten war, ich den beruhigenden Ton der Stimmen meines Vaters und meiner Mutter hörte, die das, was sie sahen, kommentierten – er den Fortschritt der jährlichen Arbeit und den Zustand der Tiere auf den Weiden, sie Aussehen und Größe der Häuser und Gärten, der Farben der Gebäude. Der Ton ihrer Stimmen war ohne Hast und voller Selbstsicherheit, drückte er doch das Wissen aus, dass die Arbeiten bei uns weiter, unsere Gebäude größer und besser gepflegt waren. Wenn ich heute an sie zurückdenke, weiß ich, dass sie wahrscheinlich kaum viel mehr von der Welt gesehen hatten als ich zu der Zeit. Aber als ich damals ihrem Duett und den Vergleichen lauschte, war es, als könnte ich mich in die Sicherheit dieses Lebensweges nesteln – unsere Farm und unser Leben schienen unerschütterlich und gut.
2
Jess Clark war dreizehn Jahre fort. Er ging aus einem alltäglichen Grund – er wurde zum Militär einberufen –, aber innerhalb weniger Monate, nachdem Harold seinen Sohn zum Busbahnhof in Zebulon Zentrum begleitet hatte, rutschte Jess und alles, was mit ihm zu tun hatte, in die Kategorie des Unaussprechlichen, und niemand erwähnte ihn mehr bis zum Frühling 1979, als ich Loren Clark zufällig in der Bank von Pike traf und er mir erzählte, dass Harold zur Feier von Jess’ Rückkehr ein Spanferkel rösten würde, ob wir alle kämen, mitzubringen brauchten wir nichts. Ich legte Loren meine Hand auf den Arm, so dass er sich nicht umwenden konnte und mir in die Augen sehen musste. Ich sagte: »Nun sag mal, wo ist er denn gewesen?«
»Ich schätze, das werden wir dann hören.«
»Ich dachte, er hätte keine Verbindung zu euch gehabt.«
»Hatte er auch nicht, bis Samstagabend.«
»Das ist alles?«
»Das ist alles.« Er sah mich lange an und lächelte langsam, dann sagte er: »Mir fällt auf, er hat abgewartet, bis wir mit der Aussaat fertig waren, bevor er seine Auferstehung inszeniert hat.«
Wir hatten wirklich hart gearbeitet, der Frühling war kalt und nass gewesen, und niemand hatte früher als Mitte März aufs Feld gekonnt. Dann war in weniger als zwei Wochen fast der ganze Mais im County gesät worden. Loren lächelte. Was auch immer er sagte, ich wusste, er kam sich ein bisschen wie ein Held vor, genau wie die Männer bei uns zu Hause.
Mir fiel etwas ein. »Weiß er das mit deiner Mutter?«
»Dad hat’s ihm gesagt.«
»Bringt er ’ne Familie mit?«
»Keine Frau, keine Kinder. Keine Pläne, dahin zurückzugehen, wo er herkommt. Na ja, wir werden sehen.« Loren Clark war ein großer, gutmütiger Kerl. Wenn er von Jess sprach, dann mit einem zwanglosen amüsierten Unterton, so wie er über alles sprach. Ihn zu treffen, war immer ein Vergnügen, wie ein Glas Wasser zu trinken. Harold machte wunderbare Spanferkel-Essen – während das Ferkel röstete, spritzte er ihm Zitronen- und Paprikasaft unter die Haut. Dennoch erstaunte es mich, dass Harold für einen Tag mit der Bohnensaat aussetzen wollte. Loren zuckte die Schultern. »Das kann warten«, sagte er. »Das Wetter hält sich jetzt. Du kennst Harold. Er schwimmt immer gerne gegen den Strom.«
Worauf ich mich aber wirklich freute, war, Jess Clark durch die Oberfläche all dessen hindurch brechen zu sehen, was die ganzen Jahre nicht über ihn gesagt worden war, Ich spürte mein Interesse wachsen, eine kleine Neugierde, die mir wie ein glückliches Omen vorkam. Als ich eine Weile später den Scenic Highway entlang nach Cabot fuhr, dachte ich, wie hübsch der Fluss aussah – Weiden und Silberahorn standen in vollem Laub, das Schilfrohr war grün und saftig, die wilden Lilien standen in lila Büscheln, und ich hielt an und machte einen schönen kleinen Spaziergang am Ufer entlang.
Am Valentinstag hatte meine Schwester Rose ihre Diagnose, Brustkrebs, bekommen. Sie war vierunddreißig. Die Operation und die darauf folgende Chemotherapie hatten sie schwach und nervös gemacht. Es war der trübsinnigste März und April seit Jahren, und ich kochte die ganze Zeit für drei Haushalte – für meinen Vater, der darauf bestand, alleine in unserem alten Haus zu leben, für Rose und ihren Mann Pete in ihrem Haus gegenüber von Daddy, und dazu für meinen Mann Tyler und mich. Wir wohnten nun wirklich da, wo früher die Ericsons gewohnt hatten. Es war mir gelungen, das Mittagessen zusammenzulegen, und manchmal auch das Abendessen, je nachdem, wie Rose sich fühlte, das Frühstück aber musste ich in jeder der drei Küchen einzeln machen. Meine Arbeit am Herd begann vor fünf und endete nicht vor halb neun abends.
Es machte die Sache nicht besser, dass die Männer herumsaßen und sich über das Wetter beklagten und sich sorgten, es könne kein Traktordiesel fürs Pflanzen geben. Jimmy Carter sollte dieses tun, Jimmy Carter wird ganz bestimmt jenes tun, den ganzen Frühling hindurch.
Und es machte die Sache nicht besser, dass Rose sich im vergangenen Herbst plötzlich entschlossen hatte, Pammy und Linda, ihre Töchter, auf ein Internat zu schicken. Pammy war in der siebten Klasse, Linda in der sechsten. Sie wollten absolut nicht weg, kämpften dagegen an, indem sie mich und ihren Vater gegen Rose zu ihren Verbündeten machten, aber sie nähte Namensschilder in ihre Kleider, packte ihre Koffer und fuhr sie runter in die Quäkerschule von West Branch. Sie legte eine unbeugsame Entschlossenheit an den Tag, selbst angesichts des Widerspruchs unseres Vaters; sie war wie eine Naturkraft.
Die Abreise der Mädchen war unerträglich für mich, waren sie doch beinahe meine eigenen Töchter, und als Rose die Nachricht von ihrem Arzt erhielt, war das Erste, was ich sagte: »Lass uns Pammy und Linda für ’ne Weile nach Hause kommen lassen. Das ist jetzt eine gute Zeit. Sie können das Schuljahr hier zu Ende machen, danach eventuell wieder zurückgehen.«
Sie sagte: »Niemals.«
Linda war gerade geboren, als ich meine erste Fehlgeburt hatte, und für längere Zeit, sechs Monate vielleicht, war der Anblick dieser beiden Babys, die ich mit wahrer Anteilnahme und tiefer Erfüllung geliebt und umsorgt hatte, Gift für mich. Es schmerzte mich bis in alle Fasern, wenn ich sie sah, wenn ich Rose mit ihnen sah, als trügen meine Adern Säure bis in die äußersten Bereiche meines Körpers. Ich war so eifersüchtig, und jedes Mal, wenn ich sie sah, so erneut eifersüchtig, dass ich kaum sprechen konnte, und ich war nicht besonders nett zu Rose, weil irgendetwas in mir ihr die Schuld dafür gab, dass sie das hatte, was ich wollte, und dafür, dass sie es so leicht bekommen hatte (ich hatte drei Jahre gebraucht, um überhaupt schwanger zu werden – sie war es schon zwei Monate nach ihrer Hochzeit). Natürlich hatte Schuld nichts damit zu tun, und ich überwand schließlich meine Eifersucht, indem ich mir immer wieder, wie eine heruntergebetete Litanei, die zentrale Tatsache meines Lebens in Erinnerung rief – kein Tag meines erinnerten Lebens war ohne Rose. Verglichen mit unserer schwesterlichen Beziehung war jede andere durch irgendeine Form der Abwesenheit gekennzeichnet – vor Caroline, nach unserer Mutter, vor unseren Männern, Schwangerschaften, ihren Kindern, vor und nach Freunden und Nachbarn. In Zebulon hat es immer Familien gegeben, die jahrelang miteinander lebten, ohne ein Wort zu wechseln, für die ein alter Zwist um Land oder Geld so heiß brannte, dass er jedes andere Thema verschlang, jeden anderen Berührungspunkt der Freundschaft oder Zuneigung. So etwas wollte ich nicht, das wollte ich am allerwenigsten, deshalb überwand ich meine Eifersucht und machte meine Beziehung zu Rose besser als je zuvor. Und dennoch erinnerte mich ihre Weigerung, sie aus dem Internat nach Hause kommen zu lassen, in eindeutiger Weise daran, dass sie immer ihre Kinder sein würden, niemals meine.
Ja, ich fühlte es, und ich schob es beiseite. Ich warf mich ganz darauf, ihr Essen zu machen, ihr Haus zu putzen, ihre Wäsche zu waschen, sie zur Behandlung nach Zebulon reinzufahren, sie zu baden, ihr zu helfen, eine Prothese zu finden, sie in ihren Übungen zu ermutigen. Ich sprach von den Mädchen, las die Briefe, die sie nach Hause schickten, schickte ihnen Bananenkuchen und Ingwerplätzchen. Aber nachdem die Mädchen weggeschickt worden waren, hatte ich wieder, zum ersten Mal seit Lindas Geburt, eine Ahnung davon, wie es in diesen Familien war, wie ganze Generationen des Schweigens aus einer einzigen Entscheidung erwachsen konnten.
Jess Clarks Rückkehr: Etwas, das unmöglich erschienen war, erwies sich als möglich. Es war jetzt Ende Mai, und Rose ging es ganz gut. Noch eine Möglichkeit, die sich verwirklicht hatte. Und sie sah auch besser aus, seit sie wieder ein bisschen Farbe bekam. Und es würde warm werden, sagten sie im Fernsehen. Mein Spaziergang am Flussufer führte mich zu der Stelle, wo der Fluss sich zu einem kleinen Sumpfgebiet ausweitet, oder wo, wie man auch sagen könnte, die Oberfläche der Erde unter die Oberfläche des Meeres, das in ihr ist, tauchte. Blaues Wasser funkelte im noch klaren Sonnenlicht des Frühlings. Und hier war ein Schwärm Pelikane, vielleicht fünfundzwanzig Vögel, wolkenweiß gegen den Schimmer des Wassers. Vor neunzig Jahren, als meine Großeltern sich in Zebulon niederließen und die ganze Gegend feucht war, sumpfig, und so wie jetzt schimmerte, nisteten Hunderttausende von Pelikanen im Schilf, aber ich hatte seit den frühen Sechzigern keinen einzigen mehr gesehen. Ich beobachtete sie. Diese schöne Aussicht am Scenic Highway, dachte ich, hatte mich gelehrt, dass es unterhalb des Sichtbaren noch etwas gab.
Die Clark-Brüder sahen beide gut aus, nur dass man bei Loren einen Augenblick genauer hinsehen musste, um die schön geschnittenen Augen und die fein geschwungenen Lippen zu entdecken. Seine vergnügte Veranlagung verlieh ihm etwas Einfältiges, das, was die meisten Menschen wahrscheinlich meinen, wenn sie das Wort »Hinterwäldler« benutzen. Und vielleicht war er auch ein bisschen dick um die Mitte herum geworden, wie man es eben wird, wenn man immer viel Fleisch und Kartoffeln bekommt. Es war mir nicht einmal aufgefallen, bis ich Jess das erste Mal beim Spanferkel-Essen sah. Er war wie eine Kontrastausgabe von Loren. Ich glaube, Jess war ungefähr ein Jahr älter als Loren, aber in jenen dreizehn Jahren waren sie wie diese getrennt aufwachsenden Zwillinge geworden, von denen sie im Fernsehen berichten. Sie neigten ihre Köpfe in derselben Weise, sie lachten über dieselben Witze. Bloß dass die Jahre nicht in derselben Weise ihren Tribut von Jess gefordert hatten wie von Loren: seine Taille wuchs gerade aus seinem Gürtel auf; seine Oberschenkel waren ein wenig nach außen gewölbt, so dass man die Muskeln in seinen Jeans ahnen konnte. Auch von hinten sah er anders aus als die anderen beim Spanferkel-Essen. Sein Kreuz wurde bis zu seinem Gürtel hin schmaler, und dann kam nur eine leichte Wölbung, die von der Naht und den Taschen schön betont wurde. Er ging auch nicht wie ein Farmer, das war noch etwas, was einem von hinten auffiel. Die meisten Männer gehen aus den Hüftgelenken, werfen einfach die Beine abwechselnd vor, aber Jess Clark bewegte sich aus dem Kreuz heraus vorwärts, so als wäre er jederzeit bereit, ein paar Mal Handstandüberschlag zu machen.
Auch Rose fiel er auf, zugleich mit mir. Wir stellten unsere Kasserollen auf den Tisch mit den Holzböcken, ich sah Jess an, der mit Marlene Stanley gesprochen hatte und sich gerade umwandte, und Rose sagte: »Heh. Sieh mal an!«
Sein Gesicht aber war nicht so glatt wie Lorens. Im Gesicht war er gealtert. Von seinen Augenwinkeln breiteten sich Falten wie Fächer aus, umrahmten sein Lächeln, zogen die Aufmerksamkeit auf seine Nase, die lang war und scharf geschnitten, nicht weich geworden durch Fleisch oder jahrelange leichte, harmlose Gedanken. Er hatte Lorens blaue Augen, aber es lag nichts Süßliches in ihnen, und Lorens dunkelbraune Locken, aber sie waren kurz geschnitten. Schön geschnitten. Er trug teure Turnschuhe und ein hellblaues Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln. Er sah in der Tat gut aus, aber nicht auf eine Weise, welche das Misstrauen der Nachbarschaft schnell zerstreut hätte. Trotzdem waren natürlich alle freundlich zu ihm. Die Leute in Zebulon betrachteten Freundlichkeit als moralische Tugend.
Er umarmte mich, dann Rose, und sagte: »Heh, da sind ja die großen Mädchen.«
Rose sagte: »Heh, da ist ja das kleine Ekel.«
»So schlimm war ich damals gar nicht. Ich war einfach bloß interessiert.«
»Das Wort ›Nervensäge‹ trifft es bestens, Jess«, sagte Rose.
»Zu Caroline war ich nett. Caroline war verrückt nach mir. Ist sie hier?«
Ich sagte: »Caroline lebt jetzt unten in Des Moines. Sie heiratet im Juli.« Ich klang so ernsthaft und langweilig.
»So früh?«
Rose neigte den Kopf zur Seite und schob ihr Haar nach hinten. »Sie ist achtundzwanzig, Jess«, sagte sie. »Daddy sagt, es ist beinahe zu spät für die Zucht. Frag ihn. Er wird dir alles Mögliche über Sauen und junge Kühe erzählen und über Sachen, die austrocknen, und leere Kammern. Er hat da ein ganzes theoretisches System.«
Jess lachte. »Das weiß ich noch. Euer Vater hatte immer ’ne Menge Ideen. Er und Harold konnten am Küchentisch sitzen und eine ganze Torte aufessen, ein Stück nach dem anderen, und zwei oder drei Kannen Kaffee trinken und versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen.«
»Das machen die immer noch«, sagte Rose. »Denk ja nicht, irgendwas hätte sich verändert, bloß weil du dreizehn Jahre nicht dabei gewesen bist.«
Jess sah sie an. Ich sagte: »Ich hoffe, du erinnerst dich, dass Rose ständig ihre ungehobelte Meinung äußert. Das hat sich auch nicht verändert.« Er lächelte mich an. Rose, die nichts in Verlegenheit bringen kann, sagte: »Ich hab mich auch an etwas erinnert. Ich hab mich erinnert, dass Jess früher so gerne das Schweizer Steak mochte, das seine Mutter gemacht hat. Deshalb hab ich genau das mitgebracht.« Sie hob den Deckel von ihrer Kasserolle, und Jess zog die Augenbrauen hoch. Er sagte: »Ich hab seit sieben Jahren kein Fleisch mehr gegessen.«
»Na dann wirst du hier wahrscheinlich verhungern. Da ist Eileen Dahl, Ginny. Sie hat mir Blumen ins Krankenhaus geschickt. Ich geh mal mit ihr reden.« Sie ging hinüber. Jess sah ihr nicht nach. Stattdessen hob er den Deckel von meiner Kasserolle. Ich hatte Käse-Enchiladas gemacht. Ich sagte: »Und wo hast du nun gelebt?«
»Seattle, in der letzten Zeit. Vor der Amnestie war ich in Vancouver.«
»Wir wussten überhaupt nicht, dass du in Kanada warst.«
»Kann ich mir denken. Ich bin da direkt nach der Infanterieausbildung hingegangen, bei meinem ersten Urlaub.«
»Wusste dein Dad davon?«
»Vielleicht. Ich weiß nie, wie viel er weiß.«
»Zebulon County muss dir ziemlich gewöhnlich vorkommen, danach, nach den Bergen und allem.«
»Es ist schön dort. Ich weiß nicht …« Sein Blick huschte über meine Schulter, dann wieder zurück zu meinem Gesicht. Er lächelte mich direkt an. »Wir reden mal drüber. Ich hab gehört, ihr seid jetzt unsere nächsten Nachbarn.«
»Ja, ich denk schon, nach Osten.«
Ich sah, dass das Auto meines Vaters vorfuhr. Pete und Ty waren bei ihm, das wusste ich. Aber Caroline war auch da. Das kam unerwartet. Ich winkte, als sie aus dem Auto stieg, und Jess drehte sich um und sah in ihre Richtung. Ich sagte: »Da ist sie. Das ist mein Mann, Ty. Du erinnerst dich bestimmt an ihn, und Pete, Roses Mann. Kennst du ihn?«
Jess sagte: »Keine Kinder?«
»Keine Kinder.« Ich gab dieser Bemerkung meinen üblichen heiteren Ton und ergänzte dann schnell: »Aber Rose hat zwei, Pammy und Linda. Ich bin ihnen sehr nahe. Momentan sind sie im Internat. Unten in West Branch.«
»Ganz schön anspruchsvoll für ’ne Familienfarm.«
Ich zuckte die Schultern. Mittlerweile hatten Ty und Caroline ihren Weg durch die vielen Menschen zu uns gefunden, nachdem sie Daddy bei der Gruppe Farmer abgeliefert hatten, die um Harold und Pete bei dem Fass mit dem eisgekühlten Bier standen. Ty kniff mich leicht in die Taille und küsste mich auf die Wange.
Ty und ich heirateten, als ich neunzehn war, und noch immer war es so, dass ich mich selbst nach siebzehn Ehejahren jedes Mal freute, wenn er erschien.
Ich war nicht die Erste in meiner High School-Klasse, die heiratete, und auch nicht die Letzte. Ty war vierundzwanzig. Er war bereits seit sechs Jahren Farmer, und seine Farm ging gut. Hundertundsechzig Morgen, keine Hypothek. Ihre Größe war meinem Vater recht, und sie hatte die richtige Geschichte – Tys Dad, der zweite Smith-Junge, hatte die Extrafarm geerbt, nicht das eigentliche Land. An das hatte man nicht gerührt, es ging an Tys Onkel und belief sich auf ungefähr vierhundert Morgen, keine Hypothek. Tys Dad hatte darüber hinaus Verstand bewiesen, indem er eine einfache Frau geheiratet und nur ein Kind hervorgebracht hatte, die obere Grenze, wie mein Vater oft sagte, für hundertsechzig Morgen. Als Ty zweiundzwanzig war und lange genug Farmer, um zu wissen, was er tat, starb sein Vater an einem Herzanfall, der ihn im Schweinestall traf. Meinem Vater erschien das als der reinste Ausdruck der richtigen Abfolge der Dinge, und deshalb war er, als Ty uns im darauf folgenden Jahr zu besuchen begann, voll und ganz einverstanden.
Ty konnte sich ausdrücken, er war umgänglich, und ganz von sich aus zog er mich Rose vor. Er hatte gute Manieren, eine der Eigenschaften bei Männern, dachte ich oft, die immer bleiben. Jedes Mal, wenn er hereinkam, lächelte er und sagte: »Hallo, Ginny«, und wenn er ging, sagte er mir, wann er zurück sein würde, und er legte Wert darauf, auf Wiedersehen zu sagen. Er bedankte sich bei mir fürs Essen und benutzte gewohnheitsmäßig das Wort »bitte«. Gute Manieren kamen ihm auch im Umgang mit meinem Vater zustatten, da sie gemeinsam Daddys Farm bewirtschafteten und Tys hundertsechzig verpachteten. Daddy kam mit Pete nicht so gut zurecht, und Ty verbrachte ziemlich viel Zeit damit, die Dinge zwischen den beiden zu glätten. Im Laufe der Jahre wurde deutlich, dass Tyler und ich gut zusammenpassten, besonders wenn man uns mit Rose und Pete verglich, bei denen es im Allgemeinen viel mehr Aufregung und Unzufriedenheit gab.
Ty begrüßte Jess mit seiner typischen Freundlichkeit, und es war seltsam, zwischen beiden hin und her zu blicken. Als ich Jess das letzte Mal gesehen hatte, war er mir so jung vorgekommen und Ty so reif. Jetzt erschienen sie mir beide eher gleichaltrig, wobei Jess genau genommen eine Idee weltläufiger und selbstbewusster war.
Caroline gab Jess auf ihre energische Juristenart die Hand – was Rose immer ihr »Nimm-mich-ernst-oder-ich-verklag-dich«-Auftreten nannte. Sie mochte, wie Daddy glaubte, alt für die Zucht sein, aber sie war jung für die Juristerei. Ich gab mir ihr zuliebe wirklich Mühe, mich nicht über sie zu amüsieren, aber in dem Augenblick konnte ich sehen, dass Jess Clark sich auch ein bisschen amüsierte. Sie teilte uns mit, dass sie vorhatte, die Nacht zu bleiben, dann mit uns in die Kirche zu gehen und zum Abendessen wieder zurück in Des Moines zu sein. Nichts auch nur im Geringsten Ungewöhnliches. Ja, ich habe über jeden Moment dieser Party immer und immer wieder nachgegrübelt und dabei Hinweise, Signale ausfindig zu machen versucht, ich habe nach Möglichkeiten gesucht, wie man alles hätte anders machen können.
Aber es gab keine Anhaltspunkte.
3
Die Eltern meiner Großmutter, Sam und Arabella Davis, kamen aus dem Westen Englands – hügeliges Land, nicht gut für die Landwirtschaft. Als sie im Frühjahr 1890 nach Zebulon kamen und sahen, dass die Hälfte des Landes, das sie unbesehen gekauft hatten, einen Teil des Jahres zwei Fuß unter Wasser stand und ein anderes Viertel sumpfig war, gingen sie zurück nach Mason City und blieben dort den Sommer und Winter über. Sam war einundzwanzig und Arabella zweiundzwanzig. In Mason City trafen sie einen Engländer, John Cook, der, da er aus Norfolk kam, keine Angst vor stehendem Wasser hatte. Cook war nur ein einfacher Verkäufer in einem Textilgeschäft, aber er las viel, interessierte sich für die neuesten landwirtschaftlichen und industriellen Errungenschaften, und er überredete meine Großeltern dazu, das ihnen noch verbliebene Geld für die Trockenlegung eines Teils ihres Landes zu benutzen. Er war sechzehn Jahre alt. Er verkaufte meinem Urgroßvater zwei Forken, einige Spaten, einen Nivellierschlauch, Drainagerohre, die ganz in der Nähe hergestellt wurden, und ein Paar hohe Stiefel. Als das Wetter wärmer wurde, hörte John auf, in dem Textilgeschäft zu arbeiten, und er und Sam gingen raus unter die Moskitos und fingen an zu graben. Auf dem trockeneren Stück Land baute mein Großvater zwanzig Morgen Flachs und zehn Morgen Hafer an, genau das, was jeder, der sich mit der Bodengewinnung abrackerte, im ersten Jahr anbaute. Beides gedieh recht gut, verglichen mit dem, was sie zu Hause in England gehabt hätten. In Mason City wurde meine Großmutter Edith geboren. John und Sam gruben, nivellierten und legten Rohrleitungen, bis der Boden zu hart gefroren war, als dass sie mit ihren Forken noch etwas hätten ausrichten können; dann gingen sie nach Mason City zurück, wo beide Bekanntschaft mit Edith machten und beide für die Mason City Stein- und Rohrwerke arbeiteten.
Ein Jahr später, direkt nach der Ernte, bauten John, Arabella und Sam an der südlichsten Ecke der Farm ein flaches Haus mit zwei Schlafzimmern. Drei Männer aus der Stadt und ein Farmer namens Hawkins halfen. Sie brauchten drei Wochen, und am 10. November zogen sie ein. Im ersten Winter wohnte John im ersten Schlafzimmer, Sam und Arabella im zweiten. Edith schlief in einem Einbauschrank. Zwei Jahre später erwarb John Cook, wieder zu einem guten Preis, achtzig weitere Morgen sumpfigen Bodens, der an das Land der Davises angrenzte. Er lebte weiterhin mit ihnen zusammen, bis 1899, dann baute er sich ein eigenes Haus.
Von außen konnte man dem Land unter meinen Kinderfüßen nicht ansehen, dass es nicht die Urerde war, über die ich in der Schule gelesen hatte. Sie war neu, erschaffen durch magische Leitungen aus Tonrohren, über die mein Vater mit Freude und Ehrfurcht sprach. Ton »zog« Wasser und erwärmte die Erde, so dass sie sich leicht bearbeiten ließ und er mit seinen Maschinen bereits vierundzwanzig Stunden nach dem schwersten Unwetter wieder auf die Felder konnte. Vor allem aber produzierten die Tonrohre wie durch Zauberei Wohlstand – mehr Bushel pro Morgen einer besseren Ernte, Jahr für Jahr, trocken oder nass. Ich wusste, wie Tonrohre aussahen (als ich klein war, lagen immer fünf oder zwölf Zoll lange Rohre aus echtem Ton überall auf der Farm herum, für Reparaturen oder Verlängerungen der Leitungen; als ich älter wurde, wurde der »Ton« zu langen Schlangen aus Plastik), aber über Jahre hin stellte ich mir einen Fußboden unter der oberen Erdschicht vor, blaugrün und gelb kariert, wie der Fußboden auf der Mädchentoilette in der Grundschule, ein harter glänzender Boden, in den man nicht einsinken konnte, besser als ein Treuhandvermögen, verlässlicher als eine Ernteversicherung, eines Farmers bestes Gut. John und Sam und schließlich mein Vater brauchten eine Generation, fünfundzwanzig Jahre, um die Tonrohre zu verlegen und die Entwässerungsschächte und die Zisternen zu graben. Ich in meinem Sonntagskleid und -hut, in dem Buick unterwegs zur Kirche, war eine Nutznießerin dieser gewaltigen Anstrengung, jemand, der immer Boden unter den Füßen haben würde. Wie sehr diese Morgen Land auch wie ein Geschenk der Natur aussahen oder ein Geschenk Gottes, sie waren es nicht. Wir gingen in die Kirche, um unsere respektvolle Aufwartung zu machen, nicht um zu danken.
Es war nur allzu klar, dass John Cook sich mit viel Schweiß einen Wert, einen Gewinnanteil erworben hatte, und als Edith sechzehn wurde, heiratete John sie – er war mittlerweile dreiunddreißig. Sie lebten weiter in Johns Haus, aber Sam und Arabella bestellten bei Sears ein Haus, das »Chelsea« hieß, eins, das weit größer und prächtiger war als das alte. Sie nahmen das Chelsea (vier Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer und Diele, mit Innentoilette und Schiebetüren zwischen Wohn- und Esszimmer, 1129 Dollar) in Cabot am Güterbahnhof in Empfang. Das fertig abgepackte Hauszubehör enthielt jedes einzelne Brett, jeden Balken, Nagel, Fensterrahmen und jede Tür, die sie brauchen würden, und dazu sechsundsiebzig Seiten Anleitung. Das war das Haus, in dem wir aufwuchsen und in dem mein Vater lebte. Das alte Haus wurde in den Dreißigern abgerissen, das Holz für einen Hühnerstall verwendet.
Ich war mir, so glaube ich, immer des Wassers in der Erde bewusst: wie es sich von einem Teilchen zum nächsten fortbewegt, dabei Moleküle haften bleiben, zusammenwachsen, verdunsten, sich erhitzen, abkühlen, erstarren, an die Oberfläche steigen und die kühle Luft neblig machen, oder wie es nach unten sinkt, diesen oder jenen Nährstoff auflöst, wie es flink ist in allem, was es tut, endlos arbeitend und fließend, manchmal ein Fluss, manchmal ein See. Als ich sehr klein war, stellte ich mir vor, es könnte jederzeit hochsteigen und wieder die Erde bedecken, wenn nicht die langen Reihen Tonrohre wären. Die ersten Siedler hatten die Prärie immer als See oder Ozean aus Gras gesehen, vielleicht weil die meisten unlängst den Atlantik überquert hatten. Die Davises aber fanden tatsächlich eine schimmernde weite Fläche vor, durchsetzt von Schilfrohr und Kalmus. Das Gras ist jetzt nicht mehr da und die Sümpfe auch nicht, »die weite feuchte Prärie«, aber das Meer ist immer noch unter unseren Füßen, und wir gehen darauf.
4
Haralds Farm sah der unseren sehr ähnlich, flacher als flach, aber das Haus war viktorianischer im Stil, hatte strahlenförmige Giebelbalken und eine große Schaukel auf der Veranda. Harold besaß nicht so viel Land wie mein Vater, aber er bewirtschaftete es gut und hatte genau wie mein Vater und über ebenso viele Jahre seinen Wohlstand vermehrt. Zur Zeit des Spanferkel-Essens wurmte es meinen Vater noch immer, dass Harold plötzlich im März, ohne meinem Vater vorher davon erzählt zu haben, einen brandneuen, geschlossenen, vollklimatisierten International Harvester-Traktor gekauft hatte, mit Kassettenspieler, um während der Arbeit auf den Feldern alte Bob Wills-Aufnahmen spielen zu können, und nicht nur den Traktor, sondern noch dazu eine neue Sämaschine. Mein Vater hatte sich angewöhnt, Harold jedes Mal, wenn sie sich trafen, mit einem Bob Wills-Falsett »Ah-hanh!« zu begrüßen, aber der wahre Zankapfel war nicht der Traktor und dass Harold meinen Vater im Maschinenwettstreit übertrumpft hatte, sondern dass er nicht verriet, wie er ihn finanziert hatte, ob kalt, also aus Erspartem oder dem Gewinn des letzten Jahres (in diesem Fall stand er sich besser, als mein Vater dachte, und besser als mein Vater), oder ob er zur Bank gegangen war. Es war durchaus möglich, dass Loren, der auf dem College Kurse über Farm-Management belegt hatte, Harold schließlich doch davon überzeugt hatte, dass eine gewisse Verschuldung für ein Unternehmen wünschenswert war. Mein Vater wusste es nicht, und das ärgerte ihn. Harold seinerseits ließ keine Gelegenheit aus, seinen neuen Traktor zu loben, sich kopfschüttelnd zu fragen, warum er so viele Jahre Staub geschluckt hatte, die Anzahl der Gänge (zwölf) zu verkünden, das leuchtende Rot der Lackierung zu bewundern, das sich so schön gegen ein grünes Feld, einen blauen Himmel abhob. Beim Spanferkel-Essen waren Jess Clark und die neuen Maschinen Haralds Zwillings-Ausstellungsstücke, und die Gäste aus der gesamten Umgebung konnten der Art nicht widerstehen, hatten keinen Grund, ihr zu widerstehen, mit der er sie zwischen den beiden hin- und hertrieb und dabei mit der schamlosen Unschuld, für die er bekannt war, Bewunderung von ihnen forderte und auch bekam.
Die anderen Farmer gaben ihrem Neid auf den neuen Traktor offen Ausdruck. Bob Stanley stand mitten in der Gruppe, die sich um den Tisch versammelt hatte, wo Loren das Fleisch aufschnitt, und sagte: »Wir werden uns demnächst alle diese Dinger kaufen. Wir alle haben große Felder, die tagelange Arbeit erfordern, wir alle haben keine Lust, weiter wie bisher Staub zu schlucken. Aber verdammt noch mal, wir glauben, wir hätten im Augenblick Dieselprobleme! Wartet mal ab, bis wir ’nen Haufen von diesen Monstern haben, die dann auf die Felder kommen.« Er wippte mit zufriedener Miene auf den Absätzen. Daddy hörte zu, sagte aber nichts. Er lobte das Fleisch, sah Jess von oben bis unten mit einem misstrauischen Blick an und aß eine Menge Obstsalat. Alle wussten, dass Daddy und Bob Stanley, der ungefähr in Tys Alter war, nicht die besten Freunde waren. Pete sagte manchmal: »Larry weiß, dass Bob an seinen Baum pinkeln will. Bob weiß das auch.« Bob redete mehr – er war ein geselliger Mensch –, aber es stimmte auch, dass die anderen Farmer, wenn Bob irgendeine Erklärung abgab, Daddy immer so ansahen, als erwarteten sie das letzte Wort von ihm, und Daddy liebte es, Skepsis auszustrahlen, und er konnte das mit einer ganzen Reihe von aufstöhnenden und grunzenden Lauten ausdrücken, die Bob geschwätzig und flach erscheinen ließen.
Als es zu dämmern begann, ging ich herum und sammelte Pappteller ein, und mir fiel eine kleine Gruppe auf, bei der sich Rose und Caroline und auch Ty und Pete befanden. Sie hatten sich auf Harolds hinterer Veranda zusammengefunden, und mein Vater redete ernsthaft in ihrer Mitte. Ich erinnere mich, dass Rose sich umwandte und mich über den Garten hinweg ansah, und ich erinnere mich an ein kurzes inneres Klirren, eine instinktive Gewissheit, dass ich vorsichtig sein musste, aber dann sah Caroline auf und lächelte und winkte mich herüber. Ich ging hinüber und stellte mich auf die unterste Treppenstufe der Veranda, Teller und Plastikgabeln in beiden Händen. Mein Vater sagte: »Das ist der Plan.«
Ich sagte: »Was ist der Plan, Daddy?«
Er blickte mich an, dann Caroline, und indem er sie die ganze Zeit ansah, sagte er: »Wir werden ’ne Gesellschaft bilden, Ginny, und ihr Mädchen werdet alle euren Anteil bekommen, dann werden wir diesen neuen Güllebehälter, diesen Slurrystore, bauen und vielleicht auch ein Silo, und wir werden die Schweinemast vergrößern.« Er sah mich an. »Ihr Mädchen und Ty und Pete und Frank, ihr werdet den ganzen Laden schmeißen. Ihr kriegt jeder ein Drittel von der Gesellschaft. Was hältst du davon?«
Ich leckte mir die Lippen und stieg die beiden Stufen der Veranda hoch. Jetzt konnte ich Harold durch das Fliegengitterfenster der Küche sehen, er stand in dem dunklen Türrahmen und grinste. Ich wusste, dass er glaubte, mein Vater habe zu viel getrunken – genau das dachte ich auch. Ich sah auf die Pappteller in meinen Händen hinunter, die das Zwielicht blau machte. Ty sah zu mir, und ich konnte in seinem Blick eine verdeckte und sehr beherrschte Freude erkennen – er wollte schon seit Jahren die Schweinemast ausbauen. Ich erinnere mich, was ich dachte. Ich dachte: Okay. Greif zu. Er bietet es dir an, und alles, was du zu tun hast, ist zugreifen. Daddy sagte: »Teufel noch mal, ich bin zu alt für das alles. Ihr würdet mich nie dabei erwischen, wie ich mir in meinem Alter einen neuen Traktor kauf. Wenn ich ’nem Sänger zuhören will, tu ich das in meinem eigenen Haus. Abgesehen davon, wenn ich morgen sterb, müsst ihr sieben- oder achthunderttausend Dollar Erbschaftssteuer zahlen. Die Leute tun immer so, als lebten sie ewig, wenn die Bodenpreise gut sind« (hier warf er Harold einen Blick zu), »aber wenn sie ’nen Infarkt bekommen oder ’nen Schlaganfall oder sonst was, dann müssen sie verkaufen, um den Staat zu bezahlen.«
Trotz dieses inneren Klirrens gab ich mir Mühe, freudige Zustimmung auszudrücken. »Die Idee ist gut.«
Rose sagte: »Die Idee ist hervorragend.«
Caroline sagte: »Ich weiß nicht.«
Als ich in die erste Klasse ging und die anderen Kinder sagten, ihre Väter seien Farmer, glaubte ich ihnen einfach nicht. Ich stimmte aus Höflichkeit zu, aber in meinem Herzen wusste ich, dass diese Männer Hochstapler waren – als Farmer und auch als Väter. In meiner Vorstellung war nur Laurence Cook Farmer und Vater. Im Ernst zu glauben, dass neben ihm auch andere so etwas sein konnten, hieß gegen das Erste Gebot verstoßen.
Meine ersten Erinnerungen an ihn sind, dass ich Angst hatte, ihm in die Augen zu sehen, überhaupt, ihn anzusehen. Er war zu groß, und seine Stimme war zu tief. Wenn ich mit ihm sprechen musste, redete ich seine Overalls, sein Hemd, seine Stiefel an. Wenn er mich nahe an sein Gesicht hob, wich ich vor ihm zurück. Wenn er mich küsste, hielt ich es aus, bot ihm als Gegenleistung eine knappe Umarmung dar. Gleichzeitig war eben dieses Furcht einflößende Wesen auch eine Beruhigung, wenn ich an Räuber oder Ungeheuer dachte, und wir lebten, das konnte jeder sehen, auf der besten und der bestgeführten Farm. Die größte Farm und der größte Farmer. Das passte zu meinem Gefühl, oder formte es vielleicht, von der richtigen Ordnung der Dinge.
Vielleicht gibt es eine Distanz, die die optimale Entfernung darstellt, aus der man seinen Vater sehen sollte, weiter als über den Abendbrottisch hinweg oder quer über den Raum, irgendwo in mittlerer Distanz: Bäume oder die geschwungene Linie eines Hügels machen ihn klein, aber seine typischen Merkmale sind noch sichtbar, seine Körpersprache ist noch deutlich. Nun, das ist eine Distanz, die ich nie gefunden habe. Die Landschaft hat ihn nie klein gemacht – die Felder, die Gebäude, der Windschutz aus Kiefern, sie waren genauso er, als wären sie aus ihm gewachsen und wie eine Hülse von ihm abgefallen.
Der Versuch, meinen Vater zu verstehen, hatte sich für mich immer ein bisschen so angefühlt, wie Woche für Woche in die Kirche zu gehen und unserem Pfarrer, Dr. Fremont, dabei zuzuhören, wie er Beweise für Gottes Güte oder Allwissenheit oder was immer zusammentrug. Er ging die neuesten Ereignisse durch, Geschehnisse der Bibel, Momente seines eigenen Lebens, Dinge, die andere Menschen ihm erzählt hatten, und er entwarf ein Bild, das für die wenigen Augenblicke feste Gestalt annahm, bevor andere Ereignisse, die nicht in das Bild passten, die Chance hatten, einem in den Kopf zu kommen. Am Ende aber gab der Pfarrer dann zu, ja er frohlockte sogar an dieser Stelle, dass die Dinge sich letztlich nicht zusammenreimen ließen, dass die Wirklichkeit unbegreiflich war und unsere Unfähigkeit zu verstehen der allergrößte Beweis nicht von Güte oder Allwissenheit oder was immer das Thema des Tages war, sondern von Macht. Und wenn Dr. Fremont von Macht sprach, wurde seine Stimme tiefer, seine Gesten wurden ausholender, und seine Augen leuchteten.
Mein Vater hatte keinen Pfarrer, niemanden, der ihm auch nur vorübergehend für uns zu einer festen Gestalt verhalf. Meine Mutter starb, bevor sie ihn uns als nur einen Menschen mit Gewohnheiten und Marotten und Vorlieben vorstellen konnte, bevor sie ihn in unseren Augen verkleinern konnte, damit wir ihn verstanden. Ich wünschte, wir hätten ihn verstanden. Das, sehe ich jetzt, war unsere einzige Hoffnung.
Als mein Vater den Kopf wandte, um Caroline anzusehen, war seine Bewegung langsam und aufgeschreckt, eine große Bewegung des ganzen Körpers, die mich daran erinnerte, wie massig er war – deutlich über einen Meter achtzig und mehr als einhundert Kilo schwer. Wenn sie es gewagt hätte, so hätte sie sagen können, sie wolle nicht auf der Farm leben, sie sei ausgebildete Anwältin und wolle einen Anwalt heiraten, aber das war ein heikles Thema. Sie rückte auf ihrem Stuhl herum und ließ ihren Blick über den sich verdunkelnden Horizont schweifen. Harald schaltete das Verandalicht an. Caroline mochte der Plan meines Vaters wie eine Falltür erschienen sein, die sie in eine Rutsche stürzen ließ und direkt wieder auf der Farm absetzte. Mein Vater starrte sie an. Weil es plötzlich so hell auf der Veranda geworden war, konnte ich ihr unmöglich ein Zeichen geben, den Mund zu halten, halt einfach nur den Mund, er hat zu viel getrunken! Er sagte: »Du willst nicht, mein Kind, also bist du raus. So einfach ist das.« Dann schob er sich aus seinem Stuhl hoch, polterte an mir vorbei hinaus in die Dunkelheit.
Caroline sah erschrocken aus, aber niemand sonst. Ich sagte: »Das ist lächerlich. Er ist betrunken.« Aber danach standen alle auf und zogen sich schweigend von der Veranda zurück, alle wussten, dass etwas Wichtiges passiert war, und auch, was es war. Mein Vater war in seinem Stolz, der immer leicht zu verletzen war, tief getroffen. Es würde nichts nützen, ihn daran zu erinnern, dass sie nur gesagt hatte, sie wisse nicht, sie habe ihn ja nicht zurückgewiesen, nur einen vollkommen vernünftigen Zweifel angemeldet, vielleicht sogar einen Zweifel, den ein Anwalt einfach anmelden muss, den sein eigener Anwalt anmelden würde, wenn mein Vater ihm dieses Projekt unterbreitete. Ich sah, dass Caroline vielleicht falsch verstanden hatte, worüber gesprochen worden war, und als Anwältin statt als Tochter gesprochen hatte. Auf der anderen Seite, vielleicht hatte sie überhaupt nichts falsch verstanden und einfach als Frau statt als Tochter gesprochen. Das war etwas, wurde mir blitzartig klar, das Rose und ich mit ziemlicher Vorsicht vermieden.
Ich ging in die Küche der Clarks und warf Teller und Gabeln in den Abfalleimer. Als ich mich zur Hintertür wandte, stand Jess Clark direkt neben mir, und im Verandalicht konnte ich seinen neugierig fragenden Blick sehen. Sein Gesicht war vertraut und fremd zugleich, freundlich und interessiert, aber fremd, ein Wissen versprechend, das keiner meiner Nachbarn haben konnte. In meiner Wendung zur Tür stieß ich gegen ihn, und er ergriff meinen Arm, damit ich mein Gleichgewicht wiederfand. Ich sagte: »Wo kommst du denn her?«
»Hast du nicht gehört, wie die Tür zugeschlagen ist?« Seine Hand blieb kurz auf meinem Arm liegen, dann ließ er mich los. »Ich wollte nach ein paar mehr Abfalltüten gucken. Weißt du, ich hab die ganze Zeit gedacht, in dieser Küche fehlt etwas, und jetzt merk ich, was es ist. Es ist der Behälter mit dem Bullensamen. Ich hab früher beim Essen immer einen Fuß darauf gehabt.«
Ich reagierte mit einem zerstreuten »Ach ja?«. Er sah mir ins Gesicht. Er sagte: »Was ist los, Ginny? Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich war mir sicher, dass du mich gehört hattest.«
»Ich dachte gerade, dass mein Vater sich verrückt aufführt. Ich mein, ich hab’s nicht wirklich gedacht, es war mehr ein panisches Gefühl.«
»Du meinst, diese Sache mit der Gesellschaft? Wahrscheinlich ist es tatsächlich ’ne gute Idee.«
»Aber er ist nicht der Typ für gute Ideen. Das war nicht er, der gesprochen hat, das war irgendein Banker. Oder aber, wenn er es war, der gesprochen hat, dann hat er noch von was anderem gesprochen, außer dass er seine Sterblichkeit akzeptiert und Erbschaftssteuern vermeiden will. Das war enorm weitsichtig und vernünftig von ihm.«
»Na ja, wart’s erst mal ab. Vielleicht wacht er morgen auf und hat die ganze Sache vergessen.« Jess’ Stimme klang überzeugt und flach, ohne Resonanz, so als wäre alles, was er sagte, nichts als die schlichte Wahrheit.
»Aber es ist bereits ein Durcheinander. Es ist bereits ein heilloses Durcheinander, und es ist erst fünf Minuten her.«
»Aber wieso denn? Du selber hast gesagt, dass du ein Gefühl von Panik hattest…« Er fuhr fort: »Jedenfalls, ich finde immer, dass die Dinge so passieren müssen, wie sie passieren, dass so viele innere und äußere Kräfte bei jedem Ereignis zusammenkommen, dass eine Art Schicksal daraus wird. Ich habe vom Buddhismus gelernt, dass Schönheit und bestimmt auch eine Menge Frieden darin liegt, wenn man das akzeptiert.« Ich blies durch die Nase. Ein Lächeln lief etwas unsicher über sein Gesicht. »Schon gut, schon gut«, sagte er. »Wie ist es hiermit? Wer vor etwas Angst hat, zieht es an.«
»Meine Mutter hat das immer über Tornados gesagt.«
»Siehst du? Die Weisheit der Prärie. Tu so, als war nichts passiert.«
»Das tun wir immer.«
Ich empfand plötzlich eine Scheu, so offen mit jemandem zu sprechen, den ich seit dreizehn Jahren nicht mehr gesehen hatte. Ich sagte: »Lass uns meine Zweifel für uns behalten, okay?« Bei dem Gedanken, dass Harold das hier in der ganzen Gegend ausposaunte, so wie er es gerne tat, bekam ich eine Gänsehaut. Jess fing meinen Blick auf und hielt ihn. Er sagte: »Ich klatsch nicht mit Harold, Ginny. Mach dir keine Sorgen.« Ich glaubte ihm. Ich glaubte ihm alles und war beruhigt.
Eins war richtig: wenn mein Vater tot umfallen sollte, müssten wir einen Teil der Farm verkaufen, um die Erbschaftssteuern bezahlen zu können. Sam und Arabella hatten zweiundfünfzig Dollar pro Morgen bezahlt, der Preis war so niedrig, weil das Land sumpfig war, und Sam und Arabella hatten mit ihrer Vermutung Recht, dass einige ihrer Nachbarn in Mason City sich auf ihre Kosten amüsierten: Man stelle sich vor, sie haben unbesehen ein Stück Land gekauft, ein Stück Malariasumpf, man stelle sich das nur vor, wo sie doch solche Nachzügler waren und so unerfahren und so jung.
In den Dreißigern, als mein Vater und Großvater zwei Stücke Land dazukauften, bezahlten sie noch immer weniger als neunzig Dollar pro Morgen, und das für schon trockengelegtes Land. Die Familie, der er das Land abkaufte, zog zuerst nach Minneapolis, dann nach Kalifornien, aber in den Fünfzigern, als ich Kind war, sprach Bob Stanleys Vater, Newt, noch immer nicht mit meinem Vater, weil er die Stanley-Brüder bei dem Handel ausgestochen hatte – Newt und die Frau der Familie, die wegzog, waren Cousins. Die Depression war für unsere Familie eine Zeit umsichtiger Konsolidierung durch harte Arbeit, Glück und kluge Bestellung. Natürlich sah das in Zebulon nicht jeder so, aber mein Vater sagte dann immer: »Neid macht Lästermäuler.« Jedenfalls war das sumpfige Land wie Kompost, reine Fruchtbarkeit, und 1979 betrug der Marktwert des Landes 3200 Dollar pro Morgen, der Spitzenpreis für Land in Zebulon und im ganzen Staat. Seine tausend schuldenfreien Morgen machten ihn also zum mehr als dreifachen Millionär.
»Marv Carson hat ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt«, sagte Ty zu mir, als wir uns an dem Abend fürs Bett fertig machten.
Ich sagte: »Harolds Traktor hat ihm den letzten Anstoß gegeben.«
»Der Traktor war auch Marvs Idee. Loren hat mir heute Abend erzählt, dass Marv Harald seit Weihnachten bearbeitet. Harold möchte gerne, dass dein Vater denkt, er habe ihn ganz bezahlt, hat er aber nicht. Loren wollte mir allerdings nicht sagen, wie viel sie angezahlt haben. Er hat gesagt: ›Ach was, Ty, die paar Dollar Schulden spielen doch beim Wert unseres Landes gar keine Rolle.‹«
»Diese Traktoren kosten vierzigtausend Dollar.«
»Na und, sein Land ist eineinhalb Millionen wert. Die Farm meines Vaters ist beinahe ’ne halbe Million wert. Ich hab daran gedacht, sie zu verkaufen und mit dem Geld die Schweinemast zu erweitern.« Er sah mich an und zuckte die Schultern. »Mann«, sagte er, »ich hab auch mit Marv gesprochen.«
»Mir wird ganz schwindlig, wenn du mit so hohen Zahlen um dich wirfst. Außerdem, wer würde bei diesen Preisen kaufen? Und alle jammern über die Zinsen.«
»Aber die Zinsen steigen immer, und vielleicht steigen die Preise ja mit.«
»Hm.« Ich setzte mich in den Fenstersitz und blickte die Straße hinunter zu Roses Haus. Alle Lichter waren aus. Ich sagte: »Rose sah erschlagen aus, als wir gingen.«
Ty sagte: »Diese Slurrystores sind toll. Sie fassen 300000 Liter Schweine-Düngermischung. Sobald alles kalt geworden ist, kann man es sofort aufs Feld bringen. Davon hätte ich gerne einen. Und einen neuen Schweinestall. Voll klimatisiert. Und wie war’s mit zwei Eber Meisterklasse, so reinrassig, dass sie mit einem am Tisch sitzen können und nichts auf die Tischdecke kleckern.« Er legte sich auf dem Bett zurück. »Süße rosa Jungs, Rockefeller und Vanderbilt.«
Es kam selten vor, dass Ty von seinen Wünschen sprach, deshalb hörte ich zu, ohne ihn zu unterbrechen. Er sagte: »Man bringt eine eigene gute Zuchtlinie in Gang und gibt die Babys zur Adoption frei. Jeder will eins. Man kann dann sagen: ›Ja, Jake, aber du musst ihn mit deinem eigenen Löffel füttern und ihn auf deiner Seite des Bettes schlafen lassen‹, und sie sagen dann: ›Klar, Ty, was immer du sagst. Ich spar schon für sein Colleges« Er rollte sich auf den Bauch und lächelte mich an. »Oder für ihrs. Sauen mit einer solchen Aussteuer kriegen natürlich auch nur das Beste.«
»Das gefällt mir bei Schweinen. Sie dürfen groß werden. Ich hab’s immer gehasst, wenn die Ericsons ihre Kälbchen schlachteten.«
»Ich wusste gar nicht, dass sie Milchwirtschaft betrieben haben.«
»Cal liebte Kühe. Er trug Fotos von seinen Lieblingskühen in seiner Brieftasche, neben denen von seinen Kindern. Ich glaub schon, dass er nicht aufgeben musste, aber als die Kühe nicht mehr da waren, war ihm alles nicht mehr so wichtig.«
»Holsteiner?«
»Oh, ja klar. Aber er hatte auch eine kleine Jersey, die er für die Familie gemolken hat. Sie haben immer köstliches Eis gemacht. Sie hieß Violet.«
»Wer?«
»Die Jersey-Kuh. Die Kinder hatten schlichte Allerweltsnamen, Dinah und Ruth, aber die Kühe hatten alle Blumennamen wie Primrose und Lobelia.«
»Hmm«, sagte Ty, und seine Augen schlossen sich. Seine gute Laune ließ alles möglich erscheinen. Zweifellos deutete jeder von uns die Ankündigung meines Vaters als die Antwort auf irgendeinen Wunsch oder eine Angst in sich selber. Ty sah sie sicherlich als die lange zurückgehaltene Anerkennung seiner guten Arbeit mit den Schweinen. Ich sah sie als eine Art verdeckter Belohnung für Jahre schwerer Hausarbeit und artiger Höflichkeit. Pete, der kein Land geerbt hatte, musste sich in dem Augenblick von seinem Status als Pächter in den eines Landbesitzers aufsteigen gesehen haben. Rose hätte sicherlich auch das Wort »Belohnung« gebraucht, aber eine verdiente, eine gerechte, in welcher sich die richtige Abfolge der Dinge ausdrückte, so wie damals, als Tys Vater im Schweinestall gestorben war und ihm die Farm hinterlassen hatte.
Mir schien, dass Ty es auf jeden Fall verdient hatte, einige seiner Wünsche zu verwirklichen. Ich sagte: »Aber was ist mit dieser Sache mit Caroline? Sie schläft tatsächlich bei Rose. Das wird ihn noch wütender machen.«
»Er kriegt seine Wutanfälle, und dann lässt er sich durch gutes Zureden auch wieder beruhigen. Allerdings hätte sie sich auch nicht so aufs hohe Ross setzen müssen.«
»Sie hat nur gesagt, sie weiß nicht.«
»Und sie hat das gesagt, als wüsste sie es genau, so wie sie’s immer macht.« Der Ton seiner Stimme klang milde, schläfrig, er nahm dieser Bemerkung jede Schärfe. Ty hatte Caroline immer gern gemocht und sie geneckt. Damals, als sie vierzehn war und Daddy wollte, dass sie Traktor fahren lernte, hatte Ty ihm das ausgeredet, weil er sich im Gegensatz zu vielen anderen Farmern der Gefahr von Unfällen bewusst war. Aber ich wusste auch, dass er sich buchstäblich nicht vorstellen konnte, warum sie etwas getan hatte, das er niemals würde tun können: wegzugehen aufs College und eigentlich nie wiederzukehren. Er gab ein leises, stotterndes Schnarchen von sich.
Viele Frauen, die ich kannte, klagten darüber, dass ihre Männer kaum mit ihnen sprachen. In ländlichen Städtchen gibt es immer eine Menge Clubs, wo die Frauen gute Werke tun, aber die guten Werke treiben auf einem gewaltigen Redefluss dahin, und darauf kam es meiner Meinung nach im Grunde an. Ty indessen erzählte mir immer alles, alles über seinen Tag mit meinem Vater und Pete, alles über das Vieh und die Ernte und was er auf den Feldern sah und wen er in der Stadt traf. Reden fiel ihm so leicht, dass andere neben ihm irgendwie erstickt wirkten. Und im Gespräch war er immer optimistisch und guter Laune. Selbst als Pete und mein Vater einander drohten, sie würden sich gegenseitig umbringen, was ungefähr alle zwei Jahre einmal vorkam, sagte Ty: »Ach, sie spucken nur große Töne. Aber dein Dad braucht das, dass Pete ihn reizt, um jung zu bleiben. Er weiß das.« Als ich meine Fehlgeburten hatte, brachten Tys Worte mich durch, bestimmt würde es mit dem nächsten klappen, bestimmt sollte dieses einfach nicht sein, bestimmt würde es mir bald besser gehen, er liebe mich, egal was.
Ich deckte ihn mit einem alten Quilt zu, und er drehte sich darunter um, und als er sich ins Kissen kuschelte, murmelte er halb im Schlaf ein Dankeschön. Ty glaubte, wir hätten drei Fehlgeburten gehabt. Alle nahmen an, wir würden es nicht mehr versuchen. In Wirklichkeit hatte ich fünf gehabt, die letzte am Erntedankfest. Nach der dritten, im Sommer ’76, sagte Ty, er bringe es nicht mehr fertig, mit mir zu schlafen, nicht ohne Verhütung. Er sagte mir nicht, warum, aber ich wusste, dass er keine weitere Fehlgeburt mehr ertragen konnte. Ein Jahr lang fand ich mich pflichtbewusst damit ab, dass wir es nicht einmal mehr versuchten, und dann kam mir eines Abends im Badezimmer der Gedanke, dass ich einfach nur so zu tun brauchte, als setzte ich das Pessar ein, dass Schwangerschaft zu meinem privaten Projekt werden könnte. Ich stellte mir vor, wie ich das Kind ohne ein Wort austragen würde, darauf wartend, wann Ty oder Rose anfangen würden, mich anzustarren, wie sie zögerten, mich zu fragen, ob ich nicht zu viel zunähme. Wenn ich das Geheimnis bei mir behielte, dachte ich, könnte ich auch das Kind halten. Bloß dass ich dann, als ich tatsächlich schwanger wurde, so aufgeregt war, dass ich es Rose erzählte, und deshalb musste ich danach, als ich das Baby verlor, an einem Tag, als Ty mit meinem Vater übers Wochenende zur Landwirtschaftsausstellung gefahren war, Rose auch das erzählen. Damals habe ich ihr versprechen müssen, es nie mehr zu versuchen. Sie sagte, ich würde langsam besessen davon und verrückt. Deshalb erzählte ich ihr beim nächsten Mal nichts, und als ich es am Tag nach dem Erntedankfest verlor, wusste niemand davon. Ich hatte wieder Glück – Ty war früh aufgestanden, um Pete bei der letzten Bohnenernte zu helfen –, und ich stopfte einfach das Nachthemd und die Laken und die Bettunterlage in eine Papiertüte und vergrub sie im alten Kuhstall, wo der Boden noch nicht gefroren war. Ich wollte sie dann irgendwann wieder ausgraben und zur Müllhalde bringen, aber das hatte ich noch nicht getan. Wenn ich sie ausgrub, würde ich es wieder versuchen wollen, und so weit war ich noch nicht. Ich war aber auch nicht so weit, dass ich es aufgeben wollte. Mit sechsunddreißig blieben mir noch fünf Jahre, vielleicht zwei oder drei Chancen, eines Morgens aus dem Schlafzimmer zu kommen und zu sagen: »Hier, Ty, hier ist unser Baby.«
Einer der vielen Vorteile dieses privaten Projekts, so dachte ich damals, lag darin, dass es mir eine ganze geheime Welt eröffnete, ich hatte zwei Leben, war zwei Ichs. Ich fühlte mich größer und vielfältiger als seit Jahren, voller unbekannter und voller ungenutzter Möglichkeiten. Ja, im Grunde war ich auch nach den beiden letzten Fehlgeburten hoffnungsvoller als damals nach der ersten.
Jenseits von Roses Haus waren auch die Fenster meines Vaters dunkel. Mir fiel ein, dass ich nicht daran gedacht hatte zu fragen, ob ich morgen zu ihm hinübergehen und sein Frühstück machen sollte. Darüber einigte ich mich normalerweise mit Rose jeden Abend. Wenn Caroline hier war, machte sie es gerne, aber sie war mit zu Rose gegangen, nachdem mein Vater die Party verlassen hatte. Ich öffnete das Fenster und blinzelte durch das Fliegengitter. Ich war mir sicher, dass ich seinen Track neben der Scheune parken sehen konnte, Petes Truck neben ihrer Veranda, das Dach unseres Trucks dahinter, in einem perlengleichen Frieden funkelnd. Die Sommerlaute der Ochsenfrösche und Zikaden waren noch nicht zu hören, aber durch die Kiefern nördlich des Hauses stöhnte eine Brise, die Schweine im Stall klirrten an ihrer Fütterungsanlage. Es war dieselbe ruhige und sichere Aussicht, die mir jede Nacht gehörte – die zu verlassen, wie ich mir zuweilen selber eingestand, ich Angst gehabt hatte, als die High School zu Ende gegangen war und die Frage auftauchte, was ich als Nächstes tun würde. Sie passte zu mir, und es war leicht, mich jede Nacht von ihr ergreifen zu lassen, aber ich hatte auch Wünsche, heimliche, leidenschaftliche Wünsche, und während ich dort saß und die schwere feuchte Brise genoss, überließ ich mich dem Gedanken, vielleicht ist es dies, vielleicht ist es dies, was alle Strömungen verändert und das geliebte Kind ans Ufer trägt.
5
Als ich mich um sieben Uhr auf Zehenspitzen die Treppe hinauf schlich, um nachzusehen, warum mein Vater meine Rufe, das Frühstück sei fertig, nicht beantwortet hatte, sah ich, dass er nicht da war. Das Bett sah eher so aus, als habe er darauf geschlafen und nicht darin, und mein Vater war in Schuhen hinausgegangen – weil seine Stiefel an der Hintertür standen, hatte ich angenommen, er sei noch im Bett. Der Truck neben dem Stall war kalt, und ich wollte gerade hinübergehen und nachsehen, ob er vielleicht bei Rose und Caroline war, als ein großer kastanienbrauner Pontiac vorfuhr. Mein Vater stieg auf der Beifahrerseite aus und Marv Carson stieg auf der Fahrerseite aus. Marv sah wackelig auf den Beinen aus, aber eifrig, bereits ausstaffiert in Anzug und Schlips. Er hastete hinter meinem Vater her, als sie auf die Veranda zukamen. Mein Vater sagte: »Ginny, Marv isst mit. Marv, du kannst dich waschen gehen.« Marv sah sich um, während er durch die Tür kam, wahrscheinlich nach einem Waschbecken. Ich sagte: »Du bist bestimmt sauber genug zum Essen, Marv. Geh rein und setz dich.«
Ich brachte Wurst, gebratene Eier, Bratkartoffeln, Cornflakes, Englische Muffins und Toast, Kaffee und Orangensaft auf den Tisch. Mein Vater zog sich den Stuhl, auf dem er immer saß, heran und setzte sich, dann schaufelte er sich mit dem ihm eigenen Appetit den Teller voll. Als ich herauszufinden versuchte, ob er die Sachen von gestern anhatte, sah er mich an und sagte gereizt: »Hast du schon gegessen? Was siehst du mich so an?«
»Ich hab mit Ty gefrühstückt, Daddy.«