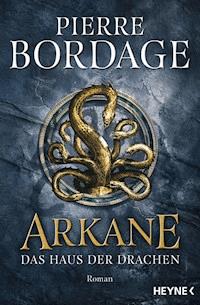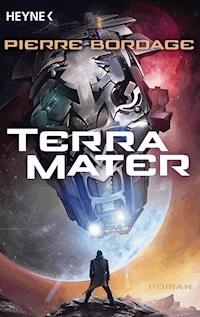
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Auf der Suche nach dem Ursprung der Legenden
Die Menschen haben die Galaxis bevölkert und eine planetenumspannende Konföderation gegründet. Doch eine gefährliche, fremdartige Spezies droht den Verbund zu unterwandern. Die Krieger der Stille sind die letzte Hoffnung der Menschen – doch existieren die legendären Wesen tatsächlich? Ein kleiner Junge macht sich auf die Suche nach dem Ursprung der Legende und nach dem Planeten, auf dem alles begann: Terra Mater!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Ähnliche
Das Buch
Die ferne Zukunft: Die Menschheit hat sich über den Spiralarm der Galaxis ausgebreitet und eine riesige Konföderation, bestehend aus über hundert Planeten, geschaffen. Doch die Scaythen – skrupellose Wesen, die mit der Kraft ihrer Gedanken töten können – haben diese Konföderation unterwandert, die ehemaligen Hochstätten der Kultur liegen brach, die Herrschergeschlechter sind entmachtet oder ausgelöscht. Mit Hilfe der Scaythen konnte die »Kirche des Kreuzes« ihre Macht manifestieren und feiert nun ihren grausamen Siegeszug … Doch es besteht eine letzte Hoffnung: Die alten Legenden von den Kriegern der Stille leben wieder auf – diese mythischen Wesen scheinen wirklich zu existieren. Aber konnten sie tatsächlich den Scaythen mit der spirituellen Kraft ihrer Gedanken entkommen? Und wohin sind sie geflohen? Ein kleiner Junge namens Jek At-Skin trägt die Wünsche und Hoffnungen der letzten Weisen in sich. Er macht sich auf nach Terra Mater, dem geheimnisvollen Planeten, auf dem alles seinen Ursprung hatte. Eine atemberaubende Reise beginnt …
»Pierre Bordage ist der Meister der französischen Science Fiction!«
Le Figaro
»Grandios! Wer endlich mal wieder in ein farbenprächtiges, actionreiches, fesselndes Abenteuer zwischen fernen Sternen und auf fremden Planeten eintauchen will, sollte Pierre Bordages Debüt in Deutschland nicht verpassen.«
Andreas Eschbach
Der Autor
Pierre Bordage, 1955 in der Vendée geboren, studierte Literaturwissenschaft in Nantes. Mit seinem ersten Roman »Die Krieger der Stille« landete er auf Anhieb einen riesigen Publikumserfolg. Das Buch wurde mehrfach preisgekrönt, unter anderem mit dem renommierten Grand Prix de l’Imaginaire. Bordage lebt mit seiner Familie in Boussay an der Atlantikküste.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Die In-Creatur – das künstliche, nicht geborene Wesen – glaubte, das Schwierigste vollbracht zu haben: denn ihre im Universum verstreut lebenden Getreuen beraubten die Menschheit nun ihres Gedächtnisses, ihrer Macht. Und der unsterbliche Hüter der Inddikischen Wissenschaften hat sich, nach fünfzehntausend Jahren untadeliger Wachsamkeit, auf die Reise in eine andere Welt begeben.
Die In-Creatur stand kurz vor der Machtergreifung. Alles war bereit. Doch jetzt beschritt ein Mann den Weg des Lichts. Ein Mann, der die geheime Pforte gefunden hat, und der – sollte er in seinem Bestreben fortfahren – durchaus die Seinen zu ihren Ursprüngen zurückführen könnte. Dann würden die Menschen wieder die Oberhoheit erlangen. Seit Tausenden von Jahren kämpft die In-Creatur gegen die Vormachtstellung der Menschen, sie verfälschte die Worte ihrer Propheten und Visionäre; sie säte Tod und Verzweiflung durch Streit, Zwist und Krieg …
Seit Urbeginn, seit die Materie unter den ersten Strahlen des Lichts Gestalt angenommen, seit die Wärme Leben ermöglicht und die Schöpfer ihr Werk begonnen hatten, musste die In-Creatur immer weiter zurückweichen, da sie diesen Kräften und der unaufhörlichen Ausdehnung des Universums nichts entgegenzusetzen hatte.
Und jetzt, gerade zu dem Zeitpunkt, an dem sie endlich die Früchte ihrer geduldigen Arbeit ernten könnte, behinderte dieser Abschaum das Wirken ihrer Göttlichkeit.
Denn dieser Mann hatte eine Vision: In der Ferne sah er ein herrliches Bauwerk, einen Tempel mit sieben Säulen und vielfarbigen Fenstern von unvorstellbarer Pracht. Dieser Tempel soll das Symbol des Ursprungs werden, das Urschiff, eine Arche, die die Inddikischen Annalen birgt – die unveränderlichen Gesetze der Schöpfung und somit den Schlüssel für die Renaissance der Menschheit.
Es drängte ihn sich zu beeilen, denn die Attacken der formlosen Kraft wurden immer heftiger, und zudem machte ihm diese unerträgliche Kälte mehr und mehr zu schaffen. Auch wenn die In-Creatur nicht direkt gegen Urmenschen – wie den unsterblichen Wächter der Annalen – vorgehen konnte, verstand sie sich doch geschickt darauf, deren Schwachstellen zu attackieren. Gierig drang sie in den Geist eines jeden ein, ließ vergrabene Erinnerungen auftauchen und säte Zweifel und Angst. Auf diese Weise würde irgendwann das mentale Gerüst dieses Menschen zusammenbrechen. Dann würde seine Persönlichkeit auseinanderfallen, er würde vor dem Nichts stehen. Hass und Entsetzen vernebelten sein Denkvermögen, und das Schiff des Lichts wurde immer undeutlicher. Eine tiefschwarze, eiskalte Spirale durchbohrte ihn und ließ ihn in einem Abgrund aus Schmerz und Verzweiflung zurück.
Er wachte im Packeis auf. Es war Nacht, und er war allein, vernichtet durch sein Scheitern. Nur seine Kleidung war ihm geblieben: eine leichte Tunika und eine Pluderhose, die ihm die Pilger geschenkt hatten. Seit Tagen marschierte er über das Eis, halb verhungert und erfroren, das einzige Geräusch war das Knirschen seiner Sandalen auf dem harschen Schnee, seinen Durst stillte er mit Eisbröckchen. Kein Stern leuchtete am nächtlichen Himmel. Das Gefühl, die Menschen verraten zu haben, lastete schwer auf ihm. Noch immer hörte er die Worte des unsterblichen Hüters des Schiffs des Lichts. Sie waren kein Trost für seine verzweifelte Seele.
»Du wirst allein sein … Solltest du scheitern, bedeutet dein Scheitern das Ende der Menschheit und den Anbruch eines neuen Zeitalters – das Zeitalters des Unfassbaren, das Zeitalter des Planeten Hyponeros …«
Er war erschöpft und fast am Ende seiner Kräfte.
Trotzdem musste er genügend Kraft aufbringen, um den geheimen Pfad wiederzufinden. Niemals könnte er sich verzeihen, das Unfassbare nicht bekämpft zu haben. Da sah er in der Ferne ockerfarbene Rauchfahnen aufsteigen.
Erst nachdem die Pilger einer nach dem anderen das Antra angerufen und um Hilfe gebeten hatten, weinte Aphykit. Die Pilger hatten sich bereits in der Unendlichkeit des Äthers aufgelöst, und das Dorf schien wie ausgestorben. Die einzigen Lebenszeichen waren die funkelnden Blüten des Dornenstrauchs, den der Narr gepflanzt hatte.
»Du darfst nicht weinen, Mama«, sagte Yelle. »Ich habe immer gewusst, dass sie fortgehen werden. Die Pilger haben mit der Arbeit begonnen, andere werden sie vollenden …«
Überrascht wand sich Aphykit zu ihrer Tochter um. Das kleine Mädchen war erst sieben und ein verschlossenes Kind, das oft vor dem Dornenstrauch des Narren kniete und dann meistens Unverständliches murmelte. Von ihrer Mutter hatte Yelle das lange gewellte Haar und von ihrem Vater die graublauen Augen. Ihr Blick schien über Zeit und Raum hinwegzugleiten. Eine seltsame, verstörende Kraft ging von ihr aus. Und ihre kindliche Stimme glich einer schneidenden Klinge.
»Welche anderen?«, fragte Tixu.
»Jene, die den Ruf hören werden … Das Blouf gewinnt an Macht …«
Ihr Vater runzelte die Stirn. »Das Blouf?«
»Das alles verzehrende Böse. Gestern Abend sind sehr, sehr weit von hier zehn Millionen Sterne verschwunden. Wenn Shari zurückkehrt, braucht er Soldaten, um das Blouf zu stoppen.«
»Vielleicht lebt Shari schon nicht mehr, Yelle«, sagte Aphykit und seufzte. »Seit über sieben Jahren haben wir keine Nachricht mehr von ihm erhalten.«
»Shari lebt!«, antwortete das kleine Mädchen bestimmt. »Er kommt zurück.«
»Warum bist du dir dessen so sicher?«
»Die Blüten des Dornenstrauchs haben es mir gesagt. Wir müssen weiteren Pilgern helfen, auf Terra Mater zu kommen. Weil das Blouf jetzt die Seele der Menschen frisst, können sie immer weniger den Gesang der Quelle hören …«
Yelle warf ihre Bettdecke von sich. Barfuß und nur mit ihrem Nachthemd bekleidet, lief sie über den verschneiten Dorfplatz und kniete vor dem Strauch. Dort betete sie mit ganzer Kraft – ein stummes Flehen durch Raum und Zeit.
ERSTES KAPITEL
Im Jahr 16 des Ang-Imperiums, am 7. Tag des Monats Mehonius, wurde ich zum jüngsten Kardinal der Kirche des Kreuzes ernannt. Noch war ich von einem glühenden Eifer besessen. Ich gehörte zu jenen, durch jahrelange Unterweisung, diamantrein geschliffenen, aber auch unerbittlichen Seelen und brannte darauf, alle Heiden zu bekehren, die Feinde des Glaubens und die des Wahren Wortes. Beim Anblick der langsam auf den Feuerkreuzen sterbenden Häretiker brach ich in ekstatische Tränen aus … Das geschah lange vor dem Erscheinen des ersten Auslöscher-Scaythen …
Am 10. Tag des Monats Mehonius wurde ich zum Stellvertreter seiner Heiligkeit, des Muffi Barrofill XXIV., auf dem Planeten Ut-Gen ernannt, der vor viertausend Standardjahren traurige Berühmtheit durch eine atomare Katastrophe erlangte, die drei Viertel der Bevölkerung auslöschte und die Hälfte seiner Oberfläche in Wüste verwandelte. Obwohl ich mir durchaus der Gefahren auf Ut-Gen bewusst war – atomare Verseuchung, Zerstörung der Zellen und somit frühzeitiges Altern, die Beta-Zoomorphie, eine ausgeprägte Form der Schizophrenie –, überwog die Freude über meine Ernennung. Die besorgten Mienen meiner Kardinalskollegen interessierten mich nicht, fühlte ich mich doch durch die himmlische Liebe der Kirche geschützt!
Am 38. Tag des Monats Mehonius betrat ich eine der Deremat-Kabinen im Palast Venicias und erlangte siebenundzwanzig Standardminuten später in einem der Tempel der Kreuzkirche in Anjor, der Hauptstadt, wieder das Bewusstsein. Ein paar Missionare, einige Diener und ein Inquisitor-Scaythe begrüßten mich dort. Eine Abteilung kaiserlicher Interlisten hatte mit der Unterstützung der Pritiv-Söldner die lokalen Herrscher ausgeschaltet und eine neue planetarische Regierung installiert: einen korrupten Haufen, der aus sechs Konsuln, Ministern und hohen Beamten bestand.
Junge Leute, die Ut-Gen nicht kennen, sollten wissen, dass dieser Planet der einzig bewohnte im Sonnensystem des Gestirns Hares ist – obwohl die Lebensbedingungen dort sehr schwierig sind. Dieses Gestirn befindet sich seit zwanzig Millionen Jahren im Stadium des Verglühens. Deshalb wird es auf diesem Planeten seit dem Jahr 714 (nach dem alten Standardkalender) wegen der abnehmenden Strahlung von Hares immer kälter. Seit Jahrhunderten zählt die Ausbeutung von Uranerzen und dem darin enthaltenen seltenen Plutonium zur einzigen Ressource Ut-Gens. Zwischen den Jahren 950 und 3500 erlebte die aus den Skoj-Welten importierte Atomindustrie dort einen ungeheuren Aufschwung. Ut-Gen wurde zum interstellaren Zentrum der Kernenergie.
Die Kernspaltung mit ihrer Energie- und Waffenproduktion, die per Atomoducti dem Planeten einen großen Reichtum bescherte, führte im Jahr 3519 deshalb fast zu seinem Untergang. Ein fürchterliches Erdbeben zerstörte die meisten Produktionsstätten, worauf radioaktive Wolken mehr als siebzehn Milliarden Menschen das Leben kosteten und den Planeten in zwei Zonen teilte: eine gesunde und eine verseuchte.
Obwohl die Utgenianer wissen, dass ihre Heimat krank ist und die sterbende Sonne sie nicht mehr wärmen wird, haben sie nicht die Kraft, ihren Planeten zu verlassen. Mit erstaunlichem Gleichmut ertragen sie die fortschreitende Vereisung, die Verdünnung des Sauerstoffgehalts der Luft und die damit einhergehenden Unbilden des Klimas … Und dieser Stoizismus wandelt sich langsam in Fatalismus.
Doch rufen wir uns die Worte des Predigers auf der Großen Düne von Osgor ins Gedächtnis zurück: »Oh ihr, die ihr euch widerspruchslos fügt, begreift ihr nicht, dass euch euer Fatalismus zu einer leichten Beute der falschen Propheten einer Irrlehre macht? Oh ihr, die ihr auf eure Freiheit verzichtet habt und euch in Illusionen wiegt …«
Auf Ut-Gen erlebte ich, wie sich an dessen Bewohnern jene göttliche Prophezeiung der Kirche des Kreuzes erfüllte. Aus dieser Erfahrung heraus möchte ich noch einmal unsere Novizen in den heiligen Propagandaschulen auf ein ehernes Prinzip hinweisen. Der Begriff Fatum – als verhängnisvolles Geschick –, ein beliebtes Argument Andersgläubiger, ist völlig abwegig, weil ein solches Denken die Saat des Wahren Glaubens wie Unkraut überwuchert und erstickt. Denn es finden immer mehr Kinderopfer, sexuelle kollektive Ausschweifungen und andere barbarisch-heidnische Riten statt.
Wie soll ich die Einheimischen beschreiben? Die utgenischen Männer sind klein und gedrungen, als würden die hier herrschende größere Schwerkraft als auf den Welten des Zentrums sie niederdrücken und deformieren. Ihre Gesichtszüge sind meistens grobschlächtig (der Beginn allgemeiner Beta-Zoomorphie?), ihre Brauen struppig, ihre Augen gelb und hervorstehend, ihre Nasen breit und flach, ihre Lippen dick, ihre Oberkiefer stehen vor … Die Frauen hingegen sind groß gewachsen, feingliedrig und haben schöne Gesichter. Soweit ich das beurteilen kann, sind sie ebenso schön wie ihre Männer hässlich sind. Eine mögliche Erklärung dieses Phänomens – über die Wissenschaftler lächeln würden, die ich aber poetisch finde – wäre, dass der dem Mond zugeordnete Stoffwechsel der Frau (der Mann wird dem Einfluss der Sonne zugeordnet) sich besser den veränderten klimatischen Verhältnissen auf Ut-Gen anpasst hat. Ich spreche hier nicht von den in den verseuchten Gebieten lebenden Überläufern, den sogenannten Quarantänern. Diese Wesen ähneln eher apokalyptischen Monstern als Menschen. Sie verdanken ihr Überleben der ehemaligen Konföderation von Naflin und deren fanatischen Anhängern, den Rittern der Absolution. Man hat mir wiederholt vorgeworfen, die Vergasung und das Zuschütten der Schächte und der unterirdischen Behausungen im Nord-Terrarium – dem Wohnsitz der Quarantäner – befohlen zu haben, aber der Oberste Ethikrat der Kirche des Kreuzes, den ich bereits vorher konsultiert hatte, versicherte mir, mich voll und ganz in meinen Maßnahmen zu unterstützen.
Am 17. Tag des Monats Jorus auf Syracusa verurteilte ich meinen ersten Häretiker zum langsamen Tod am Feuerkreuz – einen Priester der H-Prime-Religion, einen Anbeter des Sonnengottes in Frauengestalt. Bis zu meinem letzten Atemzug – gebe die Kirche des Kreuzes, dass ich noch viele Jahre lebe, denn meine Arbeit auf diesen niederen Welten ist noch lange nicht vollendet … – werde ich mich an den Hass erinnern, den er mir entgegenschleuderte, als die ersten Flammen an seinem Körper emporzüngelten. Er war im Gegensatz zu den meisten seiner Rasse ein außerordentlich schöner Mann mit einem stark entwickelten Geschlecht und somit schamlos in seiner Nacktheit. Und unter den Zuschauern waren viele Frauen, die er befruchtet hatte (natürlich hatten sie ihre Unschuld beschworen, aber der scaythische Inquisitor hatte sie mühelos überführt), und sie weinten. Zu jener Zeit war ich ganz und gar von meinem Priesteramt erfüllt. Nichts anderes beschäftigte meine Gedanken. Ich musste nicht einmal die Hilfe der Auslöscher in Anspruch nehmen, um meine Jugend zu leugnen, um meine marquisatinische Herkunft zu vergessen … Der Sohn Jezzica Boghs, der Wäscherin des Runden Hauses mit seinen neun Türmen, hatte nie existiert … Der Spielgefährte List Wortlings, des Sohns des Seigneurs Abasky, hatte nie existiert… Der aufsässige Jugendliche, der zwei Tage und Nächte den Tod Armina Wortlings weinend beklagte, hatte nie existiert …
Ich lebte weit vom Planeten Syracusa, weit von den Intrigen der Hauptstadt Venicia entfernt. Wie hätte ich von den finsteren Plänen erfahren können, die dort im bischöflichen Palast geschmiedet wurden?
Mentale Memoiren des Kardinals Fracist Bogh, der unter dem Namen Barrofill XXV. Muffi der Kirche des Kreuzes wurde.
Jek betrachtete den Wachturm der Gedanken, ein schmales hohes Gebäude, das alle Flachdächer der Hauptstadt Ut-Gens, Anjor, überragte. Dort oben, im erleuchteten runden Raum des Wachpostens, konnte er die unbewegliche Silhouette des scaythischen Inquisitors in seinem grauen Kapuzenmantel erkennen. Darüber stand am dunklen Himmel die rötliche Scheibe der sinkenden Sonne Hares.
Diese beiden Phänomene, das eine künstlich, das andere natürlich, symbolisierten das doppelte Unglück, das über Ut-Gen hereingebrochen war. Nicht nur, dass vor viertausend Jahren Hares, der Sonnengott in Frauengestalt, die nukleare Pest über dem Planeten ausgebreitet und mehr als fünfzehn Milliarden seiner Bewohner dahingerafft hatte, dann landeten auch noch Legionen des großen Ang-Imperiums, Kreuzler, Scaythen, Pritiv-Söldner und Interlisten. Diese hatten die lokalen Ordnungskräfte ausgeschaltet und die sechs Konsuln entmachtet. Seit mehr als zehn Jahren führten sie, unter ihrem größten Fanatiker, dem Kardinal Fracist Bogh, ein Terrorregime.
Jek ging weiter. Obwohl er erst acht Jahre alt war, wusste er, wie gefährlich es war, länger vor einem Wachturm der Gedanken stehen zu bleiben. Dort riskierte er, den Argwohn des scaythischen Inquisitors auf sich zu ziehen. Und nach einem mentalen Verhör würde man ihn entweder vor eines der heiligen Tribunale stellen oder in eines der Zentren mentaler Reprogrammierung einweisen. Wenn er seinen großen Plan irgendwann realisieren wollte, durfte er keine Aufmerksamkeit erregen.
Er ging die Hauptstraße Anjors wieder hoch, eine schmale und gewundene Avenue, länger als einhundertvierzig Kilometer. Die immer leuchtenden mobilen Laternen warfen gelbe Lichtflecke auf die Bürgersteige. Etwas weiter war es stockfinster. Ebenfalls leuchtende, von Nebelschwaden umwallte steinerne Pfosten markierten die Eingänge zu den unterirdischen Bahnhöfen, des Transportsystems Anjors – TRA genannt.
Jek beschloss, die sieben Kilometer nach Hause zu Fuß zu gehen. Es war ihm lieber, zu spät zum Abendessen zu erscheinen und sich deshalb von seinen Eltern rügen zu lassen, als in eine dieser überfüllten U-Bahnen zu steigen, diese großen weißen Würmer, die lärmend durch die stinkenden, mit Schmiermittel getränkten Röhren unterhalb der Stadt kreuzten.
Zuerst ging er in Richtung des rund um die Uhr geöffneten Marktes von Rakamel und betrachtete die Auslagen der Agrargemeinschaft. Die Angestellten trugen Kittel und Mützen aus ungebleichter Wolle. Seit der nuklearen Katastrophe wurden Getreide, Gemüse und Früchte in riesigen wasserdichten Gewächshäusern kultiviert und büßten jedes Jahr mehr an Geschmack und Aussehen ein. Auch das Fleisch war grau und schmeckte nach nichts.
Wenn P’a At-Skin einmal guter Laune war – was immer seltener geschah –, setzte er seinen Sohn Jek auf seinen Schoß und erzählte ihm von den guten alten Zeiten auf Ut-Gen. Von jenen Zeiten, wo die Früchte saftig und süß schmeckten, die Tiere auf den Hochplateaus frei umherliefen und die Anjorianer im warmen Zougasmeer badeten … Jek fragte sich dann immer, woher sein Vater das wisse. Denn er war jetzt fünfundsechzig, und die Katastrophe hatte sich vor etwa viertausend Jahren ereignet. Er musste also über ein ungeheures Vorstellungsvermögen verfügen, um die riesige Packeisfl äche in ein warmes Meer zu verwandeln. Doch Jek protestierte nie, er wusste, dass sein Vater manchmal das Bedürfnis hatte, allein durch Worte seine im Sterben begriffene Welt wiederauferstehen zu lassen.
Jek ging an den trübsinnig wirkenden Händlern vorbei zum Platz der Heiligen Folter. Vor der Kirche des Kreuzes, deren schlanke Türme einen seltsamen Kontrast zu den quaderförmigen Konstruktionen der einheimischen Gebäude bildeten, stand ein Wald aus Feuerkreuzen. Kardinal Fracist Bogh ließ sie Tag und Nacht von Scheinwerfern anstrahlen, sodass jeder die gefolterten Körper der Verurteilten sehen und Zeuge ihres manchmal länger als sieben Tage währenden Todeskampfes sein konnte …
Jek senkte den Kopf und biss sich auf die Unterlippe, um nicht zu weinen. Auch wenn er diesen Anblick schon seit frühester Kindheit kannte, hatte er sich im Gegensatz zu den Gaffern nie daran gewöhnen können. Er ballte die Fäuste und steckte sie in die Taschen seiner Pluderhose. Dann lief er schnell über den Platz.
Außer Atem und schweißgebadet kam er schließlich zwei Stunden später zu Hause an. Zwei fahle Gestirne hatten Hares vom Himmel verdrängt. Sein Elternhaus im Wohnviertel Oth-Anjor – wörtlich: das alte Anjor – lag halb unter der Erde. Und P’a At-Skin war sehr stolz auf den schmalen Streifen künstlichen Rasens, der das Gebäude umgab und den er den »Garten« nannte. Ein unerhörter Luxus in einer übervölkerten Stadt wie Anjor, wo sich das gesamte Leben einer Familie in einem einzigen Raum abspielte: kochen, essen, streiten, schlafen.
Seine Eltern saßen bereits am Tisch, als er den zu ebener Erde gelegenen Raum betrat: Küche, Wohn- und Kinderzimmer zugleich. Also sein Zimmer, da er der einzige Sohn war.
M’a At-Skin warf ihm einen bösen Blick zu, und P’a At-Skin runzelte die Stirn. Seine Eltern waren streng. Jek hatte nicht viel zu lachen gehabt. Es sei denn, P’a At-Skin war mit glänzenden Augen und schwerer Zunge von seinen halbjährlichen Versammlungen zurückgekehrt. Doch seit beide zum Kreuzianismus konvertiert waren, wirkten sie noch ernster. Jeks Vater war geschrumpft, sein Rücken krumm, so als ob er sich um seinen dicken Bauch zusammenrollen wolle. Und das schöne Gesicht seiner Mutter war hart und faltig geworden. Unter ihrer traditionellen Kleidung, Jacke und Hose für die Männer, und eine lange Tunika samt enger Hose für die Frauen, trugen seine Eltern nun den Colancor. Und die drei Haarsträhnen, die man trotz des Colancors sehen durfte, welche eigentlich dieser Kleidung Anmut verleihen sollten, sahen bei ihnen lächerlich aus.
Sie hatten es sich in den Kopf gesetzt, ihrem Sohn die Grundelemente des Kreuzianismus’ zu lehren, doch dabei stießen sie bei ihm auf hartnäckigen Widerstand. Jek weigerte sich kategorisch, den Messen in der Kirche beizuwohnen und dem göttlichen Wort zu lauschen. Schlimmer jedoch war es für ihn, dass seine Eltern nicht zur Konversion gezwungen worden waren, sondern quasi durch eine Erleuchtung spontan zu diesem Glauben gefunden hatten. Jedenfalls behaupteten sie das … Doch Jek hatte das Gefühl, dass sie ihn belogen.
Als er jetzt wie erstarrt in der Tür stand, hatte er den Eindruck, zwei lebenden Toten gegenüberzustehen. Allein der aufsteigende Dampf aus den Tellern schien Leben zu verbreiten.
»Wo warst du, Jek?«, fragte M’a At-Skin mit dieser säuselnden Stimme, die nichts Gutes verhieß.
»Ich war spazieren, in der Stadt«, antwortete Jek.
»Immer dieselbe Antwort!«, sagte P’a At-Skin mürrisch.
»Und immer dieselbe Frage«, entgegnet Jek und seufzte.
Die Mahlzeit verlief in tödlichem Schweigen. Doch an den flüchtigen Blicken, die seine Eltern wechselten, erkannte der Junge, dass das Thema noch nicht vom Tisch war.
Schließlich hörte P’a At-Skin mit Kauen auf und wischte sich den Mund ab. »Jek …«
»Jek …«, sagte auch M’a At-Skin mit dieser besonderen Betonung.
»Jek, mein Sohn, du wirst immer unverschämter!«
»Und immer unerträglicher …«
Jetzt bedauerte Jek, nicht dem Rat des alten Artrarak gefolgt zu sein, denn die Entschlossenheit, die er in den Gesichtern seiner Eltern lesen konnte, erfüllte ihn mit unsäglicher Angst.
»Jek, mein Sohn, wir haben, was dich angeht, eine Entscheidung getroffen«, fuhr P’a At-Skin fort.
»Es ist höchste Zeit, deinem rebellischen Kopf etwas Ordnung einzutrichtern«, fügte M’a At-Skin hinzu.
»Deswegen schicken wir dich morgen früh in die heilige Propagandaschule von Oul-Bahi …«
»Das ist eine sehr gute Schule, wo du gefördert wirst …«
Das Blut gefror dem Jungen in den Adern. Fast hätte er die bittere Erbsensuppe – eine kulinarische Tortur seiner Mutter – wieder ausgespuckt. Trotzdem zwang er sich, seinen Teller leer zu essen.
Jek stach sich mit einer Nadel aus dem Nähkorb seiner Mutter in die Wangen. Sein langer Marsch durch die Straßen Anjors hatte ihn erschöpft, und der Schlaf breitete gleich einem Vogel der Nacht seine Schwingen über ihm aus. Seine Glieder wurden schwer. Die gedämpften Stimmen seiner Eltern drangen an sein Ohr. Nur nicht einschlafen!
Auf die Ankündigung seiner Eltern hatte er emotionslos reagiert, doch sobald er in seinem Klappbett lag, hatte er heiße Tränen geweint. Sie wollten sich also von ihm trennen und ihn nach Oul-Bahi schicken, eine weit entfernte Provinzstadt, und ihn in eine Propagandaschule einsperren lassen, Tag und Nacht unter der Fuchtel dieser Kreuzler-Missionare. Jek beurteilte seine Eltern mit der Strenge aller Kinder, aber er liebte sie auf seine Weise, denn er erinnerte sich an glücklichere Zeiten, an das laute Lachen seines Vaters und die fröhlichen Augen seiner Mutter. Damals waren sie voller Wärme und Leben gewesen, und sein Elternhaus hatte einer winzigen heiteren Insel in dem ewigen kalten Grau Ut-Gens geglichen.
Er fuhr aus dem Schlaf hoch, schweißgebadet. Reflexartig stach er in seine Wange und schrie vor Schmerz laut. Dann lauschte er, alle Sinne angespannt.
Im Haus herrschte Stille, die nur von dem dumpfen Brummen der U-Bahnzüge und dem fernen Summen der Pendelflugzeuge für Handelsgüter unterbrochen wurde. Er stand auf und zog seinen Pyjama aus. Da M’a At-Skin die Angewohnheit hatte, seine Kleidung auf die Küchentheke zu legen, musste er den Raum tastend durchqueren. Es war Herbst, und P’a At-Skin hatte die Atom-Heizkugeln noch nicht installiert. (Auf Ut-Gen gab es nur drei Jahreszeiten: Tiefer Winter, Winter und Herbst.) Trotzdem fror Jek.
Seit länger als einem Jahr – genau gesagt, seit er Artrarak kennengelernt hatte – liebäugelte er mit seinem großen Projekt. Artrarak war ein alter Quarantäner aus dem Nord-Terrarium. Doch inzwischen musste Jek sich eingestehen, dass er diesen Plan nie hatte realisieren wollen. Es hatte sich vielmehr um einen Kindertraum gehandelt, eine Pforte zur Utopie, eine Flucht aus dem Alltagsleben, aus der Langeweile.
Jek stieß an einen Stuhl. Der Lärm war furchtbar. Er glaubte, sein Herz würde zerspringen. Wie erstarrt blieb er stehen und lauschte. Doch er hörte nichts, nicht die leiseste Reaktion.
Er – ein Kind von acht Jahren – war im Begriff seine Eltern zu verlassen, doch sie schliefen den tiefen Schlaf der Selbstgerechten. Widersprüchliche Gefühle beherrschten ihn. Einerseits wünschte er sich, sie würden aufwachen, ihn in die Arme nehmen und ihm tröstende Worte zuflüstern. Doch andererseits hoffte er, dass sie weiterschliefen und ihn seine lange Reise antreten lassen würden, eine Reise, von der er nie zurückkehren würde.
Er legte die Hand auf seine sorgfältig gefalteten Kleider – Ordnung, eine weitere Marotte M’a At-Skins – und zog sich hastig an. Schwieriger war es, seine gefütterten Stiefel zu finden, weil seine Mutter sie absurderweise manchmal in den Schrank unter dem Ausguss zu den Reinigungsmitteln stellte. Schließlich fand er sie, schlüpfte hinein und ging, immer noch vorsichtig tastend, zur Tür. Der Strahl einer mobilen Straßenlaterne drang durch einen Spalt der Antistrahlenrollos und wurde vom kugelförmigen Bildschirm des Holovisi onsgeräts reflektiert.
Da Ut-Gen ein unbedeutender Planet des Imperiums war, konnten die Bewohner keine transstellaren Sendungen mehr empfangen, und über die nötigen Strukturen, eigene zu realisieren, verfügten sie nicht. Trotzdem hatte P’a At-Skin die Empfangskugel behalten. Sie sei hübsch als Dekoration, hatte er behautet. Doch vor allem war sie ein demonstrativ zur Schau gestelltes Objekt des Reichtums der Familie At-Skin, weil sich damals nur wenige Utgenianer eine Bildschirmkugel hatten leisten können.
Die Hand auf dem Türgriff drehte sich Jek noch einmal um und warf einen letzten Blick in den dunklen Raum. Ein Gefühl unendlicher Einsamkeit und Traurigkeit überkam ihn und hinterließ einen bitteren Geschmack in seinem Mund. Sekundenlang war er versucht, seinen wahnsinnigen Plan aufzugeben und in die Geborgenheit seines noch warmen Betts zu kriechen. Dann dachte er daran, was die Kreuzianer aus ihm in dieser trostlosen Stadt Oul-Bahi machen würden, an die unüberwindbaren Mauern der heiligen Propagandaschule und die strengen Gesichter der Missionare. Das bestärkte ihn in seinem Entschluss. Und was würde sein Fortgehen für seine Eltern bedeuten? Nur eins: dass er ging, ehe sie ihn fortjagen konnten.
Nur mühsam unterdrückte er seine Tränen, als er vorsichtig die Tür einen Spalt öffnete. Sein Vater hatte vorsorglich auch Jeks Zellenabdrücke in den Identifikator eingegeben, sodass jetzt kein Alarm ausgelöst wurde. Als er auf dem Bürgersteig stand, hatte er das Gefühl, sich in einer feindlichen Welt zu befinden.
Die Straßenlaternen verbreiteten nur diffuses Licht; sie glichen runden kurzsichtigen Augen, denen es nicht gelang, den dichten, über der Stadt liegenden Nebel zu durchdringen. Glücklicherweise war die Straße menschenleer. Jek schlug den Kragen seiner Jacke hoch und trottete zur nächsten U-Bahnstation des TRA.
Ein paar Minuten später betrat er die Gravitationsplattform, die ihn zum Bahnsteig brachte. Die automatischen Züge fuhren nachts selten. Die wenigen Passagiere standen müde in der Nähe der schwebenden Sitze. Sie nahmen jedoch nicht Platz, so als hätten sie Angst, vor Erschöpfung einzuschlafen.
Am anderen Ende des Bahnsteigs entdeckte Jek ein paar Interlisten in ihren schwarzen Overalls. Sollten sie ihn entdecken, würden sie ihn sofort mitnehmen und ihn einer zellularen Analyse unterziehen, ehe sie ihn wieder nach Hause brächten. Fast hätte er sich gewünscht, dass dies geschehe, denn er fühlte sich noch nicht sehr wohl allein und in Freiheit. Doch dann besann er sich: Jek At-Skin, der Abenteurer, bereit, das Universum zu entdecken, sollte so schnell aufgeben? Jek At-Skin, der Junge, der die drei legendären Persönlichkeiten kennenlernen wollte, von denen der alte Artrarak erzählt hatte, wollte seine Eltern nicht verlassen? Ja, er war der Sohn ganz gewöhnlicher Utgenianer und hatte sechs Monate im Bauch seiner Mutter und drei weitere im Familienbrutkasten verbracht – wie vor ihm P’a At-Skin und vor ihm Großp’a At-Skin … Liebe und Abstammung hatten ein unsichtbares Band zwischen ihnen geknüpft …
Doch darf ich mich deswegen vor dem Unbekannten fürchten?, fragte sich Jek. Ein abenteuerliches Leben mit der tristen Existenz hinter den Mauern einer heiligen Propagandaschule vertauschen?
Jek entdeckte ein Liebespaar in seiner Nähe, nicht zu jung, nicht zu alt. Mit etwas Glück würde man die beiden für seine Eltern halten.
Er ging hinter ihnen her, als der weiße, etwa fünfzig Meter lange Zug mit schrillem Kreischen in den U-Bahnhof einfuhr und hielt. Die Schiebetüren glitten mit einem pfeifenden Geräusch auseinander. Das Abteil war nur zu drei Vierteln voll. Jeks Leiheltern setzten sich, eng aneinandergeschmiegt, auf eine leere Bank. So blieb genug Platz für ihren unbekannten Sohn. Mit dem Austausch von Küssen beschäftigt, schenkten sie ihm keine Beachtung.
Und während die Stationen an Jek vorbeizogen, beobachtete er die Verliebten aus den Augenwinkeln. Die beiden hatten sich noch nicht zur Kirche des Kreuzes bekehrt, denn sie trugen keine Colancors, und ein Kreuzler hätte es wegen des strengen Moralcodex’ niemals gewagt, der Öffentlichkeit ein derart intimes Schauspiel zu bieten. Jek hoffte, dass dieses schamlose Benehmen nicht die Aufmerksamkeit der gefürchteten Interlisten ein paar Sitze weiter erregen würde. Auch fragte er sich, ob sich seine Eltern in ihrem Schlafzimmer im Keller noch küssten, doch dann fand er, dass dies ein lächerlicher Gedanke sei. Und je weiter ihn die U-Bahn aus dem historischen Zentrum Anjors forttrug, umso blasser wurde die Erinnerung an seine Eltern, eine Feststellung, die ihn verstörte. Plötzlich schien ihm, er habe sie schon vor Jahren verlassen.
Haltestelle Traph-Anjor. Hier musste er umsteigen und die U-Bahn zum Nord-Terrarium, dem Viertel der Quarantäner, nehmen. Jek mischte sich unter den Strom der Fahrgäste und ihm wurde fast schlecht, als er an den Interlisten vorbeiging. Aber die schwarzen Gestalten rührten sich nicht. Schnell ging er zur Umsteige-Plattform. Er hatte den alten Artrarak schon so oft besucht, dass er den Weg auch mit geschlossenen Augen hätte finden können. Es gab für ihn keinen Rückweg mehr, und er fragte sich, ob ihn der alte Mann auch zu nächtlicher Stunde empfangen würde.
Das Terrarium – die unterirdischen Stadtviertel, in denen die Überläufer der verseuchten Zone hausten – erstreckte sich über Hunderte von Hektar im Norden Anjors. Es war eine Stadt in der Stadt mit eigener Verwaltung, eigenem Handel und eigener Polizei. Ein Ghetto, das die »Oberirdischen«, die auf der Erde lebenden Anjorianer, nie aufsuchten.
Ehe Jek diesen Ort zum ersten Mal betrat, hatte er alle möglichen Geschichten über die Quarantäner gehört: P’a At-Skin zum Beispiel behauptete, die radioaktiven Stürme hätten bei ihnen seltsame Krankheiten und schreckliche Deformationen hervorgerufen. Er war der Meinung, dass man sie nie hätte in die geschützte Zone lassen dürfen, und dass sie sich dort wie Karnickel vermehrten und deshalb bald zahlreicher als die gesunden Utgenianer sein würden. Weiter pflegte P’a At-Skin dann über die Regierung vor tausendfünfhundert Jahren zu schimpfen; es sei inkompetent und schwach gewesen, keine magnetische Barriere zwischen den beiden Regionen zu errichten. Diese Politik sei erst zwei Jahrhunderte später von den berühmten Tyrannen der PUGU (der Partei der Ultragesunden Ut-Gens) korrigiert worden, indem sie die Quarantäner in riesige Luftschiffe verfrachtet hätten, die während des Flugs darauf programmiert waren, zu explodieren. Die Herrscher seinerzeit glaubten, Anjor von dem infizierten Gesindel befreit zu haben, doch etliche waren den Todesbrigaden entkommen, weil sie sich in den Abwasserkanälen der Hauptstadt versteckt hatten. Auf diese Weise war das Nord-Terrarium entstanden.
Als Jek zum ersten Mal das monumentale Tor des Ghettos durchschritt, hatte er einen furchtbaren Schrecken beim Anblick der spitzen ineinander verschlungenen Betonpfähle bekommen, die die riesigen Trichter in der Erde umgaben. Er hatte erwartet, aus den unzähligen schwarzen Höhlen, deren Eingänge an den glatten Abhängen der Schächte wie Löcher klafften, abscheuliche Monster auftauchen zu sehen, und nur die spöttischen Bemerkungen seiner Freunde hatten ihn damals davon abgehalten, gleich wieder umzukehren. Doch dann hatte er festgestellt, dass die Quarantäner fast Menschen wie alle anderen waren. Er hatte sich an ihre entstellten Gesichter und Körper, an das seltsame Gluckern in ihren Bäuchen während des Sprechens gewöhnt und ihre Warmherzigkeit, ihren Humor und ihre Lebensfreude schätzen gelernt. Ihre Vorfahren waren zwar dem Zorn des Sonnengottes der H-Prime-Religion zum Opfer gefallen, aber sie litten nicht unter diesem alles beherrschenden Missmut, der die auf der Oberfläche lebenden Anjorianer innerlich zerfraß.
Die Kreuzler-Missionare wagten sich nicht in das Nord-Terrarium. Was nicht bedeutete, dass die Kirche sich nicht für das Schicksal der Quarantäner interessierte. P’a At-Skin hatte davon gesprochen, der Kardinal Fracist Bogh und seine Ratgeber dächten über eine radikale Intervention nach, um das Ghettoproblem ein für alle Mal zu lösen.
Jek lief die Treppe zum Schacht A 102 hinunter, bis zum obersten Ponton. Hier herrschte Dunkelheit. Seine Schritte auf den metallenen Stufen hallten dumpf von den Wänden wider. Er ging zu der Leuchtkonsole in einem der schwebenden Leitungsmasten und drückte auf den Knopf, der die Gravitationsplattform herbeirief. Ein peitschender Wind wehte ihm seine Haare ins Gesicht. Er musste sich an das Geländer des Pontons klammern, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren und in den einige hundert Meter tiefen Abgrund zu stürzen. Über ihm waren die Sterne und die bleichen Sicheln der Satelliten durch den dichten Nebel kaum zu sehen.
Kurz darauf tauchte die Plattform aus dem Dunkel auf und dockte langsam an dem Ponton an. Jek gab die Zahlen 2,5,4 mit der Tastatur der Konsole ein und stellte sich vorsichtig in die Mitte der kreisrunden, im Durchmesser etwa zwanzig Meter großen Plattform. Sie war mit keinem Schutzgeländer versehen wie die Plattformen des TRA, sondern von einem künstlichen Gravitationsfeld umgeben. Deshalb ging Jek, auch tagsüber, nie an den Rand, um nach unten zu schauen. Wie erstarrt stand er jetzt da und wartete auf das erlösende Gefühl, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren.
Die Plattform schwankte leicht, drehte sich um sich selbst und begann mit einem leisen Summen ihren Abstieg. Sofort gewann sie rapide an Fahrt. Da kein Zwischenstopp einprogrammiert worden war, wurde die Beschleunigung durch nichts gebremst. Obwohl Jek von der künstlichen Schwerkraft gehalten wurde, überkam ihn plötzlich die Angst, in dieser totalen Finsternis in den Abgrund zu stürzen. Sein Herz raste.
Als die Plattform langsamer wurde, beruhigte sich Jeks Herzschlag. Sie legte mit einem Klick an einem schmalen Rezepti ons-Ponton an. Das künstliche Gravitationsfeld wurde deaktiviert. Noch benommen und mit weichen Knien machte sich Jek auf den Weg, ohne wie sonst einen Blick in Richtung Schachtöffnung zu werfen, die von oben so groß und von unten so klein wirkte. Ohne zu überprüfen, ob er wirklich auf dem Niveau-254 angekommen war, ging er direkt in den Tunnel, der zu den unterirdischen Behausungen führte.
Er lief zur ersten Weggabelung, einem kleinen, von einem Deckengewölbe überspannten Platz, von dem ein Dutzend weitere Gänge abzweigten. Er konnte fast nichts sehen, aber dank seiner früheren Besuche kannte er den Weg. Die Leuchtstränge in den Tunneldecken brannten nicht. Nur schmale Lichtstreifen fielen aus den Schleusenkammern der noch beleuchteten Behausungen. Jek hatte sich immer gefragt, wie die Quarantäner den Tag von der Nacht unterscheiden konnten. Jetzt wusste er es: Wenn die Nacht hereinbrach, schalteten sie einfach das Licht in den Tunneln aus.
An der sechsten Abzweigung betrat er einen schmalen, gewundenen Gang, in dem ein ganz besonderer Geruch herrschte – nicht der modrige Gestank, der für das Ghetto charakteristisch war –, ein Geruch, der ihm sagte, dass es nicht mehr weit sein konnte. Kurz darauf kam er in eine große Grotte, eine Plumengplantage. Die aromatische Wurzel des Plumengs war das Basisprodukt, das die Quarantäner für fast alle Gewürze, Pomaden und Salben verwendeten.
Ein Lichtstrom ergoss sich aus der Wohnhöhle des alten Artrarak und beleuchtete ein Stück schwarze Erde, streichelte die braunen, geäderten Blätter der Plumengs und wanderte über eine zerklüftete Wand, ehe er sich in der Tiefe der Grotte verlor. In der Stille war nur ein leises Plätschern zu hören. Jek kam langsam wieder zu Atem und wischte sich mit seinem Jackenärmel Schweißtropfen von der Stirn.
»Du hast dich also entschlossen!«, hörte er plötzlich eine tiefe und melodiöse Stimme.
Jek schrak zusammen. Der alte Artrarak tauchte aus der Dunkelheit auf und ging lächelnd zu seinem jungen Freund.
Das Schicksal schien sich bei diesem Quarantäner einen besonders üblen Spaß erlaubt zu haben. Nicht nur, dass er einen fast unaussprechbaren Namen hatte, sein hässlicher Kopf widersprach jeglicher Ästhetik. Die Augen befanden sich nicht unter der Stirn, sondern rechts und links neben der schnauzenförmigen Nase. Sie lagen so tief in ihren Höhlen, dass man sie zuerst für ein weiteres Paar Nasenlöcher hielt, ehe man ihr Funkeln entdeckte. Der Mund ging bis zu den Ohren, die an den Schläfen saßen. Auf dem verbeulten Schädel spross spärliches weißes Haar. Arme und Beine waren so dünn und lang, dass der Mann wie eine Spinne wirkte. Und diese Gestalt war in Lumpen gehüllt, grob zusammengenähte schmutzige Stofffetzen, die man kaum als Kleidung bezeichnen konnte. Die ganze Hässlichkeit verschwand jedoch wie durch einen Zauber, wenn Artrarak sprach. Die Schönheit seines Wesens drückte sich vollkommen in seiner Stimme aus, einer warmen, tiefen, beschwörenden Stimme. Sie perlte aus seinem Mund wie duftendes Wasser aus einer Quelle, sie floss wie ein stetiger magischer Fluss dahin, in den Jek immer wieder mit Entzücken tauchte. Die kleinen Anjorianer, die ihn besuchten, wussten nicht wie alt er war, aber sie hatten ihn spontan den »alten Artrarak« genannt. Unter den anderen Quarantänern galt er als Außenseiter, ein Schwätzer, der seine eigenen Legenden zu glauben schien.
Jetzt sah Artrarak besorgt aus. Seine knochigen Finger gruben sich schmerzhaft in Jeks Schulter. »Du bist ausgerissen, nicht wahr?«
Jek nickte.
»Sehr schön, das macht mir Mut! Wenigstens einer, der meine Geschichten glaubt.«
»Meine Eltern wollten mich morgen früh in eine dieser heiligen Propagandaschulen schicken …«, sagte Jek, den Tränen nahe.
»Oh, oh! Das ist also ein Notfall. Komm in meine Höhle. Dort können wir besser reden.«
Jek kam ein hässlicher Gedanke: Kann ich dem alten Artrarak wirklich Glauben schenken? Und wenn seine schönen Geschichten nun nichts als Phantastereien eines kranken Hirns sind? P’a At-Skin hat häufig gesagt, dass die Quarantäner oft unter Schüben akuter Schizophrenie litten. Dann glauben sie Dinge zu sehen und zu hören, die überhaupt nicht existieren. Vielleicht gab es diese legendären Gestalten; die schöne Syracuserin, Naïa Phykit, den Oranger Sri Lumpa und den Mahdi Shari von den Hymlyas überhaupt nicht? Plötzlich kamen Jek diese ganzen Geschichten ziemlich unwahrscheinlich vor, dass jemand den Fängen einer Riesenechse auf dem Planeten Zwei-Jahreszeiten entkommt, die mentalen Inquisitoren an der Nase herumführt und allein durch die Kraft seiner Gedanken reist …
Artrarak ging mit dem Jungen in seine Höhle und bedeutete ihm, sich auf einen der Steinhocker zu setzen. Die Möbel in seiner Behausung beschränkten sich auf das Nötigste: noch zwei weitere Hocker, ein Tisch aus Lehm, ein paar Regale, die er aus dem Fels herausgearbeitet hatte, und eine Matratze aus Plumeng auf dem Boden. Die große, phonetisch steuerbare Lichtkugel war sein einziges Zugeständnis an die Moderne. Doch ganz gleich zu welcher Jahreszeit, ob im Tiefen Winter, Winter oder Herbst, und obwohl der alte Mann keine atomare Heizkugel besaß, herrschte in seiner Höhle immer eine angenehme Temperatur.
»Du musst hungrig und durstig sein«, sagte Artrarak.
Ohne auf eine Antwort zu warten, verschwand er in einem dahinterliegenden Raum. Jek überkam plötzlich eine unendliche Müdigkeit. Bei seinen Eltern musste er immer früh zu Bett. Daher war er jetzt richtig benommen und nahm seine Umgebung nur noch verschwommen wahr.
»Da! Das wird dir wieder Kraft geben. Und die wirst du brauchen, weil du schon vor Tagesanbruch wieder aufbrechen musst. Denn wenn deine Eltern dein Verschwinden bemerken, werden sie sofort die Interlisten benachrichtigen, und die schicken eine Geruchserkennungssonde hinter dir her …«
Artrarak stellte Jek ein Tablett hin, und der Junge griff automatisch nach einer Tasse. Das heiße, bittere Getränk trieb ihm Tränen in die Augen.
»Vielleicht könnte ich die Sonde von deiner Fährte ablenken, aber da bin ich mir nicht sicher«, fuhr der Quarantäner fort. »In Sicherheit wirst du erst in der verstrahlten Zone sein …«
Jek starrte den Alten entsetzt an.
»Die verstrahlte Zone?«
»Das ist die einzige Region, die die Interlisten nie betreten, auch die Kreuzler, die Scaythen oder die Pritiv-Söldner nicht! Doch du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du wirst dich dort nur kurze Zeit aufhalten, sodass dir die Strahlung nichts ausmacht. Dreißig Jahrhunderte, das ist ewig, und währenddessen haben unsere Freunde, die Atome, ihre furchtbare Zerstörungskraft verloren …«
»Aber da kommt man nicht rein … Die magnetische Hochspannungsbarriere …«
Artrarak lachte. »Die Quarantäner überschreiten diese Grenze jeden Tag zu Hunderten und kehren unbeschadet zurück! Keine Hochspannungsbarriere hindert Ratten zu graben … Und du wirst der erste Anjorianer sein, der diese unterirdischen Wege beschreitet. Das ist eine große Ehre … Und vor allem ist es die einzige Möglichkeit, Ut-Gen unbemerkt zu verlassen, denn alle Deremats und alle regelmäßig verkehrenden Raumschiffe werden von Aufsichts-Scaythen kontrolliert. Sie können deine Gedanken lesen, als würden sie in einem Buch blättern. Doch von der verbotenen Zone aus gelangst du in die Stadt Glatin-Bat. Dort fragst du nach dem Raumschiff des Dogen Papironda. Der Mann ist zwar ein Plünderer und Halsabschneider, aber wenn du ihm sagst, dass ich dich schicke, wird er dich zum Planeten Franzia bringen, er gehört zum Sternhaufen von Neorop …«
Gewöhnlich erweckte Artraraks Rede glühende Begeisterung in Jek, doch in dieser Nacht gefror ihm fast das Blut in den Adern. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass der alte Mann in seinen Erzählungen immer nur vom Ziel der Reise gesprochen hatte, aber nie, wie man dorthin gelangte. Jetzt erst ahnte Jek, welche Schwierigkeiten ihn erwarteten. Es war etwa so, als ob er sich eine Zeichnung vorstellte und sich dann an die Ausführung machte. Jeder Strich auf dem Papier schien ihn von dem grandiosen Bild in seiner Phantasie weiter zu entfernen. Ein Abgrund tat sich zwischen Traum und Wirklichkeit auf. Nicht nur, dass er sich in die verseuchte Zone begeben musste, er bekam es auch noch mit einem Verbrecher zu tun, einem dieser Piraten, die skrupellos im Weltraum operierten und von dem P’a At-Skin manchmal voller Entsetzen gesprochen hatte.
»Auf Franzia gibt es Geheimorganisationen, die Pilger nach Terra Mater transferieren, der Erde allen Ursprungs«, sprach Artrarak weiter. »Dort werden dich Naïa Phykit, Sri Lumpa und der Mahdi Shari von dem Hymlyas den Klang der Stille lehren, denn er allein schützt dich vor der mentalen Inquisition und erlaubt dir, kraft deiner Gedanken zu reisen. Du wirst einer der Krieger der Stille werden, kleiner Jek, einer der Menschen, der ein neues Zeitalter vorbereiten wird. Ein Krieger der Stille …«
Die letzten Worte hatte Artrarak mit großer Ehrfurcht ausgesprochen.
»Das sind doch alles nur Lügen, Legenden!«, rief Jek und stieß wütend seine Tasse zurück.
»Was ändert das schon?«, entgegnete der Alte gelassen. »Was ziehst du vor? An Legenden zu glauben, oder dich mit einem Leben ohne Hoffnung abzufinden? Ich, für meinen Teil, ziehe die Schönheit der Lügenmärchen gewissen grausamen Wahrheiten vor …«
»Und warum bleibst du dann hier?«
»Du kannst dir nicht vorstellen, wie gern ich an deiner Stelle wäre«, antwortete der alte Quarantäner mit glühenden Augen und Trauer in der Stimme. »Aber ich muss hier bleiben. Vor mehr als zwanzig Jahren war ich einer der hiesigen Korrespondenten von den Rittern der Absolution …«
»Den was?«
»Hast du nie von der Konföderation von Naflin gehört? Von den Rittern der Absolution? Wie solltest du auch? Denn das geschah alles vor deiner Geburt, vor dem Ang-Imperium … Als die auf der Erde lebenden Anjorianer die U-Bahn bauten, stellten sie voller Entsetzen fest, dass wir Quarantäner bereits seit Langem unentdeckt unter ihnen lebten. Und sie beschlossen sofort, uns auszurotten. Doch inzwischen hatte Ut-Gen um seinen Beitritt zur Konföderation von Naflin nachgesucht – eine Art supraplanetäre Regierung, die über das Gleichgewicht der Mächte wachte. Ich habe keine Zeit, dir das alles zu erklären. Doch du musst wissen, dass die Ritter der Absolution ein Geheimorden war, und dass …«
Er hielt plötzlich inne, als wäre ihm etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Dann schnupperte er wie ein Tier, und Sorge breitete sich auf seinem entstellten Gesicht aus.
»Diese verfluchten Kreuzler! Sie haben das Datum vorverlegt! Jemand hat uns manipuliert!«
Er sprang auf und lief aus seiner Behausung. Jek sah, dass der alte Mann wild die Plumeng-Blätter zertrampelte. Dann verschwand er in dem schmalen Gang, der zur Abzweigung führte.
Um sich die Wartezeit auf seinen Freund zu verkürzen, aß Jek die auf dem Tablett liegenden Plätzchen. Wenigstens schlief er, während er daran knabberte, nicht ein. Dann dachte er über das seltsame Betragen Artraraks nach und wurde immer besorgter und nervöser. Schließlich stand er auf und ging in die Grotte, sorgsam darauf bedacht, sich innerhalb des Lichtscheins zu bewegen. Jetzt stieg ihm ein stechender Geruch in die Nase. In diesem Augenblick hörte er Schritte, und kurz darauf tauchte die spinnenartige Silhouette Artraraks auf, der keuchend zu ihm rannte.
»Bleib nicht da stehen, kleiner Jek! Die Kreuzler sind dabei, uns zu vergasen!«
Aber der kleine Junge blieb wie angewurzelt stehen und schloss nur die Augen. Das kann doch nur ein Albtraum sein!, dachte er. Gleich wache ich in meinem Bett auf, und später erzähle ich diese Geschichte lachend meinen Freunden.
So merkte er kaum, dass der alte Artrarak ihn am Arm packte und in seine Behausung zerrte.
ZWEITES KAPITEL
KERVALEUR: Eigenname, männlich. Bezeichnung für ein Individuum, in dessen Gehirn ein autonomes mentales Programm implantiert wurde, damit es, unabhängig von seinem Willen, diverse Handlungen ausführt. In weiterem Sinn: Verräter, Treuloser, Wortbrüchiger. Historischer Hintergrund: Marti de Kervaleur, Spross einer syracusischen Adelsfamilie und Mitglied der Geheimorganisation Mashama, sei von den Auslöschern des Seneschalls Harkot während der »Terror der Experten« genannten Periode manipuliert worden. Aus Verzweiflung habe er später Selbstmord begangen. Viele Historiker der Sharianischen Ära zweifeln allerdings an seiner Existenz und sind der Ansicht, es handele sich um eine von den ersten Kriegern der Stille erfundene fiktive Person. Jedoch haben Archäologen auf Terra Mater ein Skelett gefunden, welches als das des Marti de Kervaleurs identifiziert worden ist.
Universallexikon pittoresker Wörter und Redewendungen Akademie der lebenden Sprachen
Zerstreut betrachtete Marti de Kervaleur das Ballett der mobilen Logen der Höfl inge – große, weiße, gepolsterte und nach vorne hin offene Kugeln –, die in den immens großen Empfangssaal des Arghetti-Ang-Palastes strömten. Sie kamen aus den vier Luftkorridoren und schwebten eine Weile in völliger Unordnung etwa zwei Meter über dem weißgoldenen Parkett aus Optalium.
Die Zeremonienmeister in ihren Prunkgewändern – purpurroten Colancors mit ebensolchen von silbernem Optalium gesäumten Capes, grauen Handschuhen und schwarzen mit Mondsteinen verzierten Dreispitzen – begannen sofort mit ihrer Arbeit. Sie standen hinter einem Schaltpult aus Edelholz, gaben die gewünschten Daten ein, und die zentrale Memodiskette steuerte die Logen dann an ihre vorgesehenen Plätze, je nach Rang und Verdienst seiner Besitzer. Entweder sie schwebten auf die mit holographischen Sternen übersäten Decke zu, oder sie glitten zwischen die bereits fixierten Logen in unterschiedlicher Höhe, wo sie ebenfalls in der Luft stehen blieben. Auf diese Weise bildeten sie ein riesiges Amphitheater in der Schwebe, dessen Lücken bald geschlossen waren.
Die untersten Ränge, direkt vor der Bühne, waren den hohen Würdenträgern der Kirche des Kreuzes in ihren traditionellen purpurroten Colancors und ihren mauvefarbenen Chorhemden vorbehalten. Die Kardinäle verständigten sich unablässig mit einer nur ihnen bekannten Zeichensprache.
Die mittleren Ränge wurden von den vornehmsten Familien Syracusas eingenommen: Vangouw, Phlel, Blaurenaar, Ariostea, Phart, Kervaleur, VanBoer … Familien, die vor Jahrhunderten das Planetarische Komitee gestürzt und die Vorherrschaft des Adels wiederhergestellt hatten … Standesgenossen Marti de Kervaleurs … Höflinge voller Anmut und Langeweile, die die Hälfte ihres Lebens damit verbrachten, die Regeln der Etikette zu lernen und die andere Hälfte, sie ja nicht zu verletzen. Eitle, untätige und selbstgefällige Männer und Frauen, pedantisch und kleinlich, die ihre Vermögen verloren hatten und seit der Inthronisation Ranti Angs bereits keine Rolle mehr spielten und von der Geschichte vergessen worden waren. Eine im Zerfall begriffene Welt …
Im Halbschatten der mit Familienwappen geschmückten Logen saßen steife Gestalten mit weiß gepuderten Gesichtern, denen weder die leuchtenden Wasserkronen noch die zwei oder drei erlaubten Haarsträhnen irgendeinen fröhlichen Aspekt verliehen.
Marti de Kervaleur hasste es, sich unter seinesgleichen aufhalten zu müssen, wozu auch seine Eltern zählten. Denn bei ihnen hatte die Gefühlskontrolle, die berühmte autopsychische Selbstverteidigung – APS – zu einem derart unbeteiligten Gebaren geführt, dass sie zu einer personifizierten Verneinung jeglichen Lebens geworden waren.
Die Insassen der obersten Logen jedoch waren am farbenprächtigsten gekleidet und am auffälligsten geschminkt. Auch ihren Schmuck stellten sie schamlos zur Schau. Diese Leute waren allesamt Arrivierte, Abgesandte der verschiedenen Gilden, die es durch Fleiß, Intelligenz oder Verlogenheit zu Ansehen gebracht hatten. Vielleicht hofften sie, durch die Zurschaustellung ihres Reichtums ihre einfache Abstammung überdecken zu können, doch sie ähnelten nur Pfauen, die während der Balz ihr Gefieder spreizten.
Das prächtige Spektakel langweilte Marti. Schon seit drei Jahren zwang ihn sein Vater, der Ehrenwerte Burphi de Kervaleur, an den Feierlichkeiten des 22. Frascius’ teilzunehmen. Als Marti offiziell bei Hofe eingeführt wurde, hatte ihn die Zeremonie begeistert. Doch die sich jährlich wiederholenden Festivitäten anlässlich der Inthronisation des Kaisers Menati empfand er inzwischen nur noch als lästige Pflichtübung. So hatte dieser eitle Pomp für ihn jeglichen Reiz verloren, was für einen abenteuerlich gesinnten jungen Mann von zwanzig Jahren kaum verwunderlich war.
Marti warf einen kurzen Blick auf seine Eltern, die links von ihm saßen. Die beiden unterhielten sich leise. Die schlanken Finger seiner Mutter in weißen Handschuhen umklammerten die Brüstung. Worüber unterhielten sie sich? Wahrscheinlich über nebensächliche Fragen, die Etikette betreffend. Über die Position ihrer Loge, gemessen an der anderer aristokratischer Familien … Über die Taktlosigkeiten der Kaiserin Dame Sibrit, die berüchtigt für ihre Unberechenbarkeit und Grausamkeit war … Oder über die Effizienz der Gedankenhüter … Über die neuen Programme des Seneschalls Harkot? Aber wahrscheinlich frönten sie nur dem üblichen Hofklatsch …
Hätten sie erfahren, welchen geheimen und verbotenen Aktivitäten ihr einziger Sohn nachging, wäre ihr mentaler Schutzschild – auf den sie so stolz waren –, die APS, sofort in tausend Stücke zersprungen.
Plötzlich überkam Marti de Kervaleur ein ungutes Gefühl. Und weil er das dringende Bedürfnis hatte, diese aufkeimende Besorgnis zu ersticken, warf er einen Blick auf seinen Gedankenschützer. Der saß in seinem weißen Kapuzenmantel bei den vier Gedankenschützern seiner Eltern auf der Hinterbank der Loge. Marti trennte sich von seinem Gedankenschützer nie – unter keinen Umständen! Denn allein der Scaythe erlaubte es ihm, den Geheimgarten seiner Gedanken zu kultivieren. Dort wuchsen üppig verbotene giftige Pflanzen, die den berauschenden Duft der Rebellion verströmten, obwohl er von den besten und teuersten Lehrern bei Hof unterrichtet worden war. Denn seine Eltern hatten keine Ausgaben gescheut, den Sohn nach ihrem Bild formen zu lassen, damit aus ihm ein perfekter Hofling werde, eins dieser Wesen, dessen Leben zwischen Intrigen und offiziellen Veranstaltungen dahintröpfelte.
Doch Marti de Kervaleur und seine Freunde – alles junge Adelige wie er – von der Untergrundbewegung Mashama (Ursprung auf Altsyracusisch) hatten von ihrer Zukunft eine ganz andere Vorstellung. Sie wollten nicht zu Hofschranzen werden, zu jenem Kreis hohlköpfiger Gecken gehören, zu denen man sie hatte erziehen wollen. Also suchten sie im Schutz ihrer Gedankenhüter und in den Schatten der Zweiten Nächte die alten Werte syracusischer Kämpfer in den Zeiten der Eroberung wiederaufleben zu lassen.
Die letzten Logen schwebten an ihre angestammten Plätze. Die obersten Ränge verschwanden fast zwischen den künstlichen Sternen an der Decke, den Holovisionkameras und den mobilen Licht-Kugeln.
Die bedeutendsten Persönlichkeiten des Ang-Imperiums waren nun versammelt: die Kardinäle des Episkopats, die Kardinäle der zweihundert Hauptplaneten, die Adelsfamilien als Hüter der Etikette und der Tradition, die Offiziere höheren Rangs der Interlist (meistens Pritiv-Söldner), die Berater des Kaisers, die Abgeordneten der Gilden und die berühmtesten Künstler, Sänger, Maler, Musiker, Bildhauer, Tänzer und Holoasten … Sie alle wurden, je nach dem Grad ihrer Bedeutung, von einem, zwei, drei oder vier Gedankenschützern begleitet.
Die Zeremonienmeister traten rechts und links neben die Hauptbühne – ein mit wechselnden holographischen Mustern geschmücktes Podium. Die Licht-Kugeln erloschen eine nach der anderen. Die Holovisionkameras liefen.
Der riesengroße Saal war in ein diffuses Halbdunkel getaucht, das nur von leuchtenden Fontänen, die aus dem Boden aufstiegen, unterbrochen wurde. Dann flammten die mobilen Projektoren auf und richteten ihre Strahlen auf die Bühne.
Eine Tür im Hintergrund glitt zur Seite. Heraus trat der Seneschall Harkot in seinem königsblauen Mantel, dessen weit geschnittene Kapuze mit einer schwarzen Borte gesäumt war. Sofort breitete sich eine tödliche Stille in dem Empfangssaal aus. Der Seneschall schritt zum Rand der Estrade und blieb vor den Logen stehen. Wie üblich, wenn er sich in der Öffentlichkeit zeigte – was immer seltener geschah –, war sein Kopf vollständig von der Kapuze verhüllt. Nur das Glühen seiner schwarzen Augen war zu erkennen.
Marti de Kervaleur war nie die Ehre zuteil geworden, das Antlitz des Seneschalls Harkot zu betrachten, doch das war ein Privileg, das er gerne anderen überließ. Eines Tages hatte er zufällig das Gesicht seines Gedankenschützers gesehen und war entsetzt über das monströse Aussehen des Scaythen gewesen: eine wie von Pocken vernarbte grünliche Haut, ein kahler, zerbeulter Schädel, hervorstehende Augen ohne Iris. Es war ihm unverständlich, warum die Syracuser die Schlüssel der Macht über ihr eigenes Schicksal in die Hände dieser menschlichen Karikaturen gelegt hatten. Die Mashama-Bewegung würde nicht ruhen, bis sie alle Scaythen vom Planeten Hyponeros von Syracusa und seinen Satelliten verjagt hatte.
Nur wenig war über den Seneschall Harkot bekannt. Er war ein diskretes, ja verschlossenes und von Geheimnissen umgebenes Wesen. Er zeigte sich nur anlässlich bedeutender Zeremonien in der Öffentlichkeit, regungslos, undurchdringlich, rätselhaft. Es wurde geflüstert, dass das Entwicklungsprogramm der Auslöscher-Scaythen, die nach Belieben Gehirne deprogrammierten, um sie neu zu programmieren – seine ganze Zeit in Anspruch nehme. Auch hieß es, er selbst habe den Seigneur Ranti Ang exekutiert, Ranti Ang, den Held der legendären Schlacht von Houhatte, in der der Orden der Absolution, der Stützpfeiler der Konföderation von Naflin, geschlagen wurde … Weiterhin hieß es, er habe mit dem Muffi Barrofill XXIV. ein Komplott geschmiedet, um den Konnetabel Pamynx seines Amtes zu entheben …
Bei der Anzahl der kursierenden Gerüchte war es schwer, die Wahrheit von der Unwahrheit zu trennen. Es gab Höflinge, die hinter vorgehaltener Hand verkündeten, Harkot sei nichts weiter als eine Marionette der Herren von Hyponeros. Worauf andere entgegneten, dass bisher noch niemand die Existenz einer Welt namens Hyponeros bewiesen habe … Doch Tatsache war, Harkot hatte die höchste Stellung bei Hofe inne, eine Schlüsselstellung, die nach Ansicht des Adels eigentlich einem der ihren gebührt hätte. Es war ein Affront, dass die Staatsgeschäfte des Imperiums einem Paritolen, einem Fremden, schlimmer noch, einem Nicht-Menschen anvertraut worden waren.
Die Syracuserverdankten dem Seneschall Harkot vor allem die ständig besetzten Wachtürme der Gedanken. In Venicia,
Titel der französischen Originalausgabe TERRA MATER
Deutsche Übersetzung von Ingeborg Ebel
Deutsche Erstausgabe 1/09 Redaktion: Lilly Weigand
Copyright © 1998 by Librairie l’Atalante Copyright © 2009 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagbild: Stephan Martiniere Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-641-08431-8
www.heyne-magische-bestseller.dewww.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe