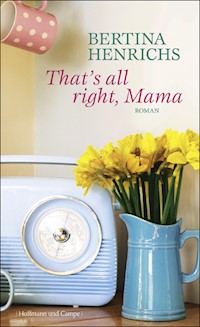
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Well, that's all right, Mama, that's all right for you ..." Evas Mutter war in ihrer Jugend ein Elvis-Fan. Als Eva sie nun nach langer Zeit wiedersieht, steht die Begegnung unter keinem guten Stern: Ihre Mutter liegt nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus und stirbt kurz darauf. Eva muss ihre widersprüchlichen Gefühle ordnen. In ihrem Leben in Paris hat sie sich von ihrer Mutter entfremdet, die in Frankfurt ein Dessousgeschäft führte und deren Liebe die Tochter als übermächtig empfand. Als Eva die Wohnung aufräumt, findet sie ein Flugticket nach Memphis, Tennessee. Hatte ihre Mutter auf ihre alten Tage tatsächlich vor, nach Graceland zu pilgern, in die Heimatstadt des King? Für Eva gibt es nur ein Mittel, Frieden mit ihr zu schließen: Sie muss die Reise für ihre Mutter antreten. Bertina Henrichs erzählt in ihrem Roman von der berührenden Versöhnung einer Tochter mit ihrer Mutter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Bertina Henrichs
That’s all right, Mama
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
Hoffmann und Campe Verlag
Für Sharon und Joséphine
And my traveling companions
Are ghosts and empty sockets
I’m looking at ghosts and empties
But I’ve reason to believe
We all will be received
In Graceland.
PAUL SIMON
1
Manche Menschen, empfänglich für die zartesten Schwingungen ihrer Seele, haben Vorahnungen. Sie fürchten und lieben sie. Eva gehörte nicht zu ihnen. Noch nie hatte sie die leiseste Vorahnung verspürt. Dieses mystische Flüstern fehlte ihr nicht, denn sie glaubte nicht ernsthaft daran, dass man Unglück oder Glück wie eine hypersensible menschliche Parabolantenne im Vorhinein erfassen kann. Sie ging nicht zu Wahrsagern, Kartenlegerinnen oder anderen Hellsehern. Sie traf ihre Entscheidungen, wenn sie zu treffen waren, ohne je einen Blick auf die Sterne zu werfen.
An dem Tag, als ihr Vater bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, hatte sie nichts gespürt. Sie spielte seelenruhig mit ihren Puppen, als das Telefon klingelte und sie ihre Mutter zusammenbrechen sah.
Keine Himmelsharfen, als sie Michel traf. Und keine Wolkenbrüche, als sie sich trennten.
Ihre Ernennung zur Dozentin erhielt sie an einem Julimorgen in einem Umschlag aus Recyclingpapier, als sie gerade den Flur wischte.
Wenn das Unglück kommen soll, kommt es. Was hilft’s, es ein paar Tage im Voraus zu wissen? Und das Glück kommt sowieso nicht, es ist plötzlich da. Manchmal.
Der Morgennebel hatte sich aufgelöst und einem schönen Frühlingshimmel – vereinzelte Schäfchen vor azurblauem Hintergrund – Platz gemacht. Es war fast warm.
Eva verließ das Universitätsgelände, wo sie ihre Vorlesung gehalten hatte, blieb einen Moment stehen und holte tief Luft. Sie blinzelte, geblendet vom gleißenden Sonnenlicht. Ihr grauer Regenmantel und der dicke Schal, drei Stunden zuvor noch angemessen, schienen jetzt von zu großem Pessimismus zu zeugen.
Ungeduldig nahm Eva den Schal ab und stopfte ihn in die große schwarze Tasche, die sie überallhin begleitete. Der Tag hatte mit einer Reihe von Missklängen begonnen, die ihre gute Laune zunehmend beeinträchtigten, und sie wollte jetzt nicht obendrein noch einen kränkelnden Eindruck machen. Nein, sie war vielmehr fest entschlossen, diesen Tag zu retten. Es war erst elf, und das Ganze konnte sich noch zum Guten wenden.
Nach dem Mittagessen würde sie Seminararbeiten korrigieren, eine Stunde im Fitnesscenter schwitzen, das sie regelmäßig besuchte, ein paar Einkäufe erledigen und den Abend damit verbringen, endlich den Roman des indischen Autors zu lesen, von dem ganz Paris sprach und den sie sich eine Woche zuvor gekauft hatte.
Dass Victor ihre Verabredung abgesagt hatte, war eine gute Gelegenheit, früh ins Bett zu gehen und in eine neue Geschichte einzutauchen. Sie liebte den köstlichen Augenblick, da sie zum ersten Mal ein Buch aufschlug, das ihrem Leben für einige Zeit den Klang und die Farbe verleihen würde.
Victor würde sie am Sonnabend sehen, denn seit dem Anfang ihrer Beziehung sahen sie sich bis auf wenige Ausnahmen jeden Donnerstag und Sonnabend.
Mit entschlossenem Schritt ging Eva in Richtung Bushaltestelle.
Als sie am Brunnen in der Mitte des Platzes vorbeikam, wurde sie jäh aus ihren Gedanken gerissen.
»Guten Tag, kleine Frau. Schöner Tag, was?«
Eva drehte sich um und sah auf einer Bank einen Clochard sitzen.
»Sie haben nicht zufällig Batterien?«
»Wie bitte?«, fragte sie.
»Na, Batterien. Runde, einfache.«
»Ach so. Nein, habe ich nicht, tut mir leid«, antwortete sie, fast stotternd vor Überraschung.
Sie sah den Mann etwas aufmerksamer an. Blaue Augen strahlten in seinem faltigen Gesicht, das von einer wirren blonden Mähne eingerahmt wurde. Sein Alter war schwer zu schätzen, aber er kam ihr noch ziemlich jung vor.
»Schade. Aber macht nichts«, sprach er weiter. »Hätt’ ja sein können. Manche Leute haben halt Batterien in der Tasche und wissen nicht, wohin damit. Deswegen frag ich. Man kann nie wissen.«
Eva nickte.
»Mir sind schon die verrücktesten Sachen passiert«, versicherte der Clochard.
»Das glaube ich wohl«, antwortete sie eilig und ging schnell weiter, weil sie fürchtete, er wolle seine Bemerkung durch irgendeine fantastische Geschichte belegen.
Nach ein paar Schritten jedoch siegte die Neugier. Sie ging in den nächsten Laden und kaufte vier Batterien. Dann kam sie zu dem Mann zurück und reichte ihm das Päckchen.
»So was auch!«, freute er sich. »Das ist wirklich nett. Wissen Sie, ich sag immer zu meinen Kollegen: Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Die Menschheit ist gar nicht so verdorben. Da haben wir den Beweis.«
Sein Interesse für Eva erlosch, er öffnete den fleckigen Rucksack, der vor ihm auf dem Boden stand, und holte einen Walkman heraus, in den er zwei Batterien legte. Grinsend stopfte er sich die Kopfhörer in die Ohren, schaltete das Gerät ein und begann im Rhythmus eines Liedes mit dem Kopf zu wippen.
Eva beeilte sich, ihr Bus kam. Sie setzte sich neben eine dicke, mit riesigen Einkaufstaschen beladene Frau. Eine sorgfältig geschminkte Dame mit Hut klammerte sich an ihre Vuittontasche wie an einen Rettungsring. Ein grauhaariger dicker Mann, dessen Körper gefährlich an einem Haltegriff schaukelte, musterte Eva unverhohlen von oben bis unten. Verärgert wandte sie sich ab und sah aus dem Fenster.
Zuweilen, wenn auch immer seltener, konnte sie Paris noch so wahrnehmen wie zu Beginn ihres Aufenthalts. Dafür musste sie die Stadt von der dicken Alltagsschicht befreien, die sich im Laufe der Jahre angesammelt hatte. Wie vielen jungen Ausländern hatte sich Paris auch ihr wie ein großes Fest angekündigt. Hemingway, Miller und Beckett im Kopf, hatte Eva alle Warnungen in den Wind geschlagen und sich in die ebenso naive wie heldenhafte Eroberung der französischen Hauptstadt gestürzt.
Auf die großen leidenschaftlichen Erklärungen folgten harte, arbeitsreiche Jahre. Aber ganz allmählich, mit vielen Niederlagen und kleinen Siegen, hatte sie schließlich ihren Platz gefunden. Sie hatte das herbe und vertraute Deutsch gegen die musikalischen Klänge des Französischen ausgetauscht, das sich nur zögernd und widerwillig, mit gespielter Schüchternheit und diversen Fluchtmanövern erobern ließ, wie eine Schöne an einem Ballabend von einem sie hartnäckig umschwärmenden Kavalier.
Nach dem Abschluss des Literaturstudiums war Eva Dozentin geworden, der höchste Rang, den sie als diplomierte Ausländerin ohne Agrégation erreichen konnte. Ihre Aufnahme in die Universitätskreise erregte Aufsehen. »Chapeau!«, hatten einige gesagt, als sie ihre Stelle erhielt: »Sie können stolz sein.« Sie hatte also die Bonuspunkte geerntet, mit denen die Grande Nation großmütig ihre eifrigsten Diener belohnt.
Sie allein wusste, dass Paris in den langen Fluren, die zur Integration führen, das Festtagsgesicht verloren hatte und dass die Geigen verstummt waren.
Manchmal aber, an einer Straßenecke oder bei einem Spaziergang im rötlich gelben Abendlicht, tauchten die Schatten des Begehrens wieder auf, letzte Relikte einer verrückten Leidenschaft.
2
Im Treppenhaus hörte Eva ihr Telefon klingeln. Sie rannte die Stufen hoch und suchte gleichzeitig in den Manteltaschen nach ihrem Schlüssel. Hastig öffnete sie die Tür, aber trotz ihrer Eile nahm sie den Hörer zu spät ab. Der Anrufer hinterließ keine Nachricht. Atemlos stellte sie die Tasche ab und zog den Mantel aus.
Insgeheim hatte sie gehofft, von Victor zu hören, dass seine Arbeitssitzung abgesagt sei und er Zeit habe, sie wie üblich zu treffen. Dabei war das sehr unwahrscheinlich. Victor arbeitete mit der gleichen Leidenschaft, mit der andere im Kasino spielen. Mit dem gleichen Fieber im Blick, wie wenn die Kugel rollt.
Er war Artdirector in einer Werbeagentur und stürzte sich in jede neue Kampagne, als wäre es die letzte. Er verdiente viel Geld, das er sorglos und gutgelaunt ausgab. Mit seinem halblangen blonden Haar, der immer gebräunten Haut und den grünen Augen galt er als schöner Mann. Sein Kleidungsstil, eine gekonnte Mischung aus Raffinesse und Nachlässigkeit, weckte die Illusion absoluter Natürlichkeit. Selbst seine Hornbrille schien eher Koketterie als ein Hilfsmittel, Kurzsichtigkeit zu korrigieren.
Eva hatte ihn in einem Restaurant kennengelernt, das sie beide regelmäßig besuchten. Sie hatten nie miteinander gesprochen, bis Eva einmal ihr Feuerzeug vergessen hatte. Sie bat ihn um Feuer, er zog seinen Stuhl heran. Bald darauf wurden sie ein Paar.
Am Anfang ihrer Beziehung hatte Victor anhand seiner zahlreichen gesellschaftlichen Verpflichtungen die Abende festgelegt, die sie miteinander verbringen würden. Den Rest der Woche lebte jeder bei sich und ging seiner Beschäftigung nach. Eva hatte sich diesem Arrangement nicht widersetzt. Sie führten eine angenehme Beziehung ohne lästige Alltagsprobleme.
Hin und wieder tauchten jedoch ohne Vorwarnung, bei irgendeinem unbedeutenden Zwischenfall, Bilder einer anderen Geschichte auf, die ebenso unvernünftig und glühend war wie die mit Victor geregelt und brav. Ein langes Kapitel in Evas Leben. Ohne Worte, um ihre absolute und verstörende Hingabe zu kaschieren. Ohne gewahrte Würde. Wenn man sie heute sah, traute man ihr so viel Verrücktheit nicht zu. Das wusste sie. Und dennoch wäre sie beinah nicht mehr zurückgekehrt.
Michel.
Niemals hatte sie davon erzählt. Diese Geschichte gehörte nicht zu den Anekdoten, die man mit einer Tasse Tee beim Nachmittagsplausch aufwärmt.
Eva war grundsätzlich zurückhaltend mit Offenbarungen. Spröde, dachte sie plötzlich auf Deutsch, während sie das dunkelblaue Kostüm, das sie insgeheim ihren Respektabilitätspanzer nannte, gegen ausgewaschene Jeans und ein weißes T-Shirt austauschte. »Spröde« war ein Wort, das ihr im Französischen fehlte, denn es gab keine richtige Entsprechung. Vielleicht war es ein zutiefst deutsches Wort. Ebenso wie »gemütlich« oder »Heimat«, drückte es offenbar eine Lebensweise, einen speziellen Blick auf die Welt aus. Irgendwas, das sich der Vereinigung, der Globalisierung, der Übertragung entzieht. Auch jedem Kommentar. Hier drückte es weniger fehlende Fantasie aus als den Hauch eines Lasters. Extreme Zurückhaltung als Treibhaus ihrer Einbildungskraft.
Eva stand auf dem winzigen Austritt voller Blumen, den sie stolz ihren Balkon nannte, und rauchte ihre Heimkehrzigarette. Sie beobachtete gern das Kommen und Gehen der Leute in der kleinen Straße unter ihr.
Mit einem mächtigen Staubsauger unter dem Arm kam die Hauswartsfrau, Madame Rodez, aus dem Haus und verschwand im Nebeneingang. Magali, die unter Eva wohnte, zerrte ihren Sohn Jules hinter sich her, der in einem von Schluchzen unterbrochenen Gestammel protestierte, und dankte Doktor Constant, der ihr höflich die Tür aufhielt. Eine alte gebeugte Frau, die Eva vom Sehen kannte, bewegte sich sehr langsam vorwärts, ein heldenhafter Kampf gegen das Eingesperrtsein in den vier Wänden. Ein Fahrradfahrer pfiff fröhlich eine nicht zu identifizierende Melodie. Weiter weg waren Radionachrichten zu hören.
Das war ihr kleiner Kokon, in dem sie sich von den Unwägbarkeiten des Daseins geschützt fühlte. Eine Zweizimmerwohnung im 18. Arrondissement, in der sie sich nach mehrjährigem Studentendasein niedergelassen hatte.
Sie hatte jedes Möbelstück passend zu dieser Wohnung sorgfältig ausgewählt, jeder Gegenstand hatte seinen Platz. Ein Plakat mit einem Ausschnitt aus einem Goya-Gemälde hing gerahmt über dem Büfett. Es zeigte eine junge Frau, die einen mit grünen Trauben gefüllten Korb auf dem Kopf trägt. Die gegenüberliegende Wand war mit einem großen abstrakten Gemälde geschmückt, in dem Weiß dominierte und das wie ein Palimpsest die Farbsubstanz hervortreten ließ. Sie hatte es bei einer Reise nach Dieulefit von einem Maler gekauft. Es war das erste Mal, dass sie ein Gemälde kaufte, und dieser Vorgang, daran erinnerte sie sich gut, hatte irgendwie etwas Feierliches.
Eva achtete darauf, ihren Lebensraum so rein wie möglich zu halten. Die Aschenbecher waren immer geleert und gewaschen. Kein unansehnlicher Zeitungsstapel verdarb den Eindruck. Sie wollte nicht von dem Trödel überwältigt werden, der sich in den meisten Wohnungen ansammelte. Dieser Anspruch verlangte große Konzentration, denn sie war eigentlich kein ordentlicher Mensch. Ihre unzähligen Bücher drohten deshalb auch ständig, sich dem allgemeinen Ordnungsbemühen zu entziehen.
Evas jüngster Kauf war ein rotes Samtsofa. Es war sehr teuer gewesen, und sie hatte es sich zum Teil von ihrer Mutter zum Geburtstag schenken lassen. Noch nie hatte sie etwas so Schönes besessen. Magali hatte vor Bewunderung gejubelt, als sie sich genüsslich auf die weichen Kissen setzte. Selbst Eva war immer noch etwas eingeschüchtert von diesem Sofa. Eines Tages wache ich auf und es ist nicht mehr da. Dann werde ich merken, dass ich es geträumt habe, dass es nie wirklich existiert hat, dachte sie.
Ein paar Jahre zuvor hatte sie häufig den gleichen Alptraum gehabt. Sie kam in die Uni, um ihre Vorlesung zu halten. Sie stand vor fünfzig Studenten, machte den Mund auf und stellte plötzlich fest, dass sie nicht mehr französisch sprach, dass sie kein Wort mehr von dieser Sprache konnte, die ihr wieder völlig fremd geworden war. Die Studenten wurden ungeduldig, lachten und verließen den Hörsaal. Jedes Mal war sie schweißnass aufgewacht und hatte eine halbe Stunde gebraucht, um sich zu beruhigen. Vielleicht würde sie nie mehr anders als mit der Angst leben, den Pariser Alltag wie eine Halluzination verschwinden zu sehen. Eine Hochstapelei.
Um die unangenehmen Gedanken zu vertreiben, drückte sie energisch ihre Zigarette aus und verließ den Balkon. Aus ihrer Sammlung von Opernplatten wählte sie eine Aufnahme der Sonnambula von Bellini, die sie besonders mochte, gesungen von der Callas. Bei den ersten Akkorden des Orchesters ging sie in die Küche, um sich etwas zu essen zu machen. Während sie ihre Salatsoße umrührte, begann wieder das Telefon zu klingeln.
Diesmal nahm Eva rechtzeitig ab. Eine zögernde Frauenstimme fragte auf Deutsch nach ihr. Etwas verwirrt bestätigte Eva, dass sie am Apparat sei. Die Frau schien beruhigt, ohne dass sich ihre Stimme jedoch völlig entspannte.
»Ich bin Carola. Carola Horwitz. Wir kennen uns. Ich bin eine Freundin Ihrer Mutter, erinnern Sie sich?«
Eva sagte nur ja. Anrufe von fernen Bekannten, die mit einem über eine Verwandte reden wollen, verhießen nichts Gutes. Sie war beunruhigt.
»Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Es tut mir sehr leid. Ihrer Mutter ist etwas zugestoßen. Sie müssen sofort herkommen«, sagte die Frau.
Jetzt war es passiert. Früher oder später musste es kommen. Eva hatte immer erwartet, dass man sie eines Tages anrufen würde, um ihr so etwas mitzuteilen. Andererseits hatte sie auch nicht oft daran gedacht. Die Katastrophe, obwohl wahrscheinlich, musste immer in der Zukunft bleiben, nicht morgen und nicht übermorgen. Eines Tages, so unbestimmt wie möglich. Und jetzt materialisierte sie sich plötzlich in Gestalt dieses unseligen Nachmittags.
Sie erkundigte sich, was geschehen war, fragte nach der Adresse des Krankenhauses, notierte eine Telefonnummer und dachte sogar daran, ihrer Gesprächspartnerin zu danken, ehe sie auflegte.
Die folgenden Stunden waren reine Panik. Sie bekam einen Flug, informierte das Universitätssekretariat, packte ihren Koffer und stürzte los.
Das Warten am Flugplatz kam ihr endlos vor. Sie war gleichzeitig abwesend und angespannt in einer Konzentration ohne rechten Gegenstand. Die Zeitschrift, die sie sich gekauft hatte, lag geschlossen auf ihrem Schoß. Immer wieder stand sie auf und lief hin und her. Schon unter normalen Umständen hasste sie den Flughafen, diese Verkörperung eines Nichtortes. Sie fühlte sich dort ebenso wohl wie in einer Luftschleuse. Diesmal war es noch schlimmer. Lebenszeit für nichts, unmöglich zu leben, unmöglich zu überspringen. Übergang. Wie die Trauer, dachte sie plötzlich und zuckte zusammen. Und die Genesung, beruhigte sie sich.
Das Flugzeug startete mit einer halben Stunde Verspätung. Ein kleines Ärgernis, das sie an diesem Abend in abgrundtiefen Zorn stürzte. Alles, was sie seit Jahren nicht erledigt hatte, schien in diesen dreißig verlorenen Minuten zu kondensieren, die sich zwischen ihrer Mutter und ihr wie ein unüberwindbares Hindernis aufrichteten. Sie beschimpfte die Stewardess, die mit kalter Liebenswürdigkeit reagierte. Sie war an jammernde Fluggäste gewöhnt.
An Bord bekam Eva einen Becher mit Orangensaft und zwei aufgeweichte Kekse, die sie mechanisch kaute. Die Sorge zehrte an ihren Kräften, über Straßburg fiel sie in unruhigen Schlaf.
3
»Na, wo soll’s denn higehe?«, fragte der Taxifahrer freundlich im vertrauten Dialekt ihrer Kindheit. Eva gab ihm in dialektfreiem Deutsch Auskunft über ihr Fahrziel. Sie wollte nicht als Kind dieser Stadt erkannt werden. Es gab kein Wiedersehen zu feiern. Sie nannte nur die Adresse. Das Taxi fuhr los. Der Fahrer war auf einmal gar nicht mehr gesprächig. Touren vom Flughafen zum Krankenhaus ließen Böses ahnen. Da hielt man besser Abstand.
Während der Fahrt stellte Eva fest, dass die Zahl der Wolkenkratzer seit ihrem letzten Besuch noch zugenommen hatte. Dieser futuristische Anblick war beinah schön, vielleicht etwas größenwahnsinnig. Allmählich verdiente Frankfurt den Namen »Little Manhattan«, mit dem die Stadt seit mehr als vierzig Jahren Geschäftsleute anzulocken suchte. Die ersten Abendlichter spiegelten sich im Fluss. Das Mainufer war einst das bevorzugte Ziel ihrer Sonntagsspaziergänge gewesen. Sie hatte gern die großen Schiffe beobachtet, die gelassen durch das Wasser glitten. Es war wie ein Vorgeschmack auf das Meer. Dabei war das Meer weit weg. Von Frankfurt aus war ihr alles weit weg vorgekommen.
An der Anmeldung schenkte ihr eine Frau um die vierzig, stark geschminkt hinter ihrer länglichen Brille aus rotem Schildpatt, ein professionelles Lächeln, während sie ins Telefon sprach. »Universitätsklinik, guten Tag.« Bestimmt dreihundert Mal am Tag wiederholte sie die knappe Begrüßungsformel, die sich zwischen ihren Lippen so sehr abgenützt hatte, dass sie fast unverständlich geworden war. Eine traurige, mit extremer Sparsamkeit ausgestoßene Tonfolge, ihrer Endungen beraubt und ihres Sinns entleert. Eine Folter für die Ohren.
»Universitätsklinik, guten Tag. Einen Moment bitte.« Sie drückte auf verschiedene Knöpfe. Zwischen zwei Anrufen fand sie endlich den Namen Helene Jacobi in ihrem Computer und erklärte Eva den Weg. »Universitätsklinik, guten Tag. Er ist heute nicht da. Rufen Sie bitte morgen an.«
Während Eva durch grünliche Flure lief, hörte sie noch mehrmals die immer gleichen Worte.
Als sie die Tür öffnete, die man ihr gezeigt hatte, bekam Eva einen Schock. Das bleiche Altfrauengesicht auf einem bläulichen Kissen hätte sie fast nicht erkannt. Der in ein einfaches Krankenhausnachthemd gehüllte Körper ihrer Mutter verschwand unter Schläuchen. Die Haut war weiß und faltig; Lena gehörte nicht zu den gebräunten, muskulösen Sechzigjährigen, die auf den Reiseprospekten strahlten. Sie war eine verblühte Frau mit dauergewelltem, blond gefärbtem Haar. Sogar in diesem schwachen Licht sah man die grau nachwachsenden Haarwurzeln. Sie schlief und schnarchte leise.
Nach kurzem Zögern legte Eva ihre Sachen auf einen Stuhl und trat ans Bett. Sie griff nach der Hand ihrer Mutter, dabei stieß sie an einen Infusionsschlauch.
Aus dem Flur kamen die üblichen Krankenhausgeräusche, das Quietschen von Betten, die über das Linoleum geschoben wurden, das leise Zischen von Gummisohlen, die unaufhörlich kamen und gingen, mal schneller, dann wieder langsamer wurden, das Klappern von Löffeln, Gesprächsfetzen, manche geflüstert, andere erstaunlich laut.
Als Eva vorsichtig aufstand, um den Arzt suchen zu gehen, öffnete ihre Mutter die Augen. Der Blick irrte ein paar Sekunden umher, dann richtete er sich auf die Tochter. Ein schwaches Lächeln erhellte ihr Gesicht.
»Sie haben dich den ganzen weiten Weg machen lassen, mein armer Schatz, nur damit du deine Mutter in diesem Zustand siehst«, sagte sie schließlich.
»Das ist doch das Mindeste, Mama. Ich habe mir große Sorgen um dich gemacht.«
»Ich glaube, das war nicht nötig, es geht mir schon viel besser. Sie werden mich sicher in ein, zwei Tagen rausschmeißen«, sagte sie mit schwacher Stimme, die ihre Worte Lügen straften.
»Das werden wir sehen. Wenn sie es für richtig halten, umso besser«, sagte Eva und setzte sich wieder. »Erzähl erst mal, was passiert ist.«
»Ach, das Herz.« Lena winkte mit einer schwachen Bewegung ab. »Es wollte Sperenzchen machen. Das kommt öfter vor. Diesmal war es halt etwas unangenehmer. Ich hatte nicht mal Zeit, meine Tasche zu packen, und bin ohne alles los.«
»Wie bist du denn hergekommen?«
»Im Krankenwagen, mit Sirene und allem. So ein Spektakel! Das war das erste Mal.«
»Ich hoffe, auch das letzte. Du hast mir wirklich Angst gemacht.«
»Ich bin froh, dich zu sehen«, sagte Lena und drückte Evas Finger schwach. »Egal, wie die Umstände sind, Mütter freuen sich immer, ihre Töchter zu sehen. Da ist nichts zu wollen. Das ist halt so. Eines Tages wirst du das vielleicht selbst erleben …« Sie hielt inne, als Eva verlegen lächelte. »Könntest du etwas für mich tun, Kätzchen?«
»Natürlich, Mama.«
»Dann fahr nach Hause und bring mir meine Toilettentasche, ein Handtuch und ein Nachthemd, das diesen Namen verdient. Ich kann doch nicht in diesem Ding bleiben.« Sie wies auf den hässlichen Kittel, der sie kaum bedeckte.
»Aber …«, sagte Eva. »Das kann doch bis morgen warten.«
»Nein, mir ist kalt«, entschied ihre Mutter. »Nimm ein Taxi. Dann geht’s schneller.«
»Weißt du, Mama, ich bin fast vierzig. Ich weiß, wie …«
Sie sprach nicht weiter. Ihre Mutter hatte die Hand gehoben, um sie zu unterbrechen.
»Mach schnell, ich warte auf dich. Dann können wir uns unterhalten.« Jetzt spürte man, wie es sie anstrengte zu sprechen.
Eva küsste sie auf die Stirn und verließ das Zimmer.
Sie ging den Weg zurück. Ehe sie das Gebäude verließ, hörte sie noch einmal »Universitätsklinik, guten Tag«.
Vor dem Haupteingang fand sie ein Taxi, das sie in die Welt ihrer Kindheit zurückbrachte.
4
Als Eva die Wohnung betrat, schlug ihr sofort der Geruch entgegen. Eine Mischung aus Zigaretten, trockener Wärme, Holz und Katze, etwas Herbstliches, das sie unter allen Gerüchen der Welt erkennen würde.
Im Treppenhaus hatte es nach Kohl gerochen. Sicher hatte am Vortag jemand das Gemüse gekocht, dessen hartnäckige Ausdünstungen sich an Wände, Teppiche und Vorhänge heften. Lüften reicht nicht, um sie zu vertreiben. Man muss sich damit abfinden, bis sie von selbst verschwinden.
Die Wohnung war in Eile verlassen worden. Im Schlafzimmer lagen getragene Kleidungsstücke herum. Das Flakon mit Lenas Lieblingsparfum stand auf der Kommode. Eine Schublade mit Strümpfen war halb geöffnet. Eine Strumpfhose quoll hervor, ein weiches, seidiges Bein drinnen, das andere draußen.
Auf dem Küchentisch lag eine angefangene Schachtel Marlboro light. Kippen füllten den schartigen Aschenbecher, den die Mutter immer benutzte, wenn sie allein war. Die Katzenkiste stand am gewohnten Platz. Wo war eigentlich die Katze? Offenbar hatte jemand sie mitgenommen. Wahrscheinlich diese Carola Horwitz. Ich muss sie anrufen, dachte Eva ohne Begeisterung. Sie setzte sich einen Moment und nahm eine Zigarette aus Lenas Schachtel.
Seit Eva sechzehn war, teilte sie mit ihrer Mutter diese unvernünftige Leidenschaft für den Tabak. Für die kleinen Stäbchen, die der Zeit ihren Rhythmus gaben und sie in ihr winziges Wölkchen hüllten.
Als die Zigarette aufgeraucht war, machte sie sich auf die Suche nach den Dingen, die Lena verlangt hatte. Aus dem Badezimmerschrank nahm sie ein Handtuch und legte es in eine kleine Reisetasche. Dazu kam ein violett geblümtes Etui, das sie mit Toilettenartikeln füllte. Sie dachte sogar an das Flakon mit Lenas Lieblingsparfum. Die Uhr der Mutter lag auf dem Nachttisch neben einem schwedischen Krimi, den Eva ebenfalls einpackte. Dann sah sie sich um. Wenn etwas fehlt, kann ich es ihr morgen bringen, dachte sie.
Sie wollte gerade losgehen, als ihr das Nachthemd einfiel.
Sie öffnete den Schrank und holte einen ganzen Stapel hervor, fand aber nur fantasievolle Gebilde. Nicht direkt Reizwäsche, aber auch nicht passend für einen Krankenhausaufenthalt. Sie waren mit roten Rüschen, schwarzer Spitze oder smaragdgrünem Satin verziert. Nicht warm genug. Sicher Restbestände aus dem Geschäft, die Lena schließlich selbst getragen hatte.
Eva kehrte das Unterste zuoberst, fand vierzig Mark, die Lena dort wohl vergessen hatte, aber kein langärmliges Nachthemd aus einfarbigem Flanell oder einfachem Baumwollstoff.
Seufzend betrachtete sie die Unordnung, die sie angerichtet hatte, und entschied sich schließlich für ein himmelblaues Modell aus Seide, das vorn zugeknöpft wurde.
Eva sah auf die Uhr. Es war fast acht. Sie musste sich beeilen, sonst würde man sie nicht mehr ins Krankenhaus lassen.
Sie griff nach der kleinen Reisetasche und schloss eilig die Tür ab. Glücklicherweise fand sie sofort ein Taxi.
»Universitätsklinik, guten Tag.« Die Frau an der Aufnahme war verschwunden. Eine andere hatte ihren Platz eingenommen. »Einen Moment, ich sehe nach.« Sie drückte auf einen Knopf, wartete ein paar Sekunden. »Nein, tut mir leid. Er ist schon weg. Universitätsklinik, guten Tag.«
Eva blieb nicht stehen, sondern setzte ihren Weg fort.
Als sie gerade die Tür zu Lenas Zimmer öffnen wollte, sprach ein junger Arzt sie an.
»Frau Jacobi?«, fragte er etwas atemlos. War er gerannt, um sie einzuholen?
Eva nickte kaum wahrnehmbar. Irgendwas in der Stimme hatte sie alarmiert. Sie stellte die Tasche ab.
»Ich muss mit Ihnen sprechen«, sagte der Mann im weißen Kittel.
»Ja, natürlich«, antwortete Eva und wartete.
»Kommen Sie bitte in mein Büro«, sagte der Arzt hastig.
Er führte sie in ein winziges Zimmer, das fast vollständig von einem großen Schreibtisch eingenommen wurde, der unter den Akten fast zusammenbrach.
»Frau Jacobi …«, begann er noch mal, als sie ihm in einem Sessel gegenübersaß. Wie er ihren Namen wiederholte, missfiel Eva. Sie hatte es eilig, ihre Mutter zu sehen, und hoffte, er werde endlich zur Sache kommen.
»Ich habe …« Er zögerte, nahm die Brille ab und putzte sie mit einem Papiertaschentuch, ehe er fortfuhr. »Es ist etwas passiert, was wir nicht vorhersehen konnten.«
Er machte wieder eine Pause, suchte sichtbar nach Worten.
»Der Zustand Ihrer Mutter hatte sich stabilisiert. Es ging ihr besser. Wir waren ganz sicher, dass sie außer Gefahr ist. Und dann plötzlich … Das kommt sehr selten vor … Hier haben wir normalerweise alles zur Hand, um schnell zu reagieren, aber auch das ist keine Garantie …«
Eva war ganz steif vor ängstlicher Erwartung.
»Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand …« Er hob die Arme zum Zeichen seiner Ohnmacht. Der Satz blieb unvollendet. »Ihre Mutter hatte einen weiteren Herzanfall. Einen sehr schweren.«
Eva spürte, wie sie erblasste, ihr Kopf begann zu dröhnen. Sie sprang auf. »Wo ist sie? Kann ich sie sehen?«
»Nein. Das heißt, doch …«
Er stammelte. Plötzlich verstand Eva.
»Ist sie tot?«, fragte sie ungläubig.
Der Arzt nickte. »Mein herzlichstes Beileid.«
»Aber wie ist das möglich?«, schrie Eva.
»Frau Jacobi, es war nichts zu machen. Alles ging außerordentlich schnell. Wir haben sofort versucht, sie zu reanimieren. Aber vergeblich.«
»Ich bin nur nach Hause gefahren, um ein paar Sachen zu holen, um die sie mich gebeten hatte. Ich war kaum zwei Stunden weg. Und jetzt komme ich wieder, und Sie erzählen mir … Das ist doch nicht möglich! Ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe sie gesehen. Es schien ihr gutzugehen, na ja, halbwegs. Und jetzt, auf einen Schlag, im Handumdrehen … Das kann nicht sein!«
Eva sah dem jungen Arzt starr in die Augen, als könnte sie ihn dazu bringen, seine Meinung zu ändern.
»Das ist tatsächlich sehr selten. Aber es kommt vor. Leider. Manchmal verlassen uns die Kranken ganz plötzlich, ohne dass wir irgendetwas tun können.« Er ruderte mit den Armen, als suchte er einen Halt. Einen Ast, einen Felsen. Eine Gewissheit.
Als sie ihn so sah, diesen jungen Mann, den die Routine noch nicht abgestumpft hatte, begriff Eva, dass es keinen Sinn hatte zu kämpfen. Er war müde. Er war traurig. Er wäre gern Gott gewesen, aber er war es nicht.
Von plötzlicher Übelkeit gepackt, fragte sich Eva, ob sie auf seinen Schreibtisch erbrechen würde. Sie wollte noch etwas sagen, da kam das Blackout.
Als sie wieder zu sich kam, beugte sich der Arzt über sie. Er sah noch besorgter aus. Hatte er sie geohrfeigt, um sie wieder aufzuwecken?
»Ich werde Ihnen ein Beruhigungsmittel geben«, erklärte er. Er verschwand einen Moment und kehrte mit einer Spritze in der Hand zurück.
Eva wehrte sich nicht.





























