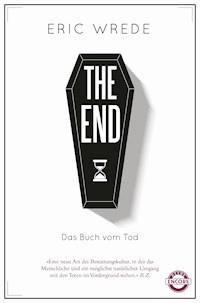
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Tod. Er erwischt uns irgendwann alle. Aber wer weiß, wie das geht? Sterben, beerdigen und trauern. Erklärt hat es uns niemand. Im schlimmsten Fall treten die Kirche und die Bestattungsbranche als Gralshüter einer „Kultur“ auf, die vor allem ihnen selbst nützt. Eric Wrede war Musikmanager und wurde Bestatter. Er will etwas ändern an der gängigen Trauerkultur. Er begleitet Menschen auf ihrem letzten Weg frei von Konventionen. In seinem Buch zeigt er anhand vieler Beispiele aus der Praxis, wie die Alternative aussehen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch:
Der Tod. Er erwischt uns irgendwann alle. Aber wer weiß, wie das geht? Sterben, beerdigen und trauern. Erklärt hat es uns niemand, und die bestehenden Antworten erfüllen ihren Zweck nur noch selten. Im schlimmsten Fall treten die Kirche und die Bestattungsbranche als Gralshüter einer „Kultur“ auf, die vor allem ihnen selbst nützt. Aber statt zu meckern gilt es, eigene Antworten zu geben.
Eric Wrede war Musikmanager und wurde Bestatter. Er will etwas ändern an der gängigen Trauerkultur. Er begleitet Menschen auf ihrem letzten Weg frei von Konventionen. In seinem Buch zeigt er anhand vieler Beispiele aus der Praxis, wie die Alternative aussehen kann.
In THE END wird nichts glorifiziert und schon gar nichts verklärt. Es wird persönlich, aber auch immer wieder an praktischen Beispielen gezeigt, was im Rahmen von Tod und Trauer möglich ist und was schiefgehen kann.
Der Autor:
Eric Wrede wurde an der ostdeutschen Riviera in Rostock geboren. Nach dem Abitur studiert er Germanistik sowie Geschichte und haut sich die Nächte als Schallplattenunterhalter um die Ohren. Er taucht immer tiefer in die Musikszene der Hauptstadt ein und wird schließlich Musikmanager bei einer Plattenfirma. Irgendwie reicht ihm das aber nicht, die Leidenschaft zur Musik erstickt unter der Last der Vermarktbarkeit. Als er eines verregneten Sommertages das Radio anschaltet und ihm die Geschichte vom Trauerbegleiter Fritz Roth entgegenschallt, macht es Klick. Eric entschließt sich Bestatter zu werden. Er lernt das Handwerk in einem klassischen Berliner Betrieb und erfährt alle Details des Bestattungswesens. 2014 gründet er sein eigenes Unternehmen mit dem ungewöhnlichen Namen lebensnah-Bestattungen.
ERIC WREDE
THE
END
Das Buch vom Tod
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Unter www.heyne-encore.de finden Sie das komplette Encore-Programm.
Weitere News unter www.heyne-encore.de/facebook
Copyright © 2018 by Eric Wrede
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Loel Zwecker
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign
Bild auf Rückseite und Klappen: Erik Weiss
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-22841-5V001
Für Manfred Timm und Gundula Kassem
Inhalt
Prolog Mein Testament
1. Kapitel I Fought The Law
2. Kapitel 21 Gramm
Interview: Clemens Schick über das Abschiednehmen
3. Kapitel Schickt mir die Post schon ins Spital
Interview: Henning Wehland über den Tod seiner Mutter
4. Kapitel Keep Me In Your Heart
5. Kapitel London Bridge Is Down
Interview: Madeleine Wehle über sprachlose Trauer
6. Kapitel Behind Blue Eyes
7. Kapitel Der, die, das
Interview: Judith Holofernes über trauernde Kinder
8. Kapitel Cemetery Gates
9. Kapitel Tanzen auch auf Gräbern
Interview: Flake über seine Beerdigung
10. Kapitel Shine On You Crazy Diamond
Interview: Sebastian Fitzek über Opfernde und Trauernde
11. Kapitel Let It Be
Danksagung
Anhang
1. Kapitel
I Fought The Law
Waren Sie schon einmal mitten in der Nacht auf einem Friedhof und haben versucht, eine Urne auszubuddeln? Nein? Ich hatte das auch nicht in meiner Lebensplanung vorgesehen. Selbst dann nicht, als ich mich nach langen Überlegungen dazu entschlossen hatte, mit Anfang dreißig Bestatter und Trauerbegleiter zu werden. Und doch stand ich in jener Nacht mit einer Stirnlampe, einer kleinen Gartenschaufel und einem großen Rucksack vor einer Berliner Friedhofsmauer und versuchte, meinen langen Körper so geräuschlos wie möglich über das Hindernis zu wuchten, um ein Grab auszuheben. Wie zur Hölle war ich nur hierhergekommen?
Bevor ich mich dazu entschloss, Bestatter zu werden, war ich Musikmanager. In die Branche war ich durch diverse Zufälle gestolpert. Es war nie mein erklärtes Ziel gewesen, für ein Label zu arbeiten. Während meines Studiums jobbte ich nebenher in einem Berliner Plattenladen, nachts legte ich manchmal als DJ auf. Mit einem Bekannten sprach ich irgendwann über die von mir verehrten, aber in Deutschland noch recht unbekannten The Killers. Dass man die hierzulande noch nicht anständig bekannt gemacht hatte, empfand ich Großmaul und Musik-Nerd als klaren Beweis dafür, wie mies es um die deutsche Plattenindustrie bestellt war. Mein Bekannter sagte: »Du hast eine große Klappe. Komm doch mal mit und sag das meinen Freunden, die machen sich gerade selbstständig.« Also besuchte ich die Jungs von Motor Music, und die boten mir anschließend einen Job an.
Ich war in meinen Zwanzigern, arbeitete mit coolen Musikern zusammen und verdiente mehr Geld, als ich es mir zu Studentenzeiten je erträumt hatte. In Berlin hat man damit eigentlich den Gipfel erreicht. Es war ein toller Job. Aber ich hatte ihn nie bewusst ausgesucht, er war mir einfach so zugeflogen. Und als ich mir wie fast jeder andere mit Anfang dreißig die Frage stellte, ob mich mein Leben wirklich glücklich machte, dachte ich über meinen Job nach. Und dass ich doch eigentlich tief im Inneren auf der Suche nach einer echten Berufung war. Der Stein im Schuh drückte, aber ich wusste noch nicht, wie ich ihn ausschütteln konnte.
Ich begann, Listen zu erstellen. Mit Antworten auf Fragen wie »Was brauche ich?« oder »Was will ich?«. Am Ende stand da unter anderem: »Ich will mich um Menschen kümmern«, »Ich will dafür anständig bezahlt werden« und »Ich möchte Prozesse abschließen«. Das war eines meiner großen Probleme mit einem Job in der Musik- oder Medienbranche: Man hat nie das Gefühl, Dinge wirklich zu beenden. Ich dachte nach. Sollte ich anfangen, Psychologie zu studieren? Eine Schreinerausbildung beginnen oder Möbelrestaurator werden? Wirklich richtig fühlte sich das alles nicht an.
2010 besuchte ich Freunde in Mönchengladbach. Gemeinsam gingen wir zu einer Tattoo-Convention. Ich wollte eigentlich erst am Montag wieder zurück nach Berlin fahren, setzte mich dann aber doch schon am Sonntag ins Auto und gab Gas. Ich schaltete das Radio ein, suchte irgendwas Entspanntes und blieb bei WDR 3 hängen. Im Kulturradio lief ein Interview mit Fritz Roth, einem Pionier der alternativen Bestattungsszene in Deutschland. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Er erzählte von seiner Ausbildung zum Trauerpädagogen, seiner Trauerakademie »Haus der menschlichen Begegnung« und dem von ihm gegründeten ersten privaten Friedhof in Deutschland. Seine Aussagen über seine Motivation und seinen Beruf trafen mich wie ein Schlag. Das war genau das, was ich mir auf meine Listen geschrieben hatte! Die Bestattungsbranche, so Roth, sei sehr verschlossen und unmodern. Sie brauche dringend jüngere Kräfte, die mit neuen Ideen das bestehende knochentrockene Gewerbe aufbrechen. Für mich war dieses Interview ein Erweckungserlebnis, mitten auf der A2. Ich steuerte eine Raststätte an und musste mich erst mal sammeln. Bestatter also. What the fuck? Das würde mir doch niemand abnehmen.
Was faszinierte mich so an diesem Job? Bis dato hatte der Tod in meinem Leben so gut wie keine Rolle gespielt. Eine ferne Oma und ein noch fernerer Onkel waren gestorben, aber diese Todesfälle hatten mich nicht wirklich berührt. Ich ging recht naiv an die ganze Thematik heran. Was mich an Roths Interview so begeistert hatte, waren seine Erzählungen über einen Beruf, bei dem man Menschen in Extremsituationen betreut und ihnen dabei hilft, Verluste durchzustehen und zu verarbeiten. Das wollte ich auch machen.
In den Wochen nach dem Interview googelte ich mich ein wenig schlauer über diese mir gänzlich unbekannte Branche, informierte mich über die Ausbildung, die verschiedenen Angebote und sammelte virtuelle Erfahrungen. Mit jeder Suche fand ich das Ganze noch etwas abstoßender. Es gab so vieles, was es zu verändern galt, so vieles, was ich verändern wollte. Das System in seiner bestehenden Form gefiel mir ganz und gar nicht. Die Idee, ein eigenes Bestattungsinstitut aufzumachen, existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Mein Plan sah vor, zunächst einmal echte Erfahrungen in einem Bestattungshaus zu sammeln, mich hochzuarbeiten, um vielleicht in ferner Zukunft eine eigene Filiale zu übernehmen. Ich wollte das System in kleinen Schritten bearbeiten. Aber zunächst mal waren das nur Pläne. Ich setzte sie erst in die Tat um, als mir das Schicksal einen ordentlichen Schlag auf den Hinterkopf verpasste. Ein guter Freund von mir war krank geworden. Todkrank. Zu verstehen, dass dieser Mensch sehr bald sterben würde, machte mich fertig. Auch, weil ich realisierte, dass so etwas auch mit mir geschehen könnte.
Worauf wartest du eigentlich, fragte ich mich selbst, als ich den ersten Schock über die Krebsdiagnose meines Freundes verdaut hatte. Darauf, dass auch du bald dran bist? Was soll denn schon passieren, wenn du deinen Job endgültig hinschmeißt und dein Leben umkrempelst? Im schlimmsten Fall landest du wieder hinter irgendeiner Theke. Im Frühjahr 2013 gab ich meinen Job als Musikmanager auf, um ein Praktikum in einem Bestattungshaus zu beginnen. Natürlich unbezahlt. Ich zog aus meiner großen schönen Wohnung aus und in eine kleinere und weniger schöne ein. Und fing an, in einem veganen Café zu jobben. Ich meinte es wirklich ernst.
Es war gar nicht so einfach gewesen, ein Bestattungshaus zu finden, das mich a) überhaupt als Praktikant beschäftigen wollte und b) meinen Vorstellungen von einem klassischen Institut entsprach, das noch alle für eine Bestattung notwendigen Handlungsschritte selbst übernahm. Jeden Morgen stand ich jetzt vor dem Spiegel, um meine dunkle Krawatte akkurat zu binden, meine Tattoos zu verstecken und jenen pastoralen Gesichtsausdruck einzustudieren, der dem Gegenüber gleichzeitig Seriosität und Mitleid suggerieren sollte. Eine unangenehme Mischung, aber ich war Lehrling und wollte nicht auffallen. So aufmerksam wie möglich sog ich sämtliche Eindrücke meiner neuen Tätigkeit in mich auf und notierte sie abends in ein kleines Notizbuch. Wie ein kleiner Günter Wallraff. Ich wollte verstehen, wie dieser Beruf funktioniert, wie in einem klassischen Bestattungshaus mit den Verstorbenen und aber auch mit den Angehörigen umgegangen wird. Ich wollte einen Blick hinter die Kulissen dieses Gewerbes werfen, das doch jeder kennt, von dem aber fast niemand weiß, wie es wirklich funktioniert.
Vier Wochen nach meinem Praktikumsbeginn machte ich mich mit Stirnlampe, Schaufel und Rucksack mitten in der Nacht auf dem Weg zum Friedhof, um gegen eine ganze Reihe Regeln und Konventionen zu verstoßen, weil ich Menschen dabei helfen wollte, anständig Abschied zu nehmen. Dass ich meinen Job in der Musikindustrie aufgegeben hatte, um stattdessen Bestatter zu werden, hatte sich natürlich längst in meinem Bekanntenkreis herumgesprochen. Eines Tages hatte sich ein Freund bei mir gemeldet: »Eric, die Frau eines Freundes ist gestorben. Kannst du helfen?« Natürlich wollte ich das können. Meinem Praktikumsbetrieb sagte ich: »Da ist jemand gestorben, aber die kommen nur zu uns, wenn ich das selber mache.« Glatt gelogen, aber sei’s drum, ich übernahm meinen ersten Fall.
In den Gesprächen mit den Angehörigen stellte ich fest, dass sich die Familie nichts sehnlicher wünschte, als die Urne der Verstorbenen zu Hause aufzubewahren. Unerfahren (und unerschrocken) wie ich war, sagte ich: »Kein Problem, wir setzen die Urne auf dem Friedhof bei und buddeln sie danach einfach wieder aus. Das merkt schon keiner.« Was hatte mich nur geritten? Nicht nur, dass die Familie davon ausging, dass ich derjenige sein würde, der des Nachts seine Schaufel in ein frisches Grab stechen würde, besagter Friedhof liegt auch noch direkt neben einer Polizeistation. Ein Bestatter, ein Wort. Kurz vor Mitternacht nahm ich meine dunkle Aufgabe in Angriff.
Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn mich jemand dabei erwischt hätte. Während ich mit meinen Händen immer tiefer grub – so eine Urnengruft ist achtzig Zentimeter tief, und wer es mir nachtun möchte, dem sei gesagt, dass eine Blumenschaufel dafür ziemlich ungeeignet ist –, sah ich die Schlagzeilen schon vor mir: »Bestatter-Praktikant beim Klauen einer Urne erwischt!« Im Idealfall noch mit Beweisvideo für einen viralen Spitzenreiter in der Kategorie: »Die dämlichsten Typen des Jahres«.
Doch niemand bemerkte mich. Niemand beobachtete, wie ich endlich die Urne in den Händen hielt, das Loch wieder zuschaufelte, über die Mauer kletterte und mir mit zittrigen Händen erst mal eine Zigarette ansteckte. Gott sei Dank war auch niemand dabei, als ich feststellte, dass ich die falsche Urne ausgegraben hatte. Vor Wut und Ärger schossen mir die Tränen in die Augen. Ich war der schlechteste Kriminelle der Welt. Noch einmal kletterte ich über die Mauer, noch einmal schürfte ich mir die Handgelenke an der Erde auf, noch einmal klaute ich eine Urne. Der Schein meiner Stirnlampe bestätigte mir: Diesmal hatte ich das richtige Grab erwischt. Fix und fertig kam ich wieder nach Hause, in meinem Rucksack die Urne mit der Asche der verstorbenen Frau. I fought the law.
Ich lernte eine Menge während meines Praktikums. Ich bekam Einblick in ein Geschäft, das durchsetzt ist von Vorschriften und Regeln, von fehlender Menschlichkeit und vom Streben nach Gewinnmaximierung; das sich als rein technischer Dienstleister für die Bestattung sieht und trauernde Angehörige uninformiert, aber um einiges ärmer zurücklässt. Ich lernte ein System kennen, in dem das Bedürfnis nach Zeit und Ruhe zum Trauern nicht berücksichtigt wird. Bestatter haben sich in Deutschland den Ruf von Schlüsselnotdiensten erworben. Man meldet sich nicht gerne bei ihnen (und auch nicht häufig – die Deutschen haben es im Schnitt alle achtzehn Jahre mit dem Tod eines nahestehenden Menschen zu tun) –, und wenn man es tut, dann ist einem bewusst, dass man sehr viel Geld für eine Dienstleistung zahlen wird, weil einem sonst keiner akut helfen kann. Und mir wurde klar, wie es generell um die Trauerkultur in diesem Land bestellt ist. Welche Fortschritte wir gemacht haben, und wo die Probleme liegen.
Ein Fallbeispiel. So oder ähnlich läuft es tagtäglich in Deutschland ab. Nennen wir unsere Familie »Familie Schulze«. Großmutter Schulze ist mit vierundachtzig Jahren in einem Pflegeheim verstorben. Ihre Angehörigen hatten nicht die Zeit und die Energie, Oma zu Hause zu pflegen, aber sie waren so oft wie möglich bei ihr. Mehrmals hat das Pflegeheim in Oma Schulzes letzten Monaten geraten, den Kontakt eines Bestatters zu hinterlegen, nur für den Fall der Fälle, aber an diesen Fall wollte Familie Schulze nicht denken, und außerdem war doch eh fast jeden Tag jemand bei Oma. Dann geht alles sehr schnell: In der Nacht ist Großmutter Schulze überraschend verstorben und das Heim informiert die Familie, dass Oma zeitnah abgeholt werden muss, nachdem der Arzt den Tod festgestellt hat. Hastig sucht Familie Schulze nach einem Bestatter, denn nur er darf die Verstorbene abholen. Das Heim empfiehlt ein Bestattungshaus um die Ecke, und obwohl die Schulzes bei der Suche nach einem anständigen Pflegeheim ein halbes Dutzend Institutionen besuchten, nehmen sie diese erstbeste Empfehlung gleich an, schließlich muss es schnell gehen.
Bis zum Abtransport der Oma bleiben nur ein paar Stunden, die Familie stellt ein paar Kerzen im Zimmer der Großmutter auf und bietet den anderen Heimbewohnern an, sich noch einmal zu verabschieden. Dann taucht ein ihnen bis dato unbekannter Mensch auf und nimmt Oma mit an einen Ort, den die Schulzes ebenfalls noch nie gesehen haben. Und nur wenig später sitzt die Familie im Büro des Bestatters, um so kurz nach dem Tod der Oma diverse Fragen zu klären. Wie viele Sterbeurkunden werden benötigt? Welcher Sarg soll es sein? Soll die Großmutter eingeäschert werden? Welche Kleidung soll sie tragen? Soll eine Todesanzeige in der Zeitung erscheinen? Welcher Blumenschmuck ist gewünscht? Soll es vielleicht die etwas höherwertige Sarggarnitur mit den Rüschen sein? Dazu jener pastorale Gesichtsausdruck, den ich mir schleunigst wieder abgewöhnte. Und so nehmen für Familie Schulze die Dinge ihren Lauf.
Dabei hätte es durchaus Möglichkeiten gegeben, den Schulzes einen wesentlich sanfteren Abschied zu verschaffen. In den meisten Bundesländern zum Beispiel darf man verstorbene Angehörige noch sechsunddreißig Stunden nach Eintreten des Todes zu Hause aufbahren; wem das zu kurz ist, der kann über den Bestatter eine Fristverlängerung beantragen, die meistens auch bewilligt wird. Nur hatte das der Familie Schulze niemand gesagt. Jetzt ist es ohnehin zu spät. Abends sitzt man zusammen, was im Laufe dieses traurigen Tages entschieden wurde, ist fast schon wieder in Vergessenheit geraten, außerdem müssen ja Familienmitglieder und Freunde informiert, eine Traueranzeige und Einladungen für die Beerdigung gestaltet werden. Und wo soll Oma überhaupt bestattet werden? Auf dem städtischen Friedhof, wo sie noch nie war? Oder lieber im Garten neben dem großen Nussbaum, den Großmutter Schulze vor sechzig Jahren selbst gepflanzt hatte? Hinter dem Haus, in dem sie den Großteil ihres Leben verbrachte? In dem ihr Mann vor fünf Jahren an einem Herzinfarkt starb?
Eine schöne Idee, aber wir sind ein Land der Regeln, und eine der Regeln besagt, dass man auf einem Friedhof bestattet werden muss, und der wiederum ist in Deutschland der heilige Ort der Regulierungswut. Wie und wo bepflanzt werden darf, ist klar definiert. Kieselsteine auf Grabstellen sind meistens ebenso verboten wie Hunde auf dem Friedhofsgelände. Größere Steine müssen genehmigt sein, dafür muss man einen speziellen Grabmalantrag stellen, Kinder müssen in Begleitung sein – die Liste ist endlos. Am Ende wird Oma Schulze auf dem städtischen Friedhof beigesetzt. In einem Sarg, der mehr gekostet hat als ihr erstes Auto. Vor der Kapelle wartet schon die nächste Trauergemeinde. Der Bestatter verabschiedet sich. Das Leben geht weiter, die nächste verstorbene Großmutter wartet schon, recht herzliches Beileid.
Wie hat die Familie in der kurzen Zeit überhaupt richtig Abschied nehmen können? Welchen Raum gibt es für die Trauer, wenn in vielen Bundesländern ein verstorbener Mensch innerhalb von zehn Tagen beerdigt sein muss? Was macht es mit unserer Familie Schulze, wenn die tote Oma so schnell aus ihrem Zimmer abgeholt werden muss? Wenn eine fremde Person der letzte Mensch ist, der Oma anfasst und mitnimmt? Wenn man sich mit der Auswahl von sehr kostspieligen Holzkisten beschäftigen muss, statt zusammenzusitzen, um erst mal zu begreifen, dass Oma nicht mehr da ist? Was ist, wenn die Bestattung gar nicht zu Oma Schulze und ihrer Familie passt? Warum hat sich das Bestattungshaus nicht die Mühe gemacht, Familie Schulze bei diesem schwierigen Abschied mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, statt Oma lediglich unter die Erde zu bringen? Warum ist unsere Sterbe- und Trauerkultur so durchkommerzialisiert und unpersönlich? Und warum ändert sich daran so wenig? Niemand bringt uns bei, richtig Abschied zu nehmen. Nicht vom Liebsten, der uns verlässt, nicht von dem Job, den wir verlieren, und schon gar nicht von Omi, die wir nie wiedersehen werden. Wir werden nicht ausreichend informiert, wie man Wege findet, den Verlust eines Menschen auf angemessene Weise zu verarbeiten.
Nach zehn Monaten Praktikum wusste ich, dass ich als Teil dieses Systems gar nichts würde ändern können. Ich musste etwas Eigenes auf die Beine stellen, mein eigenes Bestattungshaus eröffnen. Aber bis dahin war es noch ein weiter Weg. Das Praktikum endete nach einem Vierteljahr, und während ich damit begann, meinen Traum vom eigenen Institut zu verwirklichen, arbeitete ich für 8,50 Euro die Stunde weiter in jenem Haus, in dem ich auch das Praktikum absolviert hatte. Eine knüppelharte Zeit. Früher hatte ich viertausend Euro verdient und niemandem erklären müssen, warum ich mir gerade den Job in der Musikbranche ausgesucht hatte. Jetzt bekam ich den Mindestlohn und musste neben meinen eigenen Zweifeln, die mich in jener Zeit regelmäßig heimsuchten, auch die Zweifel in meinem Umfeld bekämpfen. Manchmal lag ich nächtelang wach, heulte in mein Kopfkissen und fragte mich, warum ich Esel nur so dumm gewesen war, mein schönes altes Leben auf den Müll zu werfen. Dann wieder hielt ich emotionale Reden, wie jene vor meiner Oma, in der ich ihr verklickern wollte, warum ich mich so entschieden hatte. »Oma«, sagte ich, »ich möchte doch glücklich sein!« Ihre Antwort lautete damals: »Tja, dann wirst du ja wohl nie heiraten.« Für sie, die im Osten groß geworden war, wo Bestatter ein ähnlich ruhmreiches Image hatten wie Müllmänner, war meine Entwicklung unbegreiflich. Heute denkt sie anders.
Während ich immer mehr Eindrücke sammelte und mich mit meinem Mindestlohn-Gehalt durch die Wochen und Monate hangelte, fing ich an, mir ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wie mein eigenes Bestattungshaus wohl aussehen sollte. Ich malte Skizzen für die Räumlichkeiten, suchte sehr lange nach einem Namen, werkelte an einer Homepage, bastelte erste Logos. Mein Startkapital bestand aus der finanziellen Unterstützung meiner Mutter und den fünftausend Euro, die ich mir von einer Freundin geliehen hatte. Während ich nach einer passenden Unterkunft suchte und mein Gewerbe anmeldete, kreisten meine Gedanken darum, wie ich wohl die ersten schwierigen Monate überstehen würde. Mut machte mir der Gedanke daran, dass sich mein Wandel vom Musikmanager zum Bestatter in spe bereits herumgesprochen hatte und ich vermutlich alleine aus meinem Umfeld zwei oder drei Fälle betreuen würde, die mir das nötige finanzielle Fundament verschaffen würden. Ende 2015 eröffnete ich schließlich mein eigenes Bestattungsinstitut: lebensnah. Das erste Vierteljahr überstand ich quasi als Ein-Mann-Betrieb. Dann schrieb mich nachts auf Facebook eine Frau an und erzählte mir von ihrer Mutter, die so schöne Trauerkarten bastele, und ob das nicht was für uns wäre. Heute arbeitet Leo als Bestatterin bei lebensnah. Sie kennengelernt zu haben, ist ein großes Geschenk.
Seit der Fahrt von Mönchengladbach nach Berlin sind bald acht Jahre vergangen. Ich habe mir eine gewisse Erfahrung und Reputation als Bestatter erarbeitet und lerne trotzdem noch jeden Tag dazu. Ich kenne Mittel und Wege, den Wünschen von Verstorbenen und Angehörigen nachzukommen, ohne dass ich nachts mit einer Schaufel über eine Friedhofsmauer klettern muss.
Der Kampf mit den Konventionen und Gesetzen dauert allerdings an. Wie bei der unsinnigen Regelung für das Tragen von Urnen und Särgen. Als mein Großvater starb, fand ich die Vorstellung fürchterlich, dass ein fremder Mensch der letzte sein sollte, der die Urne mit der Asche meines Opas berührt. Bei seiner Beerdigung baute ich mich also vor den Verantwortlichen auf und sagte: »Ich werde die Urne zum Grab tragen.« Ich bin Bestatter und habe leicht reden. Der Grund, warum in der Regel ein Friedhofsmitarbeiter oder Bestatter diesen Job übernimmt, ist simpel: Menschen, die ihre Verstorbenen selbst tragen, sind dafür nicht versichert. Ich vermute aber, dass ich nicht der Einzige bin, der gerne bereit wäre, die paar Euro für eine entsprechende Versicherung zu zahlen. Es gibt in Deutschland für diesen Fall keine einheitliche Richtlinie, die Regeln sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Manche lassen das Tragen offiziell gar nicht zu, in anderen darf man die Urne zwar bis zur Gruft tragen, sie aber nicht hinabsenken. Manche Friedhöfe haben Treppen, die diesen Vorgang hinfällig werden lassen und so weiter.
Verantwortlich ist immer die jeweilige Friedhofsverwaltung. In Großstädten bzw. auf Friedhöfen, auf denen besonders viele Menschen beerdigt werden, kommt ein weiteres Problem dazu: Um Kosten zu sparen, finden Trauerfeiern in einer so engen Taktung statt, dass die Trauernden quasi Schlange stehen. Darf man so etwas Intimes wie Trauer und Abschiednehmen von einem geliebten verstorbenen Menschen takten? Ich finde nicht. Niemand erinnert sich an den Sarg oder die Urne. Aber jeder, der dabei war, wird die letzten gemeinsamen Stunden mit Freunden, Familie und dem verstorbenen Menschen nie vergessen. Vor allem dann nicht, wenn man den Raum und die Zeit hat, diesen Abschied so schön und angemessen wie möglich zu gestalten.
Vor Kurzem habe ich die Großmutter meines Lieblingsfloristen beigesetzt. In seinem wirklich sehr schönen Laden serviert der Florist Kaffee, Tee und Kuchen, aber das eigentliche Highlight sind seine beiden Papageien. Seit dem Tod der Großmutter haben die Tiere Gesellschaft, in einer Ecke steht jetzt ein kleiner Schrein für die verstorbene Dame. Die Beisetzung fand auf dem Friedhof ihres Heimatdorfes vor den Toren von Berlin statt. Einer dieser Friedhöfe, wie es sie wirklich nur noch außerhalb der Städte gibt. Um die Verwaltung kümmert sich ehrenamtlich eine Frau aus der Gemeinde, jede größere Familie hat ihre eigene Grabstätte, und in der Kapelle wird es bei zwanzig Gästen schon sehr eng. Das Schöne an solchen Friedhöfen ist, dass man noch alles selbst machen muss/darf. Am Morgen der Beerdigung bekamen wir einen Schlüssel für die Kapelle, dann ließ man uns allein. Gemeinsam hoben wir das Grab aus, der Florist schmückte die Kapelle.





























