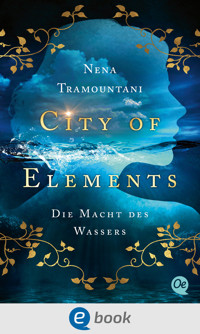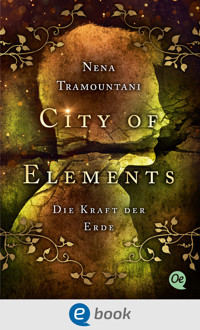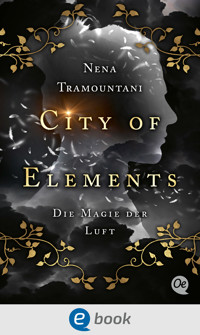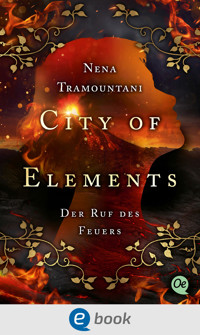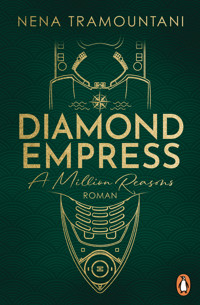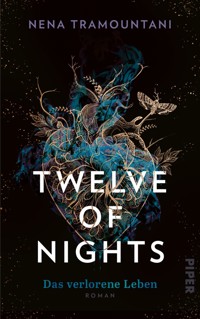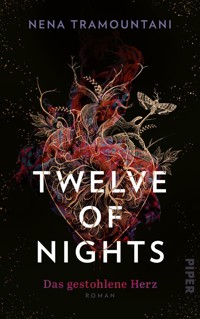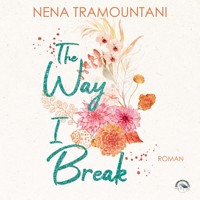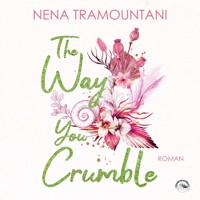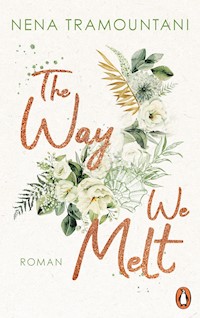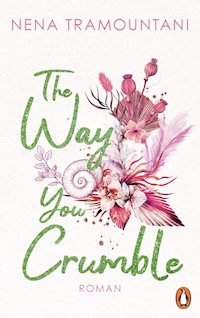
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hungry Hearts
- Sprache: Deutsch
Echo & Alexis: Ihr Leben schmeckt schon immer bitter. Nur er besitzt die Gabe, es zu versüßen.
Echo ist wütend. Wütend auf ihre Mutter, die sich das Leben nahm, aber am meisten auf sich selbst, weil sie sich wie eine Versagerin fühlt. Nur ihrem Großvater zuliebe nimmt sie einen Aushilfsjob im Sternerestaurant Prisma an und ist überrascht, als sie Gefallen am Konditorhandwerk findet – und an ihrem Kollegen: Alexis ist der jüngste Sohn der Restaurantbesitzer und mindestens genauso wütend wie sie. Er versucht nicht, Echo gute Ratschläge zu geben, doch das hat einen ernsten Grund: Alexis spricht nicht. Offenbar braucht er Hilfe, aber wie soll jemand wie sie ihm schon helfen? Während sie Seite an Seite feine Desserts kreieren, lässt Alexis‘ Nähe Echos Nervenenden vibrieren. In ihr keimt plötzlich Hoffnung auf eine glücklichere Zukunft auf – wäre da nur nicht ihre Vergangenheit, die alles zerstören könnte …
Die süchtig machende Hungry-Hearts-Reihe geht weiter.
Entdecken Sie auch die weiteren Bände der Hungry-Hearts-Reihe:
1. The Way I Break
2. The Way You Crumble
3. The Way We Melt
Alle Romane können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
NENA TRAMOUNTANI, geboren 1995, liebt Kunst, Koffein und das Schreiben. Am liebsten feilt sie in gemütlichen Cafés an ihren gefühlvollen Romanen und hat dabei ihre Lieblingsplaylist im Ohr. Nach ihrer erfolgreichen Soho-Love-Reihe nimmt sie ihre Leserinnen mit ihrer Hungry-Hearts-Trilogie mit auf eine kulinarisch-prickelnde Reise in ein Sternerestaurant an der englischen Küste. Nena Tramountani lebt in Stuttgart.
Außerdem von Nena Tramountani lieferbar:
Fly & Forget
Try & Trust
Play & Pretend
The Way I Break
Nena Tramountani
The Way You Crumble
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de).
Umschlag: www.buerosued.de unter Verwendung von Motiven von www.buerosued.de
Redaktion: Melike Karamustafa
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-28534-0V001
www.penguin-verlag.de
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet sich hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen allen das bestmögliche Leseerlebnis.
Nena Tramountani und der Penguin Verlag
Für alle, die es leid sind, in zwei Welten zu leben.
1. KAPITEL Echo
The devil I know
Zu meiner Verteidigung: Mir war von Anfang an klar gewesen, dass es nicht funktionieren würde. Es war bloß eine Überraschung, wie schnell ich diesmal einen neuen Rekord aufgestellt hatte.
»Ausweis«, knurrte der bullige Typ vor mir.
Ich hatte ihn noch nie gesehen. Mein Glück.
Mit ausdrucksloser Miene zog ich meinen Ausweis hervor, und Sekunden später winkte er mich durch, ohne mich noch eines weiteren Blickes zu würdigen. Ich sah nicht halb so abgefuckt wie noch vor einem Monat aus. Immerhin das hatte ich der Klinik zu verdanken. Nach all den Jahren hatte ich es perfektioniert, in der feiernden Meute unterzugehen. Eine gute Mischung zwischen lässig und erwachsen darzustellen. Trotz der einstündigen Fahrradfahrt von Goldbridge hierher sah ich entspannt aus, wie meine Handykamera mir bestätigt hatte: goldfarbene Bomberjacke, die mir über den Arsch reichte, darunter ein schwarzer Jumpsuit und Stiefel mit fettem Plateau – dreifacher Vergewaltigungsschutz –, dunkles Augen-Make-up, meine kurzen Haare so mit Gel in Form gezupft, dass nicht mal der Fahrtwind eine Chance gehabt hatte.
Der Boden vibrierte unter meinen Füßen.
Ich lächelte nicht, als ich den schummrigen Gang entlang und die Treppen nach unten lief. Da war keine Vorfreude in mir. Die würde noch kommen. Sie kam immer, sobald das Zeug anfing, seine Wirkung zu entfalten. Aber nicht jetzt. Noch nicht. Ich hatte einen Plan. Ich war konzentriert. So wie heute Mittag bei meiner Entlassung und das gesamte Abendessen mit Luke über. Mein Plan hatte mir geholfen, der Mensch zu sein, den mein Großvater sich wünschte. Zwei Stunden lang hatte ich brav gegessen, gelacht, genickt, die richtigen Dinge gesagt, um ihn in Sicherheit zu wiegen. Auch diese Rolle hatte ich mit der Zeit perfektioniert.
Die bunten Lichter der Discokugel zuckten über die Tanzfläche. Es war brechend voll im Fever. Immerhin war es Samstagnacht, und zu dem einzigen größeren Club in der Nähe von Goldbridge und den Nachbarkäffern gab es keine wirkliche Alternative. Nicht dass die Musik oder sonst irgendwas hier besonders berauschend war. Berauschend würde heute nur eines sein. Ha.
Als ich auf dem Weg zu den Toiletten an der ewig langen Bartheke vorbeikam, traf mich Dimis Blick. Er war gerade dabei, den Cocktailshaker über der Schulter zu schütteln, und ließ ihn abrupt sinken. Im Gegensatz zum Türsteher war er leider nicht neu. Seit über zwei Jahren arbeitete er als Barkeeper im Fever und kannte deshalb meine Historie.
»DEIN SCHEISS ERNST?«, brüllte er über den wummernden Bass hinweg. Eine Mischung aus Wut und Enttäuschung machte sich auf seinem bärtigen Gesicht breit.
Ich legte meinen Mittelfinger an die Lippen, küsste ihn und hielt ihn für genau eine Sekunde in die Höhe, bevor ich den Arm wieder sinken ließ und mich hinter einer Gruppe von spanischen Touristen wegduckte. Schnell weg hier. Ich konnte nicht einschätzen, wie ausgeprägt sein Beschützerinstinkt inzwischen war. Am Anfang hatte er sich mit dem ein oder anderen tadelnden Kommentar zufriedengegeben, doch mit jedem Entzug – ich hatte heute Mittag Nummer drei abgeschlossen – und jedem Rückfall schien er nerviger zu werden. Lieber nichts riskieren.
Als ich den schmalen Flur zu den Toiletten erreichte, atmete ich erleichtert aus. Die Wände waren mit Konzertplakaten zugekleistert, die Luft stank nach Zigarettenrauch und Kotze, aber immerhin war hier nicht viel los. Die meisten Fever-Besucher tranken keinen Alkohol, sie warfen Pillen ein oder zogen sich den Spaß durch die Nase, was bedeutete, dass sie stundenlang durchtanzen konnten und höchstens aufs Klo rannten, um sich die nächste Dröhnung zu geben.
Nun spürte ich doch Vorfreude. Sie zuckte durch mich hindurch wie die Lichter über die tanzenden Leute. Meine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, während ich den Reißverschluss meiner Bauchtasche öffnete und nach den Scheinen tastete.
Augenblicklich hatte ich Lukes gutmütiges Gesicht vor Augen.
Nein. Weg damit. Es würde ihm nicht auffallen. Ich würde es ersetzen. Immerhin hatte ich ja jetzt einen Job. Mal sehen, wie lang ich ihn behielt. Andererseits, für ein bisschen Kohle würde ich mich zusammenreißen.
Ich hatte das Ende des Gangs erreicht, bog um die Ecke und fand mich vor dem defekten Zigarettenautomaten wieder, der sich zwischen den beiden Toilettentüren befand. Isla lehnte gelangweilt dagegen und wickelte sich eine blonde Strähne um den Finger. Sie trug ein schickes weißes Kleid aus Seide, das genau wie der Rest ihrer Erscheinung kein bisschen in einen heruntergekommenen Laden wie diesen passte.
Sobald sie mich erblickte, stieß sie sich vom Automaten ab und lachte hämisch. »Aller guten Dinge sind drei, dachte ich?«
»Ja, ja, lass stecken. Pax ist heute nicht da?«
Isla war die Vertretung meines Dealers und – zugegeben – die geeignetere Person für den Job. Niemand würde es wagen, sie zu filzen. Sie war gerade mal volljährig, stank nach Luxus und hatte ein süßes Engelsgesicht mit den dazu passenden Goldlocken. Außerdem hatte sie im Gegensatz zu Pax ihr Gewissen im Griff und verkaufte mir, was ich wollte.
»Nee, der ist krank«, erwiderte sie mit ironischem Unterton. »Und damit meine ich, in einer ›glücklichen‹ Beziehung.«
Die Anführungszeichen waren nicht zu überhören.
Ich wies mit dem Kinn zur linken Toilettentür, vergewisserte mich, dass sie mir folgte, stieß sie auf und quetschte mich an zwei knutschenden Typen vorbei.
Wir verschanzten uns in einer freien Kabine und schlossen ab. Prompt stieg mir ihr süßliches Vanilleparfüm in die Nase.
»K?«, raunte sie mit einem lasziven Lächeln, das ihre jadegrünen Augen zum Strahlen brachte.
Als ich nickte, griff sie in ihren BH. »Wie viel?«
Noch ein Grund, aus dem sie mir lieber als Pax war: Sie verschonte mich mit dummem Gelaber.
»Ein halbes Gramm.«
Heute würde ich es langsam angehen lassen. Ein, zwei Stunden tanzen, dann ab zurück ins Bett, die Nachwirkung wegschlafen, morgen früh fröhlich und munter zu meinem neuen Job antreten und Luke stolz machen. Alles entspannt. Alles unter Kontrolle.
Wir tauschten Geld gegen Plastiktütchen, sie hauchte Luftküsse rechts und links neben meine Wangen in die Luft und verließ die Kabine. Ihre hohen Absätze klapperten auf den Fliesen.
Nachdem ich mir die Tüte in den Ausschnitt gesteckt hatte, folgte ich ihr nach draußen, lief aber nicht in Richtung Tanzfläche, sondern betrat durch die Nebentür die Frauentoiletten. Die meisten gaben zu Recht einen Scheiß auf Geschlechtertrennung, aber hier war es aus irgendeinem Grund trotzdem immer sauberer.
Niemand war zu sehen. Der Spiegel über dem Waschbecken rechts von mir war mit bunten Schriftzügen vollgekritzelt, sodass ich nur meine Augen und meinen Mund erkennen konnte. Ich grinste mir zu.
Kaum dass die Tür hinter mir zugeklappt und die Musik von draußen nur noch gedämpft zu hören war, vernahm ich das Stöhnen aus der hintersten Kabine. Inzwischen war das nicht mehr abstoßend für mich. Wenn man monatelang mit Leuten auf dem Parkplatz eines Motels lebte, für die Sex das beste Mittel war, um schnell an Geld zu kommen, härtete man ab.
Da die erste Kabine abgeschlossen war, blieb mir nur die mittlere. Ich schlüpfte hinein, verriegelte sie hinter mir und klappte den Klodeckel runter. Nachdem ich mich gesetzt hatte, atmete ich ein paarmal tief durch.
Das Stöhnen neben mir wurde lauter, dann erklang ein dumpfer Schlag, zusätzlich wackelte die Wand, die unsere Kabinen trennte.
Jäh verflog meine Vorfreude. Was tat ich hier?
Die körperliche Entgiftung war schlimmer denn je gewesen. Ich hatte geschrien, getobt, gebettelt – und schließlich doch weitergekämpft. Tag für Tag war ich von Psychologen begleitet worden, hatte geredet und zugehört, in Einzel- und Gruppentherapie, geredet, geredet, geredet, keinen Bullshit diesmal, nicht wie beim ersten Entzug, sondern die Wahrheit, wie beim zweiten Mal, nur dass ich diesmal richtig ausgepackt und jedes Detail offengelegt hatte. Keine Ahnung, woher ich die Kraft genommen hatte. Vielleicht weil ich immer wieder Lukes verheultes Gesicht vor mir gesehen hatte. Zum ersten Mal die ganze Wahrheit: »Hi, ich bin Echo, und ich bin süchtig. Hi, ich bin Echo, und ich weiß nicht, wer ich ohne die Drogen bin. Hi, ich bin Echo, und jedes Mal, wenn ich geglaubt habe, echtes Glück zu empfinden, ist es zwischen meinen Fingern zerbröckelt. Hi, ich bin Echo, und ich bin Abschaum. Hi, ich bin Echo, und es ist meine Schuld, dass meine Mutter keinen Bock mehr auf dieses Leben hatte.« Dann Kunsttherapie, Achtsamkeitsübungen, Bewegungstherapie, Musiktherapie. Noch mehr reden und noch mehr zuhören. Als ich nach drei Wochen in der Klinik aufgewacht und mein erster Gedanke nicht der ans Aufgeben gewesen war, hatte sich etwas verändert. Mein Selbstbewusstsein war zurückgekehrt.
Selbstbewusstsein war mit Selbstüberschätzung gleichzusetzen, wenn man süchtig war. Ich schaffe das, hatte ich mir gesagt, ich schaffe es, meinen Grandpa stolz zu machen. Diesmal schaffe ich es, ein normales Leben zu führen. Was ist schon dabei, wenn ich ein bisschen Hilfe brauche? Deshalb war ich ins Fever gekommen, statt meine alte Crew aufzusuchen und dort weiterzumachen, wo ich vor einem Monat aufgehört hatte. Diesmal wollte ich vernünftiger sein.
Beinahe hätte ich über meine eigene Logik gelacht. Meine Vernunft, mein bisschen Hilfe war das Ketamin.
»Das ist so gut«, erklang eine Stimme neben mir, gefolgt von einem genussvollen Keuchen.
Abrupt stand ich auf. Wenn ich das durchziehen wollte, musste ich mich vergewissern, dass ich keine Zeugen hatte, die mich anschwärzen würden. Kurzerhand stützte ich mich an der Kabinenwand ab und stieg auf die Kloschüssel. Links von mir ertönte die Spülung, eine rothaarige Frau war gerade dabei, die Kabine zu verlassen. Sie bemerkte mich nicht. Rechts waren wie erwartet zwei Leute zugange. Ein großer Typ mit dunklen kurz rasierten Haaren und hellem Teint, eine etwas kleinere Frau mit schwarzen Braids und dunkler Haut. Sie hatte ihr kurzes Kleid hochgeschoben, ihr Slip und die Strumpfhose lagen auf dem Boden. Seine Jeans und Boxershorts baumelten um seine Knöchel, er trug nur noch ein schwarzes weites Hemd. Seine rechte Hand verschwand zwischen ihren Beinen, die andere lag an ihrem Hinterkopf. Ein rundes Tattoo prangte auf seinem Handrücken. Voller Leidenschaft küssten sie sich.
Sekundenlang starrte ich auf sie hinab und vergaß zu atmen.
Im nächsten Moment hatte er sie an den Hüften gepackt und hochgehoben, sie schlang die nackten Beine um seine Mitte, überkreuzte sie an seinem Hintern, er presste sie mit dem Rücken gegen die Wand und drang in sie ein.
Mein Mund wurde staubtrocken, Hitze durchflutete mich.
Beide stöhnten jetzt, mit jeder Sekunde wurden ihre Bewegungen heftiger. Die Kabinenwand, an der ich mich festhielt, bebte, und plötzlich rutschte meine Hand ab und ich schwankte. Im letzten Augenblick konnte ich mich festkrallen, ehe ich das Gleichgewicht verlor.
Ein überraschter Laut entwich mir. Die Frau schien nichts davon zu bemerken, doch der Typ schaute hoch.
Dunkle Augen, wie zwei Kohlestücke in dem blassen Gesicht, tief liegende Brauen, harte Züge.
Fuck.
2. KAPITEL Echo
When push comes to shove
Obwohl ich ihn seit Jahren nicht mehr aus der Nähe gesehen hatte, hätte ich dieses Gesicht niemals vergessen können. Außerdem kannte ich die Gerüchte über ihn, die in Goldbridge kursierten. In unserer Schulzeit hatte er trotz seiner Größe etwas Zerbrechliches gehabt, inzwischen wirkte er nicht nur erwachsen, sondern irgendwie scharfkantig. Früher waren ihm ständig die dunklen Locken in die Augen gefallen, jetzt betonte der Buzzcut seine harten Züge.
Erkannte er mich auch? Starrte er mich deshalb an, ohne eine Miene zu verziehen? Und wieso vögelte er sie einfach weiter?
Irgendwann wurde die Hitze in mir so unerträglich, dass ich zurückwich und von der Kloschüssel sprang.
Scheiße!
Ich durfte nicht hier sein. Wenn er mich gerade nicht sowieso schon erkannt hatte, würde ihm spätestens morgen aufgehen, dass ich es war, die ihn beim Vögeln beobachtet hatte.
Reflexartig griff ich in meinen Ausschnitt und zog das Tütchen hervor, mit der anderen Hand klappte ich den Klodeckel hoch.
Für den Bruchteil eines Moments zögerte ich. So was hatte ich noch nie getan. Meine Hand begann zu zittern, während das Stöhnen in der Kabine neben mir erneut lauter wurde. Bald beschränkte sich das Zittern nicht nur auf meine Hand, sondern auch auf meinen restlichen Körper.
Es brauchte eine einzige Sekunde voller Schwäche, um rückfällig zu werden. Um monate-, oft jahrelange Arbeit zunichtezumachen. Und es brauchte jede verfluchte Sekunde jedes verfluchten Tages voller Willensstärke, um nicht rückfällig zu werden.
Ich hatte gerade einen Grund gefunden, um stark zu bleiben. Je länger ich darüber nachdachte, desto wahrscheinlicher war es, dass ich Gründe finden würde, die mich vom Gegenteil überzeugten. Also pfefferte ich das Tütchen in die Toilette und drückte auf die Spüle, wieder und wieder, während ich den Blick gen Decke richtete, damit ich nicht dabei zuschauen musste, wie es weggeschwemmt wurde, und die Nerven verlor.
Mein Zittern wurde immer schlimmer.
Weg hier. Ich musste weg hier.
Mit hastigen Schritten verließ ich die Toilette. Meine Umgebung verwischte vor meinen Augen, als ich mir meinen Weg zur Bar bahnte und mich nach vorn kämpfte, bis Dimi vor mir erschien.
Er kniff die Augen zusammen. Sein Blick tanzte über mein Gesicht, als versuchte er, Anzeichen für meine Schwäche zu finden.
»Ich lass dich rausschmeißen«, rief er mir zu, doch er klang nicht mehr wütend. »Ich sorge dafür, dass du nie wieder einen Fuß in diesen Club setzt.«
»Okay.« Ich rang mir ein Lächeln ab. »Krieg ich davor noch eine Fanta?«
Mit einem Stöhnen wandte er sich ab und kehrte mit einer Flasche zurück, die er öffnete und mir kommentarlos hinknallte.
Ich nahm einen großen Schluck. Die eiskalte Flüssigkeit verstärkte mein Zittern.
»Alexis Bithersea«, stieß ich schließlich hervor, »vögelt jemanden in den Toiletten.«
Dimi starrte mich noch ein paar Sekunden zweifelnd an, dann zuckte er mit den Schultern. »Erzähl mir was Neues.«
»Was ist mit ihm los?«
Wie passte das mit den Gerüchten zusammen? Der jüngste Bithersea-Sohn war schon immer der ruhigste der drei Brüder gewesen. Doch ich hatte gehört, dass er inzwischen kaum noch redete. Dass mit ihm etwas nicht stimmte.
Dimi hob eine Braue. »Ist halt sein Ding. Dafür kommt er her. Ist mir lieber als Junkies.«
Das letzte Wort klang herausfordernd.
»Woher weißt du, dass er keiner ist?«, gab ich grinsend zurück.
Böse funkelte er mich an. »Er trinkt nicht mal. Und seine wichtigste Regel, wenn er jemanden klarmacht: hundertprozentige Nüchternheit auf beiden Seiten.«
Ich schnaubte und trank den Rest meiner Fanta auf einen Zug leer. »Also ein ganz Korrekter.«
Als ich meine Bauchtasche öffnete, um zu bezahlen, winkte Dimi ab. »Lass stecken. Und jetzt verschwinde, bevor ich dich höchstpersönlich hier raustrage. Und ruf verflucht noch mal deine Sponsorin an, sonst ruf ich Luke an.«
Erneut zeigte ich ihm den Mittelfinger, gehorchte aber.
Während ich das Fever hinter mir ließ und die kalte Septemberluft einatmete, zog ich meine Kopfhörer hervor und steckte sie mir in die Ohren. Ein paar Meter vom Club entfernt stand mein Fahrrad an einen Laternenpfahl geschlossen. Ich entsperrte die Kette, schwang mich auf den Sattel und holte mein Handy aus der Jackentasche. Dann wählte ich die Nummer, von der ich niemals gedacht hätte, sie so schnell nach meiner Entlassung zu nutzen. Allerdings nicht, weil ich angenommen hatte, dass ich so lang clean bleiben würde. Im Gegenteil.
Als es klingelte, steckte ich das Handy zurück in die Tasche und fuhr los. Der Wind schlug mir ins Gesicht und trieb mir Tränen in die Augen, auf einmal schien die ganze Welt mit mir zu zittern. Der Boden, die Bäume rechts und links der Straße, die Industriegebäude weiter vorn.
Nach dem achten Klingeln klickte es in der Leitung.
»Echo?«
Sie klang schlaftrunken. Ihr Akzent, über den ich mich am Anfang lustig gemacht hatte, weil ich wie gesagt Abschaum war, löste jetzt das Gefühl von Geborgenheit in mir aus.
Wütend kämpfte ich die Tränen zurück.
»Schönen guten Abend, Soula. Ich hab’s verkackt.«
3. KAPITEL Echo
No more hiding
»Du hast nichts verkackt.«
Soula goss uns entkoffeinierten Schwarztee in altmodisch geblümte Porzellantassen – »sonst können wir noch weniger schlafen« – und nickte mir aufmunternd zu.
Obwohl mir überhaupt nicht danach zumute war, musste ich grinsen. Ich liebte es, wenn sie mit ihrem schweren griechischen Akzent Vulgärsprache benutzte.
Sie hatte so lang mit mir telefoniert, bis sie sich sicher gewesen war, dass ich auf direktem Weg zu ihr fahren würde, auch wenn es inzwischen drei Uhr nachts war. Ihr Haus befand sich auf dem East Hill, wenige Meter neben Lukes, und lag nur eine kurze Fahrradfahrt von dem Wohnheim entfernt, das von nun an mein Zuhause sein würde. Luke hatte alles für mich in die Wege geleitet. Der einzige Grund, aus dem er eingewilligt hatte, mich unbeaufsichtigt leben zu lassen, war die Nulltoleranz des Wohnheims gegenüber Alkohol und Drogen – es gab tatsächlich eine Taschenkontrolle am Eingang – und die Tatsache, dass man ins System einchecken musste, sobald man das Gebäude betrat. Ganz nach dem Motto: »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser«.
Na gut, es gab noch einen zweiten Grund. Er wusste, dass ich den Job nicht angenommen und mich nicht bereit erklärt hätte, einen Neuanfang zu wagen, wenn ich bei ihm wohnte.
Soula und Luke waren befreundet – manchmal hatte ich sogar den Verdacht, dass sie mehr als Freunde waren –, doch am Anfang der Sponsorschaft hatte sie mir versichert, dass alles, was wir besprachen, unter uns bleiben würde. »In erster Linie bin ich deine Bezugsperson, Echo«, hatte sie gesagt. »Und er liebt dich mehr als sein eigenes Leben, aber er wird dich nie so verstehen, wie ich dich verstehe.«
Diese Worte waren dafür verantwortlich gewesen, dass ich ihr nach langem Hin und Her schlussendlich vertraut hatte. Und weswegen ich in diesem Moment die unangenehme Wahrheit aussprach.
»Ich hab Luke vorhin beim Abendessen bestohlen.«
Soula verzog keine Miene, während sie sich mit dem dampfenden Tee in ihrem Plüschsessel zurücklehnte. Hinter ihr hingen unzählige goldgerahmte Ikonen an der Wand, und in ihrem Wohnzimmer roch es immer ein bisschen nach Weihrauch. Meine Sponsorin war religiös. Griechisch-orthodox. Das war sogar schlimmer als katholisch, wenn man Luke Glauben schenken durfte. Vor langer Zeit war er selbst katholisch gewesen. Inzwischen hasste er sich dafür. Mir war die Konfession egal. Religion war Religion. Einer der vielen Gründe, aus denen es mit dem Vertrauen zu Soula eine ganze Weile gedauert hatte. Mum war religiös gewesen. Hatte sie am Ende auch nicht gerettet. Hatte eher uns beiden das Leben zur Hölle gemacht. Im wahrsten Sinne.
»Wie viel?«, wollte Soula wissen.
Ich wandte den Blick von den gruseligen Heiligenbildern ab und fixierte sie. Ihre welligen grauen Haare waren zu einem Dutt am Hinterkopf verknotet, ihr Gesicht war rund und aufgeschwemmt, die dunklen Augen ganz klein vor Müdigkeit. Sie trug einen lilafarbenen Bademantel, eine gepunktete Pyjamahose und glitzernde Pantoffeln.
»Dreißig Pfund.«
Sie nahm einen großen Schluck, als wäre sie immun gegen die Hitze. »Er wird es überleben. Wieso hast du es geklaut?«
Gerade noch so konnte ich mich vom Lachen abhalten. »Was glaubst du?«
Ihr Blick bohrte sich in meinen. »Am Telefon hast du gesagt, du hast nichts genommen.«
»Hab ich auch nicht. Aber ich hab was gekauft und es dann die Toilette runtergespült.«
»Siehst du.« Ihre Mundwinkel zuckten. »Nichts verkackt.«
»Das Geld ist trotzdem weg.«
»Dann gibst du es deinem Großvater schnellstmöglich zurück und entschuldigst dich. Du fängst doch morgen deinen Job an, oder nicht? Als Kellnerin bekommt man bestimmt Trinkgeld auf die Hand. Wenn du dich gut anstellst, hast du es bald zusammen.«
Ich würde mich nicht gut anstellen, das wussten wir beide.
»Könntest du …« Ich zögerte. »Könntest du es morgen nicht schon mal ersetzen, wenn du zum Kaffee bei ihm vorbeischaust? Ich zahle es dir zurück, sobald ich es zusammenhabe.«
»Netter Versuch.« Nun breitete sich ein richtiges Lächeln auf ihren Lippen aus. Es brachte ihr Gesicht zum Strahlen und lenkte beinahe von den eindeutigen Spuren ihres jahrelangen Drogenmissbrauchs ab. »Ich bin nicht deine Enablerin, Echo. Du wirst schon ehrlich sein müssen, wenn du willst, dass das hier funktioniert.«
»Enabler« war der Begriff für jemanden, der Leuten wie mir dabei half, die dreckigen Seiten ihrer Sucht zu verstecken. Ein Möglichmacher.
»Wer sagt, dass ich das will?«, murmelte ich in meine Tasse.
Sie verstand mich natürlich trotzdem.
»Die alte Echo hätte das Zeug nicht die Toilette runtergespült. Und sie hätte mich erst recht nicht angerufen. Die alte Echo hätte nicht gekämpft, wie du heute gekämpft hast.«
Ich verdrehte die Augen. Ihre Stimme wurde immer ganz heiser, wenn ihr etwas wichtig war. Normalerweise hasste ich es, wenn sie oder sonst jemand in meiner Nähe zu viele Emotionen zeigte. Am liebsten hätte ich ihr gesagt, dass ich nur von meinem Vorhaben abgebracht worden war, weil mich Alexis Bitherseas nackter Arsch aus dem Konzept gebracht hatte, nicht, weil ich stark war oder gekämpft hatte. Aber ich war zu müde für diese Diskussion.
»Du kannst hier schlafen«, fuhr sie in normaler Tonlage fort und deutete überflüssigerweise aufs Sofa, auf dem ich saß und das sie bereits mit rot-weiß geblümter Bettwäsche bezogen hatte. »Du musst morgen erst um zwölf im Restaurant sein, richtig?«
»M-hm.«
»Gut. Ich fahre dich. Wenn du dich gleich hinlegst, bekommst du immer noch genug Schlaf, um fit in deinen ersten Arbeitstag zu starten.«
Ich verzog das Gesicht. Falls ich es schaffen würde einzuschlafen.
»Ich bin stolz auf dich, Echo.«
»Halt die Klappe«, entfuhr es mir.
Ihre Brust vibrierte, und bevor ich eine Entschuldigung hervorwürgen konnte, brach ein kehliges Lachen aus ihr hervor. »Du kleines Arschloch.«
Jetzt musste ich auch lachen. So hatte sie mich bei unserem Kennenlernen genannt. Es war eins meiner ersten NA – Narcotics Anonymous – Treffen gewesen und für sie vermutlich das tausendste. Nach ein, zwei widerwillig rausgequetschten Sätzen meinerseits bei der Vorstellungsrunde hatte sie mich am Ende, als die meisten schon gegangen waren, am Ausgang abgefangen und gefragt, ob ich noch eine Sponsorin brauchte.
»Lern erst mal richtig Englisch«, hatte ich sie angefahren. Und es bereits Sekunden später bereut. Aber Soula hatte nur hämisch gelacht. »Du denkst, damit kannst du mich beeindrucken, du kleines Arschloch?«, hatte sie gekontert. »Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe?«
Ab diesem Moment hätte mir eigentlich klar sein sollen, dass wir eines Tages Freundinnen werden würden.
Als wir uns wieder beruhigt hatten, sah sie mich mit ernster Miene an. »Machst du dir Sorgen wegen morgen?«
»Nicht wirklich.«
Mit ihrem bescheuerten Röntgenblick starrte sie mich nieder, bis ich mich seufzend ergab.
»Ich habe eine Scheißangst.«
»Wovor?«
»Du weißt wovor.«
»Ich will es dich sagen hören.«
Nur zu gerne hätte ich sie beleidigt. Stattdessen schluckte ich die Wut herunter. »Ich habe Angst, Luke einmal zu oft zu enttäuschen. Ich habe Angst vor dem Job. Ich habe Angst, die einfachsten Sachen nicht auf die Reihe zu bekommen. Ich habe Angst, dass alle merken, was für eine Versagerin ich bin. Ich habe Angst, gut darin zu sein, Erfolg zu haben, es zu mögen und dann rückfällig zu werden und es zu verlieren.« Ich holte tief Luft. »Aber hey, immerhin habe ich keine Angst davor, dass Alexis Bithersea ausplaudert, mich im Fever gesehen zu haben.«
Von der Begegnung mit Alexis hatte ich Soula vorhin am Telefon erzählt, und sie hatte mir bestätigt, dass der jüngste Sohn der Bitherseas nicht sprach – zumindest so gut wie nie, und wenn, dann auch nur mit Leuten, die nicht zu seiner Familie gehörten. Sie hatte keinen engen Kontakt mit Alexis’ Mutter und meiner zukünftigen Arbeitgeberin Thea Bithersea, da diese ihr zufolge die Flucht ergriff, sobald sie Soula sah. Die beiden waren die einzigen Griechinnen in der Stadt, und Thea wollte aus irgendeinem Grund nichts mit ihrer Herkunft zu tun haben, was anscheinend andere Leute aus Griechenland einschloss. Aber Soula hatte genug Bekannte in Goldbridge, die Kontakt zu Theas Familie hatten. Die Gerüchte machten überall die Runde.
»Okay«, erwiderte sie nach einer Weile. »Das sind alles nachvollziehbare Ängste. Mir würde es ganz genauso gehen.«
»Aufmunternd wie immer, Soula«, gab ich ironisch zurück.
Ihre Augen funkelten amüsiert. »Wenn ich dich aufzumuntern versuche, reißt du mir den Kopf ab.«
Wo sie recht hatte …
»Wegen einer Sorge kann ich dich allerdings beruhigen: Luke wirst du niemals so sehr enttäuschen können, dass er dir nicht mehr verzeiht. Außer du kratzt ab, natürlich. Ich kann dir versichern, das würde er dir niemals verzeihen.«
Ein hohles Lachen entfuhr mir. Ich liebte es, dass sie kein Problem damit hatte, solche Dinge vor mir auszusprechen, während die meisten Menschen in meiner Gegenwart vor dem Thema Tod zurückschreckten, seit das mit meiner Mutter passiert war.
»Danke. Ich glaube, ich werde jetzt versuchen zu schlafen.«
»Immer gern.« Sie trank ihren Tee aus. »Und ich werde erreichbar sein, wenn du mich brauchst. Du kannst dich jederzeit melden.« Mit einem Ächzen erhob sie sich. »Im Bad liegt eine neue Zahnbürste. Schlaf gut.«
»Du auch.« Mit einem unschuldigen Lächeln schaute ich zu ihr hoch. »Grüß den lieben Herrn von mir.«
Das quittierte sie lediglich mit einem Seufzen, ehe sie mir den Rücken zukehrte und die Treppe nach oben schlurfte. Wahrscheinlich war sie langsam zu müde für Blödsinn. Schließlich hatte ich sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen.
»Danke«, flüsterte ich, sobald sie außer Hörweite war. »Danke, dass du für mich da bist, obwohl ich die größte Loserin bin.«
Am Anfang hatte ich das getan, was alle taten, wenn sie zum ersten Mal an einer Selbsthilfegruppe teilnahmen: Ich hatte mich mit Soula und allen anderen verglichen und mir selbst versichert, dass sie erbärmlicher als ich waren, im Gegensatz zu mir ein echtes Problem hatten, dass ich auf keinen Fall mit ihnen in einen Topf geworfen werden konnte, da ich, anders als sie, mein Leben unter Kontrolle hatte. Doch mit jedem weiteren Rückfall war die Wahrheit weiter aus den Tiefen meines Unterbewusstseins hervorgekrochen und schließlich allgegenwärtig geworden.
Ich war wie meine Mutter. Immerhin hatte sie mir meinen Namen aus gutem Grund gegeben. Sie war die Erbärmlichste von allen gewesen, und ich würde nie etwas anderes als ihr Widerhall sein.
4. KAPITEL Alexis
Darker in the day than the dead of night
»Wieso bist du schon wach?«
Vasile beobachtete mich mit verschränkten Armen und gerunzelter Stirn, als ich aus dem Aufzug trat und in Richtung Ausgang lief. Es war kurz nach sechs und damit selbst für meine Verhältnisse früh, zumal ich erst gegen drei ins Bett gekommen war. Aber ich hatte heute die perfekte Ausrede.
Seine Verwirrung wich der Vorfreude, sobald er die weiße Box in meinen Händen erkannte.
»Das ist nicht nötig, Kleiner, wie oft denn noch? Du hast deine Schuld längst beglichen.«
Wir waren gleich groß, um die eins fünfundachtzig, aber er war ungefähr doppelt so breit wie ich, was ihm wohl das Recht gab, mich als klein zu bezeichnen. Das und die Tatsache, dass er zwanzig Jahre älter als ich war.
Lächelnd drückte ich ihm die Box in die Hand. Darin befanden sich wie immer süße Kreationen, die ich ihm zum Probieren mitgebracht hatte. Diesmal waren es Cupcakes in den Geschmacksrichtungen Salted Caramel, Pistazie und Vanille-Macadamia, meine übrig gebliebenen Testkuchen für die mehrstöckige Torte, die ich heute fertigstellen würde. Eigentlich hatte ich sie ihm gestern Abend nach meiner Schicht geben wollen – ich fühlte mich besser, wenn ich im Voraus »bezahlte«, nicht erst im Nachhinein mit dem Zeug anrückte –, aber ich hatte zu spät Feierabend gemacht, und er war nicht mehr auf seinem Posten gewesen, als ich ins Wohnheim eingecheckt hatte.
Vasile war unser Hausmeister, und wir hatten den Deal, dass ich sein Auto benutzen durfte, wenn er es nicht brauchte. Sprich: Wenn es im Hof stand. Ich hätte auch das Auto meiner Eltern oder den Lieferwagen unseres Familienrestaurants nehmen können, aber dann hätte ich mir den Trip genauso gut sparen können. Ich brauchte ein Auto, um an Orte zu gelangen, an denen nicht alle Leute Bescheid wussten, was für ein bemitleidenswerter Kerl ich war. Ich brauchte ein Auto für ein paar Stunden Freiheit.
»Alles gut bei dir, hm?« Vasile legte mir die freie Hand auf die Schulter und drückte leicht zu.
Augenblicklich versteifte ich mich, beeilte mich aber zu nicken. Er sollte nicht denken, dass ich mich unwohl in seiner Gegenwart fühlte. Ich war ihm wirklich verdammt dankbar für alles. Im Gegensatz zu den anderen Bewohnern Goldbridges hielten sich seine Kommentare zu meinem Zustand in Grenzen, und er behandelte mich ganz normal, auch nachdem er mir vor ein paar Monaten eines Nachts im dunklen Flur auf dem dritten Stock, in dem mein Zimmer lag, begegnet war und ich eine meiner berühmten Panikattacken bekommen hatte.
Hastig zog ich mein Handy hervor, entsperrte es und klickte auf meine Galerie, wo ich meine Skizze der Torte abgespeichert hatte. Ich drehte das Display in seine Richtung.
Seine hellgrünen Augen weiteten sich, und er ließ seine Hand sinken.
Erleichterung durchflutete mich. Ich hatte kein Problem mit Körperkontakt. Solange ich ihn selbst initiierte.
»Sieht ja irre aus! Sag bloß, das ist die Torte für Lucindas Tochter? Also stimmt das Gerede?«
Mein Lächeln wurde breiter. »Es stimmt.«
Lucinda war die Besitzerin der Cornish Bakery Naughty & Nice, die sich genau wie das Prisma hier in der Straße befand, und ihre Tochter Ann hatte erst letztes Jahr einen reichen Typen aus Dublin geheiratet. Für die Hochzeit hatte ich eine fünfstöckige Torte kreiert, an der ich tagelang gearbeitet und die dem Prisma eine saftige Summe beschert hatte. Jetzt, kaum ein Dreivierteljahr später, hatte Ann eine neue Bestellung bei uns aufgegeben. Wieder sollte es eine fünfstöckige Torte sein – diesmal für ihre Scheidungsparty.
Vasile prustete los, sodass sein massiger Körper bebte. »Die haben wirklich einen Knall. Aber was soll’s – gut fürs Prisma und für dich. Dir macht so was bestimmt Spaß, oder?«
»M-hm.«
In meiner Kochausbildung an der Ashburton Cookery School hatte ich mich aufs Konditorhandwerk spezialisiert und schließlich den Patisserie-Bereich im Prisma, dem Restaurant meiner Familie, übernommen. Der Job war meine Leidenschaft, doch inzwischen konnte ich die Desserts auf unserer Speisekarte im Schlaf zubereiten, also war jede ausgefallene Bestellung eine willkommene Abwechslung. Außerdem: Mehr berufliche Herausforderungen bedeuteten, ich musste mich weniger mit dem Scheiß um mich herum auseinandersetzen.
Ich straffte die Schultern und steckte das Handy weg.
Vasile hatte den Blick wieder auf mich gerichtet. Seine dunklen buschigen Augenbrauen zogen sich zusammen. Was jetzt folgen würde, würde mir nicht gefallen. Ich konnte es förmlich spüren.
Raus hier. Schnell. Bevor es zu spät war.
Ich wollte mich gerade in Bewegung setzen, doch es war zu spät.
»Dein Vater«, raunte Vasile. »Also, ich wollte … Ich …«
Halt die Klappe! Halt einfach deine dumme Klappe!
Das wollte ich ihm entgegenbrüllen. Diesem Menschen, der von Anfang an ausschließlich nett zu mir gewesen war. Der keinen blassen Schimmer hatte, was er mit seinen Worten in mir auslöste. Aber natürlich brachte ich nichts hervor. Meine Stimme hatte mich genau in solchen Situationen bereits vor langer Zeit im Stich gelassen, und sie würde sich garantiert nicht jetzt auf meine Seite schlagen. Das war mein Schicksal.
Natürlich rührte ich mich auch nicht von der Stelle, statt schnellstmöglich das Weite zu suchen.
»Ich wollte nur sagen, dass es mir leidtut. Es muss hart für dich … für deine ganze Familie sein. Es ist jetzt schon über einen Monat her, nicht? Falls ich irgendetwas für dich tun kann, Alex …«
Hitze durchfuhr mich. Dann Kälte. Dann wieder Hitze.
Vasile hatte es mitbekommen. Er hatte mitbekommen, wie mein Vater Abend für Abend ins Wohnheim gekommen war und es erst spätnachts wieder verlassen hatte. Man musste schließlich einchecken, wenn man hier rein wollte.
Das Wohnheim war für die Prisma-Mitarbeiter eine günstige Alternative zu den meist überteuerten Stadtapartments, aber es war auch immer schon ein kleines Gefängnis gewesen, weil die Mitarbeiter nicht unbedingt die vertrauenswürdigsten Menschen waren. Es gab hier strenge Regeln. Mich hatten sie nie gestört. Alles war besser, als noch einen weiteren Tag bei meinen Eltern zu wohnen, hatte ich damals gedacht. Sie hatten pausenlos gestritten. Tja, und dann war ich im Frühjahr letzten Jahres hier eingezogen und eines Besseren belehrt worden. Wäre ich zu Hause geblieben, wäre vermutlich alles anders gekommen. Wäre ich zu Hause geblieben, hätte ich nie herausfinden müssen, was für ein beschissener Schwächling ich war.
»Hey, sorry, ich lass dich damit in Ruhe«, ertönte Vasiles Stimme wie aus weiter Ferne.
Sein Gesicht verschwamm vor meinen Augen. Zu spät. Der Schaden war bereits angerichtet.
Was ich gesagt hätte, hätte ich eine Wahl gehabt: Es ist nicht hart, weil er weg ist, es ist hart, weil er eines Tages zurückkommen wird. Deine Hilfe brauche ich jetzt auch nicht mehr – ich hätte sie gebraucht, als er Nacht für Nacht ins Wohnheim kam und mich wie seinen Scheißkumpel, nicht wie seinen Sohn behandelt hat. Du hast es mitbekommen und nichts getan. Warum hast du nichts getan? Ich weiß, es war nicht deine Verantwortung. Aber war es meine?
»Es tut mir leid«, sagte Vasile, jedes Wort schmerzverzerrt. Er trat einen Schritt zurück und hob die Box in die Höhe. »Die werde ich mir gleich zum Frühstück gönnen.«
Ich konnte nicht lächeln. Ich wünschte mir, es zu können. Aber ich war zu beschäftigt damit, nicht schon wieder ein Drama vor ihm zu veranstalten.
In meinem Kopf führte ich eine Liste darüber, wie viele Ausraster ich mir schon bei den Leuten in meinem Umfeld geleistet hatte. Je mehr es waren, desto mehr musste ich mich zusammenreißen. Nicht dass das sonderlich gut funktionierte. Aber der Wille zählte, oder? Jedenfalls hatte mich Vasile schon entschieden zu oft so erlebt.
Atmen. Einfach atmen.
Leider war nichts an den Dingen, die den meisten Menschen leichtzufallen schienen, einfach für mich. Atmen. Sprechen. Normal sein.
»Hast du Mic gesehen? Hat sie schon Futter bekommen?«
Das war es.
Sobald der Name unserer geheimen Wohnheimkatze fiel, trat die Schwere für einen Augenblick in den Hintergrund. Vasile und ich waren die Einzigen, die von ihrer Existenz wussten. Zumindest nahmen wir das an. Bestimmt hatten sie schon mehrere Bewohner auf den Fluren herumstreunen sehen. Ich hatte die Kleine vor einem Monat blutend neben unseren Mülleimern gefunden. Vasile hatte sie Mic getauft und zum Tierarzt gebracht, und jetzt fütterten wir sie trotz des ausdrücklichen Tierverbots im Wohnheim in meinem Zimmer und hatten sogar einen Kratzbaum und ein Katzenklo für sie besorgt. Seitdem schaute sie immer wieder bei mir vorbei.
Ich nickte. Und endlich schaffte ich es, ein wenig die Mundwinkel zu heben.
»Gut.« Er erwiderte mein Lächeln, wenn auch besorgt. »Dann mache ich mich mal auf die Suche nach ihr.« Und damit wandte er sich von mir ab.
Das war mein Zeichen. Endlich schaffte ich es, mich in Bewegung zu setzen.
Als ich durch die Drehtür nach draußen trat, erwarteten mich die salzige Meerluft und ein dunkelblauer Himmel, der bestimmt noch eine gute halbe Stunde brauchte, um aufzuhellen. Kein Mensch war auf der Straße zu sehen, die bunten Häuserfassaden wirkten grau, durch das Licht der Straßenlaternen wurden unheimliche Schatten auf den Asphalt geworfen.
Die Nächte waren mir deutlich lieber als die Tage. Nachts war ich jemand anderes. Ich konnte tanzen, manchmal sogar lachen, aber vor allen Dingen konnte ich neue Menschen kennenlernen und mich in ihnen verlieren. Tagsüber war ich nur eines: der jüngste Bithersea-Sohn – traumatisiert, zerbrechlich, stumm.
5. KAPITEL Echo
Head down, hands up
Luke hatte sein bestes Hemd angezogen und sich sogar seine graue Zottelmähne gekämmt. Ein äußerst ungewöhnlicher Anblick. Außerdem strahlte er über beide Backen.
»Das wird toll, glaub mir. Wenn du möchtest, komme ich noch mit hoch, dann können wir das Einführungsgespräch mit Thea zusammen ...«
»Nein.« Scheiße. Meine Stimme klang viel zu hart. »Nein, danke.« Ich lächelte. Es fühlte sich wie eine Grimasse an.
Luke hatte schon vor dem Prisma gewartet, als ich angekommen war, obwohl ich selbst eine Viertelstunde zu früh dran war – dabei hatte ich mich sogar noch im Wohnheim umgezogen. Aber so, wie ich ihn kannte, lungerte er schon seit mindestens einer Stunde hier rum. Soula hatte mir mehrfach angeboten, mich zu fahren, aber ich hatte abgelehnt. Hätte Luke mich aus ihrem Auto steigen sehen, wäre ihm sofort klar gewesen, dass der gestrige Abend nicht wie geplant verlaufen war …
»Du bist bereit dafür«, fuhr er fröhlich fort. »Das wird dir guttun. Du hast hart gekämpft und es schon so weit geschafft. Ich glaube an dich.«
Mir war schlecht. Nicht nur, weil ich gleich durchs Eingangstor und die Treppen nach oben in diesen Schickimicki-Laden laufen musste, zu dem ich ungefähr so gut passte wie die weiße Bluse und die schwarze Businesshose zu mir. Sondern weil sich Lukes ganzer Stolz gleich in Luft auflösen würde.
Ich sah mich um. Pastellfarbene Häuser. Hügel. Der hübsche Teil Goldbridges. Schäfchenwolken am blaugrauen Himmel. Ein paar Möwen, ein paar Autos, ein paar Fußgänger – Letztere allerdings nicht in Hörweite. Also holte ich tief Luft und würgte die Worte hervor.
»Ich habe gestern Geld aus deiner Jackentasche genommen.«
Stille. Nur das Rauschen des Meeres und die quietschenden Reifen eines Autos waren zu hören.
Weiter. Schlimmer wird’s nicht. Hau’s einfach raus.
»Es tut mir leid. Ich werde dir das Geld zurückgeben, sobald ich es verdient habe, das schwöre ich dir. Ich war gestern Nacht noch im Club. Bin direkt von dir dort hingefahren, statt wie abgemacht ins Wohnheim zu gehen. Hab mir was gekauft, es aber nicht genommen, sondern das Klo runtergespült, Soula angerufen und bei ihr gepennt. Das Geld ist trotzdem weg. Tut mir leid.«
Luke lächelte nicht mehr. Da war etwas Intensives in seinem Blick. Das Graublau seiner Augen verflüssigte sich. Bevor ich mir einen Reim darauf machen konnte, war er einen Schritt auf mich zugetreten und hatte mich in eine feste Umarmung geschlossen. Der Duft nach Holzspänen, starkem Espresso und Leder stieg mir in die Nase.
Obwohl alles in mir sich dagegen wehrte, stellte ich mich auf die Zehenspitzen und schlang ihm meine Arme um den Hals. Ein paar Sekunden erlaubte ich ihm, mich zu halten. Ein paar Sekunden genoss ich die Wärme und die Illusion, dass ich eine ganz normale Enkelin war, die ihren Grandpa umarmte.
»Danke«, flüsterte er.
Ich wich zurück. »Was?«
Er blinzelte viel zu oft. »Du hast mir diesen Mist noch nie von dir aus erzählt. Ich musste es immer selbst herausfinden.«
Ein ungläubiges Lachen entwich mir. »Juhu, eine Runde Applaus für mich. Ich bin so ein guter Mensch.«
»Der beste, den ich kenne«, erwiderte er ernst.
Mein Inneres zog sich zusammen. Ich wollte das nicht. Ich ertrug es nicht. Nicht von ihm. Nicht von dem Menschen, der mir bereits Millionen Chancen gegeben hatte, obwohl ich nicht mal die zweite verdient hätte.
»Dann kennst du echt viele Nullen.«
Seine Mundwinkel zuckten, doch er schien das Lächeln zurückzuhalten. »Unter normalen Umständen würde ich sagen, vergiss das Geld, aber ich habe genau wie du dazugelernt. Also würde ich mich freuen, wenn du es mir schnellstmöglich zurückzahlst.«
Luke hatte an unzähligen Beratungskursen für Angehörige von Suchtkranken teilgenommen und mich auch schon zu NA-Treffen begleitet. Außerdem tauschte er sich mit Soula aus.
»Unser Verhalten hat Konsequenzen«, hatte sie mal gesagt. »Das dürfen wir nie vergessen. Und wenn unsere Liebsten uns dabei helfen, die Konsequenzen auszulöschen, dann helfen sie nicht uns, sondern unserer Sucht.«
Deshalb hatte sie auch darauf bestanden, dass ich Luke meinen Diebstahl beichtete.
Ich nickte. »Das werde ich. Versprochen.«
Nun lächelte er wieder, gab mich frei, tippte mir einmal auf die Nasenspitze und nickte in Richtung Prisma. »Na, los, hau ab. Du willst an deinem ersten Tag nicht zu spät sein. Grüß Thea von mir.«
»Mach ich.«
Blitzschnell wandte ich mich von ihm ab und lief durchs Eingangstor.
Das war zu einfach gewesen. Viel, viel zu einfach. Aber ich würde mir später noch den Kopf darüber zerbrechen können. Jetzt musste ich meine ganze Energie in meine Außenwirkung stecken.
Es war nicht mein erster Job. Zwar hatte ich keinen Schulabschluss, da ich im Abschlussjahr irgendwann aufgehört hatte, zum Unterricht zu gehen, aber ich war einundzwanzig Jahre alt und hatte die letzten drei Jahre nicht ausschließlich mit Süchtig-, Clean- und Rückfälligwerden verschwendet. Da waren Aushilfsjobs an der Tankstelle, im Tesco, in einer Cornish Bakery gewesen. Gut, länger als ein paar Wochen hatte ich nie durchgehalten, aber immerhin hatte ich eine ungefähre Ahnung davon, was mich erwartete. Egal, in was für ein Arbeitsumfeld ich kam, es fühlte sich an wie eine Wiederholung meiner Schulzeit. Zähne zusammenbeißen, versuchen so auszusehen, als wüsste ich, was ich tat, schnellstmöglich die Sozialhierarchie analysieren, mich gleich zu Beginn mit denen, die was zu sagen hatten, anlegen, damit sie kapierten, dass ich keinen Schiss vor ihnen hatte, und mich dann an die Person hängen, von der am wenigsten Mobbinggefahr ausging, damit ich meinen Seelenfrieden hatte. Mit der Strategie war ich bisher ganz gut gefahren.
Okay, das war Bullshit. Mit der Strategie hatte ich mich in trügerischer Sicherheit gewogen, bis ich den Weg zurück zu den Drogen fand. Aber zumindest das Zähnezusammenbeißen und Faken würde ich auch im Prisma anwenden können.
Ich nahm die in den Fels eingelassenen Stufen nach oben, und mit jedem Schritt beschleunigte sich mein Herzschlag. Das Restaurant befand sich in einer Grotte mit Terrasse zum Meer hin, und ich war mir jetzt schon sicher, dass es der edelste Ort war, den ich je betreten hatte und würde.
Fuck, das war eine schlechte Idee – was mir von Anfang an klar gewesen war. Wiedereingliederung in einen normalen Alltag, schön und gut, aber nichts hier hatte mit meinem Alltag zu tun.
Ich schaute zurück. Luke stand nach wie vor an der Straße und reckte nun zwei Daumen in die Höhe, während er mich aufmunternd angrinste.
Augenrollend wandte ich mich ab, lief weiter.
»Ja, es ist suboptimal, wenn du bei der Arbeit mit Alkohol in Berührung kommst«, hatte er gesagt, als er mir zum ersten Mal von dieser »tollen Gelegenheit« erzählt hatte. Wir wussten beide, dass das Angebot viel zu gut war, um es auszuschlagen. Nirgendwo sonst würde man einem Junkie ohne Abschluss einen Job in einem Sternerestaurant anbieten. »Aber ich habe mit Thea gesprochen, und sie hat mir versichert, dass es kein Problem sein wird. Sie wird alles dafür tun, dir den perfekten Neuanfang zu ermöglichen.«
Thea konnte nicht ganz bei Trost sein. Ich kannte sie nur vom Sehen – in diesem Kaff kannte jeder jeden zumindest vom Sehen –, aber das letzte Mal, dass wir uns begegnet waren, war Ewigkeiten her. In meinem Kopf war sie damals nur als Alexis’ Mum abgespeichert gewesen. Wenn man selbst Versagereltern hatte, achtete man genauer auf die seiner Klassenkameraden. Insgeheim vermutete ich, dass Luke Thea bestochen hatte, mir diesen Job zu geben. Er hatte mir erzählt, dass es im Restaurant gerade nicht besonders gut lief, aus welchem Grund auch immer. Tja, mit mir im Team würde es bestimmt noch viel grandioser laufen.
Ich war in einem spärlich beleuchteten Felsgang angekommen. Kleine grüne Lichtpunkte waren in den Stein über mir eingelassen. Am Ende des Gangs erwartete mich eine weitere Treppe und oben eine gläserne Eingangstür.
Mein bescheuertes Herz wollte nicht zur Ruhe kommen. Dabei hatte ich schon so viel Schlimmeres überlebt. Das hier war im Vergleich nichts.
Sobald ich die Glastür geöffnet hatte und mich auf der hölzernen Restaurantfläche wiederfand, erstarrte ich. Es war wirklich deutlich zu schick.
Die Tische waren rund mit schneeweißem Gedeck. Auf jedem stand ein kleiner Herbststrauß in verschiedenen Orangetönen. Vorne links führte ein Absatz die Klippe entlang, wo weitere Tische standen, dahinter kam das dunkelblaue, heute stürmische Meer zum Vorschein. Laternen hingen über den Tischen, und die Felswände schimmerten in einem subtilen Türkis.
Bevor ich die Nerven verlieren konnte, kam mir eine bekannte Gestalt in weißer Schürze entgegen. Rostrote Locken, zu einem hohen Zopf gebunden, Sommersprossen, Brille, hellblaue, in diesem Moment geweitete Augen.
Tori.
Als ich sie vor etwa drei Monaten eines schönen Sommermorgens – schön für mich, weil ich bekifft gewesen war – an einem der hässlicheren Strände Goldbridges aufgegabelt hatte, war sie alles andere als glücklich gewesen. Sie hatte den Eindruck gemacht, als würde sie sich jeden Moment in Luft auflösen wollen. Wie war das noch mal gewesen? Ah ja, sie war vor ihrem manipulativen Ex geflüchtet und spontan nach Goldbridge gekommen. Ein paarmal waren wir uns in der Stadt begegnet, und einmal hatte ich sie mit Julian Bithersea – Alexis’ älterem Bruder – gesehen, aber ich hatte keine Ahnung gehabt, dass sie ausgerechnet im Prisma arbeitete. Verdammt. Das war’s dann mit meinem Neuanfang. Sie wusste von meiner Vergangenheit. Hatte mich mehrmals high erlebt. Und ich hatte echt viel von meinem Leben ausgeplaudert.
Tori erholte sich schneller von der Überraschung als ich.
»Echo?«, quietschte sie voller Begeisterung.
Hätte ich gerade nicht deutlich größere Sorgen gehabt, hätte ich laut aufgestöhnt. Sie klang so hoffnungsvoll.
»Hi.«
Blitzschnell scannte sie mich von oben bis unten. Als Verwirrung über ihr Gesicht zuckte, versetzte es mir einen Stich. Jep, den Neuanfang konnte ich mir definitiv abschminken. Ich passte hier nicht rein. Ganz im Gegensatz zu Leuten wie Tori.
»Was machst du denn hier?«
Ich bin zum Arbeiten hier, aber ich glaube, ich habe es mir anders überlegt. Cool, dich wiederzusehen. Bis dann. Ciao.
»Wie geht’s dir?«
Beschissen, und dir?
Abhauen war keine Option. Luke würde immer noch draußen warten. Ich kannte ihn. Und er kannte mich. Er wusste, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass ich einen Rückzieher machte. Der einzige Weg war vorwärts. Also musste eine neue Strategie her.
Ich könnte sie am Handgelenk packen und auf die Straße zerren.
Nein. Wenn sie meine Kollegin war, dann durfte ich es mir nicht gleich mit ihr verscherzen. Zwar hatten wir uns recht gut verstanden, aber keine Ahnung, wie gut mein Urteilsvermögen vor ein paar Wochen funktioniert hatte. Immerhin war ich alles andere als nüchtern gewesen.
»Kommst du kurz mit in den Gang?«, flüsterte ich.
Zu meiner Erleichterung nickte sie sofort.
Ich drehte mich um, stieß die Glastür auf und eilte die Treppenstufen wieder nach unten. Ihre Schritte erklangen hinter mir. Erst als ich im Felsgang war, drehte ich mich zu ihr um.
Ihre Miene war ernst.
»Ich wusste nicht, dass du im Prisma arbeitest«, brachte ich hervor. »Sonst hätte ich Luke gleich gesagt, dass es eine ganz dumme Idee ist, hier anzufangen.«
Als hätte ich das nicht so oder so gesagt …
Tori runzelte die Stirn. »Wieso?«
»Niemand soll wissen, dass ich … Also … du erinnerst dich an die Sache mit den Sternschnuppen?«
»Ich saß neulich eine ganze Nacht lang hier und habe auf Sternschnuppen gewartet«, hatte ich ihr bei unserem Kennenlernen erzählt. »Wenn ich drei hintereinander seh, habe ich mir gesagt, dann versuch ich noch mal, clean zu werden.«
Erkenntnis zuckte über ihr Gesicht. »Niemand?«
»Thea weiß es natürlich. Aber die Abmachung war, dass es sonst niemand erfährt. Damit ich hier … normal sein kann.«
Meine Güte, wie armselig ich klang. Als würde mir jemals irgendjemand abnehmen, dass ich normal war.
Doch Toris Miene wandelte sich plötzlich. Ihr Blick glühte geradezu. »Von mir wird es niemand erfahren. Das schwöre ich. Jeder Mensch verdient einen Neuanfang.« Bevor ich ihr mit Misstrauen begegnen konnte, strahlte sie mich an. »Ich freu mich so sehr, dass du hier anfängst! Ich hab mir schon Sorgen gemacht, weil ich dich seit Wochen nirgendwo mehr gesehen habe. Klar, das liegt daran, dass ich nicht mehr im Seascape Inn wohne, ich bin ins Mitarbeiterwohnheim gezogen, aber trotzdem … Es ist wirklich schön, dich zu sehen.«
Okay. Unerwartet. Die Vorstellung, dass sie tatsächlich Ausschau nach mir gehalten hatte, war seltsam. Es fühlte sich ungefähr so übelkeitserregend wie Lukes und Soulas Stolz an. Wie ich diesen Mist hasste.
Schnell ablenken.
»Dann sind wir anscheinend schon wieder Nachbarinnen.«
Sie riss die Augen auf. »Du wohnst in der Nähe des Wohnheims?«
»Ich wohne seit heute im Wohnheim. Hab sogar ein Zimmer. Nicht nur ’nen Schlafsack auf dem Parkplatz.«
»O mein Gott, ist das cool! Wir werden so viel Spaß haben.« Damit hakte sie sich bei mir unter und lotste mich wieder in Richtung Restaurant.
»Wer bist du und was hast du mit meiner lebensmüden Strandbekanntschaft gemacht?«, murmelte ich.
Ein freies, losgelöstes Lachen erklang, das kein bisschen zu der Version von ihr passte, die ich in Erinnerung hatte.
»Wie oft muss ich dir noch sagen, dass ich noch nie lebensmüde war?«, gab sie zurück. »Und hey, du siehst auch nicht unbedingt wie die Echo aus, die ich zuletzt gesehen habe.«
»Will ich doch hoffen. Sonst wäre Lukes Geld wirklich für den Arsch gewesen.«
Die Entzugsklinik war nicht gerade billig. Dummerweise gab es auch keinen Mengenrabatt, wenn man zum dritten Mal dort aufkreuzte. Dafür zunehmend angepissteres Personal. Es war mir wirklich schleierhaft, wie man tagein, tagaus mit Süchtigen arbeiten und immer noch enttäuscht reagieren konnte, wenn eine von ihnen zurückkehrte.
Als wir am Fuß der Treppe angekommen waren, ließ Tori mich los.
»Was ist unsere Story?«, raunte sie verschwörerisch.
»Hä?«
»Wie haben wir uns kennengelernt? Oder soll ich tun, als würde ich dich heute zum ersten Mal sehen?«
»Das kann nur peinlich für dich werden. Ignorier mich einfach, das ist besser für dich, glaub mir. Keine Sorge, ich werde mich nicht an dich hängen oder irgendetwas von dir erwarten oder so.«
Verständnislos sah sie mich an.
Ich seufzte. Waren wir mal ehrlich, selbst wenn niemand von den anderen Mitarbeitern von meiner Liebe zu Drogen wusste, würde ich eindeutig die größte Loserin im Laden sein. Jeder, der sich mit mir abgab, würde ebenfalls als Loser betrachtet werden.
Tori wirkte plötzlich beinahe ein wenig wütend. »Ich werde sagen, dass wir uns bei deinem Einzug ins Wohnheim kennengelernt haben«, verkündete sie nach ein paar Sekunden entschlossen.
»Du checkst es nicht, oder?«, zischte ich. Wir waren inzwischen auf der Hälfte der Treppe angekommen und beide stehen geblieben. »Ich bin nicht wie du. Ich komme nicht aus deiner hübschen Welt. Du bist abgehauen, weil dein Ex ein krankes Arschloch war, nicht, weil du selbst ein absolutes Desaster ...«
Ihre Augen funkelten. »Du erinnerst dich an meinen Ex. Und daran, was für ein Arschloch er ist.«
»Ich war in einer Entzugsklinik. Ich habe nicht mein Gedächtnis verloren. Der Typ war zehn Jahre älter als du und dein Chef. Also bitte.«
Erst lachte sie, dann schüttelte sie den Kopf. »Wir kommen nicht aus derselben Welt. Aber hier spielt das keine Rolle, okay? Es ist egal, wer du zuvor warst. Im Prisma kannst du sein, wer du willst.«
Ich war drauf und dran, ihr entgegenzuschleudern, dass sie keinen Schimmer hatte, wovon sie da sprach, doch in diesem Moment flog die Glastür über uns auf. Ich war zu beschäftigt mit Tori gewesen, um darauf zu achten, wer uns vielleicht beobachten könnte.
»Hier bist du!«, rief die junge Frau. Sie hatte schwarzes glattes Haar, ebenfalls zu einem Zopf gebunden, einen Pony, der ihr bis kurz über die geschwungenen Augenbrauen reichte, und in ihren Ohren funkelten mehrere Ohrringe. Genau wie Tori trug sie eine weiße Schürze.
»Oh, hi Darcy«, gab Tori fröhlich zurück. »Das hier ist Echo. Sie wohnt auch im Wohnheim und fängt heute neu bei uns an. Echo – Darcy.«
In dem Moment, in dem sie den Namen aussprach, dämmerte es mir. Darcy Gruber war wie ich in Goldbridge aufgewachsen und zusammen mit Julian zwei Klassenstufen über Alexis und mir gewesen. Zu Beginn hatte ich sie für Geschwister gehalten, weil sie Julian äußerlich ähnelte und die beiden ständig miteinander rumhingen, aber es hatte sich herausgestellt, dass die Bitherseas drei Söhne hatten. Der Älteste arbeitete im Gegensatz zu seinen Brüdern nicht im Familienrestaurant, soweit ich wusste.
»Hey.« Darcy lächelte mich an und legte den Kopf schief. »Kenne ich dich nicht irgendwoher?«
Ein Lächeln gelang mir nicht, allerdings klang meine Stimme wieder relativ normal, als ich antwortete. »Wir waren beide auf der St. Louis.«
»Ah, cool! Du warst dann wahrscheinlich eine Stufe unter mir, oder?«
»M-hm.«
Die Älteren erinnerten sich selten an die Jüngeren. Das war mein Glück. Goldbridge war keine besonders große Stadt, und auch wenn ich nach meinem Schulabbruch eine Weile abgetaucht war und die Normalos, deren Leben in geregelten Bahnen lief, nicht genau wussten, was aus mir geworden war, hoffte ich, dass die anderen im Team nicht auch alle aus Goldbridge stammten. Es war schlimm genug, dass Alexis hier arbeitete, der damals hautnah miterlebt hatte, wie erbärmlich ich war.
»Willkommen im Prisma-Team! Kellnerst du?«
»Ich … Ich glaub schon.«
Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, was ich tun würde. Ich wusste nur, dass ich es nicht in den Sand setzen durfte.
Apropos in den Sand setzen …
»Und ich bin spät dran«, fuhr ich hastig fort. »Ich sollte mit Thea sprechen. Wisst ihr, wo ich sie finde?«
»Fürchte dich nicht, ich bin mit dir«, wisperte eine kleine Stimme in meinem Kopf, während ich mich von ihnen durchs Restaurant führen ließ. »Weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.«
Ich ballte meine Hände zu Fäusten. Du mich auch, schoss ich in Gedanken zurück. Du mich auch, Mum.
6. KAPITEL Alexis
Black hole
Wollten mich eigentlich alle verarschen?
Sowohl Ginevra als auch Dani hatten sich krankgemeldet. Erstere war Auszubildende in der Patisserie, Letztere Springerin, sie half also überall dort aus, wo es nötig war. Beide hatten gewusst, dass heute die Bestellung fällig war. Die letzten Tage hatten wir damit verbracht, alles für die Torte vorzubereiten, hatten verschiedene Buttercremes, Basiskuchen und Verzierungen ausprobiert. Ich hatte kaum ein normales Dessert für einen Gast zubereitet. Nicht dass es viel Andrang gegeben hätte. Seit sich die Sommersaison dem Ende zuneigte, konnten wir nicht mehr auf Touristengruppen hoffen. Aber wie zur Hölle sollte ich die Bestellung heute allein fertigstellen? Ich brauchte jemanden, der meine Handgriffe vorhersehen konnte, der meine Arbeitsweise kannte.
Als hätte er meine Gedanken gehört, schneite im nächsten Augenblick Julian in den Patisserie-Bereich des Restaurants.
Hervorragend. Der hatte mir gerade noch gefehlt.
»Hi, Alex, alles gut bei dir? Ich hab dich heute noch gar nicht gesehen, aber Mum hat gesagt, du bist vor allen anderen da gewesen, stimmt das?«
Julian war der einzige Mensch aus meiner Familie, der nach wie vor mit mir redete, als würde ich antworten können. Manchmal machte mich das nur noch wütender, weil ich mir dadurch jedes Mal wie der größte Loser vorkam; manchmal war ich dankbar, denn damit gab er mir tausend Chancen, einfach draufloszureden, sollte ich eines Tages wieder in der Lage dazu sein.
Mit beiden Händen, an denen unzählige silberne Ringe funkelten, fuhr er sich durch die schwarzen zerzausten Haare. Seine Stimme klang betont fröhlich, aber ich hörte den besorgten Unterton heraus. Und die Distanz zwischen uns, die mit jedem Tag größer wurde. Es hatte eine Zeit gegeben, da war er ganz normal mit mir umgegangen. Und es hatte eine Zeit gegeben, da hatte ich keine unbändige Wut verspürt, wenn er den Raum betrat. Das lag nicht nur an Julian. Auf den Rest meiner Familie reagierte ich genauso. Mit Ausnahme von Nicolas, meinem ältesten Bruder. Aber der befand sich sowieso in einer ganz anderen Kategorie – und derzeit auch auf einem anderen Kontinent. Nic war seit Ewigkeiten nicht mehr in Goldbridge gewesen, weil er seinem Beruf als freier Fotograf nachging. Mit Abstand betrachtet, war das so ziemlich das Schlauste gewesen, was er hatte tun können. Der Glückliche hatte keine Ahnung vom Ausmaß unseres Familiendramas. Mir war das ganz recht. So gab es wenigstens eine Person, die mit mir verwandt war und mit der ich unbefangen kommunizieren konnte. Wir schrieben uns alle paar Tage, nichts besonders Tiefgründiges, aber er machte nie Anstalten, das zu ändern. Vermutlich war er genauso froh, dass ich ihn nicht nach seinem wahren Gemütszustand fragte, wie andersrum.
Ich richtete den Blick auf die Arbeitsfläche, wo ich gerade damit beschäftigt war, Buttercreme mit Kakao zu mischen. Wenn ich Julian lang genug ignorierte, würde er sich schon wieder verpissen.
»Hey«, erklang seine Stimme erneut, diesmal sanfter, was mich nur noch wütender machte. »Ich bin hier. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Draußen ist kaum was los.«
Ich presste die Lippen zusammen und widerstand dem Bedürfnis, die Schüssel mit der Creme vor mir zu packen und an die Wand zu pfeffern. Oder in sein Gesicht.
Wenn ich Hilfe brauchte … So, wie es klang, meinte er nicht nur die Torte.
Julian war mal mein Lieblingsmensch gewesen. Ich konnte verstehen, wieso alle Prisma-Mitarbeiter ihn mochten, obwohl er kein großes Talent fürs Kochen besaß. Wieso er Mums Lieblingssohn war. Wieso er nie ein Problem damit gehabt hatte, Freunde zu finden. Er war immer der Interessanteste im Raum. Die Sonne schien ihm aus dem Arsch. In seiner Nähe fühlte man sich gut aufgehoben. Er war nicht perfekt. Er hatte Ecken und Kanten, war ein Chaot und oft unfreiwillig witzig, hatte aber fast ausschließlich gute Laune und riss alle in seiner Umgebung mit. Und dann war da noch sein Menschenhelfersyndrom, das er sich von unserer Mutter abgeguckt hatte. Kurzum, er war der ideale Protagonist. Und ich? Ich war die tragische Randfigur, die nur dazu diente hervorzuheben, was für ein toller Kerl er war.
»Ich wünschte, du würdest mir sagen, was ich falsch gemacht habe.«
Ich riss den Kopf hoch. Vorsichtig, mit unterdrückter Wut, stellte ich den mit Kakao gefüllten Messbecher ab und klammerte mich so fest mit beiden Händen an der Arbeitsfläche fest, dass meine Knöchel weiß hervortraten.
Er kann nichts dafür, er kann nichts dafür, er kann nichts dafür …
Dieses Mantra wiederholte ich jedes Mal in Gedanken, wenn sein bescheuertes Gesicht in mein Sichtfeld kam. Ich wusste, es war die Wahrheit. Und trotzdem half es nichts.
Noch mehr Wahrheiten: Ich hasste Mum. Dafür, dass sie der Auslöser gewesen war. Dafür, dass sie mich nicht beschützt hatte, obwohl sie es dank ihrer Vergangenheit besser wissen sollte. Ja, Julian hasste ich inzwischen auch. Dafür, dass Dad seinetwegen seit fünf Wochen einen Entzug machte. Davor hatte ich noch Zeit mit Julian verbracht. Auch wenn ich nicht mit ihm hatte sprechen können, ich hatte mir von ihm helfen lassen. Aber dann hatten ein paar Worte von ihm ausgereicht, während Tausende von mir nutzlos gewesen waren. Wie sollte ich ihn nicht hassen?
Außerdem hasste ich jede Person in meinem Umfeld, die nicht kapiert hatte, was mit Dad los war, bis es zu spät gewesen war. Aber am allermeisten hasste ich mich selbst. Denn ich hatte es kapiert. Und es mir monatelang zur Aufgabe gemacht, es zu verstecken. Wer tat so was? Wer half einem Alkoholabhängigen freiwillig dabei, seine Sucht zu verheimlichen, wenn er selbst am allermeisten darunter litt?
Ein absoluter Vollpfosten. Der dann den Preis dafür zahlte, während alle anderen ihr Leben normal weiterführten.
»Alexis …«
Meine abgehackten Atemzüge erfüllten den Raum.
Verschwinde. Bitte, verschwinde einfach, sonst muss ich dir eine reinhauen.
Im nächsten Moment trat unsere Mutter neben Julian.
Am liebsten hätte ich gelacht. Jetzt war die Runde vollständig.
Ihre Miene war angespannt, ein paar dunkle Strähnen hatten sich aus ihrer Frisur gelöst, und auf ihren Wangen prangten rote Stressflecken. »Es gibt draußen einen Zwischenfall. Jules, kannst du kurz für mich einspringen? Und Alexis – ich habe Unterstützung für dich gefunden.« Ihr Lächeln erreichte ihre Augen nicht. Für den Bruchteil einer Sekunde schaute sie zwischen Julian und mir hin und her, runzelte die Stirn, dann schüttelte sie den Kopf, als hätte sie entschieden, dass sie jetzt keine Zeit für so etwas Belangloses wie ihre Söhne hatte.
Bevor Julian loslaufen konnte, setzte ich mich in Bewegung. Ich wusste nicht, wohin ich wollte, ich wusste nur, dass ich es keine weitere Sekunde mit den beiden in einem Raum aushielt. Meine Beine trugen mich aus der Patisserie und durch die Küche, vorbei an den bekannten Gesichtern, Richtung Restaurantbereich. Ein paar Blicke streiften mich flüchtig, doch keiner verharrte auf mir. Die Leute hier waren meine Aussetzer gewohnt. Inzwischen war das mein Merkmal Nummer eins. Manchmal hatte das tatsächlich Vorteile.