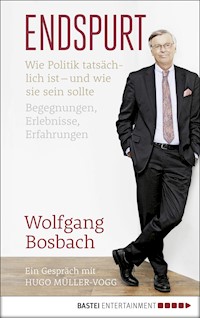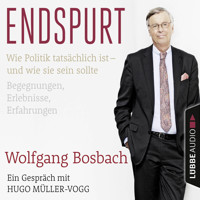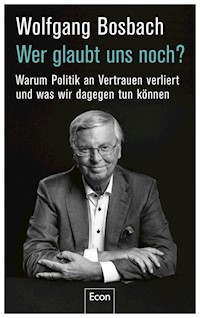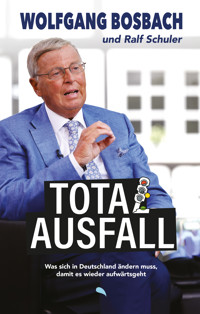
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Deutschland steckt tief in der Krise. Die Ampel-Regierung erweist sich als dramatischer Totalausfall. Im Gespräch mit Ralf Schuler analysiert der beliebte Klartext-Politiker Wolfgang Bosbach die Situation mit inhaltlicher Tiefenschärfe. Der Austausch zwischen dem Elder Statesman Bosbach und dem scharfsinnigen Journalisten Schuler ist ein Lehrstück über die inneren Mechanismen der Politik. Sie bieten auf verständliche Weise klare Analysen und zeigen Fehlentwicklungen und mögliche Lösungen für Deutschland auf. Eindrücklich wird sichtbar, wie berechtigt Bosbachs frühe Warnung vor ungeregelter Migration war. Der auch ohne öffentliches Amt engagierte CDU-Mann brilliert in dieser unterhaltsamen Lektüre mit Kompetenz und einmaliger Schlagfertigkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang BosbachRalf SchulerTotalausfall
www.fontis-verlag.com
Für meine Enkel Camer Can jun. und Loran.Euch gehört die Zukunft.Wolfgang Bosbach
Wolfgang BosbachRalf Schuler
Totalausfall
Was sich in Deutschland ändern muss, damit es wieder aufwärtsgeht
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Der Fontis-Verlag wird von 2021 bis 2024vom Schweizer Bundesamt für Kultur unterstützt.
© 2024 by Fontis-Verlag Basel
Umschlag: René Graf, Fontis-VerlagUmschlagfoto: © M. Hangen für NIUS/Schuler! Fragen, was istE-Book-Vorstufe: InnoSET AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Stefan Jäger
ISBN (EPUB) 978-3-03848-461-5
Inhalt
«Mein Land wird mir langsam fremd»
Unbegrenzte Migration und ihre Folgen
«Längst von der Lebenswirklichkeit abgekoppelt»
Der Realitätsverlust der Ampel
Gewalt, Hetze, Ausschreitungen
Wo bleibt in Deutschland die innere Sicherheit?
Die Union zwischen Leitkultur und dem Islam in Deutschland
Krisen, Krisen und noch mehr Krisen
Ist heute noch irgendetwas sicher?
Schwarz, Grün, Blau …
Eine politische Farbenlehre
Kanzlerpolitik
Wie viel Merkel steckt in Scholz?
Debattenkultur, Medien und Meinungsmache
Wie gespalten ist unsere Gesellschaft?
Aus Fehlern lernen!
Was Deutschland jetzt braucht
Jetzt mal persönlich, Herr Bosbach!
Personenregister
Über die Autoren
«Mein Land wird mir langsam fremd»
Unbegrenzte Migration und ihre Folgen
Ralf Schuler: Herr Bosbach, ganz persönliche Frage: Machen Sie sich eigentlich Sorgen, wie sich das Deutschland entwickelt, in dem Ihre Kinder und Enkelkinder aufwachsen?
Wolfgang Bosbach: Wenn wir so weitermachen wie in den letzten Jahren, dann mache ich mir Sorgen. Und zwar nicht grundlos. Unter anderem, weil ich das Gefühl habe, dass wir den Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen und der sozialen Leistungsfähigkeit unseres Landes verlieren. Wenn wir glauben, bei nachlassender Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit den Sozialstaat immer weiter ausbauen zu können – Gesundheit, Pflege, Rente –, ist das ein gravierender Irrtum – es sei denn, wir gehen den Weg der Verschuldung mit astronomischen Zahlen immer weiter. Dazu kommen noch Migration und Integration und einige weitere Themen, die deutlich machen: Wir gehen einen ganz, ganz schweren Weg.
Altbundespräsident Gauck hat die Verunsicherung vieler Menschen durch Zuwanderung so beschrieben: «Ich bin nicht mehr dort zu Hause, wo ich wohne.» Fühlen Sie sich in Deutschland noch zu Hause?
Nicht jeden Tag, nicht an jedem Ort. Deutschland war immer mein Land, hier lebe ich sehr gerne und das wird auch immer so bleiben. Aber mittlerweile gibt es Entwicklungen, die mich fremdeln lassen.
Nur ein kleines Beispiel: Wenn von «sozialer Gerechtigkeit» gesprochen wird, geht es immer um die Bezieher von staatlichen Transferleistungen. Soziale Gerechtigkeit schulden wir aber auch denjenigen, die von morgens bis abends dafür arbeiten, dass diese Leistungen überhaupt bezahlt werden können.
Und immer mehr fragen sich: «Womit beschäftigen die sich eigentlich in Berlin? Was haben die Debatten mit meinem Leben, meinem Alltag zu tun?» Okay, zukünftig soll man einmal im Jahr sein Geschlecht offiziell wechseln können und zukünftig darf auch straffrei gekifft werden, aber deshalb den Titel «Fortschrittskoalition» wählen? Sind das wirklich Fortschritte im Sinne von positiver Zukunftsentwicklung?
Ich treffe immer mehr Menschen, die mit dem Gedanken spielen, das Land zu verlassen, und hoffe gleichzeitig darauf, dass sie es nicht tun werden. Obwohl ich verstehen kann, dass viele sagen: «Mein Land wird mir langsam fremd!»
Hängt das damit zusammen, dass die Veränderungen zu schnell gehen? Dass zum Beispiel innerhalb einer Lebensspanne nicht nur Technologien sich wandeln, sondern eben auch Stadtbild und gesellschaftliche Mechanismen sich ändern? Oder ist tatsächlich irgendetwas ins Rutschen geraten, wie mir ein Politiker unlängst sagte?
Aktuell kommen viele Faktoren zusammen und die Probleme addieren sich. Das gilt sowohl für den Krieg Putins gegen die Ukraine als auch für den Kampf von Hamas, Hisbollah und Co. mit dem Ziel, Israel zu vernichten.
Wir leben in einer Zeit multipler außenpolitischer Krisen mit unmittelbaren Auswirkungen auch auf uns.
Wir müssen die Ukraine nicht nur politisch und finanziell unterstützen, auch militärisch. Sie darf diesen Krieg nicht verlieren, denn wenn Putin sein militärisches Ziel erreicht, wird das nicht der letzte Krieg in Europa gewesen sein. Allerdings hatten die wirtschaftlichen Sanktionen der EU gegen Russland bislang nicht den erhofften Erfolg. Aber die Gegenreaktionen machen uns ökonomisch spürbar zu schaffen.
Gegenüber Israel haben wir aus historischen Gründen die ganz besonders hohe Verantwortung, für das Existenzrecht dieses Landes einzustehen und jüdisches Leben auch in Deutschland unter allen Umständen zu schützen.
Aus historischen Gründen haben wir die ganz besonders hohe Verantwortung, für das Existenzrecht Israels einzustehen.
Israel ist der einzige sichere Hafen für alle Juden – weltweit. Aber wenn wir das Abstimmungsverhalten der UN sehen, dann ist es dort – zurückhaltend ausgedrückt – keineswegs selbstverständlich, dass sich Israel gegen einen militärischen Angriff auch militärisch zur Wehr setzen darf. Und dass sich ausgerechnet Deutschland bei der Abstimmung in der UN-Vollversammlung zur sogenannten Gaza-Resolution Ende Oktober 2023 enthalten hat, war mehr als peinlich. «Staatsräson» sollte nicht nur in feierlichen Sonntagsreden ein wichtiges Prinzip sein, sondern auch im politischen Alltag.
Hinzu kommt eine Fülle von gesellschaftlichen Veränderungen. Die negative demografische Entwicklung wird fast ausschließlich mit dem Thema Migration verbunden. Genauer gesagt mit der Zuwanderung von Menschen aus asiatischen und afrikanischen Ländern. Damit sollen all unsere Probleme gelöst werden: der Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt ebenso wie die überlasteten Sozialsysteme, die besonders unter der immer älter werdenden Bevölkerung leiden. Das wird aber nicht funktionieren.
Katrin Göring-Eckardt hat im November 2015 eine Rede gehalten, die inzwischen fast schon ein Klassiker ist. Damals sagte sie: «Wir reden darüber, wie unser Land in zwanzig, in dreißig Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn! Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen! Es wird bunter werden! Ja, wie wunderbar ist das! Das haben wir uns immer gewünscht! Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden, na klar. Und ja, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins: Ich freue mich darauf.»
Deutschland wird bunter werden. Sie freut sich darauf. Freuen Sie sich auch darauf?
(lacht) Ich fürchte, Katrin Göring-Eckardt unterliegt einer Täuschung. Wer diese Passage aus ihrer Rede hört, der muss den Eindruck gewinnen, sie glaube, alles sei ein riesiges ganzjähriges Tag und Nacht stattfindendes Straßenfest, bei dem sich die Aufnahmegesellschaft und die Migranten in den Armen liegen, Volkstänze veranstalten und die regionalen Spezialitäten ihrer Heimat auf den Tisch bringen. Alle sind glücklich und zufrieden.
Deswegen gibt es in der Vorstellungswelt von Katrin Göring-Eckardt auch nur bestens gelungene Integration, keine Segregation – also keine Trennung von Wohngebieten nach sozialer und ethnischer Herkunft, insbesondere in Großstädten –, keine arabischen Großfamilien, die uns Kummer machen – Stichwort Clankriminalität –, es gibt keine Zuwanderer, die sich nicht integrieren lassen wollen. Das alles gibt es in ihrer Vorstellungswelt nicht – und ihre Vorstellungswelt ist die von vielen Grünen.
Zugegeben: In allerhand Fällen war und ist es tatsächlich so, dass Migranten unser Land bereichern, es vielfältiger, lebendiger machen. Aber eben bei Weitem nicht alle! Doch weil nicht sein kann, was nicht sein darf, suchen die Grünen die Gründe für fatale Fehlentwicklungen, für Desintegration wie ganz selbstverständlich bei uns, bei der Aufnahmegesellschaft – nach dem Motto: «Wir haben sie halt nicht gut integriert!»
Das ist doch total schräg. Wenn ich in ein anderes Land gehe, aus welchen Gründen auch immer, um dort ein besseres Leben zu führen, muss ich mich in die gesellschaftlichen Verhältnisse des Landes integrieren, muss die Rechts- und Werteordnung akzeptieren. Das ist meine Aufgabe, meine Verpflichtung. Das Aufnahmeland kann und soll dabei helfen; aber wenn es an Integrationswillen fehlt, dann werden alle Integrationsanstrengungen des Staates nicht viel nützen.
Wenn ich in ein anderes Land gehe, um dort ein besseres Leben zu führen, muss ich mich in die gesellschaftlichen Verhältnisse des Landes integrieren.
Als der Vater meines Schwiegersohns vor vielen Jahrzehnten aus der Türkei eingewandert ist, gab es keine Sprach- oder Integrationskurse. Da geschah Integration durch Arbeit: auf der Baustelle mit der Schaufel in der Hand. Auf diese Weise haben die Kumpels für Integration gesorgt.
Heute haben wir ein unglaubliches Angebot an staatlichen Integrationshilfen, was ich ausdrücklich begrüße; doch wir tabuisieren, dass es bei einigen an der Integrationsfähigkeit fehlt, auch am Integrationswillen.
Rein demografisch betrachtet hat Katrin Göring-Eckardt übrigens recht: Wir werden jünger, denn es kommen ja nicht große Familien zu uns, sondern weit überwiegend junge Männer aus Osteuropa, dem arabischen Raum und aus Afrika. Das Problem ist nur, dass unsere demografische Krise nicht nur das Alter betrifft. Im Kern geht es um das Fehlen junger, sozialversicherungspflichtig Beschäftigter. Insofern klingt es schön, wenn der Altersdurchschnitt sinkt. Für die Sozialsysteme hilft es allerdings wenig, wenn sie noch mehr Kunden bekommen.
Sie sehen ja, wie die politischen Debatten laufen. Bei den Migranten, die 2015/2016 gekommen sind und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen könnten, haben wir eine Erwerbsquote von etwa 50% – also zugleich eine Arbeitslosenquote von 50%. Die einen würden sagen: «Nur jeder Zweite arbeitet?» Die anderen meinen: «Immerhin! Jeder Zweite arbeitet!»
Fakt ist, dass die Arbeitslosenquote und auch der Sozialhilfebezug unter diesen Einwanderern wesentlich – um ein Mehrfaches! – höher sind als ihr Anteil an der Bevölkerung. Das zeigt, dass sich die Erwartungen nicht erfüllt haben. Es handelt sich auch nicht vorwiegend um die lang ersehnten Fachkräfte. 2015/2016 wurde uns vermittelt, es kämen vor allem Ärzte und Ingenieure. Ja, die waren auch dabei! Aber so zu tun, als könnten wir den Fachkräftemangel durch diese Form der Migration lösen – das ist eine Selbsttäuschung.
Im Übrigen: Wenn wir einen Fachkräftemangel haben, dann in der Bundesregierung! Natürlich gibt es ihn auch in der Wirtschaft. Aber die Fachkräfte, die wir dringend benötigen – und das in mehreren Branchen –, die kommen doch nicht in Booten per Schlepper übers Mittelmeer!
Der investigative Journalist Jan Karon hat eine bemerkenswerte Dokumentation mit dem Titel «Lampedusa. Ansturm auf Europa» gedreht.1 Darin bestätigt er, dass 95% dieser Migranten junge Männer sind. In der Tagesschau heißt es aber, es seien Männer, Frauen und Kinder. Man hat den Eindruck, dass ein paar Journalisten auch aus Furcht vor den Abstoßungsreaktionen mit der hiesigen Bevölkerung eine Wunschwelt zeichnen.
Vollkommen richtig. Ich habe im Herbst 2015 die Bundespolizeiinspektion auf dem Hauptbahnhof in München besucht und mit den Beamtinnen und Beamten gesprochen. Als unser Gespräch zu Ende war, sagte ein Beamter: «Herr Bosbach, bleiben Sie noch für eine halbe Stunde. Gleich kommt ein ICE.» München hat einen Kopfbahnhof. Am Kopfende warteten Fotojournalisten, vielleicht zwanzig, fünfundzwanzig. Der Zug kam. Knapp 1.000 Menschen stiegen aus, davon schätzungsweise 80 bis 85% junge Männer, dazu ein paar Frauen und ein paar Kinder.
Und was geschah? Ausnahmslos alle Fotografen stürzten sich auf die Kinder und Frauen und machten von ihnen Bilder, die man am nächsten Tag in den Medien sehen konnte. Auf diese Weise wurde der Eindruck erweckt, es kämen überwiegend hilfsbedürftige Familien und Kinder zu uns. Wer verschließt denn vor der Not der Kinder seine Augen?
Nirgendwo habe ich gelesen, dass es in Wahrheit etwa 70 bis 80% junge Männer aus Schwarzafrika waren. Nirgendwo. Bei solchen Bildern handelt es sich nicht um falsche Berichterstattung im eigentlichen Sinne, aber um eine zweckdienliche Täuschung, die den wahren Sachverhalt verschleiert – vermutlich sogar aus edlen Motiven: nämlich um die Akzeptanz für die Aufnahme der Menschen in Deutschland zu erhöhen.
Bei manchen Leuten, die sich heute erschüttert über Folgen ungesteuerter Migration äußern, hat man den Eindruck, dass es so eine Art nachholender Ehrenrettung sein soll, weil man damals fröhlich auf der politischen Wunschwelle surfte und diesen Opportunismus nun durch besonders radikale Analyse zu kompensieren versucht.
«Wir haben versagt», erklärte zum Beispiel der damalige SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel, der im Migrationsherbst 2015 mit einem «Refugees welcome»-Anstecker auf der Regierungsbank saß, obwohl jeder denkende Mensch absehen konnte, dass ungesteuerte Masseneinwanderung zu Verwerfungen führen würde.
Heute will man dann nachträglich durch die härteste Analyse und Selbstgeißelung Punkte machen. Sie haben damals schon in der Fraktionssitzung der Kanzlerin widersprochen, als man gesagt hat, die Grenzen ließen sich nicht schließen. Also, was ist das? Was sagt das über das Land und die politische Debatte aus, wenn jemand in der jeweiligen Situation möglichst intensiv mitschwimmen möchte und dann hinterher möglichst intensiv beim Aufräumen der selbst hinterlassenen Trümmer helfen will?
Dieses Phänomen ist in der Politik gar nicht so selten. Olaf Scholz hat eine Impfpflicht ursprünglich strikt abgelehnt. Dann gab es immer mehr Befürworter, woraufhin auch er dafür war, natürlich weil er das «immer schon gesagt» hatte. Heute ist er sicherlich froh, dass sich seine ursprüngliche Meinung durchgesetzt hat, weil es keine parlamentarische Mehrheit pro Impfpflicht gab. Gut so.
Schon im September 2015 war es mir und einigen wenigen – zu wenigen – Kolleginnen und Kollegen klar, dass offene Grenzen auf Dauer für jedermann zu erheblichen Problemen führen würden. Die Aufnahme jener Flüchtlinge, die damals in Zügen auf einem Bahnhof in Budapest festsaßen, habe ich selbst für richtig gehalten. Ungarn wollte sie nicht aufnehmen, Österreich auch nicht, nächste Station: Deutschland. Man konnte diese Menschen ja nicht für längere Zeit zwischen Baum und Borke festhalten.
Aber dann sollten die Grenzen plötzlich ganz generell offen bleiben. Zukünftig galt – und gilt im Grundsatz immer noch: Wer an der Grenze ein Asylbegehren vorträgt, darf einreisen. Auch wenn er schon über diverse sichere, verfolgungsfreie Demokratien gereist ist, auch wenn er ohne gesicherte Identität und Nationalität kommt oder komplett ohne Papiere.
Mir war sofort klar, was das bedeuten würde. Kritische Einwände waren aber nicht erwünscht. Mir wurde regierungsamtlich mitgeteilt: «Du musst dir das wie eine Pipeline vorstellen. Im Moment kommen viele, dann immer weniger und dann nur noch vereinzelt.» Also, alles null Problem. – Ich dachte, ich höre nicht richtig. Darauf habe ich sinngemäß geantwortet, dass man eine Tür zwar schnell aufmachen kann, aber kaum wieder schließen, wenn unablässig Menschen hineinwollen.
Deutschland wollte der Welt Ende September 2015 demonstrieren, dass man auf der richtigen Seite der Geschichte stehe, eine schrankenlose Aufnahmekapazität meistern könne und eine grenzenlose Integrationskraft habe. O-Ton der damaligen Kanzlerin Angela Merkel: «Ich muss ganz ehrlich sagen: Wenn wir jetzt anfangen, uns noch dafür entschuldigen zu müssen, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.»
Heute gehen viele durch Problemviertel einiger Großstädte und denken sich: «Das ist nicht mehr mein Land.»
Fakt ist: Kein Land der Welt hat eine völlig grenzenlose Aufnahme- und Integrationskraft. Und die Grenzen dieser Integrationskraft dürfen wir nicht überdehnen, sonst kippt die gesellschaftliche Aufnahmeakzeptanz und wir haben mehr Segregation als Integration.
Kein Land der Welt hat eine völlig grenzenlose Aufnahme- und Integrationskraft.
Begleitet wird diese Debatte nach wie vor von hehren Absichten.
Nr. 1: «Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen!» Wie machen wir das denn ganz konkret, wenn die Menschen vor Kriegen oder Bürgerkriegen fliehen, vor Diktatoren und Terrorregimen wie dem der Taliban?
Nr. 2: «Wir müssen das Schlepper- und Schleuserwesen bekämpfen.» Nur zu! Und dennoch werden nach wie vor unablässig Schleuserdienste angeboten.
Nr. 3: «Wir müssen die Flüchtlinge in der EU gerecht verteilen.» Abgesehen davon, dass das nicht klappen wird, bleibt die konsequent unbeantwortete Frage: Wer entscheidet nach welchen Kriterien darüber, wer nach Bulgarien, wer nach Deutschland, wer nach Dänemark und wer nach Lettland kommt? Und ist die Zuweisung eines nicht gewollten Staates ein rechtsmittelfähiger Verwaltungsakt mit Klagemöglichkeit?
Wir müssen der Wirklichkeit ins Auge sehen: Das Wohlstandsgefälle zwischen Europa und den meisten Hauptherkunftsländern der Flüchtlinge ist derart groß, dass auch ohne Kriege und Bürgerkriege der Migrationsdruck bleiben wird.
Wenn man die Bundesregierung in diesen Tagen hört, hat man den Eindruck, man könne eigentlich überhaupt nichts gegen diesen Zustrom machen. Ist das so?
Doch, wir können etwas machen. Und wir tun es auch: seit geraumer Zeit mit der bayerischen Grenzpolizei im Grenzgebiet Bayern-Österreich. Leider behauptet die Gewerkschaft der Polizei – anders als die Deutsche Polizeigewerkschaft –, das bringe alles nichts, dabei gab es an dieser Grenze schon mehrere Tausend Zurückweisungen.
Zunächst hatte sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser monatelang geweigert, die schon an diesen Grenzabschnitten praktizierten und bewährten Kontrollen auch nur bei der EU anzumelden und sie dann auf die Grenzen zur Schweiz, zu Polen und zu Tschechien auszudehnen.
Erst als der Druck – vor allem aus den völlig überforderten Kommunen und auch aus der Union – immer größer wurde, hat sie im Herbst 2023 für Kontrollen grünes Licht geben. Und das war auch gut so. Schon nach wenigen Wochen hatte sich allein an der Grenze Brandenburgs zu Polen die Zahl der illegalen Einreisen fast halbiert – was Kritiker natürlich nicht davon abhält, weiterhin zu behaupten, stationäre Kontrollen hätten keine Wirkung. Die Kritiker verraten allerdings nicht, welche Maßnahmen denn bessere Wirkungen hätten.
Haben Sie das Gefühl, dass der Grenzschutz bei Nancy Faeser in guten Händen ist?
Nein, ich fürchte, Nancy Faeser ist fachlich überfordert. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium hat, die man in einer solchen Situation braucht. Das sind bestimmt stramme Parteisoldaten, daran habe ich keine Zweifel; aber jetzt wären im Innenministerium Führungspersönlichkeiten vonnöten, die der Innenministerin sagen: «Frau Faeser, so geht es nicht mehr weiter.»
Ich glaube, auch Olaf Scholz wird sehen, dass es mit ihr so nicht weitergeht. Und was für ein Gamechanger eine einzige richtige Personalentscheidung sein kann, das hat man im Verteidigungsministerium gesehen. Mit Boris Pistorius sieht die Welt in diesem Ressort schon ganz anders aus. Das könnte im Innenministerium auch passieren. Möglicherweise hält Olaf Scholz an Nancy Faeser fest, weil sie eine Frau ist oder weil sie aus Hessen kommt.
Fachliche Defizite, schlechte Umfragewerte – das bringt mich zur Frage, ob Nancy Faeser als Innenministerin noch tragbar ist.
Ich fürchte nein – zumal die Affäre Schönbohm gezeigt hat, dass es da auch ein paar charakterliche Defizite gibt. Wir wissen ja immer noch nicht, wer die Wahrheit sagt: Frau Faeser oder ihr Abteilungsleiter Martin von Simson. Er ist auch ihr Vermieter – vielleicht will sie sich mit ihm nicht anlegen, weil er sonst Eigenbedarf geltend macht. Ich weiß es nicht.
Aber es bleiben immer noch viele Fragen offen. Wer hat eigentlich Nancy Faeser daran gehindert zu sagen: «Ich bin auf den Clown Jan Böhmermann reingefallen. Das war ein Fehler. Ich habe mich geirrt, ich habe eine Personalentscheidung getroffen, die ich im Nachhinein bereue. Es tut mir auch für Herrn Schönbohm leid.» Ich wette, nach zwei Tagen wäre das Thema durch gewesen und viele hätten gesagt: «Die gibt wenigstens mal einen Fehler zu.»
Zurück zum Thema Migration. In einem Interview im Deutschlandfunk wurde unsere Außenministerin Annalena Baerbock gefragt: «Alt-Bundespräsident Joachim Gauck spricht angesichts der Stimmung im Land, der Besorgnis in vielen Kommunen, Städten und Gemeinden von einem Kontrollverlust bei der Migration. Sehen auch Sie diesen Kontrollverlust?»
Daraufhin antwortete Annalena Baerbock: «Nein, es ist eine absolut angespannte Situation in den Kommunen. Das weiß ich ganz genau, dass etliche Kommunen an der Belastungsgrenze sind. Das heißt, dass unklar ist, wie man überhaupt noch Kita- und Schulplätze bereitstellen soll für geflüchtete Kinder. Auch bei der Unterbringung gibt es wahnsinnigen Druck, das ist uns allen in der Bundesregierung sehr klar. Aber deswegen handeln wir auch, deswegen unterstützen wir die Kommunen bei der Unterbringung und deswegen arbeiten die Innenministerinnen und ich als Außenministerin so hart, dass wir in Europa endlich zu gemeinsamen Regelungen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik kommen.»
Also kein Kontrollverlust? Was genau kontrollieren wir denn?
Wenn ich an der Grenze niemanden kontrollieren möchte, dann kann ich auch nichts verlieren. Insofern hat sie recht. Und wir müssen fair bleiben: Wir haben eben schon seit September 2015 darauf verzichtet, die regulären Einreisevoraussetzungen zu kontrollieren, wenn ein Asylantrag gestellt wird. Also gucken wir jetzt nach Menschen, die eine Wiedereinreisesperre haben, die also schon mal hier waren, aber nicht noch einmal einreisen dürfen. Die können wir an der Wiedereinreise hindern. Das kontrollieren wir also tatsächlich.
Und: Wir weisen diejenigen zurück, die die Pass- und Visumpflicht nicht erfüllen und keinen Asylantrag stellen. Wer zum Beispiel ehrlich sagt, er möchte nach Deutschland, um hier zu arbeiten, oder er will in die skandinavischen Länder durchreisen, wird zurückgewiesen. Wenn diese Menschen allerdings wiederkommen und sagen, sie möchten in Deutschland einen Asylantrag stellen, dann dürfen sie einreisen.
Jens Spahn hat gesagt, wir seien kein Einwanderungsland, sondern ein Einreiseland.
Das eine schließt das andere nicht aus, denn jedes Land der Welt kennt Migration – vielleicht abgesehen von Nordkorea und anderen Exoten. Es ist eine reine Frage der Definition. Wenn man sagt, ein Einwanderungsland ist ein Land, in das Menschen einwandern, dann sind das 198 von 200 Ländern dieser Welt. Wenn man jedoch sagt, ein Einwanderungsland ist nur ein Land, das sich gezielt um Einwanderung bemüht, dann denkt man klassischerweise an Staaten wie die USA oder Kanada. Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels bemühen wir uns auch um Einwanderung – das darf man allerdings nicht verwechseln mit der Migration aus humanitären Gründen.
Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels bemühen wir uns um Einwanderung – das darf man allerdings nicht mit der Migration aus humanitären Gründen verwechseln.
In Äußerungen der Bundesregierung hört man immer wieder die klassische Floskel: «Wir brauchen und wir müssen.» Mir scheint, wenn Politiker nicht weiterwissen, verwenden sie diese Phrase. Sie signalisieren damit, dass sie das Problem kennen, aber keine Lösung anbieten können. Haben Sie den Eindruck, dass bei der Bundesregierung der Wille da ist, das Problem zu lösen?
Nein. Das zeigt ja auch das Interview mit Annalena Baerbock im Deutschlandfunk. Ihre Problembeschreibung war richtig. Nur wird sie nie gefragt: «Frau Baerbock, was machen wir denn jetzt?» Vermutlich würde sie darauf sagen: «Wir verhandeln mit anderen Staaten Rückführungsabkommen» und so weiter, was nichts am Migrationsgeschehen als solchem ändert.
Auch wird immer wieder die Chiffre bemüht: «Wir brauchen die große europäische Lösung.» Dänemark gehört ebenfalls zu Europa – doch es denkt überhaupt nicht daran, auf die große europäische Lösung zu warten. Dänemark war an der Überforderungsgrenze und hat gehandelt. Eine sozialdemokratische Regierung! So eine Politik würde sich unsere SPD niemals trauen!
Ich wünsche mir gar nicht, dass wir dieselben Maßnahmen wie Dänemark ergreifen. Aber gar nichts zu tun und auf Brüssel zu warten, ist kein Programm, sondern Hilflosigkeit.
Mit der großen europäischen Lösung ist wohl auch gemeint, einen europäischen Verteilschlüssel zu finden. Der Migrationsforscher Prof. Dr. Ruud Koopmans hat einmal Folgendes dazu gesagt: «Die Deutschen diskutieren, als ob die Badewanne überläuft, möchten aber den Hahn nicht zudrehen.» Was bringt ein anderer Verteilschlüssel innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europas?
In Deutschland erfolgt die Verteilung der Flüchtlinge nach dem sogenannten «Königsteiner Schlüssel». Dieser orientiert sich zu zwei Dritteln am Steueraufkommen in den sechzehn Bundesländern und zu einem Drittel an deren Bevölkerungszahl. Diese Form der Verteilung ist innenpolitisch weitestgehend akzeptiert.
Sie ist auch deshalb nicht so problematisch wie die EU-weite Verteilung, weil hier die Wohlstandsunterschiede nicht so erheblich sind wie in allen Staaten zwischen Griechenland und Schweden, zwischen Portugal und Finnland. Ob man nach Hildesheim kommt, nach Hannover oder nach Nürnberg, ist kein großer Unterschied, weder was die Unterbringung noch die medizinische Versorgung noch die schulischen Angebote betrifft. Aber innerhalb der Europäischen Union sind die Unterschiede massiv.
Mittlerweile ist der Satz: «Wir brauchen die große europäische Lösung» nur noch ein Deckmäntelchen für: «Wir machen hier gar nichts.» Wenn wir jedoch so lange warten, bis die EU diese Probleme löst, können wir noch sehr lange warten.
Und selbst wenn: Es ist doch eigentlich ziemlich logisch, dass man bei einem begrenzten territorialen Gebiet mit Verteilung keine grundlegende Lösung herbeiführt, wenn der Nachstrom nicht gebremst wird; man zögert die Überforderung lediglich etwas hinaus. Ist Ungarn also, wie der Migrationsforscher Gerald Knaus sagt, «unsolidarisch», weil es sich weigert, Migranten aufzunehmen, und nicht die gleichen Zustände haben möchte, wie sie in Deutschland herrschen?
Aus Sicht der Europäischen Union verhält sich Ungarn in der Tat unsolidarisch, allerdings hat Viktor Orbán für seine Haltung in dieser Frage offensichtlich innenpolitisch großen Rückhalt. Das wiederum scheint in der EU niemanden so richtig zu interessieren.
Noch einmal: Mich wundert, dass noch nie hartnäckig nachgefragt wurde, nach welchem System genau eine EU-weite Verteilung erfolgen soll. Und wie geht es weiter, wenn die Flüchtlinge partout nicht in das Land möchten, in das sie verteilt werden sollen? Ist die Verteilungsentscheidung (gegen den erklärten Willen der Betroffenen) ein rechtsmittelfähiger Verwaltungsakt, gegen den man klagen kann? Wenn ja – wo und nach welcher Verfahrensordnung?
Unterstellt, die Betroffenen sind gegen ihren Willen in eine Region verfrachtet worden, in der sie nicht bleiben möchten (und man sie möglicherweise auch nicht freudig empfängt) – wie sollen sie dann daran gehindert werden, in das Wunschland weiterzureisen? Ich behaupte: Wer es von Afghanistan oder Syrien nach Bulgarien oder Lettland geschafft hat, der schafft es auch von dort nach Deutschland, Frankreich oder in die Niederlande. Menschlich gesehen kann ich das sogar verstehen, dass diejenigen, die auf dem Weg sind, gerne dorthin möchten, wo der Wohlstand hoch ist. Und wie wollen wir sie aufhalten, wenn wir die Grenzkontrollen abschaffen?
Im Rheinland gibt es den schönen Satz: «Von nix kütt nix.» Wir müssen immer ganz ehrlich bleiben. Es war die damalige Große Koalition und mit ihr die Kanzlerin Angela Merkel, die die üblichen Einreisevoraussetzungen suspendiert hat. Seit September 2015 gilt wie gesagt, dass die Asylantragstellung an der Grenze – formal das Asylbegehren beim Grenzübertritt – schon die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ermöglicht, und zwar ohne die geltenden Einreisevoraussetzungen wie Pass, Visum oder irgendwelche Personendokumente. Das könnte man allerdings wieder ändern.
Es war auch Angela Merkel, die damals gesagt hat, man könne Grenzen gar nicht schließen. So ein bisschen höre ich das bei der Bundesregierung jetzt ebenfalls wieder raus. Warum kann die Türkei Grenzen schließen, warum konnte Österreich damals Grenzen schließen? Warum können die skandinavischen Länder jetzt ihren Zustrom begrenzen und wir nicht?
Wenn sie unter «schließen» meinen: «hermetisch abriegeln» – nein, das kann man nicht. Ich wünsche mir auch nicht ein Land, das luftdicht abgeschlossen ist, das von niemandem mehr betreten werden kann, denn: Wir haben neun Nachbarländer: acht EU-Mitglieder und die schnuckelige Schweiz. Und wir haben den Schengen-Prozess. Also: Das Land derart zusperren, dass keiner mehr reinkommt, kann auch Dänemark nicht.
Aber es wäre sinnvoll, auf den Hauptherkunftsrouten stationäre Grenzkontrollen einzurichten, damit wir wenigstens die aufhalten können, die schon mal ausgewiesen wurden – viele davon, weil sie Straftaten begangen und eine Wiedereinreisesperre haben. Im Moment gelingt das wie gesagt nur an den Grenzen zu Österreich, Polen und der Tschechischen Republik.
In einer Umfrage2 wurde ermittelt, was die Menschen über bestimmte Maßnahmen denken, die man in der Migrationspolitik anwenden könnte. Das Ergebnis ist: Ein Drittel der Befragten befürworten Seeblockaden im Mittelmeer. Mehr als die Hälfte, nämlich 54% der Befragten, sind für stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland. Fast die Hälfte, 47%, würde die direkte Rückführung mit Booten auf dem Mittelmeer unterstützen. Sind das Maßnahmen, die man ergreifen könnte?
Nein, rechtlich nicht. Was die Rückführung anbelangt: Wenn man beispielsweise ein Boot aus Libyen mit Flüchtlingen aus Kriegs- oder Krisengebieten ablehnt und zurückschickt, handelt es sich um verbotenes Pushback.
Was Seeblockaden anbelangt: Was meinen Sie, wie viele Schiffe wir brauchen würden, um eine Seeblockade zu organisieren, die vom Osten Griechenlands bis nach Portugal reicht? Allein die Große Syrte, eine halbmondförmige Mittelmeerbucht an der Nordküste Libyens, hat eine Länge von 1700 Kilometern. Wie also sollte so eine Seeblockade bewerkstelligt werden?
Dazu kommt: Die Schlepper ziehen die Boote mit den Flüchtlingen oft aufs offene Meer, montieren den Motor ab, fahren dann wieder zurück und überlassen die Menschen ihrem Schicksal. Nun gibt es ein internationales Abkommen namens SOLAS. Die Abkürzung steht für «Safety of Life at Sea», also Schutz des menschlichen Lebens auf See. Dieses Abkommen verpflichtet alle Kapitäne der Weltmeere, Schiffbrüchige zu retten. Es ist also unmöglich, ein motorloses Boot voller Flüchtlinge abzublocken.
Wenn Menschen um ihr Leben kämpfen, dann ist das Gebot der Stunde nicht, über Ausländerrecht oder Grenzschutz zu diskutieren. In dieser Situation halte ich es für unsere Pflicht, ihnen einen Rettungsring zuzuwerfen.
Und das ist auch vollkommen richtig: Wenn Menschen um ihr Leben kämpfen, dann ist das Gebot der Stunde nicht, über Ausländerrecht oder Grenzschutz zu diskutieren. In dieser Situation halte ich es für unsere Pflicht, ihnen einen Rettungsring zuzuwerfen. Das heißt nicht, dass sie automatisch ein Aufenthaltsrecht in einem Land der Europäischen Union bekommen, aber zumindest ein Anerkennungsverfahren.
Wäre es nicht denkbar, durch eine Präsenz von Marineschiffen die Boote am Ablegen zu hindern? Wenn ich sehe, dass ich direkt in die Arme einer patrouillierenden Armada fahre, würde ich es vielleicht lassen.
Da haben Sie recht. Das setzt allerdings voraus, dass die betroffenen Staaten mitmachen.
Dazu will ich eine Geschichte erzählen: Ich war – es müsste so um das Jahr 2000 gewesen sein – auf Einladung der spanischen Regierung auf den Kanarischen Inseln. Damals gab es dort einen enormen Zuzug von Flüchtlingen aus der Subsahara über Marokko. Fuerteventura ist die nächstgelegene Insel zum afrikanischen Festland. Dort sind die Migranten als Erstes angekommen. Als wenige kamen, waren das sogar begehrte Hilfskräfte für die Landwirtschaft, die Gastronomie und die Hotellerie.
Als es dann immer mehr wurden, hat die Inselregierung gesagt: «Schöne Grüße nach Madrid. Wir können nicht mehr.» Daraufhin hat Spanien Verhandlungen mit Marokko geführt und schließlich ein Abkommen mit dem nordafrikanischen Land geschlossen. Marokko hat dann – offensichtlich erfolgreich – Maßnahmen ergriffen, die das Ablegen der Schiffe verhindert und die Schleuserkriminalität unterbunden haben. Die Folge war: Die Flüchtlinge sind nach Norden gegangen, also Richtung Libyen.
Ich habe mir die Maßnahmen damals im Detail angesehen. Wir waren mit der Küstenwache unterwegs und ich war in den Aufnahmeeinrichtungen. Als ich wieder in Deutschland war, habe ich von den Erfahrungen dieser Reise berichtet. Das könnte auch uns erwarten. Aber so richtig interessiert hat das damals kaum jemanden.
Wenn wir uns angucken, was andere Länder machen: Soweit ich weiß, hat Dänemark ein Abkommen mit dem Kosovo (oder ist dabei, es zu schließen), um Menschen dorthin abzuschieben. Pro abgeschobene Person, um die sich der Kosovo kümmert, gibt es 15.000 Euro. Großbritannien hat ein ähnliches Abkommen mit Ruanda. Belgien bringt alleinstehende Männer in Obdachlosenheimen unter. Österreich nimmt niemanden mehr auf. Frankreich stoppt beispielsweise die Sozialleistungen bei Ablehnung im Asylverfahren. Sind das alles Methoden, die sich für Deutschland nicht eignen?
Es kann sein, dass diese Methoden am Ende den Zweck erfüllen, aber ich wünsche sie mir nicht. Ich mache schon einen Unterschied zwischen Rückführung und Verbannung.
Ein sehr aktuelles Thema sind Rücknahmeabkommen. Ein Thema, über das seit Jahren gesprochen wird und bei dem man nicht vorankommt. Deshalb die Frage: Sind solche Rücknahmeabkommen überhaupt so auszuhandeln, dass sie für die Gegenseite, also den rücknehmenden Staat, interessant sind?
Ich war schon mit Alt-Kanzlerin Angela Merkel in Nigeria, und der dortige Präsident hat ihr ganz offen gesagt, dass er kein Interesse an der Rücknahme von Landsleuten hat, weil diese mit ihren Überweisungen aus Deutschland mehr Geld ins Land bringen, als wir mit Entwicklungshilfe je zahlen könnten.
Olaf Scholz hat es im vergangenen Jahr auch wieder versucht und angeboten, Fachkräfte aus Nigeria nach Deutschland kommen zu lassen, wenn Nigeria seine abgelehnten Landsleute zurücknimmt. Das klingt nach keinem guten Geschäft für Nigeria – um mal bei diesem Beispiel zu bleiben –, wenn wir die Fachkräfte kriegen und Afrika dafür unausgebildete junge Männer zurückbekommt.