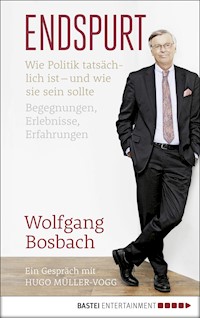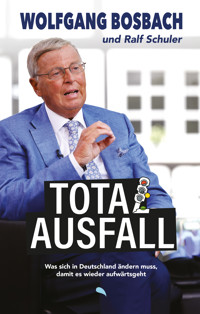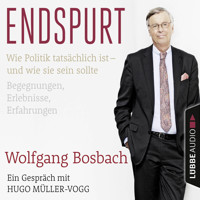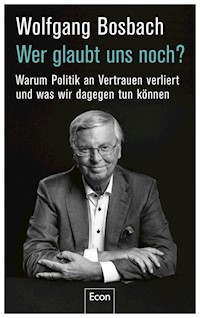
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Wir haben keine Politikverdrossenheit. Wir haben eine Politikerverdrossenheit.« sagt Wolfgang Bosbach. Zu oft wurden die Wählerinnen und Wähler enttäuscht. Nach dem Standard-Eurobarometer der EU-Kommission hatten im Frühjahr 2021 nur noch rund 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland Vertrauen in unsere politischen Parteien. Ein trauriger Befund. Welche Personen und Institutionen könnten in diesen Zeiten Orientierung und Halt geben? Wolfgang Bosbach hat in fünf Jahrzehnten Politik auf Bundesebene eine Fülle von unterschiedlichen Erfahrungen gesammelt. Auf einige hätte er verzichten können, aber die meisten waren positiv. Er ist der festen Überzeugung, dass es der Politik gut tun würde, etwas mehr und besser zuzuhören, was die Menschen bewegt. Nicht um allen nach dem Munde zu reden, sondern die Hoffnungen und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger intensiver mit der eigenen politischen Agenda zu verzahnen. Mit schlichten Schlagworten (wie links, rechts und Mitte) lassen sich weder politische Inhalte differenziert erläutern noch Debatten sinnvoll führen oder von der Politik Enttäuschte zurückgewinnen. Es gibt Handlungsbedarf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Wer glaubt uns noch?
Der Autor
WOLFGANG BOSBACH, geboren 1952, ist seit 1972 CDU-Mitglied. Von 2000 bis 2009 war er stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und von 2009 bis 2015 Vorsitzender des Innenausschusses des Bundestags. Zwischen 2012 und 2016 war er der meistvertretene Politiker in TV-Talkshows und verstand es, eine konservative Position überzeugend zu vertreten, ohne in Rechtspopulismus zu verfallen. 2017 kandidierte er nicht mehr für den Bundestag, bleibt aber ein interessierter politischer Beobachter und Kommentator. Seit 2020 moderiert er mit Christian Rach den Politik-Personality-Podcast »Die Wochentester«.
Das Buch
»Wir haben keine Politikverdrossenheit. Wir haben eine Politikerverdrossenheit«, ist Wolfgang Bosbach überzeugt. Zu oft wurden die Wählerinnen und Wähler enttäuscht. Nach einer Erhebung der EU-Kommission vertrauten im Frühjahr 2021 nur noch rund 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland unseren politischen Parteien. Wolfgang Bosbach hat in fünf Jahrzehnten Politik auf Bundesebene viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln können. Auf einige hätte er gerne verzichten können, aber die meisten waren durchweg positiv. Im Laufe der Zeit ist aber die Kluft zwischen Wählern und Gewählten immer größer geworden. Es täte dem politischen Personal gut, mehr hinzuhören, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, um deren Hoffnungen und Erwartungen stärker mit der eigenen politischen Agenda zu verzahnen. Leerformeln wie »links« oder »rechts« sind dabei nicht hilfreich, meint Bosbach. Sie taugen nicht zur differenzierten Darstellung und damit lassen sich auch keine von der Politik enttäuschte Menschen zurückgewinnen. Die CDU muss sich fragen: Wie unterscheiden wir uns von der politischen Konkurrenz? Welche Positionen sind für uns von fundamentaler Bedeutung und daher nicht verhandelbar?
Wolfgang Bosbach
Wer glaubt uns noch?
Warum Politik an Vertrauen verliert und was wir dagegen tun können
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2022 Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Dr. Annalisa Viviani, MünchenUmschlaggestaltung: total italic, Thierry WijnbergUmschlagfoto: © Phil Johann (Sallyhateswing) | Nullzwei PodcastAutorenfoto: © Manfred EsserE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN: 978-3-8437-2853-9
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Bitte keine unnötige Aufregung!
»Angst um die Zukunft meiner Kinder«
Denken Sie wie Cato?
Sie kennen mich!
Nur 1,6 Prozent
Ein trauriger Befund
Haaaalloooo! Hört uns irgendjemand da oben?
Wem vertrauen Sie? Und warum?
Gebrauchtwagenkauf ist Vertrauenssache!
Zu Gast in Auerbachs Keller
Von allen guten Geistern verlassen!
Und was wird aus mir?
Framing & Wording – auf den Rahmen kommt es an. Angeblich!
Worauf Sie sich verlassen können!
Ein historischer Moment im ZDF-Morgenmagazin
Und täglich grüßt das Murmeltier
Aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 8, Vers 6
Der XXL-Bundestag
Nicht der Fehler ist das größte Problem
Sieben Millionen!
Prüfet alles und behaltet das Gute!
Schiller,
Don Carlos
, 3. Akt, 10. Auftritt
Mehrheit oder Überzeugung?
Deutschland-Fähnchen an einem Wahlabend – ungeheuerlich oder selbstverständlich?
»Ich liebe mein Land«
So wenig Lust am Wählen war selten
Das Leid mit der Leitkultur
Die gespaltene Gesellschaft
Epilog
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Für Caroline, Natalie, Viktoria und Camer Can jun. –euch gehört die Zukunft!
Prolog
Diejenigen, die zu klug sind, um sich in der Politik zu engagieren, werden dadurch bestraft, dass sie von Leuten regiert werden, die dümmer sind als sie.
Platon
»Dieser Film ist ein Loblied auf die Schule, aber es ist möglich, dass die Schule es nicht merkt« – so heißt es gleich zu Beginn des Film-Klassikers Die Feuerzangenbowle, nach dem berühmten Roman von Heinrich Spoerl. In der Hauptrolle der unvergessene Heinz Rühmann als Dr. Johannes Pfeiffer – mit drei »f«.
Zwar ist dieses Buch nicht unbedingt ein Loblied auf die aktuelle Politik, aber dennoch geschrieben mit großer Sympathie für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und in der Hoffnung auf eine Politik, die von den Bürgerinnen und Bürgern nicht mit Skepsis betrachtet und mit eher spitzen Fingern angefasst wird, sondern die möglichst viele überzeugt und zum Mitmachen motiviert. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht das Land der Regierungen, nicht das Land der Abgeordneten, der Parteien oder der Politikerinnen und Politiker. Es ist unser aller Land! Und Politik ist zu wichtig, um sie ausschließlich den Politikern zu überlassen. Mit unserer Stimmabgabe in der Wahlkabine übertragen wir zwar auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene politische Verantwortung – aber unsere eigene Verantwortung für das Gemeinwesen können wir nicht delegieren. Millionen nehmen sie in vielfältiger, ganz unterschiedlicher Form wahr: durch ehrenamtliches Engagement im sozialen Bereich, im Umwelt- und Naturschutz, in den verschiedenen Hilfsorganisationen, in der sogenannten Blaulichtfamilie im Sport oder in der Kultur. In Verbänden und Vereinen, im gesamten vorpolitischen Raum.
Nur den Parteien fällt es zunehmend schwer, Frauen und Männer – vor allem junge Menschen – für ihre Aufgaben und mit ihrer Arbeit zu begeistern. Das gilt nicht nur, aber insbesondere für die Volksparteien CDU / CSU und SPD. Woran liegt das, und war das schon immer so?
Keineswegs! Zunächst in die Junge Union und kurz danach auch in deren Mutterpartei CDU eingetreten bin ich im Sommer 1972. Mitten in einer Zeit heftiger innenpolitischer Auseinandersetzungen und eines Bundestagswahlkampfs, der unter dem Kürzel »Willy-Wahl« bekannt wurde. Besonders umstritten war die neue Ostpolitik von Kanzler Willy Brandt (SPD) unter der Formel »Wandel durch Annäherung«. Das konstruktive Misstrauensvotum vom 24. April 1972, mit dem Brandt das Misstrauen ausgesprochen und an seiner Stelle der Abgeordnete Dr. Rainer Barzel (CDU) zum Kanzler gewählt werden sollte, heizte die politische Stimmung weiter an. Die Abwahl Brandts scheiterte mutmaßlich an zwei gekauften Stimmen. Auf den Straßen und Plätzen der Republik gab es lautstarke Demonstrationen für Brandts Verbleiben im Amt – dann folgte ein Wahlkampf, der mit erbitterter Härte geführt wurde. Hunderttausende strömten in jenen Jahren in die Parteien oder deren Jugendorganisationen, man bekannte sich in aller Öffentlichkeit zu dieser oder jener Partei, viele Autos trugen entsprechende Aufkleber – heute eher eine Rarität.
In den zurückliegenden 50 Jahren habe ich zunächst auf kommunaler Ebene (1975–1999) und dann im Bund (1994–2017) viele Erfahrungen sammeln können – oder sammeln müssen. Je nach Betrachtung. Auf einige hätte ich liebend gerne verzichtet, aber die meisten waren durchaus positiv. Nicht nur innerhalb der eigenen Partei, auch über Parteigrenzen hinweg, und es ist gut, dass Vertrauen und persönliche Sympathie nicht an Parteigrenzen haltmachen müssen. Zu diesen Erfahrungen gehört leider auch, dass nach meiner Beobachtung die Kluft zwischen Wählern und Gewählten im Laufe der Zeit immer tiefer geworden ist. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, die ich in diesem Buch etwas näher beleuchten möchte. Ebenso möchte ich aufzeigen, was wir tun können, um die Kluft nicht noch größer werden zu lassen, um verlorenes Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen.
Manchmal sind es weniger spektakuläre Ereignisse, die prägend sind, als ganz persönliche Erlebnisse und Begegnungen, die bei mir einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben.
Während ich das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt und anschließend an der Universität zu Köln Rechtswissenschaften studiert habe – wobei einige meiner Professoren meinten, ich hätte eine Art Fernstudium absolviert –, arbeitete ich nebenbei für Franz Heinrich Krey, den langjährigen Bundestagsabgeordneten des Rheinisch-Bergischen Kreises, dessen Mandat ich 1994 übernehmen durfte. Für ihn war »Bürgernähe« kein Wahlkampfslogan, sondern tägliche Praxis. Seine Devise: Immer Kuli und Papier dabeihaben, um Wünsche und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu notieren, gut zuhören und nie auf die Uhr schauen. Das schafft Vertrauen.
Im Herbst 2003 beschlossen sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat die Einrichtung einer »Föderalismuskommission«, deren Ziel es war, die Zahl der im Bundesrat zustimmungsbedürftigen Gesetze zu reduzieren, Zug um Zug für mehr Kompetenzen der Länder, insbesondere in den Bereichen Bildung und Beamtenrecht. Co-Vorsitzende waren der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) und der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering.
In meiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender der CDU / CSU-Bundestagsfraktion für die Bereiche Innen- und Rechtspolitik, also auch für das Verfassungsrecht, war ich Obmann einer kleinen Delegation der Unionsfraktion. Die Aufgabenstellung für die Arbeit der Kommission hörte sich einigermaßen schlicht an, aber auch hier steckte der Teufel im Detail. Schon in den ersten unionsinternen Abstimmungsrunden gab es, vorsichtig ausgedrückt, einige Differenzen zwischen den Interessen des Bundes und denen der Länder, also auch zwischen Edmund Stoiber und mir. Und da Nachgeben nicht gerade zu unser beiden Kernkompetenzen gehört, wurde es bisweilen auch etwas heftiger.
Ende des offiziellen Teils. Ein Mitarbeiter des bayerischen Ministerpräsidenten kam auf mich zu und teilte mir zackig mit, der Herr Ministerpräsident wünsche ein Gespräch unter vier Augen. Zwei davon sollten meine sein. Erster Gedanke: Oha. Jetzt gibt es Ärger! Nur nicht einknicken, immer schön auf (Bundes-)Linie bleiben! Und dann kam alles ganz anders: Edmund Stoiber bot mir spontan das Du an, es gab nicht nur Alkoholfreies zu trinken, und es wurde ein langer Abend. Stoiber hat mit einer Detailkenntnis und Leidenschaft diskutiert, die man in der Politik leider viel zu selten antrifft. Er brannte förmlich für seine Überzeugungen und Ideen und warb für die Positionen der Länder mit einer Hingabe, die mich beeindruckt hat – und die mich auch heute noch beeindruckt. Jedes Mal, wenn wir uns treffen. Edmund Stoiber ist Jahrgang 1941. Es ist nicht das Alter, es ist die Einstellung zur politischen Arbeit, die entscheidend ist. Seine Einstellung war – und bleibt – vorbildlich, beeindruckend. Wer Politik als »Job« begreift, der sollte noch einmal in Ruhe darüber nachdenken, ob er die richtige Berufswahl getroffen hat.
Ich habe kein politisches Amt mehr inne, strebe auch kein neues mehr an. Ich habe – so gut wie es mir möglich war – versucht, in allen Ämtern mein Bestes zu geben. Mögen andere entscheiden, ob mir das gut oder doch nur suboptimal gelungen ist. Geblieben ist die Leidenschaft für die Politik. Die Treue zu »meiner« Union, auch wenn ich manchmal mit ihr hadere. So, wie sie gelegentlich auch mit mir gehadert haben dürfte. Aber es war auch nie mein Ziel, Regierungssprecher zu werden. Ich wollte – und will auch heute noch – nur meinen politischen Idealen und Überzeugungen treu bleiben und mich dafür einsetzen, dass die Bürgerinnen und Bürger der Politik wieder mehr Vertrauen entgegenbringen können.
Bergisch Gladbach, im Juli 2022
Bitte keine unnötige Aufregung!
Die Sprache macht den Menschen – die Herkunft macht es nicht!
Aus: My Fair Lady, Musical von Alan Jay Lerner
Ein schöner Herbstabend in einem Hotel im Hochschwarzwald. In dem gut besuchten Veranstaltungssaal des Hauses fiebert das Publikum sowohl einem vorzüglichen Menü als auch der nachfolgenden geselligen Veranstaltung entgegen.
Gut gelaunt begrüßt der Hotelier die »Gäste« des Hauses, wünscht einen interessanten, abwechslungsreichen Abend – aber zunächst einmal von Herzen »Guten Appetit«! Höflicher Applaus, unspektakulärer ist eine Veranstaltung selten eröffnet worden.
Den ganzen Abend über wurde das Publikum bestens unterhalten, überall nur fröhliche Gesichter. Jedenfalls war das der allgemeine Eindruck. Von einem Skandal keine Spur. Dieser Eindruck sollte sich am nächsten Morgen allerdings abrupt ändern.
Beim Frühstück saßen an meinem Nachbartisch zwei Paare, die es jedenfalls zu diesem Zeitpunkt noch waren. Zwei Frauen und zwei Männer. Eine der Damen beklagte sich bitterlich darüber, dass der Hausherr am Abend zuvor nur die männlichen Gäste begrüßt habe, nicht aber auch die weiblichen. Er habe laut und deutlich die »Gäste« begrüßt, also nur den männlichen Teil des Publikums, nicht auch die »Gästinnen«, den weiblichen Teil. Dadurch fühle sie sich ausgeschlossen und diskriminiert, das sei untragbar. An der Sprache erkenne man den Charakter eines Menschen, schließlich gebe es doch aus einem Musical das Zitat »Die Sprache macht den Menschen, die Herkunft macht es nicht!« Betretenes Schweigen.
Das Zitat kannte ich, es stammt aus My Fair Lady. Das Wort »Gästinnen« hatte ich allerdings noch nie gehört. Ich hatte sogar meine Zweifel, ob es das Wort überhaupt gibt, genauer gesagt, ob es im Duden zu finden ist. Spontaner Griff zum Smartphone, und dank Google konnte ich schnell finden:
»Gästin klingt auch in unseren Ohren ungewohnt, steht aber als feminines Pendant zu Gast im Duden. [Oha …] Im Allgemeinen wird das Wort Gast bzw. Gäste (aber) als geschlechtsneutraler Oberbegriff [Aha …] empfunden, vergleichbar mit dem Wort Person.« Und – Überraschung – selbst Katia Mann, verheiratet mit dem Schriftsteller Thomas Mann, verwendete dieses Wort ebenso wie die Gebrüder Grimm. Jetzt war ich eines Besseren belehrt, die Wörter »Gästin / Gästinnen« gibt es tatsächlich. Bleibt die Frage: Muss man sich wirklich ernsthaft darüber empören, dass der Hausherr nur die »Gäste« begrüßt hatte und nicht gendergerecht die »Gästinnen und Gäste«? Hat der Hotelier durch seine Ausdrucksweise, die vermutlich 99 Prozent aller Personen in gleicher Lage auch benutzt hätten, die am Vorabend anwesenden Damen tatsächlich diskriminiert? Wenn ja, warum ist dieser Fauxpas allen anderen Damen – die am Vorabend in der Mehrzahl waren – offensichtlich gar nicht aufgefallen? Ich selber saß am Vorabend mit drei Damen an einem Tisch, keine einzige kritisierte die Wortwahl »Gäste«.
Indes ging die Debatte am Nachbartisch munter weiter. Allmählich pendelte sich die Lautstärke auf einem beachtlich hohen Niveau ein mit der Folge, dass immer mehr »Gästinnen und Gäste« wider Willen zuhören mussten. Offensichtlich wurde die Debatte auch deshalb heftiger, weil weder der Partner der empörten Tischnachbarin noch das andere Paar bereit waren, sich gleichfalls zu empören. Kurzum: Ein Wort gab das andere. Irgendwann verließ die nicht empörte Nachbarin den Tisch unter Protest, offenkundig deshalb, weil sie zum einen nicht gewillt war, den Gegenstand des Streites als echtes Problem anzusehen und noch länger darüber zu debattieren, weil sie sich zum anderen weigerte, sich entgegen ihrer eigenen Meinung auf Wunsch zu empören, und weil sie sich drittens das Frühstück durch die lautstarke Diskussion nicht länger verderben lassen wollte.
Hand aufs Herz, liebe Leserin, lieber Leser: Wer von Ihnen hat schon einmal das Wort »Gästin« gehört oder sogar benutzt? Wenn nicht, würden Sie denn fortan – um nicht unter Diskriminierungsverdacht zu geraten – bei passender Gelegenheit dieses Wort wählen, oder es doch bei der herkömmlichen Wortwahl belassen?
Natürlich ist es richtig, dass wir mit der Sprache in Wort und Schrift sorgsam umgehen sollten! Unsere Worte sind ausformulierte Gedanken und mit unserer Sprache sollten wir niemanden beleidigen, ausgrenzen, verletzen, diskriminieren. Aber müssen wir deshalb aus Formulierungen wie »Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter« schriftlich und phonetisch unbedingt »Mitarbeiter:innen«, »MitarbeiterINNEN« oder »Mitarbeitende« machen? Wobei sich bei der letzten Wortwahl viele Fragen stellen, zum Beispiel ob der Begriff auch dann noch richtig ist, wenn sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im wohlverdienten Urlaub befinden. Oder krankheitsbedingt nicht arbeiten können?
Auffallend ist auch, dass mittlerweile in den meisten TV-Sendungen streng auf eine gendergerechte Sprache geachtet wird, aber keineswegs konsequent: Begriffe wie »Extremisten« oder »Aktivisten« werden weiterhin gerne benutzt. Am 15. Mai 2022 wurde im Hörfunk zunächst über die Arbeit der »Wahlhelfer« berichtet, aus denen dann eine Stunde später »Wahlhelfende« wurden. Ganz originell war der Sender HR-Info am 21. Mai 2022, der nach einem Besuch des Ministerpräsidenten von NRW, Hendrik Wüst, in der von einem Tornado heimgesuchten Stadt Paderborn von Begegnungen des Landesvaters mit »Anwohnern und Helfenden« berichtete. Da hatte man ganz offensichtlich die Orientierung verloren, ob nun gegendert werden sollte oder nicht. Ich fürchte, mittlerweile wird mehr Zeit damit verbracht, Texte aller Art gendergerecht zu formatieren, als auf deren inhaltliche Aussagekraft zu achten. Und der Kfz-Hersteller Audi muss sich vor Gericht von einem klagenden Mitarbeiter des VW Konzerns, der nicht als »Audianer_in« angeschrieben werden möchte, die – berechtigte – Frage gefallen lassen, ob denn Sätze des Konzerns wie »Der_die BSM-Expertin ist qualifizierte_r Fachexpert_in« unbedingt notwendig sind, um auch nur den Anschein mangelnder Sprachsensibilität tunlichst zu vermeiden. Der offensichtlich alltagstaugliche Richter schlug Audi vor, den Kläger zukünftig »halt normal« anzuschreiben, was Audi jedoch ablehnt. In einer Handreichung »Gendergerechte Sprache« der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen wird die These vertreten, dass zunächst ungewohnt erscheinende Formulierungen – siehe Fall Audi – nach einer gewissen Zeit »zur Normalität« würden.
Nein, hier geht es gerade nicht um einen natürlichen Sprachwandel aus der Mitte der Gesellschaft, hier wird die Sprache »durch politischen und institutionellen Druck von oben« (FAZ) gewandelt.
Denn es war nicht der Staat, es waren nicht heillos überforderte Politikerinnen und Politiker, die Gendersternchen, Doppelpunkt in einem einzigen Wort oder das große Binnen-I erfunden haben oder gar deren Benutzung vorschreiben würden! Es hat auch keinen natürlichen Sprachwandel gegeben, in dessen Verlauf derartige Wortschöpfungen entstanden wären. Es ist vielmehr die »Kombination von Bitten und Befehlen« (FAZ), namentlich an unseren Hochschulen, die ihre »Studierenden« auf »geschlechtergerechte Texte« festlegen. Bei Verweigerung, ganz gleich ob vorsätzlich oder nur fahrlässig, natürlich mit negativen Konsequenzen bei der Notengebung.
Der Rat für deutsche Rechtschreibung spricht sich übrigens gegen eine Verpflichtung zum Gendern aus, weil es der Klarheit der Sprache eher schade als diene. Wörtlich heißt es in dessen Empfehlung vom 26. März 2021: »Der Rat (…) bekräftigt (…) seine Auffassung, dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll und sie sensibel angesprochen werden sollen. Das ist allerdings eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe, die nicht allein mit orthografischen Regeln und Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden kann. Das amtliche Regelwerk gilt für Schulen sowie für Verwaltung und Rechtspflege. Der Rat hat vor diesem Hintergrund die Aufnahme von Asterisk (›Genderstern‹), Unterstrich (›Gendergap‹), Doppelpunkt und anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinnern in das Amtliche Regelwerk der Deutschen Rechtschreibung zu diesem Zeitpunkt nicht empfohlen.«
Das wiederum hinderte den hoch angesehenen Duden nicht daran, sogar dem Wort »Spitzbübin« den gendergerechten Ritterschlag zu verleihen, obwohl das Wort ein Widerspruch in sich ist. Bislang fand das Wort »Bube« richtigerweise nur in Verbindung mit jungen männlichen Wesen Verwendung. Es handelt sich übrigens um den gleichen Duden, der »Bub« als »Kind männlichen Geschlechts« charakterisiert. Wenn das richtig ist, wie kann es dann eine »Spitzbübin« geben? Fragen über Fragen! Und da schon 2014 die Zahl der Genderprofessuren in Deutschland, Österreich und der Schweiz diejenige der Professuren in Altphilologie locker überstiegen hatte, vermute ich: Da kommt noch einiges auf uns zu.
Nicht aber in diesem Buch.
Gerne leiste auch ich meinen ganz persönlichen Beitrag zum Thema Gleichberechtigung – auch ohne Zwang von wem auch immer. Aber Genderstern oder ein Doppelpunkt im Wortinneren kommen hier ganz bewusst nicht vor. Eine künstlich veränderte Sprache möchte ich auch nicht in Schriftform nutzen. Ich möchte meine Gedanken so formulieren, wie es – auch heute noch – dem allgemeinen Sprachgebrauch entspricht. Und sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, in diesem Buch ein Maskulinum entdecken, dann darf ich Ihnen versichern, dass es sich um ein generisches handelt – natürlich nicht um ein spezifisches. Es sei denn, dass sich aus dem Kontext etwas anderes ergibt.
Und wenn Sie einverstanden sind, geht es ab sofort nur noch darum, warum nach meiner Beobachtung und Erfahrung die Distanz zwischen Wählerinnen und Wählern einerseits und den Gewählten anderseits in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten leider immer größer geworden ist und was wir dagegen tun können, damit sich das wieder ändert.
Und sollten Sie, liebe Leserin, demnächst bei irgendeiner Veranstaltung wieder mit »Liebe Gäste« begrüßt werden, bitte regen Sie sich nicht auf. Es gibt so viele andere Dinge und unhaltbare Zustände, über die wir uns alle aufregen können. Und das nicht grundlos.
»Angst um die Zukunft meiner Kinder«
Lass deine Taten sein wie deine Worte. Und deine Worte wie dein Herz.
Ludwig Uhland
Wir stehen vor großen Problemen und Herausforderungen, national und global. Der unaufhaltsam erscheinende Klimawandel, die Coronapandemie mit all ihren gesundheitlichen, ökonomischen und psychosozialen Folgen, die vielen politischen, ethnischen und religiösen Konflikte und nicht zuletzt der Überfall Putins auf die Ukraine sind hierfür nur wenige, aber besonders prägnante Beispiele. Spätestens am 24. Februar 2022, als die russischen Streitkräfte ihren Angriff auf die Ukraine starteten, starb die Hoffnung, dass es in Europa nie wieder Krieg geben würde.