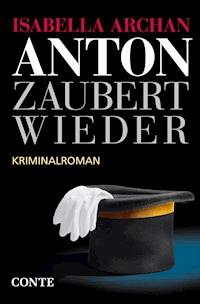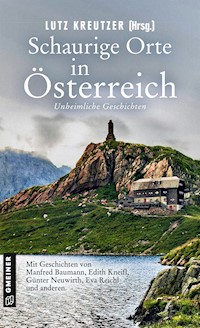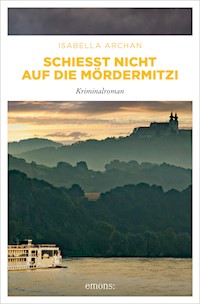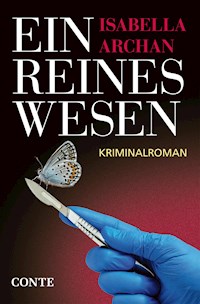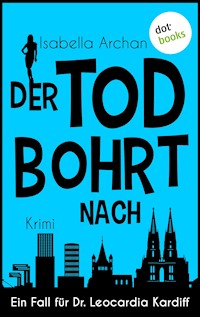0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Dr. Leocardia Kardiff
- Sprache: Deutsch
Mörderjagd im Zahnarztkittel: Die rasante Krimikomödie »Tote haben kein Zahnweh« von Isabella Archan jetzt als eBook bei dotbooks. Sie fühlt dem Bösen auf den Zahn … Dr. Leocardia Kardiff ist Zahnärztin mit Spritzenphobie – und zu ihrem Unmut macht die selbstverordnete Hypnosetherapie nur dürftige Fortschritte. Doch eigentlich hat sie ein viel dringlicheres Problem: Leo ist auf die Leiche einer Seniorin gestoßen, die augenscheinlich ermordet wurde! Eigentlich beginnt jetzt die Arbeit der Polizei … doch als sie mitbekommt, dass der Toten eine Goldbrücke im Gebiss entfernt wurde, muss sie als Frau vom Fach natürlich ermitteln – ganz zum Unmut des verflucht starrköpfigen und leider auch entwaffnend attraktiven Hauptkommissars Jakob Zimmer …! »Ein ungewöhnlicher und sehr witziger Krimi. Die Hobbyermittlerin allein ist schon preisverdächtig«, urteilt der Saarländische Rundfunk. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der humorvolle Köln-Krimi »Tote haben kein Zahnweh« von Isabella Archan ist der Auftakt ihrer Reihe humorvoller Krimis um Dr. Leocardia Kardiff – die Zahnärztin mit Spritzenphobie. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie fühlt dem Bösen auf den Zahn … Dr. Leocardia Kardiff ist Zahnärztin mit Spritzenphobie – und zu ihrem Unmut macht die selbstverordnete Hypnosetherapie nur dürftige Fortschritte. Doch eigentlich hat sie ein viel dringlicheres Problem: Leo ist auf die Leiche einer Seniorin gestoßen, die augenscheinlich ermordet wurde! Eigentlich beginnt jetzt die Arbeit der Polizei … doch als sie mitbekommt, dass der Toten eine Goldbrücke im Gebiss entfernt wurde, muss sie als Frau vom Fach natürlich ermitteln – ganz zum Unmut des verflucht starrköpfigen und leider auch entwaffnend attraktiven Hauptkommissars Jakob Zimmer …!
»Ein ungewöhnlicher und sehr witziger Krimi. Die Hobbyermittlerin allein ist schon preisverdächtig«, urteilt der Saarländische Rundfunk.
Über die Autorin:
Isabella Archan, 1965 in Graz geboren, lebt als Schauspielerin und Autorin humorvoller Kriminalromane in Köln. Neben Theaterengagements ist sie immer wieder in Rollen in Film und Fernsehen zu sehen, u. a. im »Tatort« und in der »Lindenstraße«. Ihre »MordsTheater«-Lesungen erfreuen sich großer Beliebtheit.
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre humorvolle Krimireihe um die Hobbyermittlerin Dr. Leocardia Cardiff: »Tote haben kein Zahnweh«, »Auch Killer haben Karies« und »Der Tod bohrt nach«.
Die Website der Autorin: www.isabella-archan.de
Die Autorin bei Facebook: www.facebook.com/archankrimis/
Die Autorin auf Instagram: www.instagram.com/isabella_archan/
***
eBook-Neuausgabe Februar 2023
Copyright © der Originalausgabe 2016, Emons Verlag GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München, unter Verwendung eines Bildmotivs von Adobe Stock/SimpLine
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-472-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tote haben kein Zahnweh« an: lesetipp@dotbooks.de (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Isabella Archan
Tote haben kein Zahnweh
Kriminalroman
dotbooks.
Dieses Buch ist Gabriela & Dr. Cornelia Assaf gewidmet.
Mitunter sitzt die ganze Seele in eines Zahnes dunkler Höhle.
Wilhelm Busch
TEIL 1 ‒ AUGEN SCHLIESSEN
KAPITEL EINS
Hedda Kernbach sah den Tod in weißem Strick.
Vielleicht, weil sie ihn sich immer so gewünscht hatte.
Nicht so merkwürdig, so eigenartig und schräg, aber in ihrer Phantasie hatte sie dem Sterben immer schon einen reinen und auch heiteren Anstrich geben wollen. Warum also nicht so sterben, als hätte eine Strickomi ihre letzte Arbeit an den Herrn Sensenmann verkauft? Doch diese Handarbeit hätte sie früher besser hinbekommen.
Sie war als kleines Kind bei ihren Pflegeeltern in Hasenthal an der Mur sehr begabt im Umgang mit den langen, dicken Nadeln gewesen und hatte vom Strickumhang bis Strickpüppchen alles aus den dicken Wollknäueln gestrickt.
Von den vielen Schafen ihrer Ersatzfamilie war weiße Wolle leicht zu bekommen gewesen. Die kratzte zwar, aber hielt Nässe und Kälte ab. Dort in Hasenthal, in der Fremde, wo sich tatsächlich Fuchs und Hase Gute Nacht sagten, weit weg von ihrem Zuhause in Köln, hatte sie ihre Liebe zum Stricken und dem Weiß entdeckt.
Wegen der unschuldigen Reinheit war so ein Weiß für die kleine Hedda das Allerschönste gewesen. Weiß wie die Wolken, die am Himmel vorüberzogen und sie nicht mitnehmen konnten, zurück zu Mama und Papa, weiß wie die Schafe, die vor dem einfachen Bauernhaus das grüne Gras zupften. Hedda mochte auch die anderen Farben der Palette, nur Schwarz klammerte sie aus, Schwarz war in ihrer kindlichen Seele die Farbe des Krieges, des Hungers und des Alleinseins gewesen.
Weiß war Sanftmut, Geduld und stilles Träumen. Bis heute, bis zur alten Hedda. Nur das Stricken hatte sie schon vor Jahrzehnten aufgegeben.
Nun, wie es schien, hatte auch Heddas Mörder eine Vorliebe für weiße Strickwaren.
Sein gesamter Kopf war hinter einer bizarren weiß gestrickten Maske verborgen. Doch das Einzelstück war nicht besonders praktisch. Die Augenschlitze wirkten zu eng, und der Mundbereich war vollkommen dicht. Alles in allem eine dilettantische Handarbeit.
Außerdem, wer bitte schön hatte schon jemals vom schwarzen Mann mit blütenweißer Maske gehört? War Heddas Mörder ein Purist erster Güte, der es selbst bei seinen Verbrechen ablehnte, im gängigen Schwarz aufzutreten? Wollte er sich von all den anderen schwarzen Männern unterscheiden, die an diesem Mittwochmittag unterwegs waren, um in Köln alten Damen die Kehle aufzuschlitzen?
Wie auch immer, die weiße Strickmaske löste in der sterbenden Hedda Kernbach eine solche Heiterkeit aus, dass sie ihre zusammengepressten Lippen löste und zu lachen versuchte.
Der hohe Schwall von Blut, der daraufhin aus der klaffenden Wunde an ihrem Hals schoss, ließ das weiße Strickmaskengesicht nach hinten zucken. Der Mörder mochte anscheinend nichts weniger als rotes Blut, das sich nur mit kaltem, am besten eisig kaltem Wasser aus dem weißen Strick herauswaschen ließ. Er wich dem Schwall nach oben aus, verschwand aus Heddas Blickfeld. Kaum versiegte der Blutschwall aus ihrer Kehle, tauchte sein Strickmaskenkopf wieder auf, seine Augen hinter den schmalen Schlitzen zusammengekniffen, was graue Schattenlinien im endlosen sauberen Weiß hinterließ.
Heddas Kehlkopf setzte noch mal zu diesem ultimativen Lachanfall an, der aber aus rein anatomischen Gründen nicht mehr möglich war. Das fein geschliffene Messer des weißen Strickmaskenmörders hatte ihren Schildknorpel in zwei fast gleich große Hälften geteilt.
Alles, woran sich Hedda erinnerte, war ein zweimaliges Klingeln an der unteren Haustür. Sie hatte den Summer gedrückt, wieder mal ohne zu fragen, wer da unten denn hereinwollte. Leichtsinnig, würde ihre beste Freundin sagen, aber in Wahrheit hörte Hedda schon schlecht und wollte nicht mehrfach nachfragen müssen. Sie hatte ohnehin mit dem Paketboten gerechnet, sie war meistens zu Hause und nahm die Päckchen der Nachbarn an. Mit dem jungen Mann ließ sich gut über das Wetter und die Welt im Allgemeinen plaudern.
Hedda war zur Eingangstür ihres Appartements gegangen, hatte geöffnet, leichtsinnig, aber leichten Sinns. Dort stand der Maskenmann wie eine schlechte Kopie aus einer Horrorkomödie, mit dunkelgrauem Mantel und weißer Strickmaske und gezücktem Messer. Hedda hatte ungläubig auf die Gestalt gestarrt, viel zu überrascht, um noch zu schreien oder die Tür wieder zuzuschlagen. Der Strickmaskenmann hatte Hedda wortlos durch den Flur ins Wohnzimmer gedrängt, bis Heddas Knie am Vorstelltisch zum Halten gekommen waren.
Sie hatte auch da noch statt Angst nur Verwunderung verspürt, ja, auch schon einen Schalk im Nacken, glaubte an den schlechtesten aller Scherze, an einen schiefgegangenen Witz ihrer Skatdamen. Die waren für ihren manchmal seltsamen Humor bekannt.
Sie setzte zu der Frage an, was denn bitte dieser weiße Witz von einer Strickmaske sollte und überhaupt dieser komische Überfall, da schoss die Hand mit dem Messer nach vorn und leicht schräg nach oben. Hedda spürte es wie einen harten Schlag an ihrem Hals, dann ein Brennen und Ziehen. Es wurde dunkelgrau um Hedda, die Wände schienen sich zu drehen, und sie kippte seitlich weg.
Ihr Aufprall wurde vom Perserteppich vor dem Vorstelltisch abgemildert. Ihr Blick heftete sich an ihren Lüster oben an der Decke. Seine goldenen Engelchen schwankten leicht, und Hedda kam sich schon halb im Himmel vor, da tauchte das maskierte Mördergesicht vor ihr auf und verursachte Heddas missglückten Versuch eines letzten Lachens.
Die Geräusche, zu denen sie noch fähig war, kamen ihr wie die Schreie eines Dinosauriers vor. Vielleicht ein Velociraptor ‒ die hatte sie in Spielbergs Trilogie besonders gemocht. Heddas Humor hatte sich im Laufe der Jahre dem ihrer Skatfreundinnen angeglichen, ihre Heiterkeit steigerte sich bei dem Gedanken, gleich einem prähistorischen Untier abzutreten. Würde sie auch in wenigen Augenblicken ausgestorben sein, sie hinterließ keine eigenen Kinder.
Hedda konnte den Schnitt an ihrer Kehle nicht sehen, aber sie spürte ihn wie einen zu engen Kragen, der Druck auf die Gurgel ausübte. Das Blut, das mit schneller Geschwindigkeit aus der Wunde floss, war warm, weshalb es Hedda so vorkam, als wäre ein heißer Lappen um ihren Hals gewickelt. Apropos Blut: Den Fleck würde keine Reinigung mehr aus dem Perser rauskriegen, da ging sie jede Menge letzter Wetten ein.
Zu Heddas Heiterkeit, als sie so am Boden lag und langsam in die andere Welt hinüberglitt, gesellte sich ein Gefühl der Liebe aus schwer pumpendem Herzen.
In Liebe gehen, das hatte sie immer gewollt und würde sie sich auch nicht nehmen lassen. Mord und Mörder, Strickmaskenmann hin oder her, von diesem Bösewicht würde sie sich nicht davon abbringen lassen, ihre Gefühlslage bis zur letzten Sekunde in der Hand zu behalten.
Sie dankte einem Gott, dem sie vielleicht bald persönlich die Hand schütteln würde. Sie dankte dem Schicksal, das ihr, nach der harten Kindheit in den letzten Kriegsjahren, nicht nur gute Pflegeeltern und eine solide Ausbildung geschenkt, sondern sie auch mit ihrer großen Liebe zusammengeführt hatte. Wie hatte sie jeden Tag mit Erich genossen, seine Liebe, den Sex und, ja, auch sein Geld aus der Pudding-Dynastie Kernbach, das ihnen beiden später ein unabhängiges Leben ohne Verpflichtungen und Arbeitsstress ermöglicht hatte.
Auch Erich würde sie ja gleich Wiedersehen, so sagten es doch die Rückkehrer, die, deren Zeit noch nicht gekommen war, die zurückgeschickt worden waren und von dem Licht und ihren Lieben erzählten, die sie abholen wollten. Hedda hoffte, ihr missglückter Lachanfall hatte diese Geister nicht verschreckt und vertrieben, denn so ganz allein hinüberzumüssen, machte auch der heiteren Hedda ein wenig Angst.
Ein paar gute Jahre hätte sie schon gern noch gehabt. Sie fühlte sich mit fünfundsiebzig noch rüstig und agil. Wohltätigkeit, Spaziergänge, Skatabende und die warme Sonne im Landkartengesicht. Gesund bleiben, solange es geht. Doch es kommt immer anders, als man denkt, dieses Sprichwort fiel ihr jetzt ein, und mit aufgeschnittener Kehle sollte man keine Pläne für den nächsten Tag mehr machen.
Zu guter Letzt versuchte sie sogar, diesem Schneeweißchen-Mörder, der ihr trotz seiner Untat doch einen Abgang in exzentrischer Heiterkeit ermöglichte, noch etwas Positives abzuringen. So kann man wirklich abtreten, oder, Frau Kernbach?
»Umpfl«
Ein dumpfer Laut über ihr ließ Heddas letzten Gedankenstrom anhalten. Sie konzentrierte sich wieder auf das vermummte Strickgesicht.
Der böse weiße Maskenmann hatte seine Schlitzaugen weit aufgerissen, und jetzt lag ein eigenartiger Glanz in seinem Blick. Seine rechte Hand tauchte in Heddas Blickfeld auf. Er trug dunkelgraue Handschuhe mit einem weißen Muster, als ob er alle Mörderaccessoires aufeinander hätte abstimmen wollen. In seinen Fingern hielt er ein kleines Messer, das Hedda an ihr eigenes erinnerte, mit dem sie in der Küche Zwiebeln schnitt.
Wer hätte gedacht, dass man damit auch Kehlen schneiden konnte?
Die Hand fuhr nach unten und zwang ihren Kiefer auseinander, dann vergruben sich die Finger in Heddas Mund. Das Messer fand seinen Platz zwischen Heddas Zähnen, und Hedda konnte fühlen, wie er damit gegen ihr Zahnfleisch drückte und versuchte, etwas anzuheben, auszustemmen. Keine Schmerzen, Gott sei Dank, aber ihre Heiterkeit bekam Risse.
Was kam denn jetzt noch?
Der Schneeweißchen-Mörder keuchte, und der Druck auf Heddas Kiefer nahm immens zu. Was machte der Maskenmann dort nur? Neugier und Erstaunen, eine letzte große Verwunderung.
Holte der Maskenmann einen Zahn aus ihrem Kiefer?
Sie hatte wertvolle Gemälde und jede Menge Goldschmuck in ihrer Wohnung. Dazu kam ihre Pelzmantelsammlung, immerhin achtzehn an der Zahl, jedes Weihnachten einen von Erich, bis sie sich beide mit dem Tierschutz zu beschäftigen begonnen hatten und Hedda lieber für lebende Tiere spendete, als tote an ihrem Körper zu tragen. Aber der Mann war so gierig, auch noch das Zahngold aus ihrem Mund zu stehlen. Oder wollte er einen ihrer Beißerchen als Trophäe auf sein Küchenbord stellen?
Hedda hörte einen lauten Knacks. Der Druck auf ihren Kiefer ließ nach. Die Finger verließen ihren Mund, ihre Lippen schlossen sich. Sie konnte weder das Gesicht mit der Maske noch die behandschuhte Hand mit dem Messer sehen. Vielleicht hatte der Mörder nur eine Schraube aus Heddas Gebiss entfernt, um sie bei sich selbst einzusetzen, weil ihm in seinem Mörderhirn doch sicher eine fehlte?
Das war doch glatt der nächste Witz an diesem Todestag von Hedda Kernbach. Anatomisch unmöglich, aber mit Willenskraft und einer letzten Zuckung doch machbar, fing Heddas Mund zu schmunzeln an. Dazu ein Glucksen und heiseres Röcheln, das komisch gemeint war und auch dem Mörder mit der weißen Strickmaske nicht entging.
Sein rundes Strickmaskengesicht kam zurück in Heddas Blickfeld, und auch ohne seine genauen Züge sehen zu können, war eindeutig klar, dass er sich darüber jetzt maßlos ärgerte. Gut so.
Die grau-weiß besternte Handschuhhand tauchte ebenfalls wieder auf. Diesmal hielt sie ein Rohr oder eine Rolle in den Fingern. Hatte der Mörder denn sämtliches Werkzeug aus seiner Schublade mitgebracht?
»Dummpftesmpftaltesmpftstück, du!«
Dem Maskenmann fehlte ganz eindeutig eine freie Stelle um den Mund herum, seine Worte klangen dumpf und für Hedda völlig unverständlich. Gern hätte sie einen weiteren Witz dazu losgelassen, aber für Worte reichte es wirklich nicht mehr.
Das Rohr oder die Rolle kam auf Hedda zu, wurde in ihren Mund gedrückt, und das war endgültig.
Heddas Seele löste sich sanft vom Körper, und die Stille danach wirkte vollkommen humorlos.
KAPITEL ZWEI
Ich schwebe in einer Art Nichts.
Nicht gar nichts, aber ein wenig Nichts.
Außer laufenden Gedanken, die kann man auch im Nichts nicht aussperren. Ich kann es zumindest nicht.
Meine Gedanken laufen.
Trippeln wie eine Horde Ameisen, hin zu mir, vor mir davon und am Ende über mich. Ich atme und fühle dieses kleine Nichts. Es kitzelt und macht mir ein bisschen Angst. Aber damit kann ich gut leben.
Etwas mehr Angst habe ich vor dem Geräusch eines Zahnarztbohrers.
Ich fürchte mich auch ein wenig vor den weißen Kitteln der Ärzte. Allgemein, nicht nur, wenn es sich um Zahnärzte handelt.
Ein richtig flaues Gefühl im Magen, Herzklopfen und Schweißperlen auf meiner Stirn bekomme ich allerdings bei Spritzen.
Ich visualisiere mir eine in mein Nichts.
Mein rechtes Augenlid zuckt, meine Atmung wird schneller, und ich muss mich zusammenreißen, um nicht auf der Stelle auf und davon zu laufen. Weg von der Liege, raus aus dem Zimmer. Wie ein kleines Kind vor dem schwarzen Mann.
»Langsam und tief einatmen, Dr. Leo«, sagt mein Hypnosetherapeut zu mir. Seine Stimme kommt zu mir wie die Flügel einer Libelle an einem Sommerabend am See meiner Kindheit.
Wow! Hypnose macht mich poetisch.
Ich mache diese Hypnosetherapie wegen meiner Ängste.
»Du bist so tief in der Entspannung, dass nur noch meine Stimme zu dir dringt, meine Stimme, die dir sagt, dass alles gut ist. Alles.«
Ich bin in verschiedenen Therapien, seit dreißig Jahren, mit kurzen Unterbrechungen in der Zeit, als ich durch Portugal trampte, und später, als meine Töchter zur Welt kamen, und ich habe weiß Gott Fortschritte gemacht. Doch niemals habe ich mich so leicht und frei gefühlt wie während dieser Tiefenentspannung.
Früher konnte ich schon mal beim Aufziehen einer Spritze das Bewusstsein verlieren oder während einer Behandlung zu schluchzen beginnen. Heute ist es nur mehr das Herzklopfen, das schnelle Atmen, der Schweiß.
Damit kann ich umgehen.
Ich bin Zahnärztin von Beruf.
Ich bohre Zähne auf, und ja, ich trage in meiner Praxis manchmal einen weißen Kittel. Spritzen sind mein Alltagsgeschäft und meine tägliche Überdosis Adrenalin zugleich.
Die Stimme meines Hypnosetherapeuten wogt über mein getrübtes Tagesbewusstsein wie Wellen über einen Strand. Sharif El Benna ist Tunesier und seit dreißig Jahren in unserem Land. Wahrscheinlich kam er nach Deutschland, als ich meinen Hintern mit vierzehn das erste Mal auf einem Sessel eines Gesprächstherapeuten für Teenager wetzte.
Sharif hat eine weiche Stimme mit einem leicht gerollten R, und sein S ist lang und scharf wie das Schwert eines Wüstenpiraten. Doch er macht mir überhaupt keine Angst. Er nennt mich Dr. Leo, und wenn ich auf seinem breiten Behandlungssofa niedersinke, ist es, als würde ich in ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht eintauchen. Ein süßlich-orientalischer Duft treibt durch den Raum, und ich habe mich schon oft gefragt, ob Sharif El Benna in den hinteren Zimmern der großen Wohnung auch wohnt und kocht.
Ich traue mich nicht zu fragen, will das Verhältnis von Therapeut und Patient nicht ins Persönliche gleiten lassen. Zumal er mich nie nach dem Warum meiner Ängste gefragt hat, sondern mich nur in die innere Tiefe führt, in der jede Veränderung möglich werden kann.
Atme, Dr. Leo. Atme und lass alles fließen …
Wenn es in meinem Kopf nur nicht immer so trippeln und trapsen würde.
Dr. Leocardia Huberta Kardiff, reiß dich zusammen und entspanne dich.
Leo ist besser als Leocardia.
Dr. Leo ist besser als Dr. Leocardia Kardiff.
Wirklich alles ist besser, Huberta. Die Menschen, die meinen zweiten Vornamen kennen, kann ich an einer Hand abzählen.
Mein Vater, Dr. Gerwald Hubertus, lebte bereits von meiner Mutter getrennt, als sie mit mir schwanger wurde, und sie hatte schon wieder ihren Mädchennamen Kardiff angenommen. Meine Mutter wollte meinen Vater trotz der Schwangerschaft nicht zurück, auch wenn die beiden noch lange Zeit nach ihrer Trennung Sex miteinander zu haben pflegten. Klar, wie sollte ich sonst entstanden sein, an den Heiligen Geist glaubt niemand in meiner Familie, und der Klapperstorch war’s auch nicht. Dr. Hubertus aber wollte irgendwie ein Teil des Lebens seiner Tochter sein.
Somit blieb nur der in Amerika beliebte Brauch, den Nachnamen des Erzeugers als zweiten Namen des Kindes einzusetzen.
Warum mir meine Mutter zusätzlich als Erstnamen Leocardia aufdrückte, hat sie mir bis heute nicht verraten. Um ehrlich zu sein, ich habe sie nie danach gefragt.
Die Zeit mit Papa Gerwald verbrachte ich als kleines Kind hauptsächlich in seiner Zahnarztpraxis. Meistens verkroch ich mich in seinem Büro, mit angezogenen Knien unter dem Schreibtisch, meine Puppe Popsi an mich geklammert. Ich zählte die abertausend Sekunden, bis mich Mama wieder abholen kam. Gedämpft klang durch die Tür das hohe, ziehende Geräusch des Bohrers an mein Ohr. Oft verbunden mit kleinem, aber durchdringendem Wehklagen der Patienten.
Wenn Papa mit einem Patienten fertig war, kam er ins Büro, um seine kurzen Pausen mit mir zu verbringen, und ich dachte jedes Mal, wirklich jedes Mal, jetzt wäre ich an der Reihe, mit dem Bohrer gequält zu werden. Um mich zu beruhigen, hatte er immer eine Spritze mit dabei. Natürlich nicht für mich, sondern für die arme Popsi. Damit wollte Papa mir zeigen, dass ich bei einer seiner Behandlungen niemals Schmerzen zu befürchten hätte. Er hob meine Puppe hoch ‒ sag schön Ahhh, du Püppchen ‒ und drückte die Spritze in Popsis weiche Plastiklippen. Würde ich sie heute wiederfinden, wäre ihr Mund mit Einstichlöchern übersät.
Dabei zwinkerte er mir vertrauensvoll zu.
Wenn ich nur daran denke, wird mir sofort übel. Keine Therapie wird das je ändern können.
Trotzdem bin ich nach einem heftigen Streit mit dem neuen Freund meiner Mutter mit vierzehn ganz zu Papa Gerwald gezogen. Er nahm mich wortlos bei sich auf, der Grund interessierte ihn nicht. Ab da war klar, dass ich später auch Zahnmedizin studieren und seine Praxis übernehmen würde. Das Thema wurde nie in Frage gestellt, und ich kam wegen meiner Spritzenphobie in Therapie. Von persönlichen Tochter-Vater-Gesprächen hielt mein Papa nichts. Als er die große Praxis in Köln-Sülz zusammen mit dem ehrgeizigen Dr. Frederic Lang übernahm, arbeitete ich in den Schulferien als Praktikantin bei ihm.
Nach meinem Studium war ich immerhin zwei Jahre in einer Zahnklinik am Rheinauhafen, aber als Dr. Gerwald Hubertus wegen einer beginnenden Parkinsonerkrankung früher als gedacht in den Ruhestand trat, nahm ich naht- und widerstandslos die Stelle meines Vaters ein. Dazu kam, dass ich für eine Familie zu sorgen hatte und man in einer gut gehenden Praxis wesentlich mehr verdienen kann als im Klinikum.
Beim ersten Privatpatienten fiel ich mit der Spritze in der Hand in Ohnmacht, aber außer diesem einen Eklat schlage ich mich nach außen hin ganz gut.
Gern würde ich Sharif El Benna alle diese Dinge erzählen, aber er fragt ja nie. Manchmal, so wie heute, traue ich ihm allerdings zu, dass er meine Gedanken liest.
Ein toller Mann. Aber vergeben. Ich übrigens auch. Eigentlich.
Ich bin vierundvierzig und in der Blüte meiner weiblichen Existenz. Zumindest lese ich das immer in den Zeitschriften, die im Wartezimmer meiner Praxis ausliegen. Vierundvierzig, stolz und selbstständig, im Feuer der mittleren Frauenjahre und noch Lichtjahre vom Klimakterium entfernt. Naja.
Ich …
»Wenn ich das nächste Mal mit den Fingern schnippe, erwachen Sie frisch und erholt und sind wieder voll da, Dr. Leo.«
Sharif schnippt, und ich bin wieder voll da.
Mein erster Blick geht zum Handy, nein, seit einer Woche Smartphone. Mein Geliebter, Magister Heinz Lerbaum, hat es mir geschenkt. Es singt den Song »Candy« von Robbie Williams, wenn er anruft.
Sharifs weitläufiger, in weichen Farben bemalter Behandlungsraum in der Brahmsstraße 4 in Lindenthal ist bei dreimaligem Umsteigen von der Linie 7 auf die 13 auf die 18 etwa fünfundzwanzig Minuten von meiner eleganten Praxis am Nikolausplatz in Sülz entfernt. Dreimal umsteigen klingt viel, aber ich liebe es, die Straßenbahn zu nehmen. Jedes Mal komme ich mir vor wie ein Tourist auf Sightseeingtour in den Kölner Veedeln. Entspannt, wie ein Reisender im Bummelgang. Sonst brauche ich den Wagen, ich lebe in einem Haus in Junkersdorf, mein Alltag lässt selten Mußestunden zu.
Wie immer verbeugt sich Sharif mit gefalteten Händen vor mir, legt dann eine Hand auf sein Herz und blinzelt mir zu. Ich schwärme in diesem Moment ein klein wenig mehr für ihn und fühle mich bereit für den Arbeitsnachmittag und die Patienten.
Diese Arbeitstage nach Ostern sind immer besonders voll, und bis übernächste Woche muss ich ohne Sharifs weiche Stimme und sein Schnippen auskommen. Seit ich ihn in den Gelben Seiten, ohne Internet und Smartphone, gefunden habe, nehme ich diese Mittagstermine wahr. So verliere ich keinen Abend mit Luise und Nathalie, meinen fünfzehnjährigen Zwillingstöchtern, zweieiig und seit jeher jede für sich eine unverwechselbare Persönlichkeit. Auch für Magister Heinz nehme ich mir dann Zeit. Vom Vater meiner Töchter bin ich längst geschieden.
Hungrig bin ich jetzt, wie eine Wölfin.
Ich versuche, auf mein Äußeres zu achten, auf meine Figur. Was gar nicht so leicht ist. Der Stresspegel, unter dem ich lebe, macht mich dauerhungrig. Ich beherrsche mich noch beim Frühstück, kann mich aber spätestens in der Mittagspause nicht mehr zurückhalten. Da brauche ich Nervennahrung. Knäckebrot macht mich depressiv, und einen melancholischen Zahnarzt wünsche ich keinem. Gott sei Dank habe ich ein hübsches Gesicht mit hellen blauen Augen und lockiges blondes Haar von meiner Mutter vererbt bekommen, damit überspiele ich meine Fettröllchen an Bauch und Hüfte.
Nachdem ich die Tür zu Sharif El Bennas Hypnoseraum passiert habe, schlüpfe ich im Vorzimmer in meine hohen Schuhe und spüre den Schmerz am linken Zeh wieder. Ein Hühnerauge. Aber die hohen Absätze machen mich größer, und das genieße ich. Ich gehe durch die Eingangstür hinaus auf den Hausflur, schließe die schwere Holztür und drücke auf den Knopf für den Aufzug. Ich bemerke einen hellen Streifen, der den sonst dunklen Korridor erleuchtet.
Ich hebe den Kopf und sehe, dass die Wohnungstür zum Appartement gegenüber offen steht. Von irgendwoher muss ein Luftzug kommen, die Tür bewegt sich leicht, schabt weich über den glatten Steinboden, ein paar Millimeter hin und wieder zurück.
Es ist kurz nach zwei Uhr mittags. Im Haus ist es still, so still, dass mir eine leichte Gänsehaut über den Rücken läuft. Am liebsten würde ich zu Sharif zurück, wieder seine Finger schnippen hören, seiner Stimme lauschen. Oder in den Aufzug steigen, der eben vor mir hält und seine Tür für mich öffnet. Allein heute stehen so viele Zahnschmerzgeplagte in meinem Terminkalender. Wenn ich mich beeile und in den Lift springe, könnte ich mir sogar noch einen Latte vom Eckcafé an der Haltestelle mitnehmen. Einen Latte mit viel Schaum und dazu eine Nussschnecke.
Lecker!
Ich bleibe aber stehen, wo ich bin, die Lifttür schließt sich. Dann mache ich fünf Schritte hin zur Nachbarwohnung.
Eine unverschlossene Wohnungstür gibt ein eigenes Bild ab. Ähnlich wie ein herrenloser Hund oder eine Börse, die im Bus auf einem leeren Sitz liegen geblieben ist, strahlt sie etwas Einsames, Verirrtes aus. Sie kann von Vergesslichkeit oder Nachlässigkeit erzählen oder auch von einem Übel, einem ungewollten oder absichtlichen Verlust.
Ich seufze und klopfe laut an den Türrahmen.
»Hallo, ist da jemand?«
Meine Stimme hört sich ein klein wenig zu hoch an, so ähnlich klinge ich beim Einspritzen und Betäuben, wenn ich nach meinem Tuch greifen muss, um die Schweißperlen dezent abzuwischen.
Ich räuspere mich und versuche es noch mal.
»Hallo, dadrinnen! Sie haben Ihre Wohnungstür nicht abgeschlossen! Ist alles in Ordnung?«
Mein Bauch sagt mir schon, dass es das nicht ist. Mein Verstand klammert sich noch an vernünftige, banale Erklärungen. Ich fasse meine Handtasche fester und betrete die fremde Wohnung. Im Flur brennt Licht, das von einem glänzenden Parkettboden reflektiert wird.
»Hallo, hallo! Mein Name ist Dr. Kardiff. Ihre Tür stand offen, und ich wollte mich nur davon überzeugen, dass es Ihnen gut geht.«
Ich rufe jetzt.
»Ich komme rein. In Ordnung?«
Meine Füße gehen weiter. Auf dem Parkett hören sich die hohen Hacken meiner Schuhe wie das Ticken einer Zeitschaltuhr an. Achtung, Achtung, in zehn Sekunden geht die Bombe hoch! Zeit, zu verschwinden.
Dreh um und renn weg!
Ich gehe weiter durch den Flur, er ist lang, breit und voller gemalter Bilder. Ich sehe eine Dame mit grünem Kleid, die einen Apfel in ihren schlanken Fingern hält. Eine Jagdgesellschaft mit einer Meute von hechelnden Settern und Dienern, die gebogene Hörner blasen. Ganz vorn hängt das Porträt eines Mannes mit Fliege und Hut und einem unglaublich breiten Grinsen. Ich wende mich ab und versuche, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Die nächste Tür ist wieder nur angelehnt.
Noch einmal rufe ich, so laut ich kann, mein Hallo und klopfe wieder. Die Tür schwingt auf und gibt den Blick auf ein geräumiges Wohnzimmer frei. Große, schwere Möbel, verzierte Schränke, ein antiker Büfettschrank mit allerlei Porzellannippes hinter den Glasvitrinen und in der Mitte ein breites und reich mit Polstern belegtes Sofa. Davor ein schöner, glänzender brauner Vorstelltisch. Darunter ein sicher sehr teurer Perserteppich.
Darauf liegt eine ältere Frau, aus deren Mund eine zusammengerollte Zeitschrift ragt.
Leo! Dreh um! Renn weg!
Oh!
Ich schaue genauer hin.
Ihre Kehle ist durchtrennt worden. Das kann ich sofort erkennen. Blut hat sich im Perserteppich verteilt und ist dort getrocknet. Ihre Augen starren zur Decke, an der ein Lüster mit kleinen goldenen Engeln hängt. Mein Blick geht zweimal von unten nach oben und wieder zurück.
Ohhhhhhh!
Ich schwanke auf meinen Schuhen, komme mir vor, als würde ich gleich über eine Klippe stürzen.
Dass die alte Frau tot ist, ist klar. Dass sie nicht an einem Herzanfall gestorben ist, auch. Auf das Schwanken folgt automatisch mein Standardsatz in Notlagen: »Ich bin Arzt, lassen Sie mich durch.« Völlig absurd hier drinnen, aber …
Oh! Oh!
Jetzt geht es mit mir durch.
Ich lasse meine Handtasche fallen und stürze zu der Frau am Boden. Ich reiße die Zeitschrift aus ihrem Mund. Sie fliegt nach hinten, ich höre, wie sie gegen den Büfettschrank klatscht. Ich lege meine Hand auf das Herz der Frau, mein Ohr an ihre Lippen. Lausche nach einem Hauch von Leben, fühle nach einem Schlag in der Brust. Nichts. Niente. Nada. Aber das wusste ich schon vorher.
Mein Herz dagegen schlägt rasend wild.
Verdammt!
Ich hebe meinen Kopf wieder, betrachte das Szenario. Das Zimmer wirkt wie eine alte Fotografie. Mir schwindelt, und ich kippe leicht nach vorn. Meine Hand stützt sich auf den Körper der Frau. Er ist weich, noch keine Spur von Leichenstarre. Ich nehme meine Hand schnell wieder weg, starre auf die Wunde an ihrem Hals.
Wie ein tiefes Tal klafft der Einschnitt an ihrer Kehle. Der große Blutfleck auf ihrer Bluse glitzert leicht, noch ist nicht alles getrocknet. Ich überlege fieberhaft, gehe meine medizinischen Kenntnisse über die Stadien einer Leiche durch und schätze grob, dass die Frau nicht länger als eine halbe Stunde tot sein kann. Während ich hypnotisiert auf Sharifs Couch lag, hatte sie ihren Todeskampf. Ihr Mund ist auch ohne die Zeitschrift weit offen geblieben, ich kann den gesamten Rachenraum sehen.
Mir wird übel.
Irgendwie, tief in meinem Hirn, kommt mir die Tote bekannt vor, aber ich kann mich im Moment nicht erinnern. Stattdessen gehe ich professionell an die Sache heran, ich sehe mir automatisch ihr Gebiss an. Ihre Zähne sind weiß, sicher gebleicht, scheinen fast alle noch ihre eigenen zu sein. Links oben erkenne ich ein Implantat. Rechts unten aber klafft ein Loch, das überhaupt nicht zu ihrem sonst so gut erhaltenen, gepflegten und sicher teuren Gebiss passt. Zwei Zähne fehlen komplett, die beschliffenen Stümpfe von zweien sind als Pfeiler noch da, aber die Brücke, die zu dieser Lücke passt, die Brücke vom Siebener bis zum Vierer, ist nicht da. Warum das denn? Wer würde einer Sterbenden eine Brücke aus dem Mund entfernen? Und womit? Ich beuge mich tiefer, sehe genauer hin und …
In genau diesem Moment fällt mir wieder ein, dass ich in einer fremden Wohnung vor einer toten Frau knie, die mit hundertprozentiger Sicherheit ermordet worden ist.
Oh, oh, oh …
Das Parkett im Flur knarrt.
Mit einem Aufschrei drehe ich mich um, doch niemand steht mit einem Messer oder einer Hacke oder sonst was hinter mir. Im Zimmer ist es immer noch totenstill.
Was ich jetzt brauche, ist Hilfe. HILFE!
Ich stemme mich hoch, halte mich am Couchtisch fest. Mir fallen meine Fingerabdrücke ein, ich überlege mir ein Alibi, obwohl ich mir sicher bin, nichts mit diesem Verbrechen zu tun zu haben. Sharif El Benna fällt mir ein. Er kann bezeugen, dass ich bis vor wenigen Minuten auf seiner Behandlungscouch in tiefer Trance war.
Ich drehe mich um.
Ich renne durch den langen Flur an den Bildern vorbei nach draußen, das laute Schlagen meiner Hacken gleicht jetzt einem Klopfen aus einem verschlossenen Sarg.
Ich bin im Treppenhaus, der Aufzug wartet immer noch auf mich. Kein Mensch zeigt sich. Ich mache meine fünf Schritte zu Sharif El Bennas Praxis zurück, drücke auf die Klingel. Von drinnen summt es weich. Ich überlege, ob die Wohnungstür der alten Frau schon offen stand, als ich zu meinem Termin bei Sharif kam.
Die Tür vor mir geht auf. Ich falle Sharif in die Arme.
In diesem Moment singt mein neues Smartphone Robbie Williams’ »Candy«. Das ist der Moment, wo das Getrippel der Ameisen in meinem Kopf von den Schreien, die mein Kehlkopf wie von selbst produziert, tatsächlich einmal übertönt wird.
KAPITEL DREI
Sie kamen um zehn vor sieben.
Britti Poster, eine der Arzthelferinnen und unermüdliche Plaudertasche, erzählte später, es habe sie an »Spiel mir das Lied vom Tod« erinnert, als die drei Kripobeamten mit Schwung die Tür zur Zahnarztpraxis Dr. Lang/Dr. Kardiff aufstießen und nebeneinander durch den breiten Flur auf die Rezeption zugingen. Britti selbst habe sich wie die junge Claudia Cardinale gefühlt, was sie während der Schilderung vor Patienten und den übrigen Kollegen veranlasste, ihre rehbraunen Augen auf Tellergröße aufzureißen und die Spitzen ihres braunen Pagenkopfes wild hin- und herzuschaukeln.
Den Vergleich mit dem Westernklassiker übernahm sogar eine Onlinezeitung aus Brittis eigenem Blog, in dem sie regelmäßig über ihre Erlebnisse räsonierte. Nicht nur im realen Leben teilte Britti gern jedes Ereignis in ihrem jungen Dasein mit.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte Gerda Horst das Ermittlerteam. In Brittis Beschreibung erhielt die Sprechstundenhilfe die Rolle des Saloonwirts, der die drei Fremden als Erster empfing.
Bulldogge Gerda saß nun schon seit über fünfundzwanzig Jahren an der Rezeption und war deren unangefochtene Hüterin. Ohne ihren Segen kam hier keiner vorbei. Man munkelte, dass sie früher, sehr viel früher, mal eine Liaison mit dem inzwischen frühpensionierten Dr. Hubertus gehabt hatte, dem Vater von Dr. Leocardia Kardiff. Aber niemand hätte je gewagt, Gerda darauf anzusprechen.
Der Mittlere der Dreiergruppe holte seinen Ausweis heraus und zeigte ihn Gerda Horst. »Kriminalpolizei. Hauptkommissar Jakob Zimmer mein Name. Wir würden gern zu Frau Dr. …«
In diesem Moment kam sie in einem grünen OP-Kittel um die Ecke gestürmt. Der Mundschutz baumelte an ihrem Hals wie ein kleiner grüner Drache, der es sich unter ihrem Kinn bequem gemacht hatte. Sie war außer Atem und hatte rote Flecken auf den Wangen, was sie mit ihren hellen Haaren und dem blassen Teint ein wenig wie eine gehetzte Prinzessin auf der Flucht aussehen ließ.
»Ich habe schon den ganzen Nachmittag auf Sie gewartet!« Dr. Leocardia Kardiff keuchte mehr, als dass sie sprach.
Sie hatte in Raum eins behandelt, der direkt neben der Rezeption lag. Bei geöffneter Tür konnte man ganz gut mithören, was bei der Anmeldung geredet wurde. Leo hatte ihre Patientin Frau Reis mit einem schnellen »Komme sofort wieder« auf dem Behandlungsstuhl sitzen lassen, mit offenem Mund und betäubter halber Lippe, und war um die Ecke gerast.
Frau Reis, deren Weisheitszahn operativ entfernt werden sollte, schwankte zwischen Erstaunen und Neugier und wäre am liebsten mit Frau Doktor mitgestürmt. Britti Poster, die in Wahrheit auch erst in diesem Moment mit Leo zur Rezeption lief, um zu sehen, was denn die Bullen hier in der Praxis wollten, drehte sich kurz zu Frau Reis um und streckte ihren Daumen nach oben, als ob sie alle etwas gewonnen hätten. Schon seit Ende der Mittagspause fand Britti, dass die Chefin unausgeglichener und blasser als sonst wirkte.
Was auch stimmte, denn seit ihrer schrecklichen Entdeckung hatte Leo das Gefühl, auf rohen Eiern zu wandeln.
Gemeinsam mit Sharif El Benna war sie noch einmal zu der Leiche in der Nachbarwohnung getaumelt, und sie beide hatten dann unverzüglich die Polizei gerufen. Keine zehn Minuten später wimmelte es in dem Gang, in der Wohnung, auch in Sharifs Praxis von Uniformierten und Sanitätern, ein Bienenstock an helfenden Händen, doch für die alte Dame kam die Hilfe zu spät.
Nachdem die erste Aufregung, auch dank der immer ruhigen Art des Sharif El Benna, abgeklungen war, hatte Leo der Polizei klarmachen können, dass sie die alte Frau nur aufgefunden hatte. Sie machte ihre Aussage vor einem finster dreinblickenden, sehr jungen Polizeibeamten und bat, so schnell wie möglich in ihre Praxis gehen zu dürfen. Der Terminkalender am heutigen Mittwoch war brechend voll.
Mitten im Frage-Antwort-Polizeispiel hatte sich der Fahrstuhl geöffnet, und Magister Heinz Lerbaum war im Flur aufgetaucht. Seine Stirn war in Falten gelegt, und trotz der warmen Temperaturen draußen hatte er einen Staubmantel über seinem wie immer korrekten Anzug mit Fliege getragen.
Als Leo nach dem Auffinden der Leiche endlich an ihr Smartphone gegangen war, hatte sie ihn in ihrem Schock angeschrien, sofort zu kommen, jetzt, ja, genau jetzt brauche sie seine Hilfe, eine Leiche liege hier, und sie sei die einzige Verdächtige. Er war gekommen, hatte tatsächlich seine immer so wichtige Arbeit in der Steuerkanzlei unterbrochen, doch, wie Leo fand, zu spät, zu zögerlich. Sie hatte ihn links liegen lassen und sich nur auf das Gespräch mit dem blutjungen Beamten konzentriert.
Sie würde natürlich noch eine DNA-Probe abgeben müssen und einen Termin für eine weitere Zeugenaussage im Präsidium bekommen, aber nach der Aufnahme ihrer ersten Aussage und der Überprüfung ihrer Personalien hätte sie gehen können. Doch Magister Heinz Lerbaum, Anwalt für Steuerrecht, Leos Freund ‒ oder besser Lover, so lange, bis seine Scheidung endlich durch sein würde ‒, hatte den Aufbruch nun noch verzögert, indem er sich in Szene gesetzt und Fragen über Fragen gestellt hatte, bis Leo den Ärmel seines Staubmantels gepackt und ihn in den Aufzug gezogen hatte.
Statt sie zu umarmen, hatte Magister Heinz sie beim Hinunterfahren finster angesehen ‒ nach dem Motto: Warum musst gerade du über solch eine Schweinerei stolpern? Und ich deswegen auch noch meine Arbeit unterbrechen?
In solchen Momenten fragte sich Leo, ob sie nach ihrer Scheidung von Johannes Belmont, dem genialen, aber verkannten Künstler, nicht vom Regen in die Traufe gestolpert und ihr Magister Heinz mehr Felsbrocken als Wegbereiter war. Allein dass ihn jeder Magister Heinz anstatt nur Heinzi nannte, sprach doch schon Bände, oder?
Er hatte in Wien studiert, es bis zum Magister geschafft. Da es in Deutschland nicht üblich war, diesen Titel dem Nachnamen voranzustellen, sollte zumindest auf privater Ebene jeder Bescheid wissen. Eitel und hochnäsig, wie Leo fand, doch dieser Nachmittag war weiß Gott nicht dazu da, ihre Beziehung in Frage zu stellen, das würde später sowieso wieder aufkommen.
Schließlich waren sie beide raus auf die Straße getreten, dort standen zwei Rettungswagen und zwei Polizeiautos, auf der gegenüberliegenden Straßenseite knipsten Passanten mit ihren Handys.
Magister Heinz hatte angeboten, sie zur Praxis zurückzufahren. Leo hatte zugestimmt, obwohl ihr gerade jetzt eine Fahrt mit den drei Straßenbahnen außerordentlich gutgetan hätte. Aber sie hatte ein schlechtes Gewissen ihrem Lover gegenüber, wie meistens, und dankend sein Angebot angenommen. Als er sie am Nikolausplatz aussteigen ließ, hatte er ihr die Haare gestreichelt wie einem zitternden kleinen Hund.
»Bis heute Abend, Kindchen.«
Leo hatte genickt und war froh gewesen, aus dem Wagen mit der kalten Klimaanlage flüchten zu können. Erst in der Praxis und in ihrem Büro hatte sie weiche Knie und ein rasendes Herz bekommen, erst da bemerkt, wie sehr sie die Sache mitgenommen und wie sehr sie sich nach einer innigen Umarmung ihres Magister Heinz gesehnt hatte.
Das Wartezimmer war tatsächlich brechend voll gewesen, und sie hatte sich entschieden, nichts von ihrem Erlebnis zu erzählen, zumindest nicht, bis alle Patienten versorgt waren. Als ihre Hände bei Frau Winterkorn, der ersten Kariespatientin an diesem Nachmittag, zu zittern anfingen, fiel es nicht weiter auf. Ihre Helferinnen kannten das schon, dass Frau Doktor gern mal vor ihrer eigenen Arbeit Angst bekam. Nachdem sie den langen Gang, an dem zu beiden Seiten die Behandlungsräume lagen, zu weiteren Schmerzgeplagten entlanggehetzt war, hatte sich Leo langsam wieder in den Griff bekommen.
Nun aber, kurz vor Feierabend, tauchten die Kripobeamten auf, gleich zu dritt, gleich wie ein Minischwarm.
Als Leo um die Ecke bog, kam die diffuse Angst zurück, doch eine Verdächtige zu sein, doch auf irgendeine Weise Mitschuld am Tod der alten Dame zu haben. Würde sie das Sorgerecht für Luise und Nathalie behalten können, wenn sie unter Anklage stand? Würde Magister Heinz zu einer Kriminellen halten?
Und vor allem, was würde ihr Vater dazu sagen, dass seine Tochter, sein einziges Kind … Schluss damit. Was für dämliche Gedanken. Leo schlug sich auf die Backe.
»Hat das jetzt nicht wehgetan?«
Der große Blonde in der Mitte der Dreiergruppe sah sie mit einem erstaunten Blick an. Sein Haar stand in alle Richtungen, als wäre er eben erst aus dem Bett gesprungen, sein Kinn war unrasiert, und sein Kurzarmhemd wirkte ungebügelt. Sympathisch waren allerdings die Grübchen um seinen Mund, wie Leo binnen Zehntelsekunden feststellte.
Die schlanke, sportliche Frau mit dem Pferdeschwanz neben dem Grübchenmann hielt Leo einen Ausweis vor die Nase. »Kripo Köln, Hauptkommissarin von Zeh mein Name. Das sind Hauptkommissar Zimmer und Kommissar Fahrenz.«
Hinter Leo tauchte nach Britti Poster auch Greta Lutzinger auf, ebenfalls Zahnarzthelferin. Im Warteraum, der durch eine breite Glasfront von der Rezeption getrennt war, hoben sich Köpfe, ein älterer Herr stand sogar auf und machte einen Schritt auf die Gruppe zu.
Leo holte tief Luft und wandte sich an die Wartenden. »Es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. In meiner Mittagspause habe ich eine Leiche gefunden, das ist alles. Wirklich alles. Ihre Kehle war durchtrennt, eine Zeitschrift steckte in ihrem Mund, sie war tot, ich hätte nichts mehr tun können, wirklich, und ich …«
Britti sog hinter Leo die Luft ein. Greta kicherte völlig unpassenderweise.
Eine junge Frau erhob sich und trat neben den älteren Herrn im Wartebereich, jetzt erst erfasste das Schaulustigenfieber die Leute. Leo merkte, dass sie Rede-Mist gebaut hatte, Schweigen wäre in dieser Situation Gold gewesen. Am liebsten hätte sie sich noch mal geohrfeigt, aber der Blick des blonden Großen ruhte immer noch auf ihr, und mehr Peinlichkeit konnte sie wirklich nicht ertragen.
Gerda Horst, die Bulldogge, gewohnt, mit jeder Situation fertigzuwerden, rettete Leo aus dem tiefen Tal des schnelleren Redens als Denkens. »Dr. Kardiff, wollen Sie mit den Kommissaren nicht in Ihr Büro gehen? Dort sind Sie ungestört.«
Leo griff sich den Rettungsanker. »Ja, natürlich, meine Herren, ähm … und Sie auch, Frau … ich hab Ihren Namen …«
»Von Zeh, Hauptkommissarin Birgit von Zeh.«
»… ja, bitte, einfach durch die Tür hinter Ihnen. Dort sind wir … äh … ungestört.«
Die Dreiergruppe drehte sich gehorsam um und ging auf die Tür zu.
Leo wurde klar, dass sie in keinem Fall eine Verdächtige sein konnte, denn die Polizeibeamten hätten sich sonst niemals so höflich benommen. Sie überlegte, ob sie ihnen drinnen einen Kaffee anbieten durfte oder ob das schon in Richtung Bestechung ging. Oder sollte sie sofort Magister Heinz anrufen, ein zweites Mal seine Hilfe erbitten? Quatsch, Steuern hatte sie ja nicht hinterzogen, und noch mal hätte sie sein Hundegetätschel auf ihrem Kopf nicht ertragen. Leo dachte lieber an die Therapie, an Sharif, an seine Stimme, wenn er sie in die Tiefe lotste ‒ erst mal Augen schließen, Leo ‒, und schloss die Augen.
Leo rannte in den Türrahmen, stieß sich die Stirn, riss die Augen wieder auf, öffnete die Tür, ließ die Beamten eintreten, rieb sich die Stirn, dachte, dass sie wohl doch einen Anwalt bräuchte, bei ihrem dummen Benehmen.
Britti Poster zog sie von hinten am Kittel und riss sie aus ihren Gedanken.
»Britti, ich bitte Sie, nicht jetzt. Ich werde Ihnen alles erzählen, wenn die Zeit dafür da ist.«
»Frau Dr. Kardiff.« Brittis Stimme hatte einen beleidigten Unterton. »Ich wollte doch nur nach Frau Reis fragen. Was ist zu tun?«
Leo nahm die Hand von der Stirn, schlug sich damit nun noch mal auf die Backe, aber diesmal unbewusst. »Holen Sie den Sauger aus ihrem Mund, fahren Sie den Behandlungsstuhl wieder hoch und plaudern Sie mit ihr, das können Sie doch richtig gut.«
»Darf ich ihr von Ihrer Leiche erzählen?«
Leo stutzte. Ihre Leiche? War sie Besitzerin der toten alten Dame geworden, weil sie zufällig über sie gestolpert war?
»Reden Sie, worüber Sie möchten, Britti.«
Das würde Britti Poster ohnehin tun.
»Und Sie, Greta, gehen zu Herrn Luftig in die Drei hinein und bitten ihn um viel Geduld, ich komme, so schnell ich kann.«
Greta kicherte schon wieder, verschwand aber wortlos im Gang.
»Soll ich die Termine der restlichen Patienten auf die nächsten Tage verschieben?« Bulldogge Horst behielt wie immer den totalen Überblick.
»Ja, das ist eine gute Idee, Frau Horst. Außer den zwei akuten Schmerzpatienten, die nehme ich auf alle Fälle noch dran.«
Leo spürte Schweiß auf ihren Handflächen und wischte sie an der OP-Hose ab. Dann folgte sie den Kriminalbeamten in ihr Büro und machte die Tür geräuschvoll zu.
Leos Büro war klein, aber dafür gemütlich eingerichtet. Es gab eine breite rote Ledercouch mit vielen Kissen, ein hohes Bücherregal, auf dem neben den Büchern und allerhand Fotos von ihrer Familie in der mittleren Reihe eine Kaffeemaschine stand, und einen kleinen Schreibtisch, darauf, neben einem unbeschriebenen Block, ihr Laptop, davor ein ergonomischer Drehstuhl. Neben dem Regal hingen auf einem Kleiderständer Leos Alltagssachen, ihre Bluse, ihr Rock, wie wirres Blätterwerk, darunter am Boden ihre hohen Schuhe, einer auf die Seite gekippt. Die Ordnung, die sie ihren Töchtern gern predigte, hielt sie selbst selten ein. Auf dem kleinen Basttisch vor der Couch türmten sich Modezeitschriften und darauf ein Taschenbuch, ein Krimi der unteren Kategorie. Zur Entspannung gedacht.
Der große blonde Hauptkommissar, dessen Namen Leo nicht mehr einfallen wollte, hob den Krimi an. »Blutige Nächte« stand auf dem Einband, dazu das Bild einer jungen Frau, die schreiend durch eine dunkle Gasse lief.
Leo fühlte sich mal wieder ertappt. »Das liest sich nur so lange gut, bis man selbst in so was stolpert …«
Der Blonde lächelte, seine Grübchen vertieften sich. »Keine Sorge, meine Mutter liest immer die Cotton-Romane. Ich lese so was auch gern, vor allem morgens beim … na, Sie wissen schon.«
Seine Kollegin warf ihm einen strengen Blick zu. Der Dritte im Bunde, jung und lässig, setzte sich ohne Aufforderung ans linke Ende der Couch und holte ein iPad unter seiner Jeansjacke heraus. Er schob das Smart Cover nach oben, und es erwachte zum Leben. Das ist also die moderne Version von Block und Bleistift, wenn ich jetzt verhört werde, dachte Leo.
Ihr Herz klopfte zu laut und zu schnell. Immerhin fielen ihr die Namen der drei wieder ein. Zimmer, von Zeh und Fahrenz. Das beruhigte sie ein klein wenig.
»Möchten Sie einen Kaffee?«
Der große blonde Zimmer nickte und Kommissar Fahrenz am iPad auch. Nur Hauptkommissarin von Zeh blickte weiterhin streng, sie hätte sich gut im Guter-Bulle-böser-Bulle-Spiel gemacht. Leo drängte sich an dem Hauptkommissar vorbei zur Kaffeemaschine.
»Ich bin ganz zufällig rein in diese Wohnung, die Tür war ja auf. Ich kam aus der Therapie. Nicht Gesprächstherapie, nein, ich bin nicht psychisch krank, nicht dass Sie so was denken. Ich mache eine Hypnosetherapie gegen meine Phobien. Ich meine, ich habe nur eine, und die habe ich mit der Therapie im Griff. Wirklich. Möchten Sie einen Espresso oder lieber einen Crema?«
Leos Mund war ganz trocken vor Aufregung. Hauptkommissar Zimmer legte seine Hand auf ihre Schulter. Sie hob den Kopf und sah in grüne Augen.
»Das mit dem Kaffee hat Zeit, Frau Dr. Kardiff. Wir müssen eigentlich mit Ihrem Kollegen Dr. Frederic Lang sprechen. Könnten Sie ihn dazuholen?«
Die Berührung an ihrer Schulter und der sanfte Tonfall des Blonden ließen Leo vor Erleichterung laut ausatmen. »Ja, selbstverständlich. Wobei mein Kollege sicher wie immer enorm beschäftigt ist. Er ist sehr gefragt, und vor allem unsere weiblichen Patienten werden lieber von ihm als ‒«
Die strenge Hauptkommissarin unterbrach sie. »Die Tote, Frau Hedda Kernbach, war eine seiner Patientinnen. Wenn Sie jetzt so nett wären.«
Leo nickte. Es fiel ihr wie Schuppen von den Augen. Dieses Gefühl, als sie die Tote gefunden hatte. Sie war ihr bekannt vorgekommen. Das war es. Eine Patientin von Dr. Frederic Lang, dem smarten und immer charmanten Kollegen, der die Praxis zusammen mit ihrem Vater gegründet hatte.
Natürlich musste Leo diese Hedda Kernbach gekannt haben, sie wahrgenommen haben im Wartezimmer, auf dem Gang oder auch in einem der Behandlungsräume. Vielleicht war die alte Dame sogar einmal auf einem ihrer Stühle gelandet, wenn Frederic auf Urlaub gewesen war. Irgendwie machte das die Sache für Leo noch schlimmer.
Sie machte die Büro tür wieder auf und rannte zu Gerda Horst an die Rezeption. »Könnten Sie Dr. Lang zu mir holen, bitte, sofort?«
Gerda Horst nickte, und Leo rannte wieder zurück, warf einen schnellen Blick Richtung Wartebereich, stellte sich Frau Kernbach vor, wie sie wartete, eine Zeitschrift durchblätternd, ein wenig unruhig vor dem Zahnarztbesuch und der Diagnose. Das Bild der alten Dame auf dem Boden des überladenen Wohnzimmers tauchte mit voller Wucht vor Leos innerem Auge auf. Der Körper reglos, das Blut auf dem Perserteppich, die klaffende Wunde an der Kehle und die Zeitschrift, die wie ein monströser, turmartiger Tumor aus dem Mund der Toten ragte.
Als sich Leo zum dritten Mal an diesem langen, sehr langen Tag auf die Backe schlug, geschah es hart und mit einem lauten Klatsch. Die drei Kriminalbeamten von der Kölner Kripo sahen gleichzeitig zu ihr hin, sie konnte sehen, wie Zimmer verwundert eine Braue hochzog. Aber diesmal war es Leo egal, ob es peinlich wirkte oder nicht.
Diesmal war es wichtiger, nicht in Ohnmacht zu fallen.
»Wollen Sie Milch oder Zucker zu Ihrem Kaffee?«
KAPITEL VIER
Erst kurz nach neun kehrte Ruhe in der Praxis ein.
Leo hatte noch Patienten von Frederic übernommen, während er mit den Ermittlern sprach. Frederic hatte die drei in sein Büro hinübergebeten, wahrscheinlich, weil es größer war, das Ambiente dort eleganter und geordneter. Das Letzte, was Leo mitbekommen hatte, war, dass die strenge Hauptkommissarin ihn danach gefragt hatte, wo er denn in der Mittagspause gewesen sei. Später baten die Beamten noch Gerda Horst hinein, sicher wollten sie die Krankenakten von Hedda Kernbach einsehen.
Nach Bulldogge Gerda war Britti Poster gerufen worden. Die anderen Helferinnen und auch den Zahntechniker, der immer mittwochs in der Praxis war, bat man ebenfalls der Reihe nach ins Büro. Hinterher erzählte Britti aufgeregt, dass sie alle nach ihrem Aufenthaltsort während der Mittagspause befragt worden seien. Lächerlich, wie Leo fand. Nur weil sie zufällig Hedda Kernbach gefunden hatte.
Trotzdem hatte sich Britti erleichtert und stolz gezeigt, dass sie ein wasserdichtes Alibi hatte. Seit einigen Wochen opferte sie ihre Mittagspausen, um in den zwei Stunden die Notizen von Dr. Lang aufzunehmen. Also musste sich auch Leos Kollege um ein Alibi schon mal keine Sorgen machen. Nach einer guten Stunde waren die Ermittler von Frederic hinausgeleitet worden. Es hatte Getuschel und Gewisper gegeben, nur Leo hatte die letzten beiden Schmerzpatienten behandelt und eisern geschwiegen.
Britti war die letzte der Helferinnen, die nun die Eingangstür hinter sich zuzog. In ihrer freien Hand hatte sie schon ihr Smartphone und tippte mit dem Daumen darauf herum.
»Aber morgen müssen Sie uns alles erzählen, Frau Doktor, morgen gibt’s keine Ausreden mehr!«, hatte sie zum Abschied gerufen. Leo dachte an Katastrophentourismus und Staus auf der Autobahn nach einem Unfall, verursacht durch Schaulustige.
Ein letztes Kläcken, als die Tür ins Schloss fiel, dann machte sich eine fast anmaßende Stille in den Behandlungsräumen breit. Kaum vorstellbar, dass so viele Menschen hier herumgewandert waren. Erst morgen früh um sechs, wenn die Putzfrauen kamen, würde der Lärm wieder erwachen.
Leo streckte sich durch; das Knacken in ihrem verspannten Nacken wirkte wie ein Knall. Ihr war es so vorgekommen, als lauerten ihre Angestellten und auch die restlichen Patienten wie Geier darauf, die ganze Geschichte von dem Mord und der Leiche zu erfahren. Als Leo zwischendurch laut »Morgen rede ich, heute bin ich zu fertig ‒ damit das klar ist!« gerufen hatte, war tatsächlich ein herzhaftes »Super!« aus einem der Zimmer zurückgekommen.
Die Erschöpfung machte sich in Leos Körper breit. Selbst den grünen OP-Anzug aus- und die Alltagsklamotten wieder anzuziehen war wie Bergeversetzen. Sie setzte sich noch einmal auf die rote Couch; ihr Kopf brummte, und sie wollte den harten Tag mit Atemübungen, die sie bei Sharif El Benna gelernt hatte, ausklingen lassen. Die halfen nicht nur gegen ihre Spritzenphobie, sondern auch bei Kopfschmerzen und totaler Müdigkeit.
Augen schließen, damit ging es immer los.
Leo ließ ihre Lider nach unten fallen, da lag die tote Frau am Boden, ihre Kehle war aufgerissen, eine Zeitschrift steckte in ihrem offenen Mund. Leo drückte ihre Augendeckel fester zu, presste sie zusammen, um das Entspannungsritual zu erzwingen. Da stand der Mund der Frau offen und klaffte wie eine rot beleuchtete Höhle, etwas war daraus herausgerissen worden.
Plötzlich wusste Leo nicht mehr, wie die Übung weiterging, was kam nach dem Augenschließen? Sie hatte alles, aber auch alles vergessen, was ihr der Tunesier beigebracht hatte, alles war verschluckt worden von diesem offenen Mund, in dem etwas fehlte, das Leo kannte, das jeder Zahnarzt kennen musste. Die Tote war Patientin in dieser Praxis gewesen, und sie fragte sich, ob Frederic den Ermittlern auch seine ganz privaten Patientenakten gezeigt hatte, die klassischen Notizen, die sich Zahnärzte zu ihren Kunden machten. Mit seinen ganz persönlichen Bemerkungen. Das würde sie selbst jetzt brennend interessieren. Leo riss den Kopf nach oben.
Dr. Frederic Lang und ihr Vater hatten die Praxis in einer Zeit gegründet, als es noch keine Computer und elektronischen Datenbanken gab. Damals war alles per Hand notiert und aufgelistet worden. Frederic hatte sich immer solche Notizen zu den jeweiligen Patienten gemacht, manchmal fachlicher, aber oft auch privater Natur. Seiner Meinung nach diente es der individuellen Ausrichtung seiner Arbeit auf den Patienten; Frederic war ein Perfektionist, wie er im Buche steht.
Auch heute noch, in den bequemen Zeiten von Computer und Clouds, pflegte er diesen alten Brauch der persönlichen Notiz. In diesen handgeschriebenen Akten waren sicher auch seine Leistungen, die Besonderheiten und Feinheiten seiner Zahnbehandlungen erfasst, die Hedda Kernbach im Laufe der Zeit bekommen hatte.
Allerdings schrieb Frederic seine Eindrücke nicht mehr selbst auf ‒ er hatte sich in diesen hektischen Jahren eine Klaue zugelegt, die selbst er beim zweiten Lesen nicht mehr entziffern konnte. Dr. Lang ließ schreiben, von seiner jeweils neuesten Lieblingshelferin. Er diktierte in den Mittagspausen wie früher die Chefs der großen Konzerne ihren Privatsekretärinnen. Leo wunderte sich, dass sich vor allem in der heutigen Zeit keine der jungen Frauen, die als Helferinnen in der Praxis arbeiteten, je über ihn beschwerte. Im Gegenteil, sie sahen es als Privileg an, dem eleganten Herrn Doktor zu dienen.
Zurzeit war es eben Britti Poster, die nach Frederics Worten Buch führte. Jede Mittagspause zitierte er sie herein, und wenn Leo und die anderen aus der Pause zurückkamen, kam eine völlig erschöpft aussehende Britti aus Frederics Büro.
Leo vermutete stark, dass Frederic sich gescheut hatte, den Ermittlern diese ganz privaten Notizen zur Verfügung zu stellen. Er konnte und mochte sich sicher nicht vorstellen, dass ein Satz, ein Wort oder ein Gedanke von ihm in eine Mordermittlung gehörte. Aber wenn doch? Die Kommissare mussten Frederic dazu befragt haben, der fehlende Zahnersatz des Mordopfers war doch sicher dem ‒ wie hieß der Fachausdruck? ‒ Rechtsmediziner bei der Polizei aufgefallen, oder? Warum hatte ihr gegenüber keiner die Lücke im Gebiss der Toten erwähnt?
Es begann, an Leo zu nagen. Jetzt hätte sie gern gewusst, was in diesen »Geheimakten« ihres Kollegen stand. Sie würde ihn morgen früh gleich darauf ansprechen. Obwohl er sicher nicht damit herausrücken würde. Vielleicht, weil er noch wie Leos Vater einer anderen Generation entstammte.
Obwohl Dr. Gerwald Hubertus zu Hause gern erzählt hatte, wie viel ihm der eine oder andere Dauerpatient mit seinen schlechten Zähnen eingebracht hatte. »Du bekommst den neuen Wagen, den du angeblich so dringend brauchst«, hatte Gerwald mal zu seiner Exfrau Agathe, Leos Mutter, gesagt. »Mein neuer Patient ist ein Süßigkeitenliebhaber mit angedachtem Dauerabo bei mir.« Das war auch der Grund, wieso Leo ungern Süßes aß, es erinnerte sie zu sehr an Papa und seine gut zahlenden Dauerabonnenten.
Doch zur Verteidigung ihres Kollegen musste Leo zugeben, dass er nicht nur altmodisch seine Notizen pflegte, er war es auch, der die Modernisierung vorantrieb. Er hatte den 3-D-Scanner angeregt, der bald geliefert werden würde und den Betrieb sicher weiter florieren ließe. Und spendierte er nicht immer zu Weihnachten ein üppiges Büfett für die Belegschaft?
Frederic pflegte einen guten Umgang mit Mitarbeitern und Patienten. Seine Art, den Menschen direkt ins Gesicht zu schauen, tief in die Augen, und langsame Sätze und Nebensätze aneinanderzureihen, wirkten selbst bei den Ängstlichen und Phobischen wie ein fleischgewordenes Valium.
Bei den Frauen kam noch dazu, dass Frederic mit seinem vollen dunklen Haar, das fast zu perfekt, um natürlich zu sein, von grauen Streifen durchzogen wurde, und mit seinem Stil, unter dem Kittel immer ein schwarzes Hemd mit offenem Kragen, kombiniert mit einer lässigen Jeans als Beinkleidung, zu tragen, einfach bombig ankam. Sein angedeuteter Handkuss und seine gepflegten Hände taten ihr Übriges. Frederic war der ältere George Clooney unter den Zahnärzten.
Auf Leo hatte Frederics Charme keine Wirkung, für sie war er der Onkel aus Papas Praxis von früher, der Unterstützer während ihres Studiums und seit nun mehr schon über zehn Jahren Mitinhaber ihrer Gemeinschaftspraxis. Er hatte sofort zugestimmt, Leo ins Boot zu holen, als ihr Vater krankheitsbedingt aufhören musste. Für Frederic, der sich zunehmend auf Privatpatienten konzentriert hatte, war Leo die willkommene Partnerin, die für ihn das Gros der Kassenmenschen übernahm. Leo akzeptierte dieses Arrangement, und sie kamen bestens miteinander aus.
Trotzdem wollte sie heute etwas hinter seinem Rücken tun. Musste es tun, je länger es in ihrem Kopf herumspukte. Bis morgen warten und dann artig fragen verblasste als Option mehr und mehr.
Die Tür zu Frederics Büro würde verschlossen sein, aber Gerda Horst hatte einen Generalschlüssel hinter der Rezeption in einer der Schubladen liegen. Leo hatte davon erst vor einem Jahr erfahren, als sie den Schlüssel für ihr eigenes Büro verloren hatte. Dumm nur, dass sie sich nicht mehr genau erinnern konnte, wo das Ding lag.
Sie verließ ihr Büro, ging hinter den Empfang und begann, die Schubladen aufzuziehen. Natürlich lag der Schlüssel in der untersten.
Das Klicken des Schlosses und das leichte Quietschen von Frederics Bürotür kamen ihr laut, fast dröhnend vor. War es richtig von ihr, ohne seine Erlaubnis einzudringen? Sollte sie ihn nicht doch einfach persönlich fragen? Leo fand ihre Neugier etwas schamlos und unverhältnismäßig. Besser, sie ließ ihr Vorhaben sein, der Tag war grauenhaft genug gewesen.
Aber dann sah sie die alte Dame wieder vor sich, sah den Blick der Toten starr auf die Engelchen am Lüster gerichtet, sah den offenen Mund mit der Zahnlücke zwischen den Mularen und Praemularen. Wäre sie nicht Zahnärztin, hätte diese Lücke in den hinteren Zähnen sicher keinen so nachhaltigen Eindruck bei ihr hinterlassen.
Leo machte die Tür nur einen Spaltbreit auf und quetschte sich hinein, als ob das ihr Eindringen harmloser machen würde.
In Frederics Büro brannte auf seinen Wunsch hin immer eine rosa Salzkristalllampe in der Größe eines ausgewachsenen Hundes, sie stand auf einem Sockel neben einer edlen Sitzecke aus weißem Leder und tauchte den Raum in ein sanftes, weiches Licht. Das Zimmer war fast doppelt so groß wie Leos Büro, eine Front wurde von einem hohen Wandregal mit Büchern und Akten eingenommen, vor dem ein antiker Schreibtisch stand. Es gab hier keinen Computer; Frederic war ganz die alte Schule in dem Raum, in dem er seine Pausen verbrachte.
Mehr als einmal hatte Gerda Horst Frederic verzweifelt darum gebeten, ihr doch für die Computerkartei mehr Details zukommen zu lassen. Doch Frederic gab der Öffentlichkeit nur das Notwendigste preis.
Leo musste an Britti Poster denken und fragte sich, ob Frederic von ihrer ungehemmten Plapperei und Veröffentlichungswut wusste. Die Helferin hätte besser in einen Friseursalon gepasst. Zu ihrer Verteidigung aber war festzustellen, dass sie bis jetzt nichts von den gemeinsamen Mittagspausen mit Dr. Lang herausposaunt, oder wie es so schön hieß, gepostet hatte, also gab es an der hübschen Brünetten vielleicht auch eine schweigsame Seite. Eine fleißige und kompetente Zahnarzthelferin war sie auf alle Fälle.
In der hinteren Ecke, am Ende des Bücherregals, stand eine hohe Bodenvase mit immer frischen Blumen, auch das war einer der Wünsche von Dr. Lang. Sie verdeckte elegant eine schmale Brandschutztür, von der aus man in den Gang und direkt zur Treppe kam. Die Blumen dufteten leicht und verstärkten das elegante Ambiente des Büro raumes noch zusätzlich.
Leo tippelte auf Zehenspitzen zu dem Wandregal und konzentrierte sich auf die Aufschriften der Akten.
»Kann ich dir helfen, Leo?«
Das kam so überraschend, dass Leo aufquiekte wie ein kleines Ferkel. Sie drehte sich auf dem Absatz herum, verlor fast das Gleichgewicht und hielt sich am Schreibtisch fest. Frederic musste noch mal zurückgekommen sein oder hatte etwas in einem der Behandlungsräume zu tun gehabt. Leo hatte ihn glatt überhört und übersehen. Die Blamage war perfekt.
Dr. Lang trug über seiner Jeans sein klassisches schwarzes Hemd, darüber statt des Arztkittels ein blaues Gilet mit einem ebenfalls blauen Seidenschal. Mit der randlosen Brille sah er ein wenig wie ein Priester mit einer Diakonstola aus. Leo fühlte das dringende Bedürfnis, um Vergebung zu bitten.
»Frederic, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll… der Tag heute … die tote Frau … ich …« Plötzlich kamen ihr die Tränen. Sie weinte heftig und unerwartet, jetzt erst rollte dieser ganze Druck wie ein Erdrutsch über sie hinweg.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: