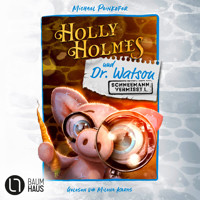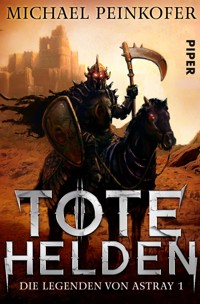
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Für die einen waren sie Helden. Für andere Legenden. Für wiederum andere waren sie nur dämliche Arschlöcher. Doch niemand ahnt, dass sie wieder zurück sind … Im Jahr 37 nach dem Fall des tyrannischen Kaiserreichs sind die Helden von einst vergessen. Der Abyss, ein tiefer Abgrund, durchzieht den Kontinent Astray seit jener letzten erbitterten Schlacht und hat die Völker gespalten. Könige, Herzöge und fanatische Sektierer ringen um die Macht. Nur der Sänger Rayan erhält die Erinnerung an die Legenden der Vergangenheit am Leben – denn seine Visionen sagen ihm, dass in den Tiefen des Abyss eine Bedrohung lauert. Und dass nur die alten Legenden ihr die Stirn bieten können …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
© Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Covermotiv: Loiċ Denoual
Karten: Helmut W. Pesch
Kapitelvignette: Sven Binner
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Dramatis Personae
(in alphabetischer Reihenfolge)
Astyragis pan Tyras
König von Altashar
Anara
ein Mädchen aus Skaradag
Barnak Habib
Schiffskapitän aus Phrygos
Birk
ein Krähenjunge
Bray
eine junge Diebin
Bror
Schenkwirt aus dem Bordland
Dana Jennara
Bordellbetreiberin aus Skaradag
Darak
Hofschreiber aus Altashar
Elayan von Archos
König des Inselreichs
Faginor
Vater der Krähen
Gadates
Wesir von Altashar
Gunryk
Hauptmann aus Achaya
Gyol
ein alter noryscher Grenzer
Hilalayan
Eunuch und Hofmarschall von Altashar
Ildarim
Heiler aus Medras
Kai
ein junger Dieb
Kalid und Hakan Sayf
Gardisten des Hauses Tyras
Keral Gulfullur
Magistrat von Skaradag
Kira
eine Dienerin
Kubwa
Pferdeknecht aus Ophira
Lahad
ein Schmuggler und Pirat
Lorymar Thinkling
ein Halbling
Lianus Conor
Kaufmann aus Skaradag
Lida
eine Köchin
Nawyd pan Tyras
Prinz von Altashar
Nyasha pan Tyras
seine Schwester, Prinzessin von Altashar
Markós
Vorsteher des Dorfes Corras
Mikol
ein junger Grenzer aus Norya
Osric Jarnhant
Stadtmarschall von Skaradag
Rayan
ein fahrender Sänger
Salacar
Exekutor von Morwa
Seana
ein Freudenmädchen aus Skaradag
Skady
eine junge Diebin
Skedder Roth
Anführer der Spinnenzunft
Thorgon-Syn
Großexekutor von Morwa
Torgny
Dieb aus Skaradag
Tymon
Sergeant des noryschen Grenzkorps
Vegar
Dorfvorsteher aus Bordland
Xusra
Hohepriester des Feuerkults
Yaron
Fürst von Archos, Vetter von König Elayan
Yris
ein Freudenmädchen aus Skaradag
So wisset, dass in den Jahrzehnten nach der Großen Divergenz die Furcht regierte in Astray.
Das Alte Reich war zerbrochen und seine Erben hatten sich entzweit. Unsicherheit herrschte allenthalben, die Grenzen waren bedroht, und mit dem Feuerkult erhob sich eine neue Religion aus der Asche der alten Welt.
Die Menschen waren ruhelos. Von ihrer Furcht getrieben suchten sie sich festzuhalten an materiellem Gut und sahen nichts als sich selbst. Prediger zogen durch die Lande, Weissager und Propheten, die die Zukunft zu kennen glaubten. Einer jedoch war unter ihnen, der die Zukunft in den Legenden der Vergangenheit sah …
Aus der Chronik der Sieben,
Vierter Band
Für die einen waren sie Legenden.
Für die anderen ein Albtraum.
Für wieder andere nur dämliche Arschlöcher.
Doch weder die einen noch die anderen ahnten, dass sie noch immer unter uns weilten …
Fragment,
Autor unbekannt
Prolog
Dorf Corras, BurgosIm 20. Jahr nach der Großen Divergenz
Fackeln erhellten den Dorfplatz, und das Auge des vollen Mondes blickte vom Himmel, so als wollte er selbst Zeuge der Verhandlung sein.
Der junge Mann, der in der Mitte des Platzes stand, hielt das Haupt gesenkt. Die strengen Blicke der Versammelten hatten ihn eingeschüchtert, die Last der Vorwürfe seine schlanke Gestalt gebeugt.
»Was also«, fragte der Mann, der ihm auf der Stirnseite des Platzes gegenübersaß, »hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, Ikerón, Sohn des Markós?«
Der Beschuldigte sah auf.
Man hatte darauf verzichtet, ihm Fesseln anzulegen – er hätte ohnehin nicht entkommen können bei all den Schaulustigen, die dem Prozess beiwohnten. Wie ein Gefangener fühlte er sich trotzdem, verhaftet und angeklagt von seinen eigenen Leuten …
»Nicht viel«, erklärte er mit leiser Stimme. »Nur dass ich unserer Gemeinschaft niemals schaden wollte.«
»Das wissen wir«, gab der Mann auf dem hölzernen Thron zurück, dessen Augen wie Kohlen zu glühen schienen. »Und doch können wir nicht dulden, was du getan hast.«
»Was ich getan habe?« Der Junge straffte sich, und sah in die Runde. Der Fackelschein beleuchtete seine ebenmäßigen Züge, die pechschwarzes schulterlanges Haar umrahmte. »Ich will euch sagen, was ich getan habe«, rief er den anklagenden Gesichtern der Dorfbewohner entgegen. »Warum, glaubt ihr, war unser Dorf das einzige, das nicht Hunger litt, als vor drei Sommern die große Dürre wütete? Warum wussten unsere Ältesten im vergangenen Jahr, dass Sontras Steuereintreiber kommen würden? Und wieso überraschten uns die Plünderer, die unser Dorf überfallen und uns alle töten wollten, nicht im Schlaf, wie sie es geplant hatten?«
»Weil du uns gewarnt hast«, erkannte der Mann mit den Glutaugen ungerührt an und trat auf den Jungen zu. »Und dafür danken wir dir. Doch was du tust … was du bist, können wir nicht länger unter uns dulden.«
»So ist es«, rief eine Frau.
»Er ist eine Gefahr für uns alle«, pflichtete eine Stimme bei, die Ikerón als jene des Dorfschmieds zu erkennen glaubte, dem er vor zwei Wintern das Leben gerettet hatte, als er ihn vor einem Steinschlag warnte.
Die Erinnerung der Menschen reicht nicht sehr lange zurück, das wurde Ikerón in diesem Moment klar …
»Da hörst du es«, sagte der Mann mit den Glutaugen, der die eiserne Kette des Dorfvorstehers trug, Zeichen seiner Amtswürde und Symbol dafür, dass er dem Gesetz verpflichtet war. »Ich wünschte, die Dinge lägen anders, doch als Vorsteher von Corras bin ich für das Wohl aller und nicht nur eines Einzelnen verantwortlich. Und du, Ikerón, bist eine Gefahr für uns alle.«
»Aber ich wollte nicht …«
»Wie lange wird es dauern, bis die Exekutoren hiervon erfahren? Wie lange, bis sie uns ihre Schwarzen Reiter schicken, um die Dinge zu regeln? Und wir alle wissen, wie Schwarze Reiter die Dinge regeln.«
Der Angeklagte blickte sich um und konnte die Furcht sehen, die sich in den Mienen der Dorfbewohner spiegelte. Die Angst vor brennenden Häusern, grausam hingerichteten Männern und verschleppten Kindern.
»Dieses Risiko«, fuhr der Vorsteher fort, »kann ich nicht länger eingehen.«
»Dann will ich dir versprechen, es nicht mehr zu tun«, versprach der Jüngling. »Ich werde nicht mehr …«
»Wir wissen beide, dass du das nicht kannst«, beschied ihm der Ältere. Ein Hauch von Milde huschte über seine graubärtigen Züge. »So wenig, wie deine Mutter es konnte.«
»I-ist es das? Gibst du mir die Schuld an ihrem Tod?«
»Nein, Junge.« Der Dorfvorsteher schüttelte den Kopf. Jede Güte wich aus seinen Zügen. »Aber da ist etwas in dir, das du nicht beherrschen kannst. Etwas Dunkles, Verbotenes, das uns alle bedroht – und das muss enden.«
Zustimmendes Gemurmel von allen Seiten.
Erneut sah sich der Beklagte um. Obwohl er die meisten dieser Leute seit seiner Geburt kannte, kamen sie ihm in diesem Moment wie Fremde vor – wohl weil ihre Blicke die von Fremden waren. Längst hatten sie sich von ihm abgewandt, trotz allem, was er für sie getan hatte.
Das Urteil war bereits gefällt.
Verzweiflung packte ihn. »Vater«, wandte er sich an den Einzigen, der ihm noch helfen konnte. »Bitte tu das nicht!«
»Ich kann nicht anders, Sohn«, entgegnete Markós, Vorsteher des Dorfes Corras, dessen Gesicht nun wirkte, als wäre es aus Stein gemeißelt. »Du bist eine Gefahr für unser Dorf und unsere Gemeinschaft – und deshalb verbanne ich dich.«
»Nein«, ächzte der Junge.
»Auf Lebenszeit ist es dir untersagt zurückzukehren«, fuhr sein Vater mit tonloser Stimme fort. »Feuer und Wasser sind dir für alle Zeit hier versagt.«
Der Junge stand unbewegt.
Die undenkbaren Worte waren ausgesprochen. Und auch wenn er im Augenblick noch nicht ermessen konnte, was sie bedeuteten, so war ihm doch klar, dass von diesem Augenblick an nichts so sein würde, wie es gewesen war …
»Vater, was hast du nur getan?«, flüsterte er.
»Was ich tun musste«, entgegnete Markós – und indem er seinem Sohn ein letztes Mal zunickte, wandte er sich von ihm ab und kehrte ihm den breiten Rücken zu.
Die anderen Dorfbewohner taten es ihm gleich.
Einer nach dem anderen verschränkte die Arme vor der Brust und wandte sich um, Männer, Frauen und sogar die Kinder. All jene, die seine Gabe gerettet hatte – und die nun nichts mehr von ihm wissen wollten.
»Das … das könnt ihr nicht tun«, rief Ikerón, wissend, dass es kein Zurück mehr gab, dass weder der Dorfvorsteher noch die Ältesten ihren Entschluss jemals wieder zurücknehmen würden. Dennoch versuchte er es, flehte und schrie – auch dann noch, als grobe Hände ihn packten und davonschleppten.
»Vater! Vater!«, hörte er sich brüllen, bis ihm die Stimme versagte. Er erheischte einen letzten Blick auf die gedrungene, grauhaarige Gestalt, die von ihm abgewandt inmitten des Platzes stand, dann zerrten sie ihn durch das Dunkel der Gasse, die sich zwischen der Schmiede und dem Gemeinschaftshaus erstreckte, und hinaus auf den Acker.
»Lauf!«, schärften sie ihm ein. »Und komm niemals wieder!«
Dann stießen sie ihn von sich. Er strauchelte und stürzte, fiel auf die Stoppeln, die die Ernte auf den Feldern hinterlassen hatte. Er konnte nicht verhindern, dass ihm Tränen in die Augen schossen. Er raffte sich auf, kam wankend wieder auf die Beine und wollte davonhumpeln – als ihn der erste Stein traf.
»Hast du nicht gehört? Du sollst verschwinden?«
Ikerón wusste nicht, ob es die Stimme von Xon war, die er hörte, von Ertós oder einem anderen der jungen Männer, mit denen zusammen er aufgewachsen war und die er bislang stets für seine Freunde gehalten hatte …
Ein zweiter Stein traf ihn zwischen den Schulterblättern, knapp unterhalb des Nackens. Den Hinterkopf mit den Händen schirmend, begann er zu laufen, sprang über Stoppeln und Ackerfurchen hinweg, fort von seinen einstigen Freunden, von seinem Vater und von allem, was er stets für seine Heimat gehalten hatte.
Sein Ziel war der Fluss, der sich glitzernd im Mondlicht abzeichnete. Das Gebiet von Corras endete dort, auf der anderen Seite würden sie ihn nicht mehr behelligen.
»Verschwinde! Los, lauf, du Missgeburt!«
Das war Xon.
Zwei weitere Steine schlugen neben ihm ein, und dann noch ein Dritter, der ihn in die Kniekehle traf. Er hörte ein hässliches Geräusch und spürte stechenden Schmerz, doch er rannte weiter, dem Fluss entgegen – und zu Trauer und Verzweiflung gesellte sich Todesangst.
Dieser namenlose Hass, der aus ihnen sprach – das war nicht nur die Furcht vor den Schwarzen Reitern. Die Bewohner von Corras und allen voran ihr Vorsteher, schickten ihn nicht nur ins Exil, weil sie die Rache der Exekutoren fürchteten – sondern weil sie selbst ihn für ein Monstrum hielten, für etwas, das es nicht geben durfte, ganz gleich, wie viel sie ihm auch verdanken mochten.
Die Erkenntnis traf ihn, als er den Fluss erreichte. Sie schickten ihn nicht fort, weil er eine Gefahr darstellte. Sondern weil ihnen vor ihm graute …
Er watete in die Fluten, wollte sich ein letztes Mal umwenden – als ihn der Stein am Kopf traf. Er war faustgroß und kantig und mit aller Kraft geworfen, und er erwischte ihn an der rechten Schläfe.
Ikerón kam es vor, als wollte sein Schädel zerspringen. Sein Bewusstsein flackerte wie eine Kerze im Wind, während er niederging und bäuchlings ins Wasser klatschte.
Und während die Strömung ihn erfasste und davontrug, verlosch es ganz, und es wurde dunkel.
ERSTES BUCH
Spuren der Vergangenheit
1
Ein Dorf im nördlichen Bordlandsiebzehn Winter später
Das Wirtshaus trug den Namen Zum Hungrigen Wolf.
Das hölzerne Schild, das über der Eingangstür angebracht war und ein Graufell mit aufgerissenem Rachen zeigte, wog sich knarrend im Wind, der an den steilen Klippen entlangblies und den Regen landeinwärts trieb. In endlosen Fäden stürzte die Flut aus dem dunklen Himmel, prasselte auf das schäbige Schindeldach und von dort in die Pfützen. Aus den Butzenfenstern des aus Stein gemauerten Hauses jedoch drang warmer Lichtschein, der einen Herd und Gastlichkeit versprach – und eine warme Mahlzeit.
Die Kapuze seines Umhangs tief ins Gesicht gezogen, trat der Mann aus den grauen Schleiern, drückte die schmiedeeiserne Klinke und trat ein.
Der Regen und die Kälte blieben draußen zurück, vor ihm lag ein Schenkraum, dessen in der Mitte gelegene Feuerstelle für wohlige Wärme sorgte. Männer in abgetragener Arbeitskleidung duckten sich an den Tischen und Bänken, die den Herd säumten, und tranken Bier aus hölzernen Krügen. Von dem Neuankömmling nahm kaum jemand Notiz – bis auf den beleibten Mann mit der schmutigen Schürze und den glänzenden Backen, der beflissen grinsend näher trat.
»Tretet ein, ehrenwerter Herr«, verlangte er, wobei er mit den ebenso kurzen wie starken Armen gestikulierte. »Mein Gasthaus ist das beste im Ort. Womit kann ich Euch dienen? Mit einem Krug Bier? Oder seid Ihr hungrig?«
Der Wanderer nickte.
Er hatte den würzigen Geruch der Fischsuppe noch vor den Schwaden süßlichen Ophirs gerochen, die die warme Luft durchsetzten, und sein leerer Magen lechzte danach, endlich einmal wieder gefüllt zu werden.
Er schlug die Kapuze zurück und ignorierte den befremdeten Ausdruck im Gesicht des Wirts. Er war daran gewöhnt, es machte ihm längst nichts mehr aus.
»Ihr wollt von der Suppe, Meister?«, fragte der Wirt. Offenbar war er sich nicht mehr ganz sicher, einen ehrenwerten Herrn vor sich zu haben.
»Bitte.« Der Mann nickte. »Aber ich habe kein Geld bei mir.«
»Kein Geld?« Entsetzen trat auf die Züge des Wirts. »Wie wollt Ihr dann bezahlen?«
»Hiermit«, erklärte der Besucher und schlug den durchnässten Umhang zurück. Darunter kam ein lederner Beutel zum Vorschein, den er wie einen Schatz an sich presste. Er öffnete den Knebel und zog eine Leier hervor.
»Was soll ich damit?« Der Wirt schüttelte das bullige Haupt, seine Backen hatten längst zu glänzen aufgehört. »Das alte Ding ist keinen Schluck Bier wert!«
»Da irrt Ihr Euch«, versicherte der Fremde, »aber ich hatte auch nicht vor, es einzutauschen. Mein Name ist Rayan, und ich bin Sänger. Als Gegenleistung für eine warme Mahlzeit werde ich Euch und Euren Gästen etwas vorsingen und Euch unterhalten.«
Die Backen des Wirts plusterten sich, seine Augen verengten sich zu Schlitzen. Es war ihm anzusehen, dass er den Vorschlag wenig praktikabel fand und im Begriff war, den ungebetenen Gast vor die Tür zu setzen – als einer der Männer an den Tischen rief: »He, Bror! Das ist eine gute Idee! Setz uns zur Ausnahme mal was anderes vor als nur dein abgestandenes Bier!«
Einige der anderen Gäste stimmten gröhlend zu, und obwohl der Gedanke dem Wirt noch immer nicht recht zu behagen schien, gab er den Weg frei und winkte Rayan vollends in den Schenkraum. »Von mir aus«, knurrte er, »setz dich und spiel!«
»Aber was Ordentliches, hörst du?«, fügte der Schreihals von eben hinzu.
»Ja, was Schmissiges«, meinte ein anderer.
»Oder was von schönen Weibern«, schlug wieder ein anderer vor, was lautstarke Zustimmung nach sich zog.
»Ihr wollt was von Frauen hören?«, fragte Rayan. Er legte den Umhang ab und setzte sich kurzerhand ans Ende eines Tisches. Dabei ließ er seine von der Kälte noch klammen Finger über die Saiten der Leier gleiten, sodass einige Töne erklangen. »Nichts leichter als das. Ich bin weit herumgekommen, meine Freunde, das könnt Ihr mir glauben. Und ich habe Frauen gesehen von solcher Schönheit, wie Ihr es Euch in Euren kühnsten Träumen nicht ausmalen könnt!«
Die Blicke sämtlicher Gäste – es waren ausschließlich Kerle – hatten sich auf ihn gerichtet. Ihre von flachsblondem Haar umrahmten Mienen waren vom Bier gerötet, die Augen glasig. Die meisten waren vermutlich Fischer und verdienten ihren Lebensunterhalt damit, in den stürmischen Gewässern zwischen Nordhorn und Kap auf Fang auszufahren; aber auch einige Bauern waren wohl dabei, die mit ihrer Hände Arbeit dem kargen, sturmgepeitschten Land etwas abzuringen suchten. Es war ein hartes Leben, voller Mühsal und Entbehrungen – kein Wunder, dass sich diese Männer ein wenig Zerstreuung wünschten.
»Sing endlich!«, rief einer ungeduldig.
Noch einmal schlug Rayan die Leier an und spielte die ersten Töne einer noryschen Volksweise. Dann begann er zu singen:
Zu alter Zeit im Bordenland,
an rauen Meeres Klippen,
da lebte eine Maid gar fein
mit roten Rosenlippen.
»Aaah«, ging es erfreut durch die Reihen. Rayan hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, seine Lieder auf das jeweilige Publikum zuzuschneidern. Das Dichten fiel ihm leicht, er brauchte sich nur vorzustellen, wovon er singen wollte, dann kamen ihm die Reime spontan in den Sinn. Zur Freude seiner Zuhörer, die ihm gebannt an den Lippen hingen …
Wer diese Lippen küssen wollt,
der musste nicht lang bitten,
tat er es doch, so zeigte sie
ihm auch noch ihre …
Zu dieser schönen Maid dort kam
ein Ritter namens Keyl,
der hatte lang kein Weib gehabt,
drum war er auch so …
Er sah das schöne Mägdelein
und ließ gleich danach schicken
und sprach: »Die solche Lippen hat,
die möcht ich gerne …«
Er überließ es den Gästen des Lokals, jeweils das letzte Wort der Strophe hinzuzufügen, was diese auch lautstark und mit großem Vergnügen taten, wobei sie mit den Bierkrügen den Takt des Liedes auf den Tischen trommelten. Das Feuer schien plötzlich noch ein wenig wärmer, sein Schein noch heller und sein Flackern noch ein wenig lustiger zu sein, und selbst Bror, der Schenkwirt, blickte nicht mehr ganz so sauertöpfisch drein wie zuvor, zumal einige der Gäste nun nochmals Bier bestellten. Er kam mit einem dampfenden Teller Fischsuppe, den er vor Rayan auf den Tisch setzte, dazu ein Stück Brot.
»Iss«, forderte er ihn auf. »Und dann spiel weiter. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber dein Geplärr scheint den Leuten zu gefallen.«
Rayan nickte bereitwillig, griff nach dem hölzernen Löffel und aß. Die Fischsuppe schmeckte tranig und war versalzen, aber sie war heiß und füllte seinen Magen. Gierig löffelte er sie in sich hinein und genoss das wärmende Gefühl, das von seinem Bauch ausging. Dann griff er wieder zur Leier.
»Was wollt Ihr hören?«, fragte er in die Runde. »Noch mehr von schönen Frauen?«
»Seejungfrauen«, rief einer der Männer. »Sing etwas von Meerweibern, die einen arglosen Seemann verführen!« Die anderen bekundeten gröhlend ihre Zustimmung.
»Na schön«, meinte Rayan und schlug erneut die Saiten an. »Wie Ihr wollt. Dann hört gut zu …« Und erneut bemühte er eine alte Weise und begann dazu zu singen:
Durch sturmgepeitschte Meereswellen
fährt ein Schiff gen Skaradag.
Der Ausguck auf dem höchsten Mast
hält stets Wacht bei Nacht und Tag.
Bald stürzt das Schiff ganz tief hinab,
verschluckt vom Wellenschlund
und droht zu sinken, Maus und Mann,
zum dunklen Meeresgrund.
Doch der Posten auf dem Mast
hält aus, behält das Land im Blick
und schaut inmittst von Sturm und Wellen
plötzlich unfassbares Glück.
Denn dort in trüber grauer See,
wo Wellen sich auftürmen,
sieht eine Maid er einsam schwimmen,
als gäbe es kein Stürmen.
»Heda!«, ruft er und winkt ihr zu,
die Maid hebt ihr Gesicht.
Sie sieht ihn an, und unser Held
traut seinen Augen nicht.
Denn niemals haben seine Augen
solche Lieblichkeit gesehn
und ihm dabei vor Lust und Wonne
seine Sinne schon vergehn.
Er verlässt seine Wacht,
vergisst Pflicht, Sturm und Leid,
denn die Schöne aus der See
trägt weder Stoff noch Kleid.
Anmutig schimmert astargleich
ihr Körper wohlgestalt,
der Held, er sieht im Meeresrausch …
»Was?«, rief der Wirt herüber, auf dessen fliehender Stirn sich Schweißperlen gebildet hatten. Ob sie von der Hitze des Feuers rührten oder von den Bildern, die das Lied des Sängers in seinem Kopf heraufbeschworen hatte, war nicht festzustellen. »Was hat er gesehen?«
Erst jetzt bemerkte Rayan, dass er verstummt war.
Sein Leierspiel hatte ausgesetzt, die Worte waren ihm nicht über die Lippen gekommen – denn das Bild, das er vor Augen gehabt hatte, jener Eindruck flüchtiger Schönheit inmitten von Sturm und Gefahr, war plötzlich einer anderen Erscheinung gewichen, die sich mit Macht in den Vordergrund drängte.
Und die sehr viel dunkler war …
»Wei-ter! Wei-ter! Wei-ter!«, skandierten die Zuhörer und starrten ihn aus großen, glänzenden Augen an – und Rayan fuhr fort, dem inneren Drang gehorchend, den er verspürte:
der Held, er sieht im Meeresrausch
… nur Blut, Tod und Gewalt.
Durch graue Regenschleier schleicht
das Grauen in der Nacht.
Schon ist es da, so seht euch vor
und nehmt euch ja in Acht!
Von blutgen Äxten sinkt getroffen
der brave Seemann nieder.
Die Seinen warten brav zu Haus,
doch er kehrt nicht wieder.
Die Mörder jedoch haben schon
ein neues Opfer ausgemacht,
sehen helle Feuer leuchten
in dunkler, rauer Klippennacht.
Nichts ist vor ihrem Zorne sicher,
nicht Mann, nicht Frau, nicht Kind.
Sie bringen Tod und wollen Blut,
auf Beute aus sie sind.
Axt und Schwert und blanke Klinge
und der Sehn’ gefiedert Tod
bringen hundertfach Verderben,
Boden färbt sich blutig rot.
Und wenn der neue Tag anbricht,
die Nacht den Mantel hebt,
dort, wo Dorf und Häuser waren
nur ein einzger Mensch noch lebt.
Rayan verstummte, und als der letzte Saitenschlag verklang, war es im Schenkraum totenstill geworden. Nur noch das Knacken des Feuers war zu hören und das Prasseln des Regens auf dem alten Schindeldach.
Die Gäste starrten den Sänger erschrocken an.
Nach Bier war keinem mehr zumute, einige standen auf und wandten sich zum Gehen.
»Was soll das?«, fragte Bror der Schenkwirt, jetzt wieder so verdrießlich wie zuvor. »Du vergraulst mir die Gäste, du elender Krähensänger! Wenn du hier schon herumgröhlen musst, dann sing wenigstens etwas Fröhliches, hörst du?«
Die anderen Gäste stimmten zu, jedoch verhalten. Es war, als hätte sich ein dunkler Schatten über den Schenkraum gebreitet, selbst das Feuer schien nicht mehr ganz so hell zu brennen wie noch vorhin.
Rayan brauchte einen Moment, um zu sich zu kommen und sich von den Bildern zu lösen.
»Verzeiht«, sagte er dann, »das war nicht meine Absicht.«
»Dann sing etwas anderes!«, ereiferte sich der Wirt.
»Das … das kann ich nicht«, entgegnete der Sänger, auf das Instrument in seinen Händen starrend. »Ich muss gehen.«
»Nachdem du gerade mal zwei Lieder gesungen hast? Ist das der Dank dafür, dass ich dich durchgefuttert habe?«
»Es tut mir leid«, versicherte Rayan – und noch ehe der Schenkwirt oder einer seiner Gäste etwas entgegnen konnte, hatte er sich bereits seinen durchnässten Umhang wieder übergeworfen und war an der Tür. »Alles tut mir leid«, versicherte er – dann zog er sich die Kapuze über und trat wieder hinaus in die dunkle Nacht und in den strömenden Regen.
2
Palast von AltasharZur selben Zeit
Ein gellender Schrei weckte Lorymar Thinkling aus dem Schlaf. Sein Herz hämmerte laut in seiner Brust. Sein Nachtgewand klebte schweißdurchtränkt an seiner kleinwüchsigenen Gestalt, und er zitterte am ganzen Körper.
Derselbe Traum.
Schon wieder.
Lorymar hasste es, diesen Traum zu haben, doch noch mehr hasste er das Erwachen danach. Wenn ihm die Bilder des Albdrucks noch gegenwärtig waren und die Erinnerung an Dinge, die er längst vergessen wähnte, wie eine verdorbene Speise in ihm hochkrochen und ihm Übelkeit verursachten.
Stöhnend warf er sich auf seiner Schlafstatt herum, in der er fast zur Gänze versank, auf seidene Kissen gebettet und von einem Himmel aus Brokat beschirmt, auf dessen dunkelblauem Firmament im einfallenden Mondlicht winzige Sterne funkelten. Die laue Brise, die zum offenen Fenster hereinwehte und den süßen Duft von Weihrauch und Jasminblüten auf ihren Schwingen trug, machte Lorymar klar, wo er sich befand.
Nicht in der Heimat, und auch nicht dort, wo der düstere Traum ihn wähnte. Sondern an jenem Ort, von dem es hieß, er wäre der Nabel der neuen Welt. Jedenfalls, wenn man den Hofchronisten Glauben schenkte, die das niederschrieben, was König Astyragis zu lesen wünschte.
Gequält schlug Lorymar ein Auge auf.
Der neue Tag hatte noch nicht begonnen. Eine dunkle Nacht voller echter Sterne breitete sich noch über der Stadt aus, deren Türme und Kuppeln, Gassen und Gärten sich nach allen Richtungen erstreckten, bis sie im Osten an die Dünen der Wüste stießen und im Westen an die Gestade der See. Altashar die Alte wurde sie genannt, die Ehrwürdige, Erhabene …
»Scheiße«, knurrte Lorymar halblaut.
Nun, da er vollends erwacht war, würde es eine kleine Ewigkeit dauern, bis er wieder einschlief. Mit einem resignierenden Seufzen setzte er sich in seiner Schlafstatt auf, was aufgrund der Kissenberge, die ihn umgaben, mit einigem Aufwand verbunden war, und ließ die kurzen Beine herabbaumeln. Im Halbdunkel, das in der Schlafkammer herrschte, tastete er nach dem kleinen Beistelltisch, auf dem die noch halb gefüllte Karaffe stand. Mit geübtem Griff langte er nach dem Becher und goss sich ein.
Wein als Schlaftrunk.
Zum Trost in der Nacht.
Zum Erwachen am Morgen.
Zur Löschung des Dursts am Tage sowie zu einem satten Dutzend weiterer Gelegenheiten, die Lorymar unmöglich alle aufzählen konnte. Vielleicht würde er sich irgendwann hinsetzen und eine genaue Liste verfassen, der peinlichen Akribie entsprechend, mit der die Dinge am Hof von Altashar festgehalten wurden. Doch sehr viel wichtiger, als alle Gelegenheiten auswendig zu kennen, war es, im rechten Augenblick eine gut gefüllte Karaffe zur Hand zu haben. Und was das betraf, hatte Lorymar Thinkling es im Lauf seines Lebens zu erstaunlichem Geschick gebracht.
Er trank in großen, routinierten Schlucken.
Der Wein war zu warm und weder mit dem zu vergleichen, was auf den sonnigen Hängen Sarassas gedieh, noch mit jenem edlen Trunk, den man im fernen Hobheim kultivierte. Aber das Zeug erfüllte seinen Zweck, zumindest so lange, bis man wieder nüchtern wurde.
Um sicherzugehen, dass dies nicht geschah, füllte Lorymar den Becher gleich noch einmal und trank erneut bis auf den Grund. Dann wollte er sich wieder auf sein Lager sinken lassen, um sich dem Schlaf tapfer ein zweites Mal zu stellen – als jemand an die Tür seines Gemachs klopfte.
»Ja?«, fragte er. »Wer ist da?«
Gedämpftes Gelächter drang von der anderen Seite. Er hatte sich mal wieder seiner Muttersprache bedient – ein Versehen, das ihm selbst nach all den Jahren noch manchmal unterlief, vor allem, wenn er in Gedanken war oder in großer Aufregung. Für die Ostragi war das jedes Mal ein Grund zur Heiterkeit, denn in ihren Ohren klang die Sprache seiner alten Heimat dumpf und bäuerisch.
»Ist alles in Ordnung?«, drang es dumpf durch die verschlossene Tür.
»Natürlich«, knurrte Lorymar laut, nun im ostragischen Dialekt von Altashar, den er fließend beherrschte – in siebenunddreißig Jahren hatte er schließlich genug Zeit zum Üben gehabt. »Was sollte auch nicht in Ordnung sein?«
»Ihr habt geschrien, Herr«, kam es zurück.
»Ich habe …?«
Lorymar stutzte. Jetzt erst entsann er sich an den Schrei, der ihn aus dem Schlaf gerissen hatte. Offenbar hatte dieser Schrei nicht zu seinem Traum gehört, sondern war ganz und gar echt gewesen – und sein eigener.
»Es ist nichts«, versicherte er schnell.
»Seid … Ihr sicher, Herr?«
»Natürlich bin ich sicher!«
»Aber der Schrei …«
»Ist dies mein Gemach oder nicht?«, begehrte Lorymar auf. »Und ist es mir gestattet, in meinem Gemach zu lassen und zu tun, was mir beliebt, oder nicht?«
»Natürlich, Herr.«
»Also schert euch gefälligst fort, habt ihr verstanden?«
Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, griff er nach der Karaffe aus Messing und warf sie, sodass sie gegen die verschlossene Tür krachte und auf den Boden schepperte. Daraufhin waren von jenseits des dicken Zedernholzes leiser werdende Schritte zu hören und das Klirren von Kettenhemden. Die Wachen entfernten sich.
Mit einem Stoßseufzer ließ sich Lorymar wieder auf sein Lager nieder. Sein Herz schlug jetzt noch schneller als zuvor, so sehr hatte er sich aufgeregt – nicht der aufdringlichen Wachen wegen, die im Grunde ja nur ihre Pflicht taten, sondern weil er im Schlaf geschrien hatte. Denn inzwischen glaubte er sich zu erinnern, was er gerufen hatte. Es war nicht nur einfach ein Schrei gewesen oder ein unartikulierter Laut, sondern ein Name, den er laut gerufen hatte – und er war froh, dass die Palastwachen ihn wohl nicht verstanden hatten.
Lorymar schluckte hart.
Er würde sich vorsehen müssen für den Fall, dass die Träume sich noch verstärkten. Bislang hatte es ausgereicht, sich mit Wein zu betäuben, aber was, wenn Freund Rebstock ihm diese Gunst nicht länger erwies? Würde er dann zu noch einschneidenderen Maßnahmen greifen müssen? Womöglich die Macht des Ophirs bemühen? Und wenn auch das nicht mehr genügte? Was dann?
Während er wieder in den Kissen versank, bedauerte er mit der Karaffe auch den letzten Rest Wein an die Tür seines Gemachs geschleudert zu haben, von wo er nun herabrann und leise zu Boden tröpfelte. Lorymar zählte jeden einzelnen Tropfen mit, bis endlich fern im Osten der Morgen heraufdämmerte und ein neuer Tag begann.
Ein neuer Tag im Leben von Lorymar Ghurab Thinkling – dem Zwerg des Königs von Altashar.
3
Nördliches BordlandNur wenig später
Von einer hohen Klippe aus beobachtete Rayan das Geschehen – aus sicherer Entfernung und doch nah genug, um alles zu erkennen, zumal der Regen nachgelassen hatte und die Schleier weniger dicht waren.
Es war nicht zu verhindern gewesen, sagte er sich. Und doch schmerzte es ihn wie eine Messerklinge, die sich tief in sein Fleisch gebohrt hatte – das Wissen, Hilfe verweigert und geschwiegen zu haben, als er hätte reden sollen.
Doch was hätte es genützt?
Nichts.
Lodernde Flammenschweife nach sich ziehend, stiegen die Pfeile in den dunklen Himmel, erreichten den höchsten Punkt ihrer Flugbahn und senkten sich dann wieder, fielen dem Boden entgegen und bohrten sich in die Dächer der Häuser. Ihre Schäfte waren mit pechgetränkten Lappen umwickelt, sodass die Schindeln trotz des Regens sofort Feuer fingen. Hell brannten die Flammen in der Nacht, und als wäre dies das Signal, wälzten sich aus den umgebenden Hügeln dunkle Gestalten auf das Dorf zu, in deren Händen blanke Äxte und Schwerter schimmerten und von deren Helmen Hörner und Geweihe ragten.
Das Gebrüll, das die Nordmänner anstimmten, als sie über das Dorf herfielen, die Türen einschlugen und in die Häuser eindrangen, war so laut, dass es bis zu Rayan herüberdrang, und es hatte kaum etwas Menschliches an sich. So weit war es mit den Menschen gekommen in dieser bis ins Mark gespaltenen, zerrissenen Welt.
Erschüttert beobachtete er, wie die Dorfbewohner aus ihren Häusern getrieben wurden, wie die grausamen Barbaren die Männer erschlugen und über die Frauen herfielen, den hungrigen Wölfen gleich, die das Schild über dem Wirtshaus beschwor. Er konnte sehen, wie die Männer, mit denen er eben noch am Feuer gesessen hatte, die über seine Lieder und Zoten gelacht hatten, ins Freie gezerrt und abgeschlachtet wurden, wie man ihre Köpfe auf Spieße steckte, die man in den morastigen Boden rammte. Grauen packte ihn, und er wandte sich ab im Wissen, dass er all dies bereits einmal gesehen hatte.
Vor wenigen Augenblicken.
Er war nicht mehr in der Lage, Trauer oder Mitgefühl zu empfinden, denn wenn er etwas gelernt hatte, dann dass sich manche Dinge nicht verhindern ließen, ganz gleich, wie sehr man es versuchte. Und so war dort, wo Bestürzung und Mitleid, Reue und Skrupel hätten sein sollen, nur entsetzliche Leere. Eine Leere in seinem Herzen und seinen Gedanken, in allem, was er war – und die ihn langsam aufzufressen drohte.
»Sänger!«, sagte in diesem Moment eine Stimme hinter ihm.
Er fuhr herum – nur um sich einer Gruppe von Männern gegenüberzusehen, die lederne Röcke trugen und Tüchern vor den Gesichtern, die nur zwei schmale Sehschlitze frei ließen.
Der Griff zu dem Dolch an seinem Gürtel war ein sinnloser Reflex – er konnte es unmöglich mit allen gleichzeitig aufnehmen. Und noch während ihm diese Erkenntnis dämmerte, traf ihn etwas hart und schwer am Kopf, und er brach zusammen.
4
Hospital von AltasharAm nächsten Morgen
»Und diese Träume kehren immer wieder?«
»Nein.« Lorymar schüttelte den Kopf, der ihm wie an jedem Morgen heftig brummte – zu viel Wein und zu wenig Schlaf … »Das heißt, eigentlich ja.«
»Was nun?«
Ildarim stemmte die ebenso langen wie dürren Arme in die Hüften und sah ihn aus seinen faltigen Zügen an. Lorymar hielt dem Blick des Alten stand, musste dazu allerdings den Kopf in den Nacken legen, was nur noch mehr wehtat.
»Manchmal kehren die Träume wieder«, gestand er widerstrebend ein, »und manchmal auch nicht. Was gilt es Euch, Heiler? Ich habe Euch nicht aufgesucht, damit Ihr mich mit Fragen löchert, sondern damit Ihr mich von diesem elenden Kopfschmerz und dieser Schlaflosigkeit befreit.«
»Das Erste ist leicht«, meinte der Gelehrte in unverhohlener Belustigung. »Sprecht dem Wein weniger zu, und Ihr werdet sehen, wie sich der Schmerz von ganz allein legt.«
»Ein billiger Rat«, knurrte Lorymar – wobei natürlich nicht von der Hand zu weisen war, dass der Heiler recht hatte. Aber eigentlich war das Schädelweh ja auch nicht der Grund dafür, warum Lorymar seine Abneigung gegen alle Ärzte und Quacksalber überwunden und sich zu einem Besuch im Hospital der Stadt überwunden hatte. Er hatte es wohl nur gesagt, um eine falsche Fährte zu legen und von seinem eigentlichen Problem abzulenken. Doch der alte Ildarim hatte nicht von ungefähr seinen Namen, der übersetzt »der Allwissende« bedeutete.
»Es wundert mich«, meinte er kopfschüttelnd, wobei er sich den langen grauen Kinnbart zupfte. »Etwas passt hier nicht zusammen. Wein ist gewöhnlich nicht das Getränk, auf das sich böse Träume einstellen. Ich habe hin und wieder sogar schon geringe Dosen als Schlaftrunk empfohlen.«
»Dann bin ich wohl eine Ausnahme«, grunzte Lorymar missmutig. Es war erniedrigend, um Hilfe zu betteln. Im Nachhinein hätte er sich für seine Entscheidung, das Hospital aufzusuchen, am liebsten geohrfeigt. »Am besten, ich werde wieder gehen«, meinte er deshalb, »und …«
»Nicht so eilig«, hielt der Heiler ihn zurück. »Ihr habt diese Hallen aufgesucht, weil Euch ein Leid bedrückt, und in den Schriften Herkabs heißt es, dass niemand abgewiesen werden soll, der unserer Hilfe bedarf.«
»Ihr habt mich nicht abgewiesen«, brachte Lorymar in Erinnerung, während er bereits Richtung Ausgang watschelte. »Ich bin freiwillig gegangen.«
»Ich habe Euch aber noch nicht entlassen«, beharrte der Allwissende, und die Art und Weise, wie er seine Worte betonte und Autorität in seine Stimme legte, behagte Lorymar gar nicht. Man konnte sich nicht dagegen wehren.
»Diese Träume«, kam Ildarim wieder auf den Kern der Sache, energischer diesmal, »kehren also wieder.«
»Nun … ja.«
»Warum geht es dabei?«
Lorymar wich dem forschenden Blick des Heilers aus. Verdammt, was sollte die Fragerei? Was wurde der alte Schwachkopf plötzlich so neugierig? »Warum ist das wichtig?«, wollte er wissen.
»Weil es mir der Schlüssel zu Eurem Problem zu sein scheint. Herkab schreibt, dass die Ursachen einer Krankheit oftmals nicht im Körper einer Kreatur zu suchen sind, sondern in ihrer Seele.«
»Ist mir egal, was Herkab schreibt«, schnaubte Lorymar verdrossen. »Ich bin nicht krank, ich schlafe nur nicht besonders gut, das ist alles.«
»Seit fünf Monden«, brachte Ildarim in Erinnerung, was Lorymar ihm zu Beginn leichtsinnigerweise erzählt hatte. Das Gedächtnis des Greises schien noch bestens zu funktionieren.
»Seit einer Weile«, drückte Lorymar es freundlicher aus. »Also gebt mir irgendetwas aus Eurer Kräutertruhe, damit ich wieder zu meinem verdienten Schlaf komme, und lasst es dabei bewenden.«
»Das würde ich gerne, aber so einfach ist das nicht. Die Lehre Herkabs kennt Hunderte unterschiedlicher Arzneien. Dabei ist wohl zu erwägen, welche in welchem Fall zur Anwendung gelangt – und für diese Entscheidung stellt die Untersuchung des Patienten die wichtigste Grundlage dar. Herkab betont überdies, dass sich diese Untersuchung nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die Gemütsverfassung des Hilfesuchenden beziehen muss.«
»Da seid ganz unbesorgt, um die ist es tadellos bestellt«, beteuerte Lorymar schnell.
»Und da seid Ihr Euch sicher?« Der Blick des Heilers fokussierte sich erneut, wurde ernst und prüfend. »Bisweilen sind es Begebenheiten aus unserer Vergangenheit, die uns nicht zur Ruhe kommen lassen und deren Geister uns bis in die Gegenwart verfolgen.«
»Ich glaube nicht an Geister«, stellte Lorymar klar. »Und da ist auch sonst nichts, das mich verfolgen würde, ich bin mit meiner Vergangenheit im Reinen. Also gebt mir jetzt entweder etwas aus Eurer Giftküche oder lasst es bleiben, aber hört auf, mir Ratschläge zu erteilen, derer ich nicht bedarf!«
»Verzeiht«, gab Ildarim mit mildem Lächeln zurück. »Mir war nicht bewusst, dass Euch die Sache so nahegeht. Aber ich habe nicht an der Universität von Medras unter den größten Heilern des Reiches studiert, um mich von einem Zwerg verunglimpfen zu lassen«, konterte der Alte. »Ihr seid gekommen, weil Ihr meine Hilfe wolltet. Nicht umgekehrt.«
»Das ist wahr«, kam Lorymar nicht umhin zuzugeben. Er war jetzt vollends davon überzeugt, dass es töricht gewesen war, den Heiler aufzusuchen. Was konnten diese Quacksalber anderes als gescheit daherreden? Nichts, rein gar nichts … »Ein Fehler, der nicht wieder vorkommen wird«, fügte er schmollend hinzu, machte auf dem Absatz kehrt und verließ nun endgültig das Behandlungszimmer.
»Nehmt das nicht auf die leichte Schulter!«, rief Ildarim ihm hinterher. »Der Mensch braucht Schlaf, um zu innerer Ruhe zu finden. Möglicherweise könnten Euch auch Bäder wohl bekommen! Ein Dampfbad mit Kräutern vielleicht …«
Lorymar drehte sich nicht mehr um. Schnaubend trat er in die Empfangshalle des Hospitals, deren hohe, fassartig gewölbte Decke von Säulen getragen wurde und in deren Mitte ein Brunnen sprudelte. Auf den steinernen Bänken zwischen den Säulen saßen Leute mit allerhand Gebrechen und warteten darauf, zum großen Ildarim vorgelassen zu werden. Lorymar sah sie mit Verachtung. Sollten diese armen Kreaturen doch den Scharlatan aufsuchen – er würde ganz sicher nicht mehr an diesen Ort zurückkehren, niemals wieder.
Die Blicke, die man ihm zuwarf, versuchte er zu ignorieren. So lange weilte er nun schon in Altashar, und doch schienen die Ostragi sich nicht an seinen Anblick gewöhnen zu können. Oder vielleicht, dachte er wutschnaubend, gab es auch immer noch ein paar zurückgebliebene Idioten, die Lorymar Ghurab Thinkling, den Zwerg des Königs, nicht kannten.
Dabei waren dieser Name und diese Bezeichnung gleich in doppelter Hinsicht irreführend. Denn zum einen war Lorymar nach den mehr als drei Jahrzehnten, die sein Aufenthalt in Altashar nun bereits währte, ganz sicher kein ghurab, kein Fremder mehr. Und zum anderen war er eigentlich gar kein Zwerg – aber was hätte es genutzt, den Ostragi den Unterschied zwischen einem stolzen Sohn von Hobheim und einem bärtigen Spross von Nifelberg zu erklären?
Schon die Bewohner von Westray waren äußerst oberflächlich, wenn es um derlei Unterscheidungen ging – die Bezeichnung »Halbling«, mit der sie Lorymar und seinesgleichen bedachten, war schließlich wenig schmeichelhaft, so als ob es sich bei ihnen nur um halbe, nicht aber um ganze Menschen handelte. Das Ostreich hingegen kannte keine kleinwüchsigen Bewohner, von den Reiterstämmen des Toten Landes vielleicht einmal abgesehen, die bucklig waren und hässlich und – falls die Gerüchte stimmten – abscheulichen Bräuchen frönten.
Lorymar hatte also nie die Mühe unternommen, den König darüber aufzuklären, dass der Zwerg, dessen er sich so gerne rühmte, eigentlich gar keiner war.
Und schließlich genoss er als »Zwerg des Königs« ja auch gewisse Privilegien, und diese aufzugeben, wäre tatsächlich noch dümmer gewesen, als wegen eines etwas unruhigen Schlafs einen Heiler um Hilfe zu bitten.
5
SalzmeerZur selben Zeit
Als Rayan wieder zu sich kam, wusste er nicht zu sagen, was schlimmer war: Das Dröhnen in seinem Schädel oder das Wissen, dass er gefangen war und sich in Feindeshand befand.
Die Erinnerung an die zurückliegende Nacht, an das Wirtshaus, das Dorf und den Überfall der Barbaren, an die grässlichen Bilder, die sich in sein Gedächtnis eingebrannt hatten, schwappte in sein Bewusstsein wie Jauche. Und tatsächlich war der Gestank von fauligem Fisch und Brackwasser das Nächste, was an sein Bewusstsein drang, zusammen mit dem Knarren vom Holz und Tauen und dem Gefühl, dass er Boden unter ihm schwankte.
Er war auf See!
Jäh schlug er die Augen auf und fuhr hoch – was sein Schädel mit pochendem Schmerz belohnte. Dennoch gehörte seine erste Sorge seiner Leier – wo war sie?
Noch halb blind tastete er umher und war unendlich erleichtert, als er das alte, glatte Holz zu fassen bekam. Wie einen kostbaren Schatz presste er es an sich. Dann rieb er sich die Schläfen, während er sich leise stöhnend umblickte und zu orientieren versuchte. Offenbar befand er sich unter Deck … Tageslicht fiel durch eine hölzerne Gräting und zeichnete ein Muster von Quadraten auf die Planken. Und inmitten des Zwielichts stand eine Gestalt, die Rayan sofort wiedererkannte. Es war der Kerl, der ihn auf der Klippe angesprochen hatte, kurz bevor er niedergeschlagen worden war.
Auch jetzt trug der Mann noch das Tuch vor dem Gesicht. Die dunklen Augen, die durch den Sehschlitz zu erkennen waren, blickten prüfend auf ihn herab. Der gekrümmte Säbel des Vermummten jedoch steckte in der Scheide, und auch an seiner Körperhaltung und den im Rücken verschränkten Händen konnte Rayan nichts Bedrohliches erkennen.
»Wo …?«, begann er qualvoll. Seine Stimme krächzte fürchterlich.
»Auf unserem Schiff«, erklärte der andere überflüssigerweise. Von einem der Haken, die an der niederen Decke angebracht waren und an denen allerhand Gegenstände hingen, nahm er einen Wasserschlauch, entkorkte ihn und reichte ihn Rayan. Der Sänger nahm ihn dankbar entgegen und trank in kleinen Schlucken. Seine Lebensgeister kehrten spürbar zurück, und auch das Brennen in seiner Kehle ließ nach.
»Warum?«, wollte er wissen und sah den Fremden fragend an. Er versuchte, von den Augen auf das Gesicht zu schließen, das sich unter dem dunkelroten Tuch verbarg, aber das war nicht möglich. Also bemühte er seine Fantasie, um es sich zumindest vorzustellen – das sonnengebräunte, wettergegerbte Gesicht eines Südländers, so wie die dunklen Augen und der fremdartige Akzent es nahelegten.
»Sieh es als Dank an, Bruder«, erwiderte der andere und verschränkte die Arme vor der Brust.
Rayan rieb sich den noch immer schmerzenden Hinterkopf – sehr dankbar kam ihm das alles nicht vor. »Als Dank wofür?«
»Für die Gunst, die du uns erwiesen hast.« Der Fremde deutete auf Rayans Haupt. »Das war nicht vorgesehen. Meine Leute sind manchmal ein wenig … übereifrig.«
»Eure Leute? Wer seid Ihr?«
Der Fremde lachte leise. »Warum wohl, glaubst du, trage ich diese Maske, Bruder? Warum verhülle ich mein Gesicht?«
»Wer weiß?« Rayan schnitt eine Grimasse. »Vielleicht bist du so hässlich.«
»Nicht hässlicher als du«, versicherte der andere in Anspielung auf die Narbe, die über Rayans Gesicht verlief. »Wenn du einen Namen brauchst, so nenne mich Lahad – in der Sprache meiner Heimat bedeutet das schlicht ›Niemand‹.«
»Turanien?«, fragte Rayan.
»Bessos«, war die Antwort.
Rayan hob die Brauen. »Was hast du hier im Norden zu schaffen? Noch dazu auf dieser Seite des Bruchs?«
»Das Ostreich und Westrien befinden sich nicht im Krieg«, versetzte der andere. »Und selbst wenn es einst so sein sollte, ist Lahad nicht der Mann, der in fremden Kriegen für fremder Herren Land kämpft. Lahad ist nur für Lahad.«
»Das leuchtet ein«, gab Rayan zu. »Wer also seid ihr? Warum habt ihr mich hierher verschleppt?«
»Wegen des Liedes, das du gesungen hast.«
»Welches Liedes?«
»Das von den Dingen handelte, die kommen würden – und die inzwischen geschehen sind. Du hast sie vorhergesehen.«
Rayan verkrampfte sich innerlich, die Narbe in seinem Gesicht, so alt sie auch war, begann plötzlich wieder zu schmerzen. »Das ist lächerlich«, behauptete er reflexhaft. »Ich habe nichts dergleichen getan. Ich bin nur ein einfacher Sänger, ein Spielmann auf Wanderschaft …«
»… der von der Zukunft singt«, bestätigte der andere unerschütterlich. »Die Barbaren sind gekommen – genau, wie du es vorausgesagt hast. Oder muss es in deiner Sprache ›vorausgesungen‹ heißen?«
»So ein Wort gibt es nicht, weder in meiner noch in deiner Sprache«, wies Rayan ihn zurecht. »So wie es auch weissagende Sänger weder gibt noch jemals gab.«
»Da irrst du dich«, versicherte Lahad. »Es hat sie gegeben – aber das ist lange her. In meiner Heimat berichten uralte Geschichten davon.«
»Ach ja?« Rayan biss sich auf die Lippen, frustriert darüber, dass ihm dieser Fehler unterlaufen war – und, noch schlimmer, dass er offenbar dabei erwischt worden war. »Für wen arbeitest du?«, wollte er deshalb wissen. »Für den Orden der Exekutoren?«
»Ich sagte es dir doch schon – Lahad ist nur für Lahad. Und du bist auch nicht mein Gefangener.«
»Nein.« Rayan rollte mit den Augen. »Natürlich nicht.«
»Trägst du etwa Fesseln?«
»Nein – aber das wäre auch überflüssig, da wir uns auf See befinden.«
»Aber du könntest mich mit deinem Dolch angreifen.«
Rayan schaute an sich herab – die Klinge steckte tatsächlich noch in seinem Gürtel.
Lahad lachte wieder. »Das unterscheidet den Sänger vom Krieger – der Krieger greift zuerst zur Waffe, der Sänger zur Leier. Aber sei unbesorgt, Bruder, dir wird kein Leid geschehen. Wie ich schon sagte, bist du hier, weil wir dir danken wollten – und dich retten.«
»Wovor?«
»Vor denselben Ungeheuern, denen auch wir nur mit Not entronnen sind. Und das verdanken wir dir.«
Rayan betrachtete den Vermummten aufmerksam, musterte ihn von Kopf bis Fuß – und dann begriff er.
Die Vision, die er in dem Wirtshaus gehabt hatte … Kurz nachdem er das Lied von den Dingen, die kommen würden, beendet hatte, hatten einige Männer das Lokal verlassen. Im Nachhinein ärgerte er sich darüber, dass er weder besonders auf sie geachtet noch sich ihre Gesichter angesehen hatte. Denn eines davon steckte wohl unter dieser Maske.
»Ihr wart auch in dem Gasthaus«, folgerte er.
»Auch Brüder müssen essen und trinken«, verteidigte sich der andere, und irgendwie wusste Rayan, dass das Gesicht unter dem Tuch dabei grinste.
»Ihr habt mein Lied gehört.«
»So wie alle anderen im Schenkraum«, räumte Lahad ein.
»Aber nur ihr seid gegangen.«
»Und deshalb leben wir noch.«
»Aber warum?«, fragte Rayan. »Warum habt ihr mir geglaubt? Was, bei Eileas’ Klinge, brachte euch auf den Gedanken, dass sich dahinter mehr verbergen könnte als nur eine schaurige Geschichte?«
»Vielleicht«, entgegnete Lahad feierlich, »glaube ich ja noch an die Kraft der Magie – auch wenn es in diesem Land bei Strafe verboten ist. Oder vielleicht«, fügte er achselzuckend und sehr viel lapidarer hinzu, »haben wir ja auch schon vor ein paar Tagen den Rauch des Todes an der Küste gesehen und wussten deshalb, dass die bleichen Schlächter auf Beutezug sind. Meine erste Vermutung war, dass du zu ihnen gehörst und irgendein dunkles Spiel mit uns treibst, aber dann sah ich das Entsetzen in deinem Gesicht – und das war echt. Du wusstest nicht, was du da singst, das konnte man deutlich sehen, und du warst selbst darüber erschrocken. Und in diesem Moment habe ich mich an die Geschichten aus meiner Kindheit erinnert, an die Trommeln von Zawara, die einst vor der Invasion der Drakis warnten …«
»Ich bin aber kein Trommler.«
»Ist mir auch schon aufgefallen.« Lahad trat vor, reichte Rayan die Hand und zog ihn vorsichtig auf die Beine. »Wird es gehen?«
»Sicher.« Rayan nickte.
»Das ist eine erstaunliche Fähigkeit, die du da hast, Bruder. Ein Segen des Schicksals.«
»Ein Segen?« Rayan lachte freudlos auf. »Wohl eher nicht. Ich kann diese Dinge nicht beeinflussen. Manchmal, wenn ich singe, sehe ich plötzlich Dinge vor mir, furchtbare Dinge – von denen ich weiß, dass sie geschehen werden.«
»Hast du je versucht, sie zu verhindern?«
Rayan sah in die dunklen Augen, die ihn fragend anblickten. »Vor langer Zeit«, räumte er ein. »Die Menschen hören nicht gerne, was ihnen bevorsteht – die meisten ziehen es vor, ihre Zukunft nicht zu kennen. Ganz abgesehen davon, dass sie mich für eine Absonderlichkeit halten und sich vor mir fürchten. Und dass ich mich vor den Exekutoren in Acht nehmen muss.«
»Hier nicht«, widersprach Lahad. »Hier auf dem Meer bist du frei, Bruder.«
»Und dafür danke ich dir«, versicherte Rayan. »Aber wie lange wird das so sein?«
»Komm mit.« Der Vermummte machte auf dem Stiefelabsatz kehrt und trat an die Leiter, die auf Deck führte. Über die knarrenden Stiegen kletterte er hinauf, und Rayan folgte ihm.
Das helle Tageslicht blendete den Sänger, und er brauchte einige Augenblicke, sich zurechtzufinden. Er befand sich auf einer Karacke, einem Einmaster mit hohem Bugsteven und geräumigem Achterhaus. Die Seeleute, die sich auf Deck tummelten, waren ebenso gekleidet und vermummt wie Lahad, der ihr Anführer zu sein schien, denn sie begegneten ihm mit Ehrerbietung. Rayan hingegen würdigten sie keines Blickes, so als wäre er nicht einmal da. Sein Blick glitt am Mastbaum empor und über das geblähte Segel hinweg zur Spitze.
Eine schwarze Flagge wehte dort im Wind, ohne jedes Symbol oder Schriftzeichen – und Rayan erschrak.
»Die Unsichtbaren«, entfuhr es ihm.
»Wie schon gesagt – ich bin niemand«, versicherte Lahad.
Rayan fühlte sein Herz schneller schlagen. Die Unsichtbaren waren eine geheime Bruderschaft, eine Vereinigung von Schmugglern, Piraten und Assassinen, deren Ursprünge in ferner Vergangenheit lagen, noch lange vor der Divergenz. Als Sänger kam Rayan viel herum, und gerüchtehalber war ab und an zu hören gewesen, dass die Unsichtbaren noch immer existierten und ihr Unwesen trieben. Doch noch nie hatte er gehört, dass es sie so weit nach Norden verschlug, und noch niemals hatte er einen von ihnen zu Gesicht bekommen.
»Ich weiß, was du denkst«, versicherte Lahad. »Du fragst dich, ob du dem einen Unheil nur entronnen bist, um nun vom nächsten ereilt zu werden.«
»Und?«, fragte Rayan.
»Sei beruhigt. Die Unsichtbaren mögen vieles sein, aber sie sind keine Barbaren, die wahllos töten und morden. Und obwohl sie die Freiheit lieben, sind sie einem strengen Kodex unterworfen.«
»Warum sagst du mir das alles?« Einmal mehr versuchte Rayan, hinter die Maske zu blicken. »Warum bin ich wirklich hier?«
»Die Täuschung ist der Unsichtbaren Geschäft – doch du, Bruder, bist schwer zu täuschen«, anerkannte Lahad. »Du bist hier, weil ich dir ein Angebot machen will – das Angebot, ebenfalls unsichtbar zu werden.«
»Ich … ich soll ein Unsichtbarer werden? Eurer Bruderschaft beitreten?«
»Und frei sein vor allen Nachstellungen, die dir in der Welt dort draußen drohen«, bestätigte der andere. »Wir bieten dir Schutz – und du stellst im Gegenzug deine Fähigkeit in unseren Dienst und warnst uns, wann immer die Zukunft für uns Böses verheißt.«
»Klingt nach einem guten Geschäft«, kam Rayan nicht umhin zuzugeben. »Die Sache hat nur einen Haken – ich kann meinen Teil des Handels nicht erfüllen. Denn ich habe keinen Einfluss auf das, was ich sehe. Ich kann weder den Ort bestimmen noch die Zeit – womöglich beschützt ihr mich ein Leben lang, ohne dass ich euch auch nur eine einzige nützliche Information gebe.«
»Und dennoch«, wandte der Kapitän der Unsichtbaren ein, »ist es besser, einen flüchtigen Blick auf die Zukunft zu erheischen, als überhaupt nichts von ihr zu wissen.«
»Und außerdem …«, fuhr Rayan fort.
»… hast du andere Pläne.«
Rayan nickte. Er war beschämt und wusste selbst nicht, wieso. Vielleicht, weil es das erste Mal war, dass er offen über seine Gabe sprechen konnte und man ihn dafür nicht verurteilte … »Ich hatte nicht vor, in jenem Dorf zu bleiben«, gestand er. »Ich war nur auf der Durchreise.«
»Mit welchem Ziel?«
»Skaradag.«
Die Augen unter der Maske blickten ihn an, als hätte er den Verstand verloren. »Skaradag? Warum, bei den Säulen von Isos, ausgerechnet Skaradag?«
»Ich habe meine Gründe«, entgegnete Rayan vorsichtig, während er sich fragte, ob die Unsichtbaren ihn nun vielleicht doch noch über Bord werfen würden.
»Keine Sorge«, versicherte Lahad, als könnte er seine Bedenken erahnen. »Deine Rettung vor den Barbaren war nicht an Bedingungen geknüpft. Im Gegenteil – wir sind es, die in deiner Schuld stehen, Sänger, und die Unsichtbaren pflegen ihre Schulden zu begleichen.« Damit wandte er sich von Rayan ab und dem Steuermann zu, der auf dem Achterdeck seinen Dienst versah. »Kurs Ost-Südost«, wies er ihn an. »Wir segeln nach Skaradag!«
6
Palast von AltasharNur wenig später
Lorymar war in Eile. Die Tagung des Kronrats, an der er als Zwerg des Königs teilzunehmen hatte, war für die zweite Stunde nach Sonnenaufgang angesetzt, und der Besuch im Hospital hatte mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet.
In den seidenen Pantoffeln, die man eigens für seine Größe angefertigt hatte, hastete er durch die Arkaden des königlichen Palasts, dabei stets bemüht, nicht über den Saum seines weiten Gewandes zu stolpern, und mit dem riesigen Turban, der auf seinem Kopf saß und bei jedem Schritt hin und her wippte, nirgendwo anzuecken. Natürlich diente dieser Aufzug dazu, seinen Träger der Lächerlichkeit preiszugeben, aber Lorymar hatte schon vor langer Zeit aufgehört, sich daran zu stören – und auch hierzu leistete der Wein einen wertvollen Beitrag.
Das Tor zum Thronsaal war dazu angetan, nicht nur Halblinge, sondern auch jede andere Kreatur, die es durchschritt, auf Däumlingsgröße schrumpfen zu lassen und ihr unmissverständlich klarzumachen, dass die Macht in diesem Teil der Welt in den Händen des Mannes lag, der jenseits dieser Pforte Hof hielt. Auf Lorymar Thinkling hatte das große Tor allerdings nie diese einschüchternde Wirkung gehabt. Vielleicht, weil er es gewohnt war, kleiner zu sein als seine Umgebung; vor allem aber deshalb, weil er es vorzog, den Thronsaal durch einen Nebeneingang zu betreten, der über einen breiten Balkon führte, der von den khalimi gesäumt wurde, den Leibwachen des Königs. Von hier aus gelangte man nicht nur sehr viel unauffälliger in den Saal, sondern konnte ihn auch zur Gänze überblicken. Selbst dann, wenn man nur viereinhalb Fuß groß war.
Lorymar hatte die Neigung der Ostragi, möglichst jeden Sachverhalt in große Worte und blumige Metaphern zu kleiden, nie recht verstanden. Zumindest aber was die Leibwache des Königs betraf, war die Bezeichnung durchaus angemessen: khalim bedeutete »unsterblich«, und zumindest dem Anschein nach waren die Wächter das auch, denn ihre Anzahl verringerte sich niemals, sondern betrug stets genau 777. Ließ einer von ihnen sein Leben oder schied aus dem Dienst aus, so wurde die Lücke sofort wieder gefüllt; und da die Unsterblichen Helme mit Kettengeflecht trugen, das ihre Gesichter verhüllte, sahen alle gleich aus, und man hatte tatsächlich stets den Eindruck, als wären es immer dieselben Krieger, die über Monde und Jahre hinweg ihren König beschützten.
In den Nischen unterhalb des Balkons waren die Hofschreiber untergebracht, die dort an ihren kleinen Tischen kauerten, um festzuhalten und noch an Ort und Stelle zu vervielfältigen, was der König und seine Berater beschlossen; im Rund der Halle selbst, unter einer gewaltigen, freitragenden Kuppel, tagten der Herrscher und sein Hofrat: Auf der einen Seite der Wesir und des Königs Neffe, auf der anderen der Hofmarschall und das Oberhaupt der Priesterschaft. König Astyragis selbst thronte auf einem erhöhten, seidenbeschlagenen Sitz, dem von Sklaven aus dem dunkelsten Ophira mit gewaltigen Fächern aus schillernden Pfauenfedern kühle Luft zugefächelt wurde. Ein leibhaftiger Löwe, Astyragis’ Wappentier, rekelte sich zu des Königs Füßen. Wie es hieß, sei es allein der natürlichen Autorität des Königs zu verdanken, dass sich die Bestie nicht auf den versammelten Kronrat stürzte und mit Haut und Haaren verschlang; Lorymar nahm allerdings an, dass auch die Tatsache, dass das Tier uralt war, halb blind und dazu noch kastriert, eine gewisse Rolle spielte.
Nach Norden hin öffnete sich der Thronsaal zum grünenden Garten, in dem Dattelpalmen, Akazien und Maulbeerfeigen wuchsen und auch im Sommer, wenn die Sonne am höchsten stand, noch kühlen Schatten spendeten. In der Mitte des Gartens sprudelte der von sieben marmornen Löwen umgebene Brunnen von Altashar, der als Symbol der Macht des Königs galt. Wie es hieß, war der Brunnen in den Wirren der großen Katastrophe und des Untergangs von Myracor nach Altashar gebracht worden.
Und mit ihm auch die wahre Herrschaft.
Was den König selbst betraf, so machte Astyragis der Löwe zumindest seinem Äußeren nach eine eindrucksvolle Figur. Waren die Abkömmlinge des Hauses Tyras ohnehin schon alle groß gewachsen, überragte der König sie noch einmal um Haupteslänge. Er war ein Riese, dabei aber von schlanker, beinahe zerbrechlich wirkender Postur. Entsprechend scharf und kantig waren seine Gesichtszüge, die wie aus Stein gemeißelt schienen. Eine ebenso lange wie schmale Nase teilte das Antlitz des Herrschers klingengleich, seine schwarzen Augen blickten aus dunklen, mit Galenit und Malachit geschminkten Höhlen, aufmerksam und, wie es schien, in stetem Argwohn. Das Kopfhaar des Herrschers, nach alter Überzeugung Symbol seiner Macht, war lang und zu zahllosen Zöpfen geflochten, von denen einige bereits ergraut waren. Sein Gewand war aus blauem Brokat und von Goldfäden durchwirkt, eines Herrschers würdig.
Zu Astyragis’ rechter Seite thronte Gadates, der alte Wesir des Reiches. Sein Gewand war nach alter Tradition, ebenso wie der Turban, den er trug, und der spitze Kinnbart. Schminke und wohlriechenden Salben, wie nicht nur der König, sondern auch die meisten Höflinge sie verwendeten, vermochte er nichts abzugewinnen. Gadates war einst der Lehrer sowohl des Astyragis als auch seines Bruders Artaban gewesen und hatte schon unter ihrem Vater gedient; Lorymar hatte ihn als einen Mann harter, aber klarer Worte kennengelernt, aus denen die Erfahrung eines langen Lebens sprach. Und mitunter auch die Verbitterung.
Neben ihm saß Nawyd pan Tyras. Als Neffe des Königs und einziger Sohn seines Bruders Artaban war Nawyd Prinz von Altashar und Anwärter auf den Thron – jedenfalls, solange Astyragis keinen leiblichen Erben hatte. Nawyd war kleiner als sein Onkel, dabei aber muskulöser und kräftiger. Die Merkmale des Hauses Tyras spiegelten sich auch in seinen kantigen Zügen wider, das pechschwarze Haar trug er kurz geschnitten bis auf den dünnen Zopf, der seine vornehme Herkunft kennzeichnete. Nach Lorymars Einschätzung hatte Nawyd die Klugkeit des Vaters geerbt, den er nie kennengelernt hatte, allerdings auch dessen Sturheit und hitzköpfiges Temperament.
Ihm gegenüber hatte Hilalayan seinen Platz im Kronrat inne, seines Zeichens Hofmarschall und Vorsteher der Hofkanzlei. Genau wie Nestor, der altersschwache Löwe, der sich zu Füßen des Throns rekelte, war auch er in jungen Jahren seiner Männlichkeit beraubt worden. Doch während bei dem Löwen das Ausmaß an Gefährlichkeit und Verschlagenheit dadurch abgenommen hatte, schien es sich bei dem gewichtigen Mann aus Phrygos noch gesteigert zu haben. Das leutselige Äußere des Eunuchen, der ein fortwährendes Lächeln in seinen bleichen, feisten Zügen trug, täuschte – Lorymar hatte schon früh gelernt, sich vor Hilalayan und seinen Spitzeln in Acht zu nehmen. Ebenso wie vor dem Mann, der neben ihm saß und ebenso kahlhäuptig war wie der Hofmarschall, dabei jedoch klein und von drahtiger Gestalt. Dies war Xusra, der Hohepriester des Feuerkults.
Schon unter der Herrschaft Artabans, aber mehr noch, seit dessen Bruder Astyragis die Krone trug, hatte sich dieser Kult im Ostreich ausgebreitet. Es gab Zungen, die behaupteten, dass es in Wahrheit der Feuerkult gewesen sei, der Astyragis zur Königsmacht verholfen habe, worauf er sich im Gegenzug selbst zur reinigenden Kraft des Feuers bekannt und geschworen habe, ihr in seinem ganzen Reich Geltung zu verschaffen, vom Markland im Norden bis hinab nach Bessos und von Turanien bis hinein in die Steppen des Toten Landes. Der machthungrige Xusra begrüßte diese Pläne, während Wesir Gadates die Wahrung der Reichsgrenzen und Hilalayan stets den Staatsschatz im Blick hatte – Interessen, die sich oftmals gegenseitig ausschlossen, sodass der Kronrat ein Schauplatz lebhaften Zwists und bisweilen auch dunkler Ränke war.
Gewöhnlich wohnte Lorymar dem Treiben belustigt bei – heute musste er besorgt zur Kenntnis nehmen, dass er zu spät gekommen war; die Sitzung des Kronrats hatte bereits begonnen, und Astyragis war nicht für seine Nachsicht bekannt. Lorymar hatte mehrfach miterlebt, wie der König Diener und selbst hohe Hofbeamte schon aus weit geringeren Anlässen hatte auspeitschen lassen. Womöglich, dachte er verdrießlich, drohte dieses Schicksal nun auch ihm, und er bereute noch mehr als zuvor, den alten Ildarim aufgesucht zu haben.
Doch das Glück schien Lorymar Thinkling an diesem Morgen hold zu sein. Denn etwas anderes hatte die Aufmerksamkeit des Königs in Beschlag genommen. Etwas, das Astyragis noch ungleich mehr erzürnte als die Nachlässigkeit seines kleinwüchsigen Hofschranzen …
Die khalimi hatten einen Mann vor den Thron geschleppt und ihn gezwungen, sich vor dem König zu Boden zu werfen. Lorymar erkannte ihn sofort. Es war Darak, ein Schreiber aus Hilalayans Kanzlei, der offenbar in Ungnade gefallen war. Lorymars erste Vermutung war eine Indiskretion oder Veruntreuung von Geld. Doch dann erhob sich Xusra der Feuerpriester in seinem orangerot leuchtenden Gewand, und Lorymar begriff, dass es um ungleich mehr gehen musste.
»Was hat dies zu bedeuten?«, erkundigte sich Hilalayan, der als Marschall dem Hofzeremoniell vorstand. Seinen geröteten Zügen war zu entnehmen, dass er nicht über die Verhaftung seines Schreibers in Kenntnis gesetzt worden war.
»Blasphemie!«, rief Xusra mit lauter Stimme und deutete anklagend auf Darak. »Dieser da hat sich geweigert, dem Ewigen Feuer die Ehre zu erweisen!«
»Ist das wahr?«
Astyragis selbst hatte gefragt, wobei sich sein misstrauischer Blick auf den Beklagten richtete.
»I-ich bin mir keiner Schuld bewusst, Herr!«, versicherte der, wobei er sein Antlitz zu Boden gerichtet hielt. Den König mit dem Blick eines Beschuldigten zu beschmutzen, wäre ein weiteres Verbrechen gewesen.
»Nein?«, fragte Xusra und trat vor. Auf seinem kahlen Haupt trug er das Feuermal, und in seinen Augen schien eine wilde Glut zu lodern. »Willst du etwa leugnen, dass du versäumt hast, dem Ewigen Feuer deine Huldigung zu erweisen, Nichtswürdiger? Sowohl gestern als auch am Tag zuvor – so wie auch schon in der vergangenen Woche?«
Abscheu zeigte sich auf den Zügen des Königs. »Ist das wahr?«, wollte er noch einmal wissen.
»Es ist wahr«, bestätigte Xusra, noch ehe der Beklagte etwas erwidern oder sich verteidigen konnte. »Es gibt dafür mehrere Zeugen.«
»Was für Zeugen?«, verlangte nun Hilalayan zu erfahren. Als Daraks direkter Vorgesetzter schien er sich gleichfalls beklagt zu fühlen.



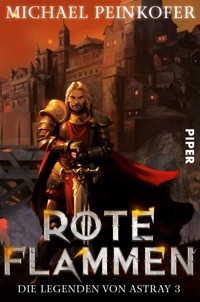
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)