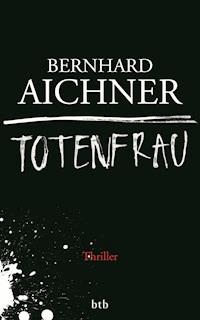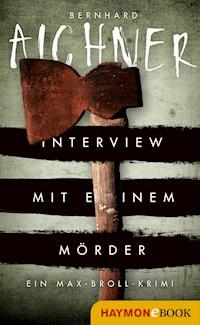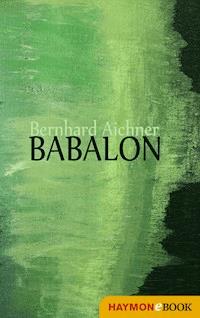8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Totenfrau-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Bei einer Exhumierung auf einem Innsbrucker Friedhof werden in einem Sarg zwei Köpfe und vier Beine gefunden. Schnell wird klar, dass es sich um ein Verbrechen handeln muss, dass hier die Leichenteile eines vor einem Jahr spurlos verschwundenen Schauspielers liegen. Nur eine Person kommt als Täterin in Frage: die Bestatterin, die die Verstorbene damals versorgt und eingebettet hat. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Brünhilde Blum den Schauspieler getötet hat. Doch die ist wie vom Erdboden verschluckt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Zum Buch
Ein seit zwanzig Jahren leerstehendes Hotel. Eine Mörderin auf der Flucht. Ein Albtraum, der kein Ende nimmt. Bei einer Exhumierung auf einem Innsbrucker Friedhof werden in einem Sarg zwei Köpfe und vier Beine gefunden. Es handelt sich um Mord. Und nur eine Person kommt als Täterin in Frage: Bestatterin Blum, die die Toten damals eingebettet hat. Nun sucht sie Zuflucht an einem Ort, den sie besser gemieden hätte …
Zum Autor
Bernhard Aichner (geb. 1972) lebt als Schriftsteller und Fotograf in Innsbruck/Österreich. Aichner schreibt Romane, Hörspiele und Theaterstücke. Für seine Arbeit wurde er mit mehreren Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet. »Totenhaus« ist die Fortsetzung des Thrillers »Totenfrau«, für den er begeisterte Kritiken erntete, er stand damit sowohl in Österreich als auch in Deutschland auf der Bestsellerliste. Die Bücher wurden weltweit verkauft, 2022 gab es bei Netflix/ORF die sechsteilige TV-Verfilmung. Totenhaus ist die Fortsetzung davon. 2017 erschien »Totenrausch«, das große Finale der Trilogie um die Bestatterin Brünhilde Blum.
Bernhard Aichner
Thriller
Drei Wochen später
Man hört, wie sie atmet. Auf dem alten Teppich ihr Gesicht. Irgendwo im Schwarzwald auf einem Hügel, sie hat keine Kraft mehr. Da ist kein Gedanke mehr, der guttut, kein Wort, keine Berührung, nichts mehr. Eine Frau am Boden, allein, die Kinder weit weg, sie hört sie nicht, spürt sie nicht, sie wird sie nicht wiedersehen, sie nie wieder küssen, ihr Weinen nicht mehr hören, ihr Lachen. Weil sie sterben wird. Weil sie auf diesem Teppich liegen bleiben und tot sein wird. In wenigen Stunden schon.
Wie es brennt. Ihr Hals ist eine Wunde, alles tut weh. Ihr Mund ist eine Wüste, ihre Zunge ein Stück Dörrfleisch, das Schlucken eine Qual. Kein Speichel mehr, kein Tropfen Wasser, nichts, das abwendet, was kommt. Sie wird das Bewusstsein verlieren, ihre Organe werden versagen, die Nieren, die Lunge, ihr Körper wird aufhören zu funktionieren, sie kann nichts dagegen tun, sich nicht mehr wehren, nicht mehr gegen die Tür treten, an den Wänden kratzen. Sie hat keine Kraft mehr, sie weiß nicht mehr, wie lange sie schon hier ist, wie viele Stunden, ohne zu trinken, wie oft es Nacht war, seit sie gehört hat, wie sich der Schlüssel gedreht hat. Wann der Tag aufhört, wann er beginnt, sie weiß es nicht.
Keine Fenster, kein Licht von außen. Nur der Kronleuchter an der Decke, die barocken Vorhänge, das Himmelbett, die Jugendstilmöbel und der riesige Spiegel mit dem goldenen Rahmen. Sie sieht sich, wenn sie die Augen offen lässt. Ihr Gesicht, ihre Lippen, keine Bewegung zu viel, sie darf ihre Kraft nicht verschwenden, sie muss wach bleiben. Immer wieder hebt sie kurz ihren Kopf, leicht nur, für zwei Sekunden lang schwebt ihre Wange über dem Boden, weil sie wissen will, ob sie es noch kann, ob sie aufstehen könnte, wenn er kommen würde. Ob sie noch aus eigener Kraft zurückkönnte in ihre Welt. Weil vielleicht doch noch ein Wunder passiert, weil jemand ihr Bitten erhört, ihr Flüstern. Deshalb muss sie wach bleiben, sie darf nicht abtauchen ins Trübe, klar denken will sie, sich erinnern. Wer sie ist. Wie sie heißt. Wie ihr Leben war. Immer wieder wiederholt sie es, wie ein Gebet ist es. Was sie sagt. Ihre kleine verhungerte Stimme. Brünhilde Blum. Ich bin Bestatterin, ich lebe in Innsbruck, ich habe zwei Kinder. Ich will leben, sagt sie und erstickt fast an dem Klumpen in ihrem Mund.
Nur noch ein leises Flüstern ist es, kaum hörbar. Mein Name ist Blum. Weil sie ihren Vornamen immer schon gehasst hat, weil sie ihn nicht mehr wollte, als sie sechzehn war. Ich heiße Blum. Für wenige Sekunden hebt sich wieder ihr Kopf. Ich habe zwei Kinder.Uma und Nela. Sie muss sich um sie kümmern, sie darf sie nicht alleinlassen, nicht aufhören zu leben, nicht auf diesem Teppich liegen bleiben. Sie muss weiteratmen, darf die Augen nicht schließen, nicht einschlafen. Sie muss die kleinen Zauberwesen beschützen, sie in den Arm nehmen, das ist alles, was sie will. Es wiedergutmachen. Sie nie wieder allein lassen. Doch zu weit weg sind sie, Blum weiß, dass sie nichts mehr für sie tun kann, sie macht sich nur noch etwas vor, nur ein weiterer unerfüllter Wunsch ist es. Sie kann sie nicht zu sich holen, nicht einfach aufstehen und aus dem Zimmer gehen, nicht zu ihnen fahren und sie in den Arm nehmen. Sie kann nicht zurück in ihr altes Leben, sogar dann nicht, wenn das Wunder eintreten sollte, das sie sich herbeisehnt. Wenn die Tür aufgehen und Wasser in ihren Mund rinnen sollte. Blum wird nie wieder ihr Haus betreten, sie wird nie wieder in ihrem Garten sitzen und Wein trinken. Da ist nichts mehr von dem, was war, die Welt hat sich gedreht, sie wird hier zugrunde gehen wie ein angeschossenes Tier, anstatt für ihre Kinder zu kochen. Anstatt mit ihnen auf der Couch zu sitzen und ihnen vorzulesen. Der Geschmack in ihrem Mund sagt ihr, dass es nicht mehr lange dauern wird. Der Uringeruch und diese Stille. Alles hört auf.
Kein Laut ist zu hören von draußen. Wo früher wahrscheinlich Fenster waren, ist jetzt eine Mauer, keine Tür führt ins Licht, keine Tür zum Badezimmer. Da ist kein Wasserhahn, da ist nur ihr Durst, die Sehnsucht nach einem See, einer Pfütze, da ist nur ihr Flüstern, das sich gegen das langsame Sterben wehrt. Szenen aus ihrem Leben, an die sie sich mit Gewalt erinnern will. So laut sie kann, spricht sie es aus. Ich lebe in Innsbruck. Bin Bestatterin. Wort für Wort, weil sie ihre Gedanken nicht mehr unter Kontrolle hat, weil alles durcheinander ist, weil sie Angst hat, dass sie den Verstand verliert. Dass sie es vergisst. Wer sie ist. Was war.
Mein Name ist Blum. Ich bin Bestatterin.Wir raten Ihnen, sich von dem Verstorbenen am offenen Sarg zu verabschieden. Es ist wichtig für die Trauerarbeit, den Verstorbenen noch einmal zu sehen. Um zu begreifen. Jedes Wort tut weh, und trotzdem sagt sie es. Blum will ihren Alltag zurück, sie sehnt sich nach diesem leicht süßlichen Geruch, nach den Toten im Kühlraum. Sie will sich um sie kümmern, sie waschen, ihre Wunden schließen, sie anziehen. Arbeiten und nicht sterben. Ihnen die Haare waschen, sie kämmen, ihre Münder schließen und sie in die Särge betten. Seit sie denken kann, war es so, eine Kindheit lang, eine Jugend, der Tod machte ihr keine Angst, das Bestattungsunternehmen Blum war ihre Heimat, der Versorgungsraum ihr Kinderzimmer. Vertraut war alles. Der Leichenwagen, der durch die Einfahrt kam, die traurigen Gesichter im Abschiednahmeraum, ihre Kinder, die im Freien auf den Kirschbaum kletterten. Und Karl, der unten stand und sie auffing.
Der beste Schwiegervater der Welt. Blum weiß, dass er für sie da ist. In diesem Moment sitzen sie auf seinem Schoß, er kocht Kakao für sie, Uma und Nela sind glücklich. Es muss so sein. Egal was kommt, auf Karl kann sie sich verlassen, er wird sich um die Kinder kümmern. Es sich anders vorzustellen, ist unerträglich. Da sind nur Bilder in ihrem Kopf, in denen die Mädchen unbeschwert im Garten spielen. Nichts fehlt ihnen, sie lachen, tollen herum, sind geborgen, da ist keine Angst, da sind keine Tränen, keine Albträume in der Nacht, aus denen sie aufwachen und nach ihrer Mutter schreien. Karl ist da. Sie fleht ihn an, sie wünscht sich nichts mehr auf dieser Welt. Bitte, pass auf sie auf, Karl.Ich komme nicht zurück. Sag ihnen, dass ich sie liebe, Karl.
Verzweifelt kommt es aus ihrem Mund. Diese Ohnmacht. Blum möchte schreien, um sich schlagen, sie möchte aufstehen und losrennen. Und sie möchte weinen. Doch da sind keine Tränen mehr, leer ist alles, sie kann nichts mehr tun, sie kann die Uhr nicht zurückdrehen, es nicht ungeschehen machen. Alles, was sie getan hat. Es ist kein Geheimnis mehr, in allen Zeitungen steht es, die Nachrichten sind voll davon, jeder kennt ihr Gesicht, alle wissen es. Dass sie ein Monster ist, dass sie ihr altes Leben nicht mehr zurückbekommt. Blum. Sie hat alles kaputt gemacht, und dafür hasst sie sich. Dass sie mit dem Schicksal ihrer Kinder gespielt hat, dass sie nur an sich gedacht hat. An ihre Wut. Daran, dass sie ihn umgebracht haben. Den Vater ihrer Kinder. Einfach so.
Erinnerungen, die ihr Herz zerreißen. Verdörrtes Fleisch auf einem teuren Teppich. Nur noch ihr Wille verhindert, dass ihre Augen für immer zufallen, dass sie ihr Bewusstsein verliert. Nur noch diese Gedanken an die Kinder, die sie am Leben halten, die Sehnsucht nach diesem Kichern, wenn sie etwas Verbotenes tun, nach ihrem Übermut, dem Geschrei, wenn sie müde sind. Die Tränen, wenn sie stürzen. Wie sie in ihren kleinen Betten liegen und schlafen, Blum sieht es. Wie alles beginnt zu verschwimmen.
Langsam dreht sie sich auf den Rücken. Seit Stunden in Seitenlage, ihre Hüfte tut weh, ihr Arm ist eingeschlafen, einmal bewegt sie ihn noch. Was früher selbstverständlich war, ist jetzt beinahe unmöglich, die einfachsten Dinge, jede Bewegung, das Atmen. Sie wird auf dem Rücken liegen bleiben, vielleicht wird sie noch einige Male den Kopf heben, aber ihr Leib wird sich nicht mehr rühren. Bis sie tot ist. Mein Name ist Blum, flüstert sie. Ich hatte zwei Kinder. Und ich hatte einen Mann. Ihre Liebe, die nach acht Jahren einfach tot auf der Straße lag. Mark. Ein letztes Mal denkt sie an ihn, an seine Hände, seine Haut, seinen Mund. Und was er immer zu ihr gesagt hat. Alles wird gut, Blum. Doch nichts wurde gut. Er ist einfach in einer Kiste unter der Erde verschwunden. Das Glück hat einfach aufgehört zu existieren. Bis jetzt kam es nicht zurück. Da ist niemand, der sie hochhebt, sie in die Arme nimmt. Blum ist allein. Die gute Fee kommt nicht. Kein Wunsch hilft. Es ist die Strafe für das, was sie getan hat, sie weiß es. Sie kann nichts mehr tun, nur noch daliegen und warten, zum letzten Mal ihre Lippen bewegen, bevor es für immer still ist. Bevor ihre Stimme verschwindet. Egal, was sie dafür geben würde, um weiterzureden, weiterzuleben, nur noch zwei Sätze kommen aus ihrem Mund. Kaum hörbar, langsam das Ende. Es tut mir so leid, sagt sie. Es tut mir alles so unendlich leid. Dann ist da nur noch ein leerer Mund.
Sie starrt an die Zimmerdecke. Seit Stunden der goldene Stuck, dieses Deckenfresko, das Paradies. Ein Bild, in dem sie sich verliert, ein Garten mit Obstbäumen, alles blüht und strahlt und wächst. Das Letzte, das sie sieht. Eine üppig gemalte Dame, die nackt in einen Apfel beißt. Wieder und wieder hat Blum in den letzten Tagen diese Frau angestarrt. Wie unbeschwert sie ist, wie sie sich dem Essen hingibt, dem Wein, dem Leben. Ein Gelage an der Zimmerdecke, Völlerei, ein Schlag ins Gesicht ist es. Blum sieht, was sie nie wieder haben wird. Wie es hätte sein können. Kirschen, die sie pflückt, wenn ihr danach ist, der Schatten im Sommer, wenn sie im Gras unter einem Baum liegt. Schön ist es. Einmal kurz noch, dann schließt sie ihre Augen und stirbt.
1
Vor drei Wochen war noch alles gut gewesen. Blum wusste nicht, dass dieses Haus überhaupt existierte. Dieses Zimmer, der Teppichboden, das Fresko an der Decke. Kein ausgetrockneter Mund, kein Hunger, da war niemand, der wollte, dass sie stirbt. Es gab noch keinen Grund dafür.
Blum war beinahe glücklich. Eine Frau irgendwo am Strand, zum ersten Mal seit langem schien wieder die Sonne, das Lachen der Kinder machte sie glücklich. Es gab nichts zu tun, alles hatte Zeit. Urlaub in Griechenland. Unbeschwert war sie, keine Arbeit, keine Beerdigungen, nur Zeit für die Familie, für Uma und Nela. Ihre Bedürfnisse spüren, mit ihnen Burgen im Sand bauen, im Wasser plantschen, ihnen zuhören, Muscheln sammeln. Keine Toten. Keine Gedanken zurück. Dass sie seit zwei Jahren keinen Vater mehr hatten, war kein Thema, keine Sekunde lang. Dass er tot auf der Straße gelegen hatte, dass er von einem Tag auf den anderen nicht mehr für sie da gewesen war. Die Kinder waren die Ersten, die alles vergessen hatten, die nicht ständig daran erinnert werden wollten, dass diese Familie einmal komplett gewesen war. Sie haben es einfach ausgeblendet irgendwann, einfach so getan, als wäre nichts passiert, sie hatten versucht, Blum glücklich zu machen, ihr die Traurigkeit zu nehmen. Mama, warum lachst du nicht mehr? Warum bist du nicht so wie früher? Warum fahren wir nicht mehr ans Meer, Mama?
Und da waren sie nun. Meer und Sand und Himmel. Keine Versorgungen, keine Angehörigen, die weinten, keine Verabschiedungen, nur der Sommer und dieses kleine Haus direkt am Strand. Nur wenige Meter zum Wasser, der Blick hinaus auf die Boote, die in der Bucht ankerten, das Leben war tatsächlich gut. Blum hatte endlich auf Karl und Reza gehört, sie hatten sie fast aus dem Haus getrieben, sie aufgefordert, endlich etwas für sich selbst zu tun, für die Kinder. Wir wollen dich drei Wochen nicht sehen, hatten sie gesagt. Wir schaffen das auch ohne dich. Reza, ihr Mitarbeiter, ihr Freund, er und Karl hatten sie nach Marks Tod aufgefangen, die beiden Männer waren für Blum da gewesen, sie fühlte sich geborgen, ihre Trauer fand immer Platz, doch nach zwei Jahren war es an der Zeit, neue Türen aufzumachen. Alle waren sich darin einig, Karl, Reza und auch die Mädchen. Drei Wochen Griechenland. Blum sollte endlich wieder leben.
Blum fühlte sich wohl. Wenn die Kinder am Abend schliefen und sie allein auf der Terrasse ihren Wein trank, glaubte sie sogar an eine Zukunft. Schön war es. Das Meer, das sie liebte, seit sie ein Kind gewesen war. Die jährlichen drei Wochen auf dem Wasser, die alte Swan, die Blum nach Marks Tod verkauft hat. Über fünfundzwanzig Jahre hatte das Boot im Hafen von Triest gelegen. Ein Stück Vergangenheit war es, das sie loswerden wollte. Hagen hatte das Segelboot vor dreißig Jahren gekauft, Blums Vater, der Mann, der sie zu dem gemacht hatte, was sie war. Bestatterin. Eine Kindheit voller Leichen, dieser unbedingte Wunsch ihres Vaters, eine Nachfolgerin für das Bestattungsinstitut heranzuziehen. Ein Mädchen nur, aber eine Nachfolgerin. Seit sie denken konnte, war Blum umgeben von Toten, nur das Segelboot im Sommer bedeutete Auszeit. Das Glück auf dem Wasser, im Wind an nichts denken, nur ihre Haut in der Sonne. Nichts sonst war wichtig gewesen. Hagen nicht. Herta nicht. Blums Mutter, die zugesehen hatte, wie da ein zehnjähriges Mädchen Münder zugenäht, die Nadel durch Fettgewebe gestochen hatte, anstatt mit Freundinnen im Garten zu spielen. Ein Kind, das Watte in die Rachen der Verstorbenen gestopft hatte, in ihre After, damit sie nicht zu stinken begannen, damit man den Tod nicht riechen konnte. Ihr Alltag war es gewesen, ein Leben im Bestattungsinstitut, egal, wie sehr sie sich etwas anderes für ihr Leben gewünscht hatte, die Toten waren nicht weggegangen. Herzinfarkte, Selbstmorde, Unfälle, Wasserleichen, still und tot hatten sie vor ihr auf dem Tisch gelegen, still und gehorsam hatte Blum getan, was ihr Vater von ihr verlangte. Blum war ihm ausgeliefert gewesen, da war niemand gewesen, der sie vor ihm beschützte, auch ihre Mutter nicht. Sie hatte nur zugeschaut, geschwiegen, gutgeheißen, was passierte, was Hagen aus ihrem Kind machte. Sie hatte Blum nicht beschützt, nichts getan, damit es aufhören, damit die Angst weggehen würde. Keine Umarmung, kein Halten, kein schönes Wort, weil Blum nicht ihr richtiges Kind war, weil sie nur adoptiert war, nur ein Balg aus dem Kinderheim, das aus dem Fegefeuer in die Hölle kam.
Jahrelang hatte sie gelitten. Nur der jährliche Urlaub hatte sie glücklich gemacht. Wie ein Traum war es gewesen, aus dem sie nie mehr aufwachen wollte, ein immer wiederkehrender Traum, in dem ihre Eltern einfach starben und sie in Ruhe ließen, ein Traum, der Wirklichkeit wurde, als sie vierundzwanzig Jahre alt geworden war. Bei einem tragischen Unfall waren Hagen und Herta ums Leben gekommen, sie waren einfach ertrunken, während Blum an Bord geschlafen hatte. Wie ein Wunder war es gewesen, von einem Moment zum anderen war alles schön geworden. Blum hatte sich verliebt, sie hatte Kinder bekommen, acht Jahre lang war da einfach nur Glück gewesen. Liebe. Bis Mark gestorben war. Bis vor zwei Jahren plötzlich alles auseinandergefallen war.
Zwei Jahre lang ohne ihn. Dann Chalkidiki. Blum wollte mit den Kindern an einen Ort, an dem sie noch nie gewesen war, das griechische Festland, keine Insel. Alle Fahnen wehten grün, alles schaute so aus, als würde der Sturm endlich vorbeigehen, die Trauer, die Tränen, die so viele Abende über Blums Wangen geronnen waren. Keine Angst mehr, die Kinder ohne Rettungswesten im Sand, keine Wellen mehr.
Vor drei Wochen am Strand. Alles fühlte sich gut und richtig an, Blum wollte weiterleben, sie saß in ihrem Liegestuhl, trank Bier aus einer Dose und schaute zu, wie die Kinder ein großes Loch in den Sand gruben. Kichernd verschwanden sie unter der Erde, ihre kleinen Stimmen überschlugen sich. Wir spielen Tote, Mama. Sie waren glücklich, Blum lehnte sich schmunzelnd zurück und machte ihre Augen zu. Da waren nur die Stimmen der Kinder, sie hatten noch zwölf Tage in der Sonne vor sich, Blum genoss es. Sie konnte sich vorstellen, einfach so sitzen zu bleiben, wochenlang, die Vorstellung, mit den Kindern eine längere Auszeit zu nehmen, war schön.
Du bist tot, Uma. Du darfst nichts mehr sagen, du musst ruhig liegen bleiben. Wenn man tot ist, bewegt man sich nicht mehr, das weißt du doch. Uma lachte, krabbelte aus dem Sandgrab und lief davon. Nela hinterher. Sie hüpften über den Strand, tanzend, kichernd. Nichts konnte passieren, der Strand sank flach ab, die Kinder konnten nicht ertrinken, da war kein Erdbeben, kein Unwetter, nichts. Kein Unheil nirgendwo. Blum sprang auf, nahm die Kinder an den Händen und lief mit ihnen ins Wasser, wild tollten sie herum, sie lachten und spielten, bis die Kinder müde wurden und schliefen. Neben ihr im Schatten Uma und Nela. Kurz noch war alles gut.
Blum genoss die Unbeschwertheit, blätterte in einer Zeitschrift, sie las über eine schwedische Prinzessin, die geheiratet hatte, eine amerikanische Schauspielerin, die ihr achtes Kind adoptiert hatte, es waren nur Klatsch und Mode, Reisen und Selbsthilfe, Artikel darüber, wie man Honig macht, wie man Ruhe findet, wie man lebt. Geschichten, die niemandem wehtun, die einem das Gefühl geben, dass es für alles eine Lösung gibt. Ein Mann, der zu Fuß von Berlin nach Peking gegangen war, eine Frau, die ihren Krebs besiegt hatte, indem sie sich täglich mit ihrem eigenen Urin eingerieben hatte, Bilder von fliegenden Fischen und Legebatterien, Reportagen über Künstler, Kochrezepte, Buchvorstellungen. Und dann der Artikel über diese Ausstellung. Dieses Foto, das ihr den Boden unter den Füßen wegzog.
Es ging ganz schnell. Eben war noch Ebbe gewesen, und plötzlich kam die Flut. Ohne Vorwarnung zog ein Unwetter auf, der Himmel verdunkelte sich, obwohl die Sonne schien. In diesem Moment, in dem sie umgeblättert hatte und begann, den Artikel zu überfliegen, veränderte sich alles. Was sie auf dem Foto sah. Was sie glaubte zu sehen. Es war so, als hätte jemand den ersten Dominostein umgestoßen, der Schneeball rollte nach unten und wurde größer und größer. Wieder schlug das Schicksal zu, Blum konnte sich nicht wehren, sich nicht entziehen, es war wie ein Faustschlag mitten in ihr Gesicht. Sie spürte, wie sich alles in ihr zusammenzog, wie es begann wehzutun, wie sich alles in ihr wehrte. Blum hörte nicht mehr, was ihre Kinder sagten, dass sie erneut ins Wasser wollten, mit allen Mitteln versuchten sie es, doch Mama rührte sich nicht. Mama war plötzlich weit weg. Wie gelähmt saß sie in ihrem Stuhl. Du sollst mit uns reden, warum sagst du denn nichts, Mama? Warum sie schwieg und auf dieses Foto starrte? Warum sie ihre Kinder ignorierte? Blum wusste es nicht, verstand es nicht, sie konnte nicht anders, sie las den Artikel, immer wieder die Bildunterschrift. Wie verschwunden war sie, unsichtbar am Strand, belagert von ihren aufgebrachten Kindern. Das ist nicht mehr lustig, Mama. Wir wollen jetzt, dass du mit uns redest. Jetzt sofort, Mama. Doch Blum sagte nichts. Sie schaute nur. Und schwieg.
Das Foto war ganzseitig gedruckt. Eine tote Frau saß auf einem Zebra, man konnte alles genau erkennen, die Nase, den Mund. Blum kannte dieses Gesicht, sofort hatte sie die Ähnlichkeit gesehen, es waren diese Augen, so vertraut alles, die hohen Wangenknochen, derselbe Körperbau, die Größe des Kopfes, die Brüste. Es konnte nicht sein, und doch war es so, da war eine Leiche auf einem ausgestopften Zebra, eine tote Frau, die genau so aussah wie sie. Trotz der Entstellungen konnte man es sehen. Es war so, als würde sie in einen Spiegel schauen.
2
– Jetzt sag schon, Blum.
– Was denn?
– Was passiert ist.
– Ich weiß es nicht, Karl. Ganz ehrlich, ich weiß es wirklich nicht.
– Du sagst mir, wenn ich irgendetwas für dich tun kann?
– Du hilfst mir, wenn du die Kinder nimmst.
– Aber wo willst du denn hin?
– Nach Wien.
– Was willst du dort?
– Ich verspreche, ich werde dir alles erklären, wenn ich zurück bin. In Ordnung?
– Du solltest noch gar nicht hier sein, Blum. Du hast noch über eine Woche Urlaub, du solltest mit den Kindern am Meer sein, im Sand spielen, dich entspannen.
– Für ein paar Tage nur, bitte. Die Kinder haben sich sehr auf dich gefreut.
– Sie haben sich auf das Meer gefreut, nicht auf mich. Du hörst sie doch, oder? Wie enttäuscht sie sind.
– Ich weiß.
– Muss ich mir Sorgen machen?
– Nein.
– Du brichst deinen Urlaub ab, kommst hier an und willst sofort wieder weg. Irgendetwas stimmt nicht, ich kenne dich doch.
– Es ist nichts.
– Reza kommt erst nächste Woche wieder.
– Und?
– Er könnte dir bestimmt helfen.
– Hör auf, dir Sorgen zu machen. Bitte.
– Wenn das so leicht wäre.
– Es ist doch alles gut, Karl. Ich fahre nur kurz nach Wien, und dann komme ich zurück.
– Du solltest nicht allein sein, Blum.
– Was meinst du?
– Das mit Mark ist jetzt fast zwei Jahre her.
– Ja.
– Du sollst glücklich sein, Blum.
– Bin ich das nicht?
– Sag du es mir.
– Ach, Karl.
– Was ist mit Reza und dir?
– Reza und ich sind Freunde.
– Ihr seid mehr als das.
– Niemand ist so wie Mark.
– Das ist richtig, Blum. Aber Mark ist tot. Und du lebst.
– Da bin ich mir im Moment nicht so sicher, Karl.
Sie wollte ihm nicht mehr sagen, ihn nicht unnötig beunruhigen. Blum wusste ja selbst nicht, was das alles zu bedeuten hatte, warum das Foto einer Verstorbenen sie angezogen hatte, wie Licht Insekten anzieht. Blum wollte es nicht mit Karl teilen, mit niemandem, ihm nicht sagen, was sie befürchtete. Karl würde es verstehen, er war der fürsorglichste Mann, den Blum kannte, Marks Vater, der beste Opa der Welt, ein guter Freund. Karl war Polizist gewesen, so wie Mark, ein Spürhund, ein begnadeter Fahnder. Er war der Vater, den Blum sich immer gewünscht hatte. Vor einigen Jahren hatten sie ihn zu sich geholt, er war die gute Seele des Hauses, er stand ganz oben auf der Brücke, er war verantwortlich, dass das Schiff auf Kurs blieb. Karl. Wie geborgen sie sich fühlte, als er sie in den Arm nahm, er nahm es einfach hin, dass sie schwieg, auch wenn er unbedingt wissen wollte, was Blum plagte, er fragte nicht weiter, bohrte nicht nach. Er wusste, wie stur sie sein konnte, er ließ sie einfach, vertraute ihr, küsste sie. Pass auf dich auf, sagte er und verschwand mit den Kindern und einem Märchenbuch oben in seiner Wohnung.
Blum war in Bewegung. Sosehr sie es auch versucht hatte, sie konnte nicht länger in Griechenland bleiben, tatenlos herumsitzen, alle Fragen unbeantwortet lassen. Sie wollte eine Erklärung dafür, warum da irgendwo jemand gelebt hatte, der genauso ausgesehen hatte wie sie. Hatte es etwas mit ihrer Adoption zu tun? Hatten ihre Eltern ihr etwas verschwiegen? Steigerte sie sich in etwas hinein? Sie war aufgeregt, angespannt, ungeduldig, sie wollte mehr wissen, graben. Elf Tage lang hätte sie warten müssen, elf Tage rätselnd in Griechenland. Das wollte sie nicht, so tun müssen, als wäre nichts passiert, den Kindern eine heile Welt vorspielen. Drei Tage war sie noch geblieben, dann hatte sie den gemeinsamen Urlaub abgebrochen, sie hatte die Koffer gepackt und die Kinder ins Auto gesetzt. Es geht nicht anders, meine Lieben. Wir werden das nachholen, irgendwann. Dann war sie gefahren.
Sechs Stunden bis nach Patras zur Fähre. Das Haus am Strand wurde Vergangenheit, Nikiti Beach, der kleine Brunnen, in dem Uma ihre Puppe gebadet hatte, der Krebs, den Nela tagelang in einem Glas am Leben gehalten hatte. Da waren Tränen, weil Blum es nicht erklären konnte, warum der Urlaub mit Mama von einem Moment zum anderen einfach zu Ende war. Traurige Kinder auf der Rückbank und das Foto, das Blum aus der Zeitschrift gerissen hatte. Bedrohlich ein Stück Papier auf dem Beifahrersitz, müde eine Familie an Deck der Fähre. Eingewickelt in eine Decke, hatten sie den letzten Sonnenuntergang betrachtet. Vierundzwanzig Stunden. Dann Innsbruck, die Villa, die wie ein Felsen an ihrem Platz stand, der große Garten, der Leichenwagen vor dem Haus. Und Karl.
Er schaute aus dem Fenster, als Blum auf das Motorrad stieg. Sie setzte den Helm auf, startete die Maschine und gab Gas. Knapp vier Stunden brauchte sie nach Wien, sie musste es sehen, sich davon überzeugen, dass sie sich getäuscht hatte. Dass sie sich irrte, dass es nichts mit ihr zu tun hatte, dass alles nur Zufall war. Nur dasselbe Lied in verschiedenen Sprachen, nur eine unfassbare Ähnlichkeit, die sie aus der Bahn geworfen hatte, dieses Gesicht, das sie immer wieder vor sich sah. Verstümmelt, zerschnitten, verwundet. Es aus der Nähe sehen. So schnell es ging über die Autobahn, der Motor schnurrte. Eine Ducati Monster 900, Marks Motorrad, das sie jetzt fuhr, seine Leidenschaft, die sie übernommen hatte, der Fahrtwind in ihrem Gesicht. Sie gab einfach Gas. So wie damals, kurz nachdem Mark gestorben war. Vor zwei Jahren mit geschlossenen Augen und zweihundert Stundenkilometern über die Autobahn. Drei Sekunden lang. Wie sie geschrien hatte. Laut über den Asphalt, weil er nicht mehr da war. Sie alleingelassen hatte.
Mark. Und die Leere, die da plötzlich gewesen war. Die Leere, die sie versucht hatte zu füllen. Der Versuch, nicht unterzugehen, die Kinder glücklich zu machen, nicht aufzugeben, nicht daran zu denken, wie schön es gewesen war. Daran, was alles fehlte. Blum lebte einfach weiter, sie machte die Augen weit auf und fuhr langsamer, sie kümmerte sich um die Kinder, brachte die Verstorbenen unter die Erde, manchmal trank sie ein Glas Wein mit Reza. Mit ihrem Mitarbeiter auf der Terrasse ohne Worte. Nebeneinander, vertraut. Weil Reza alles über sie wusste, weil er immer geschwiegen, sie nie im Stich gelassen hatte. Weil er nicht wegging und auf sie aufpasste, sie hielt, wenn sie ihn darum bat. Ohne ihn wäre das Schiff längst untergegangen. Er hatte gesteuert, als Blum nicht mehr konnte. Reza war viel mehr als nur ein Mitarbeiter, er war ihr Lebensretter, ihr Freund und Vertrauter, ein wortkarger Engel. Und trotzdem schlief er unten im Souterrain und nicht bei Blum im ersten Stock. Es gab ihre Wohnung und seine, seine Haut und die ihre. Nur manchmal fanden sie zusammen, nur manchmal verlor sich ihre Zunge in seinem Mund. Wenn sie es nicht mehr aushielt, wenn die Einsamkeit sie niederstreckte, die Sehnsucht nach Berührung, wenn das Leben zu schwer wurde, dann nahm er sie auf. Geduldig, ohne zu fordern. Reza.
Kurz vor Linz dachte sie an ihn. So gerne hätte sie ihm alles erzählt, ihn mit nach Wien genommen, doch Reza war nicht da. Irgendwo in Bosnien war er, erst in ein paar Tagen sollte er zurückkommen, Blum saß allein auf dem Motorrad, keine Arme, die sich um sie legten, niemand, dem sie sagen konnte, dass sie sich fürchtete. Vor ihrer Ahnung. Davor, das Motorrad vor dem Naturhistorischen Museum abzustellen. Davor, eine Eintrittskarte zu lösen und von Raum zu Raum zu gehen. Sie fürchtete sich davor, die richtige Vitrine zu finden. Hinzusehen.
3
– Wenn du dir etwas wünschen könntest, Blum.
– Und es wäre alles erlaubt?
– Ja.
– Keine Einschränkungen?
– Nein.
– Egal, wie unmöglich es ist?
– Völlig egal, du könntest dir wünschen, was du möchtest.
– Und es würde in Erfüllung gehen?
– Ja. Aber nur ein Wunsch.
– Mein Mann ist also die gute Fee?
– Ja.
– Wie lange habe ich Zeit, es mir zu überlegen?
– Sechzig Sekunden.
– Warum nur sechzig?
– Weil ich dich dann küssen will.
– Küss mich doch.
– Du musst dir zuerst etwas wünschen, Blum. So eine Chance bekommst du nie wieder.
– Du sollst mich küssen.
– Komm schon, Blum.
– Also gut, ich wünsche mir, dass du mich küsst.
– Das kann nicht dein Ernst sein.
– Doch.
– Das ist dein Wunsch?
– Das ist alles, was ich will.
Wie sehr sie sich danach sehnte. Dass dieser Wunsch sich noch einmal erfüllte. Sie ging die Museumsstiegen nach oben und dachte an ihn. Mark. Sosehr sie auch versuchte, ihn zu vergessen und Reza in ihr Leben zu lassen, Mark blieb. Er war tief in ihr, er ging nicht weg, in Gedanken hielt sie seine Hand, drückte sie, nebeneinander gingen sie nach oben in die Ausstellung.
Kuhns Körper-Kunst. Ein Besuchermagnet, Hunderttausende Menschen hatten bereits gesehen, was sich nun vor Blum ausbreitete, wie ein Wanderzirkus zog die Freakshow von Stadt zu Stadt. Die Gewissheit, dass sie bereits alles gesehen hatte, was mit dem Tod zu tun hatte, löste sich innerhalb von Sekunden in Rauch auf. Was man hier zeigte, war unmenschlich, es überstieg alles, was sie bereit war, sich vorzustellen, Grenzen wurden überschritten. Gequält stand Blum da und litt, allein und hilflos, weil sie es nicht verhindern konnte, die Verstorbenen nicht beschützen konnte. Was man ihnen angetan hatte, was sie über sich hatten ergehen lassen müssen. Leichen, die drapiert worden waren, zerschnitten und zusammengesetzt, gehäutet, verdreht und verbogen. Entstellte Körper, haltbar gemacht, plastiniert, ein Albtraum, in den Blum mit Anlauf hineinsprang.
Blum war durch eine barocke Flügeltür in die Hölle gegangen, es war dunkel, alles war mit schwarzem Stoff ausgekleidet, nur die Vitrinen waren beleuchtet. Überall waren Tote, inszeniert, Kunst sollte es sein, unwürdig, demütigend war es, schockierend, spektakulär, jeder einzelne Tote schrie nach Aufmerksamkeit, befriedigte die niedersten Instinkte. Schaulust, Neugier, der Wunsch, den Tod aus nächster Nähe zu sehen und ihm trotzdem nicht zu nahe zu kommen. Nur schauen und gaffen, sie kamen in die Ausstellung und ergötzten sich, gruselten sich. Für dreizehn Euro durfte man den Tod sehen, Leo Kuhn machte es möglich, der Schöpfer offenbarte sich, die Symbiose zwischen Wissenschaft und Kunst wurde sichtbar. Kuhns Körper-Kunst. Er ging weiter als alle anderen, die tote Menschen ausstellten. Viel weiter. Er konservierte und inszenierte sie nicht nur, er zerlegte sie und baute sie neu zusammen. Kuhn war Künstler, der Mensch war nur noch Rohstoff, dicke und dünne Menschen wurden zusammengenäht, Menschen mit verschiedenen Hautfarben, Kuhn setzte sich über die Natur hinweg, er setzte sich über alle ethischen Grenzen hinweg, trieb es auf die Spitze. Abartig war es. Angewidert ging Blum an den Vitrinen vorbei, sie suchte das Zebra, dieses Gesicht, das sie seit Tagen verfolgte, nur diese Figur interessierte sie, die reitende Frau, nichts sonst. Blums Blicke streiften sie nur, die Freiwilligen, die sich verewigt wissen wollten, die alles in Kauf genommen hatten für ein bisschen Ruhm. Verstümmelt hinter Glas, die Kopfhaut nach vorne gestülpt, das Gehirn vergoldet, wie ein Stück Schmuck. Wo früher ein Menschenkopf gewesen war, saß jetzt der eines Hirschs. Es reichte nicht mehr, einen Toten einfach nur zu plastinieren und ihn Schach spielen zu lassen. Kuhn bot mehr, er schockierte, schändete. Für Geld.
Blum wollte weg. Überall war tote Haut, Muskeln, Knochen, Sehnen, Blutgefäße, sie wollte das alles nicht sehen, sie verstand nicht, warum jemand so etwas tun konnte, einem Verstorbenen so etwas antun konnte. Mit wie viel Liebe und Fürsorge sie sich jeden Tag um ihre Toten kümmerte, mit wie viel Respekt, und wie sehr dieser Respekt hier fehlte. Eine Horrorshow. Sie ging schnell, ihre Augen durchstreiften die Räume, laut dem Artikel in der Zeitschrift musste dieses Plastinat hier sein, in der Ausstellung in Wien, ganz in ihrer Nähe, im nächsten Raum vielleicht. Blum ging schneller, sie hatte Angst, sie wollte davonlaufen, doch dann stoppte sie. Das, wonach sie gesucht hatte, stand vor ihr, dieser Glaskasten, die Streifen, das Zebra, alles, was sie auf dem Foto gesehen hatte. Das Tierfell, das man ihr implantiert hatte, der offene Brustkorb, das pinke Herz.
Blum verlor die Fassung. Es war so, als würde sie zerfallen, sie konnte sich nicht mehr zusammenhalten, ihre Arme nicht mehr kontrollieren, die Beine, nicht mehr denken, sich nicht mehr bewegen. Sie war zitternd in einem abscheulichen Film gefangen, es war eine Begegnung, die alles um sie herum in einen Nebel tauchte, ein Anblick, der unendlich wehtat. Die verwundete Frau, ihr Körper, der nur noch ein dekorativer Gegenstand war, eine kitschige Skulptur, eine Puppe mit lackierten Nägeln auf einem tätowierten Zebra. Wo Fell hatte sein sollen, war menschliche Haut, waren tätowierte Totenköpfe, Tiger und nackte Frauen. Die Welt stand kopf, was Tier war, was Mensch, die Grenzen waren verschwommen, schwarzweiße, mit Zebrafell überzogene Frauenbeine, ein aufgerissener Körper. Fast unerträglich war es. Hinzusehen, zu begreifen, dass alles eingetroffen war, was sie befürchtet hatte. Dass es sich noch schlimmer anfühlte, als sie gedacht hatte. So entstellt die fremde Frau auch war, man erkannte deutlich ihre Züge, das beinahe unversehrte Gesicht, Blum schaute durch das Glas der Vitrine in einen Spiegel. Und es war so, als würde sie selbst auf dem Zebra sitzen. Blum sah Blum.
Wer war diese Frau? Warum saß sie tot und zerschnitten in einer Vitrine? Sie empfand Neugier und Mitleid, Entsetzen und Rührung, es überschwemmte sie. Blum griff nach ihrem Halstuch und band es sich um ihren Kopf. Sie wollte nicht, dass jemand die Ähnlichkeit erkannte, dass jemand Fragen stellte, sie hätte es nicht ertragen, wenn man auch sie angestarrt hätte, so wie die Frau in der Vitrine. Blum verborgen unter einem Tuch, sie war nur eine Ausstellungsbesucherin, die besonderen Gefallen an der Zebrafrau gefunden hatte, nicht mehr. Man sah die Panik in ihrem Gesicht nicht, die sie gepackt hatte, ihre Gedanken waren unsichtbar, die Fragen, die sie sich stellte. Ob die Skulptur vielleicht doch nur aus Plastik war, ob man ihr etwas antun wollte, ob es eine Drohung war, eine Warnung von jemandem, der mehr über sie wusste als alle anderen. Sie fragte sich, ob es tatsächlich menschliches Gewebe war. Ob sie eine Doppelgängerin hatte? Ob diese fremde Frau mehr war als das?
Fragen, Vermutungen und ihr Zittern, das sie verzweifelt versuchte, unter Kontrolle zu bringen. Blum wollte das Naheliegende nicht wahrhaben, das Unfassbare als unmöglich abtun. Doch die Vorstellung, dass sie eine Schwester gehabt hatte, überrollte sie. Es konnte nicht anders sein, da mussten Zwillinge gewesen sein, zwei kleine Mädchen, die damals im Heim darauf gewartet hatten, dass man sie mitnehmen würde. Blum war nicht allein gewesen. Eine Zeit lang zumindest. Aus irgendeinem Grund waren sie getrennt worden, Blum hatte ihre Schwester verloren und nicht mehr wiedergefunden. Man hatte sie auseinandergerissen. Mit Gewalt versuchte Blum sich zu erinnern, doch da war nichts, keine Bilder irgendwo in ihrer Erinnerung, die es erklärt hätten, nirgendwo zwei kleine Mädchen, die sich in den Armen lagen, die weinten, weil man sie auseinanderriss. Nichts. Blum war immer allein gewesen. Seit sie denken konnte, waren da nur Hagen und Herta gewesen, das Bestattungsinstitut, die Leichen. Nichts anderes.
Eineiige Zwillinge, weil es nicht anders sein konnte, weil sich jeder andere Erklärungsversuch erübrigte, wenn man die beiden Frauen anschaute, diese Ähnlichkeit, die da war. Da war kein Zweifel mehr, wie ein Wunder war es, eine Sehnsucht, die unverhofft gestillt worden war. Jemand, der vielleicht ihre Hand gehalten hatte, der mit ihr wach gelegen hatte in der Nacht. Nebeneinander in einem Bett vielleicht, flüsternd irgendwo in einem Kinderheim. Blum malte es sich aus, sie stellte es sich vor, zwei Mädchen Hand in Hand über eine Wiese, Mädchen wie Uma und Nela, zwei Kinder, die die Welt miteinander teilten. Drei Jahre lang war Blum nicht allein gewesen, drei Jahre lang hatte sie eine Schwester gehabt. Es klang verrückt, es konnte eigentlich nicht sein, aber je länger Blum hinschaute, desto sicherer war sie sich, desto mehr tat es weh, desto mehr Tränen fielen nach unten. Eine nach der anderen über ihre Wangen, sie hielt sie nicht zurück, sie konnte sich nicht mehr dagegen wehren, weil sie plötzlich vermisste, was sie nie gehabt hatte. Weil die Vorstellung unerträglich war, der Gedanke, dass sie sich kennenlernen, dass sie ein gemeinsames Leben hätten haben können. Wie sehr sie sich das immer gewünscht hatte, eine Gefährtin, jemanden, der ihr half, alles zu ertragen. Hagen, Herta, die Toten, alles. Vielleicht wäre da Liebe gewesen, Freundschaft zwischen ihr und der namenlosen Frau in der Vitrine. Vielleicht. Obwohl da Glas zwischen ihnen war, obwohl die Frau vor ihr tot war, irgendwie war sie mit ihr verbunden. Blum wollte plötzlich daran glauben, an diese Nähe, die sie spürte. Es war nicht vernünftig, nicht logisch, alles an diesem Moment war falsch, und trotzdem blieb sie vor der Vitrine stehen und starrte. Sie drückte ihre Zweifel nach unten, löschte sie aus, sie bestand auf diesem Gefühl.
Alles stand still. Keiner rührte sich, Blum nicht, die Fremde nicht, keinen Millimeter bewegte sie sich. Sosehr sie es sich auch wünschte, die Unbekannte blieb auf dem Zebra sitzen und ritt, sie starrte weiter ins Leere, ließ sich weiter von Tausenden begaffen, sie zeigte ihnen ihr pinkes Herz, schrie weiter nach Aufmerksamkeit. Drei Wochen lang noch in Wien, dann in Berlin, dann in London, ein Wanderzirkus war es, in dem sie auftrat, ein Kuriositätenkabinett des Grauens. Am liebsten hätte Blum das Glas zerschlagen und sie einfach mitgenommen, ihren Leib versteckt, sie beschützt, sie wollte ihren Brustkorb schließen, sich um ihre Wunden kümmern, sie bestatten. Sie auf einen Friedhof legen unter einen Baum. Und mit ihr reden. Ganz allein. Lange.
Über eine Stunde lang weinte sie. Bis der Museumsführer, der schon zum wiederholten Mal an ihr vorbeigekommen war, sie höflich darauf aufmerksam machte, dass sie nur noch zehn Minuten Zeit hatte. Blum musste gehen, sie zurücklassen. Es tut mir leid, aber wir schließen. Morgen ab neun Uhr ist die Ausstellung wieder geöffnet. Ein junger Mann, der schnell begriff, was vor sich ging, der sah, wie Blum ihre Tränen wegwischte und das Tuch vom Kopf nahm. Ihr Gesicht, das ihn nicht losließ, die Ähnlichkeit, die er sofort erkannte, die Objekte seiner Ausstellung, die ihm vertraut waren. Keine Sekunde lang musste er nachdenken, sie sah es in seinen Augen, sofort zählte er eins und eins zusammen. Die Frau, die eine halbe Ewigkeit reglos vor dieser Vitrine gestanden hatte, ihr Zittern, die Tränen, da war Trauer, da war Nähe, er schaute sie an und wusste, warum. Verunsichert wich er ihren Blicken aus, als sie ihn ansprach, es war ihm unangenehm, er wollte nichts Falsches sagen. Vorsichtig und freundlich war er. Deshalb überlegte sie nicht länger. Blum fasste sich, nahm Anlauf und sprang.
– Bitte, helfen Sie mir.
– Wie gesagt, es tut mir leid, aber wir schließen jetzt.
– Ich möchte nur mit jemandem reden, der mir etwas über diese Frau hier sagen kann.
– Das ist leider nicht möglich.
– Bitte. Ich muss wissen, wer sie ist, wo sie gelebt hat, wie sie heißt, woran sie gestorben ist. Bitte.
– Vielleicht wäre es am besten, Sie sprechen mit unserer Kuratorin.
– Schauen Sie mich an.
– Ich würde Ihnen ja gerne behilflich sein, aber ich darf nicht.
– Sie sollen mich anschauen. Kommen Sie schon, schauen Sie in mein Gesicht.
– Wir dürfen keine Auskünfte über die Körperspender geben.
– Was sehen Sie? Sagen Sie mir, was Sie sehen.
– Ich muss Sie jetzt bitten, zu gehen.
– Sie sehen es doch, oder?
– Bitte hören Sie auf damit.
– Es ist Ihnen sofort aufgefallen, stimmt’s?
– Ja.
– Was sehen Sie? Bitte helfen Sie mir, ich will doch nur, dass Sie mir sagen, dass ich nicht verrückt bin.
– Wie kann es sein, dass Sie nicht wissen, wer diese Frau ist?
– Ich habe sie zum ersten Mal vor drei Tagen auf einem Foto in einer Zeitschrift gesehen. Und jetzt bin ich hier.
– Aber ich bin doch nur ein Angestellter, verstehen Sie, ich führe die Leute durch die Ausstellung, mehr nicht. Es wäre wirklich besser, wenn Sie in diesem Fall mit einem der Verantwortlichen sprechen würden. Man kann Ihnen bestimmt helfen.
– Ich möchte aber mit Ihnen sprechen.
– Aber warum denn?
– Ich werde niemandem sagen, dass Sie mit mir gesprochen haben. Kein Wort, ich verspreche es Ihnen.
– Das ist abgefahren. Sehr abgefahren ist das.
– Ja, das ist es.
– Sie müssen Zwillingsschwestern sein.
– Eine andere Erklärung gibt es nicht, oder?
– Nein.
– Sie sehen die Ähnlichkeit.
– Ja.
– Ich wurde adoptiert, als ich drei Jahre alt war. Ich wusste nicht, dass es da noch jemanden gibt. Ich hatte keine Ahnung.
– Das tut mir sehr leid.
– Wie finde ich heraus, wer sie ist?
– Ich weiß es wirklich nicht.
– Bitte.
– Die Namen der Körperspender werden nicht bekannt gegeben. Kuhn ist da sehr streng.
– Der Psychopath, der sie ausgestopft hat?
– Leo Kuhn, ja.
– Sie haben ihn kennengelernt?
– Ja, er war hier, er hat uns geschult, er hat uns alles genau erklärt, einen ganzen Tag lang, im Detail. Wie die Plastination funktioniert, wie die Präparate hergestellt werden, wie man zum Körperspender wird. Er hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir die Besucher gut informieren können.
– Er kann mir sagen, wer sie ist?
– Wenn Ihnen einer helfen kann, dann er.
– Wo finde ich ihn?
– Das Körper-Kunst-Institut ist in Nürnberg. Sie bieten dort Führungen an, man kann sich alles genau ansehen. Ich denke, es wäre am besten, Sie fahren zu ihm, er wird bestimmt mit Ihnen reden.
– Warum?
– Weil er auf dieses Exponat besonders stolz war.
– Exponat?
– Tut mir leid. Er nennt es so. Er spricht auch von Design.
– Design?
– Ja, das pinke Herz, die Art und Weise, wie der Brustkorb offenliegt, die transplantierte Haut, die Symbiose aus Mensch und Tier, die Tätowierungen, er war sehr stolz darauf. Wir haben sehr lange davorgestanden, und er hat geredet.
– Was noch?
– Dass er nur einmal in seiner Karriere jemanden plastiniert hat, den er gekannt hat. Ich glaube, dass er die Zebrafrau gemeint hat.
– Warum glauben Sie das?
– Schauen Sie sich um. Es ist das einzige Gesicht, das er nicht verstümmelt hat.
4
Blum hätte umdrehen, sie hätte auf ihr Motorrad steigen und wieder zurück zu ihren Kindern fahren können, sie hätte einfach die Augen zumachen und es vergessen können. Alles wäre anders gekommen, sie wäre nie in den Schwarzwald gefahren, sie hätte nie gespürt, wie sich eine Zunge anfühlt, die stirbt. Ein Körper, der nicht mehr aufstehen kann. Nichts davon.
Blum hatte sich bei dem jungen Mann bedankt, ihm fünfzig Euro in die Hand gedrückt, dann war sie gegangen. Weg von Kuhns Monstern, durch die Naturhistorische Sammlung, vorbei an Mammutknochen und Fossilien, hinaus in das sommerliche Wien. Durch den Park zum Palmenhaus, sie wollte den Albtraum einen Augenblick lang ausblenden, sie wollte kurz darüber nachdenken, was passiert war. Was sie tun sollte, was es bedeutete. Seit sie das Foto gesehen hatte am Strand, fragte sie sich, ob sie vielleicht in Gefahr war, ob es etwas mit dem zu tun hatte, was sie vor der Welt verbarg, mit dem, was sie getan hatte. Blum hatte sich die verrücktesten Szenarien ausgemalt, alle anderen Erklärungen als die, dass es sich um ihre Zwillingsschwester handelte, hatten sie in Panik versetzt. Der Gedanke, dass es eine Drohung war, eine Puppe aus Plastik, die man ausgestellt hatte, um ihr zu sagen, dass sie ihre Strafe noch bekommen würde. Absurde Gedanken, die vom Tisch gewischt wurden, als Blum gesehen hatte, was da hinter dem Glas war. Niemand wusste, was vor zwei Jahren passiert war, Blums Leben war nicht in Gefahr, sie war überzeugt davon, als sie sich in einen Liegestuhl setzte und Weißwein bestellte. Angst fiel von ihr ab, Erleichterung mischte sich mit der Trauer, die sie empfand. Blum trank einen langen Schluck und machte die Augen zu. Sie haderte, zögerte, wollte die Entscheidung, was sie tun sollte, hinauszögern. Abwägen, was vernünftig war, was notwendig.